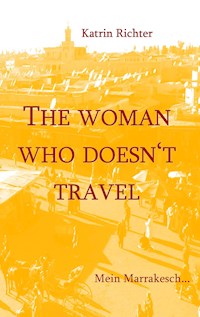Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Ehe von Matilde und Gabriel ist eigentlich am Ende. Nur, weil sie lange verabredet gewesen war, unternehmen die beiden noch eine letzte gemeinsame Reise nach Dubai, um Matildes runden Geburtstag dort zu feiern. Im Flugzeug kommt ihnen eine Idee: Jede Nacht wird eine Geschichte erzählt werden, ganz nach dem Vorbild der Prinzessin Scheherezade im Märchen. Am Ende dieser sieben und einen Nächte wird sich das Paar entscheiden, ob es sich trennt oder zusammen bleibt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Katrin Richter
Sieben und eine Nacht
Eine Liebe in Dubai
Books on Demand
Die Personen in diesem Buch, ihre Namen, ihre Geschichten und die Ansichten, die sie äußern, wurden von mir frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Menschen sind reiner Zufall und in keiner Weise beabsichtigt.
Katrin Richter, im Sommer 2011 in Berlin
Die Autorin
Katrin Richter hat - auch unter den Namen Clara Felder, Katrin Panier und Katrin Panier-Richter - bisher insgesamt dreizehn lieferbare Bücher veröffentlicht. Als leidenschaftliche Tagebuchschreiberin und Spaziergängerin lebt sie zurückgezogen mit ihrer Familie in Berlin.
Die Liste der lieferbaren Werke finden Sie am Ende dieses Buches.
Für Euch, die Ihr mich stärkt, inspiriert und an mich glaubt.
Inhaltsverzeichnis
Es war einmal …
D
IE ERSTE
N
ACHT
…
D
IE ZWEITE
N
ACHT
…
D
IE DRITTE
N
ACHT
…
D
IE VIERTE
N
ACHT
…
D
IE FÜNFTE
N
ACHT
…
D
IE SECHSTE
N
ACHT
…
D
IE SIEBENTE
N
ACHT
…
D
IE EINE
N
ACHT
…
Es war einmal …
Einst lebte ein mächtiger und reicher Sultan mit Namen Scheherban im Morgenlande. Er herrschte über ein riesiges Gebiet, die Inseln Indiens und Chinas sogar mit eingeschlossen. Bei seinem Volke galt er als weiser und gerechter Mann, jedoch achtete er auch streng darauf, daß seine Befehle eingehalten wurden. So hatte er seiner Frau, die er liebte, die Todesstrafe angedroht für den Fall, daß sie während seiner Abwesenheit ihre Zimmer verließ, mit anderen Männern sprach oder gar lachte. Sie versicherte ihm, treu und aufrichtig in dieser Sache zu sein.
Eines Tages jedoch beschloß Scheherban, sie auf die Probe zu stellen. Er tat so, als ginge er auf die Jagd, kehrte aber nach kurzer Zeit, viel früher als erwartet, schon wieder in den Palast zurück. Und was mussten seine Augen sehen?! Richtig. Sie erblickten eine Frau, die nicht nur ihre Räume verlassen hatte und in der unteren Etage Hof hielt, sondern die auch sehr ausgelassen mit den Bediensteten und weiblichen wie männlichen Gästen flirtete, lachte und scherzte. Das versetzte den Sultan in solchen Zorn, daß er sie ohne ein weiteres Wort in den Hof führen und köpfen ließ.
Die Welt hielt den Atem an. Mangelnde Konsequenz konnte dem Herrscher jedenfalls niemand vorwerfen, er selbst sich auch nicht.
Indessen, die grausame Tat verschaffte ihm nicht den Frieden, den er sich davon vielleicht erhofft hatte. Und so ließ er sich ab diesem unseligen Tag alle drei Nächte von seinem Großwesir ein weiteres schönes Mädchen bringen, das er heiratete, bis zum Morgengrauen zu seiner Ehefrau machte, und das dann, wie die ungetreue erste Gattin, bei Tagesanbruch hingerichtet wurde.
Man kann sich vorstellen, welch ein Wehklagen im Lande und in der Stadt Samarkand anhob, die Scheherbans Heimat war. Jede Familie, die eine anmutige Tochter hatte, wollte dieses Mädchen schützen und entkam den Schergen des Großwesirs doch nicht. Und so nahm ein fürchterliches Morden seinen Lauf im einst so beschaulichen Land, dem niemand Einhalt gebieten konnte, denn kein anderer Mensch hatte ja schließlich so viel Macht wie der Sultan.
Auch jener Großwesir war Vater zweier Töchter. Scheherezade, die Ältere, und Dinarzade, die Jüngere.
Scheherezade war überall bekannt für ihre Klugheit, die sie sich erworben hatte, weil sie viele Bücher las. Außerdem war sie eine Augenweide, ebenso wie ihre Schwester, die vielleicht nicht ganz so gebildet, aber ebenfalls ein heller Kopf war.
Es kam der Tag, an dem sich Scheherezade vor ihrem Vater aufbaute und sagte: »Vater, diesem sinnlosen Töten muss Einhalt geboten werden. Bitte, stelle mich dem Sultan vor und biete ihm meine Hand an. Ich glaube, ich kann ihm helfen.«
Der Großwesir glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen und wollte zunächst nichts vom Plan seiner Tochter hören. Sie war sein Lieblingskind, und schon die Vorstellung, sie zu verlieren, brach ihm schier das Herz.
Aber Scheherezade ließ nicht locker: »Papa, einer muss es tun. Ich habe eine Idee, vielleicht eine göttliche Eingebung. Also bitte, hindere mich nicht.«
Und da der Vater seiner geliebten Tochter letzten Endes keinen Wunsch abschlagen konnte, stimmte er schließlich widerwillig zu und tat, wie sie ihm geheißen hatte. Er ging zum Sultan und bot ihm Scheherezade an.
Der Sultan schaute seinem Großwesir verwundert in die Augen: »Höre ich recht? So legst du mir dein eigen Fleischund Blut zu Füßen, wohl wissend, wie ich mit meinen Frauen verfahre? Ich werde für dich keine Ausnahme machen.« Der Großwesir nickte traurig, blieb aber bei seinem Angebot.
Und so geschah es, daß die schöne Scheherezade im rosa und weißen Gewand und ohne Angst vor ihrer eigenen Courage – oder mit ihr und eben dennoch - im Palast erschien und sich vor dem Herrscher verneigte.
Scheherban mochte sehr, was er da vor sich sah, und etwas wehmütig dachte er daran, wie die Sache morgen früh unweigerlich enden würde. Nichtsdestotrotz lud er das neue Mädchen ein, ein rauschendes Fest mit ihm zu feiern, und damit begannen sie sogleich. Es gab Musik, Früchte, herrliche Speisen, köstliche Getränke und allerlei Tanz- und Kampfsportdarbietungen. Scheherezade schien sich zu amüsieren, bis sie mitten in all dem Glanz plötzlich und unvermittelt anfing zu weinen. »Aber warum weinst du, mein Schatz?«, fragte der Sultan durchaus mitfühlend, bereit, die Stimmung der Gespielin auf der Stelle aufzuhellen, falls er das denn könnte. »Ach«, seufzte Scheherezade, »ich habe vergessen, mich von meiner Schwester zu verabschieden, der zauberhaften Dinarzade. Nun ist es wohl zu spät dafür. Oder könntest du sie vielleicht noch in den Palast bringen?«
Nur zu gern willigte Scheherban ein. Eine so einfach zu erfüllende Bitte hatte er nicht erwartet.
Was er nicht wusste und nicht wissen konnte: Scherezade hatte ihre Schwester in ihren Plan eingeweiht, und als Dinarzade nun erschien, in einem gelb-violetten Kleid vielleicht und vollkommen frei von Angst, da sie ihrer großen Schwester ohne jeden Zweifel fest vertraute, da wusste sie bereits seit vielen Stunden, was sie zu tun hatte.
Das Fest nahm seinen Fortgang, und beinahe schon auf seinem Höhepunkt wandte sich Dinarzade an ihre Schwester: »Liebste Scheherezade, sag, könntest du vielleicht eine deiner Geschichten erzählen? So viele Abende hast du mir damit schon versüßt, bitte, laß mich auch heute noch eine von ihnen hören.«
Scheherezade schien zu überlegen, schien ein Für oder Wider abzuwägen, bevor sie sich schließlich zum Vortrag bereit erklärte und auf einem der Polster niederließ, um sich zu sammeln. Der Sultan wurde neugierig und fragte, ob er denn ebenfalls zuhören dürfe. Die Schwestern waren einverstanden. Und so hub Scheherezade an, eine märchenhafte Geschichte zu entwerfen, schmückte ihre Handlung aus, malte wundersame Bilder mit ihren Worten, erfand Charaktere und verband sie miteinander durch die Stränge ihrer Schicksale, Taten, Fährnisse.
Als sie an der allerspannendsten Stelle ihrer Erzählung angelangt war, gähnte sie, streckte sich und erklärte, daß sie nun zu müde sei zum Weitersprechen. Wenn der Sultan zu wissen wünsche, wie das Märchen weitergeht, dann könne er ihr ja noch einen Tag Aufschub gewähren.
Scheherban war außer sich vor Neugier, Aufregung, Ergriffensein und befahl auf der Stelle, die Hinrichtung Scheherezades zu verschieben, damit er in der nächsten Nacht erfahren könne, wie die Geschichte weitergeht.
Bei Tagesanbruch wunderte sich der Großwesir, daß niemand zum Schafott gerufen wurde, daß alles ruhig blieb. So, wie sich die Palastbediensteten wunderten, daß Scheherban ungewohnt fröhlich und in seiner Seele aufgeräumt sein Tagewerk vollbrachte. Wie hätten sie auch ahnen können, daß er sich auf den Abend freute, an dem er abermals an den Lippen seiner begnadeten Erzählerin Scheherezade hängen könnte.
Die inspirierte Schöne wusste den Sultan geschickt zu fesseln, spann immer neue Handlungsfäden und Einfälle, so daß am Ende aus einer geschenkten Nacht insgesamt Tausendundeine wurden. Während dieser Zeit, so geht die Kunde, erzählte sie ihm – teilweise in Fortsetzungen - etwa zweihundert Geschichten und gebar ihm drei Söhne.
Am Morgen nach der Tausendundersten Nacht hob Scheherban sie von ihren Polstern auf, umarmte sie und bat sie, ihn zu heiraten. »Du hast mich gerettet. Dich muss mir der Himmel geschickt haben, denn der grausame Zwang zu Töten ist durch dich von mir genommen worden. Ich danke dir und danke Allah, daß du zu mir gekommen bist.«
Der Bann war gebrochen, und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie, in irgend einer Form oder Gestalt, noch heute…
»Magst du auch einen Kaffee?«
Gabriel hält ihn schon in der Hand, während er die Frage stellt. ‚Hoffentlich tut sie nicht gleich wieder diese Sache mit ihrer Zunge!‘ denkt ein Teil von ihm. Er balanciert zwei Pappbecher links und rechts, hellbraun bedruckt, mit der schwarzen Aufschrift ‚Coffee to go‘ versehen.
Matilde fällt ein Irrtum ein, über den sie mit einer Freundin einmal sehr gelacht hat. ‚Schau mal!‘, hatte diese Freundin damals gesagt, indem sie auf einen dieser neu eröffneten Läden zeigte. ‚Hier gibt es afrikanischen Kaffee! Coffee Togo.‘ Heute ist ihr nicht zum Lachen zumute. Ihren Humor muß sie wohl irgendwo unterwegs verloren haben, vielleicht auf einer der Sitzbänke im Bus oder in der S-Bahn. Oder lange davor.
»Nein, danke. Hättest vorher fragen können. Ist doch schade drum.«
Gabriel verdreht die Augen. »Wenn ich immer alles richtig machen würde, kämen wir dann besser miteinander klar? Ich trinke gern auch zwei Kaffee. Mein Appetit ist groß genug, wenn du nicht willst.«
Aber Matilde mag keine Ruhe geben, jetzt noch nicht. »Nun gib schon her. Das tut dir doch gar nicht gut, so viel Koffein. Denk an dein Herz, deinen Magen, deine Nerven. Wo du ihn schon mal hast, ich trinke ihn. Ist doch egal, wovon mir schlecht wird.« Sie sagt das im Tonfall eines Menschen, der ein schweres Opfer bringt.
Gabriel reicht ihr den Becher. Sie nimmt ihn entgegen, als wäre der giftige Saft des Schierlings darin. Bevor sie am Rand des Gefäßes nippt, läßt sie ihre rosig gespitzte Zunge hervorschießen wie eine Kobra. Scharfkonzentriert züngelnd prüft sie die Temperatur des Getränks, um sich nicht den Mund zu verbrennen.
‚Fehlt nur noch, daß sie dazu zischt wie eine Schlange!‘, denkt Gabriel, der beiseite schauen muß, von diesem Anblick fort. Gleißend wallt ein aggressiver Schub in ihm hoch. Er hofft inständig, daß dieses Gefühl an Ort und Stelle bleibt, nach angemessener Zeit wieder in sich zusammen fällt, anstatt sich einen der Ausgänge nach draußen zu suchen. Anstatt heiße Brühe im papiernen Gefäß ihr aus der Hand zu schlagen, ihr ins Gesicht zu schütten, diese verdammte Zunge zu packen und… Gabriel holt tief, tief Luft. Noch ein bißchen tiefer. Dann läßt er das unsichtbare Element aus seinen Lungen wieder heraus strömen, sanft, gleichmäßig. Heimlich atmet er in die Wutwelle hinein, so, wie er es in einer seiner Therapien gelernt hat.
Matilde hat offenbar nichts vom Kampf ihres Ehemannes mit sich selbst bemerkt. Mit leise schlürfendem Geräusch verleibt sie sich Schluck für Schluck ihren Kaffee Togo ein. Gabriel atmet so tief, als müßte er den Grund von Loch Ness ansaugen. Unterdessen fällt ihr Auge auf die Ankömmlinge direkt vor ihnen.
Die beiden sitzen auf einem trauten Paar dieser harten Schalensitze aus Plastik im Flughafenwartebereich, und eine soeben gelandete Maschine spuckt gerade ihre Insassen aus.
»Reisende, wenn sie zurückkehren, haben immer noch den geweiteten Blick an sich und eine zarte Hülle aus irgendwas von irgendwoher, während sie Koffertürme durch Terminals bugsieren und in für die Jahreszeit unpassender Kleidung nach einem Taxi Ausschau halten.«
Klatschend fällt das Wasser in den See Loch Ness zurück. War das wirklich die Stimme seiner Frau, die einen so poetischen Satz gesagt hat?
»Wie bitte?«, versichert sich Gabriel, daß er richtig hörte. »Wo hast du denn das her?«
»Ach«, wirft Matilde ihm hin, »von irgend einem bekannten Romanautoren. Ich kann mich im Moment nicht an seinen Namen erinnern.« Mit ihrer linken Hand, der kaffeebecherlosen, greift Matilde nach dem herabhängenden Zipfel und wickelt sich ein wenig enger in ihren Schal aus weicher Kaschmirwolle, wie um sich ihres Hier und Jetzt zu versichern. Berliner Januar und Minusgrade, während die Menschen da vor ihr in leichtem Zwirn und kurzen Hosen aus einer der Sicherheitsschleusen zwischen Flugzeug und Wartehalle quellen. Braungebrannt sehen sie aus, beneidenswert. Aber auch orientierungslos wie Wesen, die gerade den Planeten wechseln und ohne Schutz in eine fremde, kalte Welt eintauchen.
‚Das Gefühl kenne ich‘, denkt Matilde.
Sie betrachtet eine Frau, deren gesamten Unterarm, das Handgelenk, den Handrücken bis in die Fingerspitzen ein fein ziseliertes Henna-Tattoo schmückt. Ein unbekannter Künstler muß es so sorgfältig gezeichnet haben, daß es jetzt wirkt, als habe jemand der Dame ein Deckchen aus dunkler Klöppelspitze über den Arm gelegt, das auf rätselhafte Weise auch dort hielt, ohne zu verrutschen. ‚Oder als litte sie unter einer seltenen Hautkrankheit‘, denkt Matilde und denkt weiter, ‚daß das typisch ist für ihre eigene seelische Lage, so düster zu kombinieren. Und das Muster, jene verschlungenen Linien, wären entweder die Zeichen des Ausschlags, der sich von den Extremitäten an unaufhaltsam den Körper hinauf ausbreitet oder die Spuren der Tinktur, die der Arzt aufgetragen hat, und die das Leiden heilen helfen soll.‘
»Vielleicht kommst du auch mit so einer Tätowierung zurück.«, hört sie Gabriel sagen, der ihrem Blick gefolgt sein muß. »Ich glaube, in der Wüste kann man sich das machen lassen. Der Reiseführer warnt nur vor bestimmten chemischen Beimischungen, die Allergien auslösen können. Da müssen wir vorsichtig sein.«
‚Ja, Herr Oberlehrer‘, kommentiert Matilde im Stillen. Wann hat das bloß angefangen, versucht sie sich zu erinnern. Daß er sagen kann, was er will; alles geht mir irgendwie auf die Nerven. Wenn er aber nur schweigt, dann auch das.
»Wir haben nie vereinbart, eine Wüstentour zu unternehmen. Wieso erwähnst du das jetzt plötzlich?«
»Schon gut.« Längst bereut Gabriel, daß er überhaupt etwas angemerkt hat. »Ich sah nur, wie du die Frau angeschaut hast. Für mich schien es etwas wie Bewunderung für das Werk des Malers zu sein. Sicherlich habe ich mich getäuscht. Vergiß es einfach.«
‚Es geht mir nicht gut. Ich bin eindeutig in keiner guten Verfassung‘. Matilde weiß, was sie weiß, und die Situation ist absurd genug. Jede andere an ihrer Stelle würde sich jetzt freuen, vermutet sie. Jede Frau außer ihr wäre glücklich, mit einem Mann wie Gabriel in ein Flugzeug zu steigen, eine volle Woche in Dubai vor sich zu haben, zum ersten Mal im Leben eine so weite Strecke zurückzulegen, um in das Märchenland der Scheherezade zu gelangen.
‚Jede andere. Nur ich nicht.‘
Wie so oft schaut sich Matilde ihren Ehemann von der Seite an. Er ist schön, sagt ihr Verstand. Nicht viele Männer seines Alters besitzen noch diese vollen Lippen, bei den meisten sind sie schmal geworden, fast verschwunden vom Zusammenbeißen, vom Sich-Durchkämpfen. Sie sieht mit ihrem Kopf, daß er von biegsamer Gestalt ist, wach und ruhig. Daß seine Haare genau die richtige Länge haben, um ab und zu in einem Zopf zusammengebunden werden zu können, der in Versuchung führen müßte, von ihrer Hand gleich wieder gelöst zu werden. Sie müßte verrückt nach ihm sein. Sie müßte. Das kann sie mit ihren eigenen Augen sehen. Und wie so oft kann sie sich nicht daran erinnern, wann der Funke erloschen ist. An welchem Tag, zu welcher Stunde es ihnen beiden geschehen sein mag, daß sie einander nur noch vernünftig liebten, jedoch nicht mehr aus der Seele.
»Möchtest du wirklich mit mir verreisen?«, läßt sich denn auch Gabriel vernehmen, als hätte er ihre Gedanken gehört. »Du mußt nicht. Noch könntest du zurück.«
»Bist du wahnsinnig geworden?« Matilde schnaubt geradezu. »Muß ich dich daran erinnern, was das hier gekostet hat? Allein die Flüge, hin und zurück, fast tausend Euro, und das war sogar ein Frühbucherpreis. An die Hotelübernachtung mag ich gar nicht denken. Vom ganzen Drum und Dran erst recht zu schweigen.«
»Das ist doch nur Geld. Nichts Ernstes.«
Das ist ganz Gabriel. So kennt sie ihn. Das hatte sie doch mal an ihm geliebt. Geld bedeutet ihm nichts. Es ist für ihn immer nur Mittel zum Zweck. Und man durfte es nicht horten, wenn etwas nachkommen sollte. So war sein Konto leer und kannte keinen anderen Zustand. Was herein floß, wurde sogleich einer Bestimmung zugeführt. ‚So müssen die Götter das gemeint haben. Die einzig richtige Art, mit Finanzen umzugehen!‘, jubelte Matilde, als sie noch eins mit ihrem Gatten war. ‚Ein Verschwender. Er ist einfach nicht imstande, zu sparen.‘, maulte sie, seit sie von ihm entzweit war. In letzter Zeit waren sie meistens ent-zweit gewesen, sie beide. ‚Sprache ist ehrlich‘, denkt Matilde. ‚Zuerst vereinen sich zwei Menschen, gehen vom ich zum wir über. Wenn alles gut geht, wachsen sie – nein, nicht zu einer symbiotischen Einheit zusammen, in der der eine sich vom anderen nicht mehr unterscheidet, sondern nebeneinander, parallel, Seite an Seite. Wachsen heran, in Liebe, zu mehr Menschsein.‘ Wachstum findet ja auf jeden Fall statt, weiß Matilde nicht erst seit heute. Wer es verweigert, wächst vielleicht körperlich, in die Breite. Oder es wächst ihm ein Zipperlein zu, eine Verwachsung. Besser wäre es, Stück für Stück über sich selbst hinaus zu wachsen. Und noch besser, es gelänge Zweien miteinander, jedem von ihnen beiden zum Nutzen. Soweit die Theorie. Bei ihr und Gabriel sieht es allerdings nicht danach aus. Nein, ganz und gar nicht. Eher danach, als wären sie dabei, sich wieder zu ver-einzeln. Ent-zwei.
Dennoch wollen sie nun also diese Reise miteinander tun. Weil sie lange verabredet war, weil all die geplanten und bezahlten Dinge nicht verfallen sollen. Zu teuer, zu groß das ganze Projekt, zu lang schon darauf eingestellt. Es sollte ihr Geburtstag werden, ein unvergeßlicher Geburtstag. Ein halbes Jahrhundert – und keine Feier für Freunde, Kollegen, Familie, sondern einmal etwas nur für sie und ihn. Etwas, von dem sie nachher hatten lange zehren wollen, an das sie vielleicht noch auf ihrem Sterbebett denken würden. Once in a lifetime. Nur einmal im Leben. Eine Woche am Arabischen Golf, in einem luxuriösen Hotel, nur sie beide. Ja, jede würde davon träumen. Erst vorhin beim Abschied hatten es ihr Nachbarinnen zugerufen: »Wir beneiden Sie alle! Gute Reise! Eine wunderschöne Zeit.«
Matilde weiß also, wie sie sich fühlen sollte. Aber sie fühlt sich kein bißchen so. Ihr wird ganz schwindelig wegen des Widerspruchs in ihrem Inneren.
Als käme daher Trost, streicht sie gedankenverloren mit dem Handrücken über die Fasern ihres gelben Tuchs, das so lang und breit wie eine ausgewachsene Decke ist. Wie üblich springen ihre Gedanken durcheinander wie kleine Kinder auf einem Klettergerüst an einem warmen Spielplatz-Sommertag.
Matilde hat schon oft so wie jetzt gesessen und einfach zugeschaut. Ein unbestimmtes Sehnen zog sie auch früher schon hierher an den Flughafen. Es hat ihr an diesem Ort immer gefallen. Sie sah sich all die Abenteurer an, die abfliegenden voller Spannung und unterdrückter Furcht. Die ankommenden, die so unpassend wirkten an einem Wintertag in Tegel wie ein Scheich in seiner Nationaltracht auf einer Schweizer Skipiste. Der Vergleich stimmt nur bedingt, verbessert sich Matilde sogleich im Geiste. Denn natürlich bauen sich die Scheichs längst eigene Loipen, Abfahrtshänge, Lifte wie in Sankt Moritz, künstlich angelegt und überdacht in ihre Einkaufszentren. Das weiß sie, und bald wird sie es mit eigenen Augen sehen. So, wie in Dubai Schlittschuhe und Anoraks bei vierzig Grad im Schatten angeboten werden, kann man in Deutschland ganzjährig Bikinis und Strandlaken kaufen. Es ist nicht sehr viel verrückter, Schnee in Shopping Malls zu türmen, Eisbahnen unter Glas anzulegen, als wenn blasse Großstädter wie sie und Gabriel lange, unbequeme Nachtflüge in kauf nehmen. Alles nur, um exotische Länder kennenzulernen und von da acht Tage später als seltsam knusprig gefärbte Sonnenhuldiger zurückzukehren. Nein, es ist nicht sehr viel verrückter, das Eine unterscheidet sich vom Anderen lediglich durch die Summe an eingesetztem Geld.
Warum wollen wir so gern das Gegenteil von dem kennenlernen, was wir bereits haben? Was läßt uns nach der anderen Seite streben und, falls wir es uns denn leisten können, danach, sie auch anschauen, erleben, fühlen zu können? Oder, um bei den Scheichs zu bleiben, sie direkt vor unserer Haustür zu erschaffen? Aber wozu in die Ferne schweifen?! Auch in der Brandenburger Heide gibt es schließlich ein ‚Tropical Island‘, eine tropische Insel in einem ehemals für Luftschiffe angelegten Hangar. Da waren, soweit es Matilde bekannt ist, keine Scheichs am Werk, und doch entstand ein Stück andere Welt auch hier, ganz in ihrer Nähe. Vielleicht für Menschen, die aus vielen Gründen nicht verreisen können. Jedoch: Gereist wird trotzdem, weiterhin und immerdar. Matilde hat das lange nicht verstanden.
»Woran denkst du?« Gabriel fragt mit sanfter Stimme, und für einen Moment vergißt Matilde, daß sie eigentlich über Kreuz ist mit ihm.
»An meine Flugangst. Daran, wie ich oft hier saß und zugeschaut habe, nur zugeschaut.«
»Du konntest dir nicht vorstellen, die Hürde zu nehmen, selbst einmal in so eine Maschine zu steigen. Und heute tust du es.«
»Ich weiß selbst noch nicht, wie ich das schaffen soll.« Matilde spürt den Anflug einer Übelkeit. Anflug ist gut, bei dem Thema!
»Da gibt es nichts zu schaffen.« Sagt Gabriel freundlich. Das Atmen hat gewirkt. »Du brauchst es nur zuzulassen.«
Er hat recht. Sie muß ja gar nichts tun. Außer immer nur den nächsten Schritt. An den Schalter, hin zur Wartebank, nachher in den Sicherheitsbereich, danach in die Schleuse und ins Flugzeug. Mehr nicht. Der Rest geschieht dann von allein. Sie braucht nicht dafür zu sorgen, daß der Flieger vom Boden hoch kommt – obwohl sie sich so fühlt, als läge das in ihrer Verantwortung. Aber nein. Sie braucht sich nur dem Piloten anzuvertrauen und einer größeren, gütigen Kraft, die ihren Job alle beide sehr viel besser beherrschen als Matilde das je könnte. Genau das fällt ihr jedoch schwer, unendlich schwer.
Wohl hatte sie immer gern dabei zugeschaut, wie andere sich bereit machen, abheben und unversehrt, wenn auch verändert, von fern, fern wieder zurückkehren. Die Aura des Reisens faszinierte sie von jeher; die Physik der tonnenschweren Vögel, die scheinbar so federleicht in die Luft kamen, sich viele Stunden lang dort hielten und, wenn es Zeit dafür war, wieder auf der Landebahn aufsetzten. Sie konnte nie genug darüber staunen – aber immer streng vom Boden aus. In Sicherheit. Dort, wo sie sich sicher wähnte, jedenfalls. Und sie besaß all diese Jahre über ein glasklares Bild von sich selbst: Das bin ich nicht. Die anderen verreisen, ich bleibe daheim. Ich muß nicht fort, ich bin ja schon da. Gehöre wie meine Mutter und meine Großmutter – auch deren Mutter und Großmutter – schlicht zum Bodenpersonal. Ein Mensch muß wissen, wo er hingehört, eine Frau erst recht! Und was das anging, hatte Matilde lange, sehr lange nicht den geringsten Zweifel gehegt: Also, das sind wir nicht, wir sind etwas anderes, eine eigene Spezies. Das muß man so annehmen, denn wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um.
Aus welchen versunkenen Tagen und lange verblichenen Mündern kamen solche Grundsätze? Wer hat sie weitergegeben, von Generation zu Generation, wie ehern festgefügte Wahrheiten? Das ist nicht mehr herauszuforschen. Aber Verreisefurcht und Flugangst waren lange kultiviert worden in dieser Familie. Matilde hatte sie widerspruchslos übernommen. Das bin ich nicht, das sind die anderen. Auf ihrem Stückchen Erde fühlte sie sich geborgen, auf den Ozean (Wasser hat keine Balken!) wie in die Lüfte ging sie nicht. Warum verschlang sie trotzdem Jahr um Jahr alles, was an Ratgebern gegen die Flugangst auf dem Buchmarkt erschien? Führte sie lange Gespräche mit Piloten und Pilotinnen, sobald sie in ihre Nähe kam; war neugierig auf deren Meinung zum Problem? Woher dieses nagende Interesse von einer Frau, die niemals ihren Fuß auf einen schwankenden Untergrund hatte setzen wollen?
Aber Gucken war erlaubt. Ein Tag am Airport war ein schöner Tag. Vielleicht stahl sie sich ein wenig von dem Prickeln unter der Haut anderer Leute, profitierte gefahrlos von deren Adrenalin unter losen Gewändern. Das hätte sie möglicherweise zugegeben. Ja, das mag sein.
»Weißt du noch, wie wir mit den Kindern oft hier gewesen sind?« Seine Stimme.
Wie hätte sie das je vergessen können.
Matilde lächelt, während Gabriel den Faden fortspinnt: »Das waren noch Zeiten! Man konnte sie einfach unter den Arm klemmen und zu irgend einem Sonntagsausflug mitnehmen. Und wie sie sich freuten, mit einer Cola und einem Eis stundenlang auf der Besucherterrasse zu stehen und zu schauen.«
»Mir ging es wie ihnen.« Matilde starrt gelöst, beinahe heiter ein Loch ins Universum.
So hat er seine Frau lange nicht lächeln gesehen. Das gibt ihm den Mut zur nächsten Frage. »Wie geht es dir denn jetzt?«, erkundigt sich Gabriel.
Sie zuckt zusammen, als erwachte sie aus einem Traum. Jetzt! Das Fliegen. Ihre Ehe. Die bevorstehende Woche zu zweit. Ihre Fluchtgedanken. Der Druck in ihrem Magen.
»Alarmzustand auf ganzer Linie.«
‚Gelinde gesagt‘, denkt Matilde. ‚Sehr gelinde.‘
***
Wie konnte ich bloß dieser Idee zustimmen, fragt sich Matilde still, während sie zum vierten - oder bereits fünften? – Mal die kurze Strecke zwischen ihrem Warteplatz und den Toiletten zurücklegt. Offensichtlich ist es ja doch zu aufregend für mich. Und von dem Mann an meiner Seite ist keine Stärkung zu erwarten. Nicht einmal das. Gabriel in seiner Freude, Vorfreude auf das Fliegen, das Starten, Landen, die gesamte Reise, ja, dieser Mensch scheint viele Lichtjahre weit von ihr entfernt zu sein. Solche Distanz kann niemand überbrücken. Und dennoch ist ein Teil Matildes beleidigt darüber, daß er zu ihr keine Brücke schlägt. Eine, die sie auch als solche empfindet, eine ganz nach ihrem Geschmack. Das könnte er doch. Oder war diese Aktion etwa ihr Vorschlag, ihr Plan gewesen? Nein, das war sie nicht. Aber sie hatte eingewilligt. ‚Ja‘ hatte sie schon gesagt. Um ihren Teil der Verantwortung kann sie sich nicht herum mogeln.
Ein Jahr war es her, da mußte Gabriel dienstlich nach Dubai reisen. Sein Architekturbüro hatte ihn dorthin geschickt, um Kontakte zu knüpfen und die Lage für zukünftige Aufträge zu sondieren. Die Arabischen Emirate schienen ein lukrativer neuer Markt zu sein, wenn man es nur geschickt anstellte. Gabriel war der Mann fürs Zwischenmenschliche. Er besaß eine natürliche Gabe, zu kommunizieren und andere für sich aufzuschließen. Daß es darunter noch eine andere, dunkle Seite gab, das wußte im Beruf niemand. Matilde, Gabriels Therapeuten, die Kinder und die Eltern allein kannten sein Problem, hatten als einzige jemals erlebt, wie er sich gebärdete, wenn sein Dämon von ihm Besitz ergriff. Aber er hatte sich ganz gut im Griff. Inzwischen gut im Griff, mußte man ehrlicherweise sagen. Und seine so geschätzte Liebenswürdigkeit war vielleicht nur die andere Seite ein und der selben Medaille. Matilde verstand nicht viel davon. Sie wußte nur eines: Eine regelrechte Charmeoffensive fand statt, wenn ihr Mann einen Raum betrat und bislang fremde Leute in seinen Bann zog. Sein Chef war klug genug, diesen Vorzug richtig einzusetzen und der Firma dienlich zu nutzen. Nicht jeder führende Kopf – beileibe nicht jeder – kann das von sich behaupten. Aber Gabriels Boss wußte es. Daß man einen wie diesen Mitarbeiter nicht am Computer versauern ließ, sondern seinen Talenten entsprechend unter Menschen schickte. Viele Male hatte sich das schon bezahlt gemacht, so auch in Dubai. Die Mission war erfolgreich gewesen, und demnächst würde Gabriel wahrscheinlich öfter dorthin fliegen, um den Bau eines Hochhauses zu überwachen, das ein besonders begabter Kollege entworfen hatte. Dabei sollte er auch Verbindungen pflegen, die gute Stimmung untereinander erhalten helfen, weitere Möglichkeiten ausloten. In Dubai war vieles möglich. Dort konnten sie auch experimentell bauen, was hier in Deutschland sehr viel schwieriger gewesen wäre.
Aber noch wesentlicher als den Bau fand Gabriel nach seinem ersten Besuch in der arabischen multikulturellen Stadt sein Erstaunen darüber, wie Vorurteile, die er gehegt hatte, sich in Nichts auflösten. Was hatte er nicht alles bewertet, verworfen, angeprangert an diesem kometenhaft gewachsenen Wüstenort, das er ausschließlich aus dem schöpfte, was er gelesen oder in Fernsehberichten gesehen hatte. Das taugt alles nichts, sagt er nun. Alles ist anders, wenn man selbst dort war, wenn man mit den eigenen Sinnen diese Welt in sich aufgenommen hat. Matilde kann sich noch gut daran erinnern, wie sie ihn damals mißtrauisch beäugt hatte. Wie konnte es sein, daß ihr Mann plötzlich so anders redete? Wer hatte ihn umgedreht? Hatten sie ihm gar einen Chip ins Hirn gepflanzt wie in manchen dieser Science-Fiction-Filme? Oder ihn geblitz-dingst wie bei ‚Men in Black‘?
Gabriel selbst konnte es ihr nicht recht erklären, ein Mann des großen, beschreibenden Wortes war er nicht. Selbst seine Dia-Vorträge, die er ab und zu vor Verwandten, Freunden hielt, zeigten nichts als Häuser, Türme, futuristische Gebäude. Kaum Menschen, Atmosphäre, lebendiges Treiben. Matilde konnte sich nicht vorstellen, daß dies eine derart kalte Welt sein sollte.
Und so mußte sie unmerklich entstanden sein, diese Idee, zu ihrem Geburtstag einmal dorthin zu reisen, damit sie selber sehen kann, was er meint. Damit er sehen kann, wie sich alles verändert, wenn er es auch durch ihre Augen betrachtet.
Das war zumindest der eine Grund.
»Irgendwohin wären wir sowieso geflogen.« Gabriel sagt es mit weichem Blick, wie um ihre ständigen Notgänge abzumildern. »Mit dem Nachtzug irgendwohin zu fahren, das hätte dir doch auch nicht gefallen.«
»In der Schweiz ist es so kalt. Und tiefen Schnee haben wir zur Zeit auch in Berlin. Nein, du hast recht. Ich wollte in die Wärme. Und meiner erwachten Neugier folgen. Selbst, wenn ich dafür fliegen muß. Das ist es mir wert.« Matilde nimmt wieder auf ihrem harten Sitz Platz und weiß jetzt schon, daß sie gleich wieder aufspringen wird. Wann darf man eigentlich eine Flugzeugtoilette benutzen? Muß man warten, bis die Maschine in der Luft ist?
»Mach dir keine Sorgen. Am Ende dieser Reise werden wir wissen, woran wir miteinander sind. Und dann wird es gut sein. Es ist ein Segen, daß wir sie unternehmen, Matti.«
Matti hatte er sie lange nicht genannt. Es klingt vertraut, auch innig. Liebevoll. Plötzlich steht ihr ein Bild vor Augen, so klar, als würde sie geradewegs, Fuß vor Fuß, in diesen Tag eintreten.
Wie lange war das her? Zwölf Jahre, fünfzehn? Damals hatte sie ab und zu als freiberufliche Reporterin für ein Musikmagazin gearbeitet. Eines Abends stand sie nach dem wundervollen Konzert dieser berühmten kubanischamerikanischen Sängerin hinter der Bühne und wartete darauf, daß die große Künstlerin Zeit für sie haben würde. Wie so oft kämpfte sie gegen ein drängendes Neidgefühl an, das in ihr aufstieg, obwohl sie es schon damals als unwürdig empfand. Es half ihr ja nicht weiter. Kein einziges, winziges, klitzekleines Stück. Aber diese Frau war nur vier Jahre älter als sie selbst, und welche Erfüllung ihrer Träume! Schließlich stand sie vor ihr. Gloria Estefan, noch glühend von ihrem Auftritt in der Berliner Deutschlandhalle. Matilde führte ihr Interview, und es war leicht, mit ihrem Idol zu sprechen. Ganz unkompliziert. Nach einer Viertelstunde hatte sie alle ihre Fragen gestellt und beantwortet bekommen. Sie war schon im Begriff, sich zu verabschieden, da wechselte die Befragte die Seiten. Was eigentlich ihrer, Matildes, Lebenstraum sei, erkundigte sie sich. Sie habe doch einen, oder? Und wie ich einen habe, schrie es in Matilde auf. Jedoch, beherrscht nickte sie und lächelte. »Singen. Lieder schreiben. Eigene Texte. Eigene Melodien. Wie verrückt.«
Gar nicht verrückt, sagte die andere auf Englisch, also »Not crazy!«. Und dann sagte sie in einem gebrochenen Deutsch: »Sie schaffen das. Sie haben den Geist. Ich kann es in ihre Augen sehen.«
Matilde stand da, als hätte soeben der Allerhöchste persönlich zu ihr gesprochen. Oder als stünde sie gesenkten Hauptes vor der britischen Queen und habe soeben den Ritterschlag empfangen. RitterInnenschlag, ob es so etwas auch gab?
Jedenfalls, nachdem sie sich stotternd bedankt, irgendwie den Ausgang gefunden, wie in einem Traum die S-Bahn-Fahrt nach Hause überstanden hatte, wankte sie durch die Wohnungstür, um gleich darauf in einen Sessel zu fallen. Gabriel war da gewesen, hatte vorsichtig um die Ecke ins Wohnzimmer geblickt, in dem sie nun also Zuflucht gefunden hatte. »Du willst deine Jacke jetzt nicht ausziehen?«, fragte er. Matilde schüttelte den Kopf. »Du willst reden?« Matilde nickte. Er ließ das Geschirrtuch fallen, das er noch in der Hand gehalten hatte und setzte sich ihr gegenüber. Er brauchte nichts zu sagen, ein abwartender Blick genügte. Seine Frau sprudelte los und erzählte ihm von der Begebenheit wie von einer Offenbarung. Augenblicklich hatte er begriffen, worum es hier ging; was dies für sie bedeutete. »Das habe ich dir doch schon immer gesagt, Matti«, ließ er Licht auf seinem Gesicht aufleuchten. »Es wird genau so kommen. Und ich bin nur rechtzeitig auf das Trittbrett des anfahrenden Zuges aufgesprungen. Schön, daß es auch mal jemand anders bemerkt, was in dir steckt.« Von diesem Tag hatte sie lange zehren können. Seine Zärtlichkeit kannte damals keine Grenzen. Seine Unterstützung für sie ebenfalls nicht. Ausdruck dessen war sein »Matti«. Matti, Matti, Matti. Warm und weich wie ihr Schaltuch. Wo ist das alles hin?
Ernüchternd genug: Heute befinden sie sich miteinander hier, auf diesem Flughafen, um etwas zu besiegeln, vielleicht – wahrscheinlich sogar – das Ende ihrer Ehe. Schon lange wissen sie beide, daß ihnen etwas fehlt, daß es nicht mehr das ist, was es gewesen sein muß, falls ihrer beider Erinnerung sie nicht trügt. Die Forderungen des Alltags, eines erwachsenen sogenannten »Sandwich«-Lebens zwischen den Generationen, zwei Berufen, Haushaltsdingen, mit Familie, Freunden, mannigfachen Verpflichtungen müssen sie ausgehöhlt haben, ganz langsam. Es ist noch gar nicht lange her, daß sie das auch so aussprechen. Zuerst tat es zu weh, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Aber wenigstens diesen Schritt haben sie nun schon gehen können: Sagen, was Sache ist. Sich nichts mehr vormachen. Darum hatte Matilde eben auch eine Weile gezweifelt, ob sie wirklich verreisen will, so weit weg, in solcher Nähe zu Gabriel; fast kam es ihr vor, auf Gedeih und Verderb. Na, jetzt dramatisiere ich aber, ruft sie sich innerlich selbst zur Ordnung. Keiner von uns wird gleich ‚verderben‘, wenn wir einander in einer Woche eingestehen müssen: Das war es. Ein schönes Ende, ein würdiges Ende. Aber ein Ende. Sie würden weiterleben, gar keine Frage. Sie waren starke Persönlichkeiten, sie beide; davon würde weder er noch sie untergehen. Also nichts mit ‚Verderb‘.
Aber vielleicht eine kleine Chance auf ‚Gedeih‘?
Kann ihre Liebe noch einmal gedeihen, wenigstens eine kleine frische Blüte treiben durch so eine Reise? Matilde weiß es nicht. Sie spürt nur eines im Moment: Die große Angst vor ihrer eigenen Courage, ihre Blase singt ihr ein deutliches Lied davon. Manche sagen ja, wenn man nicht genug weint, dann übernimmt die untere Körperetage die Funktion des Wasserund damit des Druck-Ablassens. Wie auch immer. Matilde fürchtet sich davor, Gabriel ohne Fluchtmöglichkeit ausgeliefert zu sein, nah, oh so nah. Eng nebeneinander auf Flugzeugsitzen (wenn die Passagiere nach Abstürzen gefunden werden, hängen sie oft in Bäumen, noch angeschnallt auf diesen, ihren Sitzen! Oh, mir wird nun doch noch schlecht…). Eng, so eng im selben Hotelzimmer, in einem Doppelbett gar. Zu Hause schlafen sie längst in getrennten Räumen. Wobei Matilde niemals sagen würde, daß so etwas unbedingt von Herzlosigkeit zeugen muß. Es kann genausogut ein Akt des Respekts füreinander sein. Respekt vor unterschiedlichen Einschlafgewohnheiten, vor berechtigten Vorlieben. Er mag es hell und gern auch laut, bei weit offenem Fenster. Sie braucht es stockdunkel, wird zur Prinzessin auf der Erbse, wenn nur der Lichtstrahl einer Straßenlaterne auf ihre Lager fällt. Er schaut gern fern, Fußball, Talkshows, politische Dokumentationen. Und kann problemlos, die Kopfhörer über seinen Ohren, fest einschlafen, obwohl noch lange nicht Sendeschluß ist. Sie erträgt noch nicht einmal Krimis direkt vor dem Einschlafen, höchstens eines ihrer Gute-Gedanken-Bücher, das ein sanftes Hinübergleiten in weiterführende Träume und ein neues Stückchen Weisheit möglich macht.
Es muß also keine mangelnde Liebe sein, wenn jeder sein eigenes Schlafzimmer hat.
Bei ihnen beiden, und das gibt Matilde nun inzwischen auch zu, hat es jedoch damit zu tun: Sie wollen ihre Ruhe voreinander. Der jeweils andere fehlt nicht mehr. Und oft genug sind sie in letzter Zeit auch ohne Gute-Nacht-Wunsch und -Kuß zu Bett gegangen, jeder in seines.
Es ist riskant diese Reise zu unternehmen, und das auf mehreren Ebenen gleichzeitig. So ganz weiß Matilde auch nicht, ob sie es richtig macht. An ihr hat es gehangen, denn ein Wort von ihr, ein klares »Nein!« in diesem Falle, hätte genügt, und sie wären zu Hause geblieben. Gabriel überließ die Entscheidung am Ende ihr. Und sie sagte: »Ja. Okay. Laß es uns versuchen.« Obwohl sie zuletzt auch nicht mehr wußte, wieso und wozu eigentlich.
»Wieso und wozu eigentlich? Warum tue ich das? Wem zuliebe entscheide ich jetzt so und nicht anders?!«, hatte sie eine Freundin kurz vorm Tschüß-Sagen gefragt. »Du hast es längst entschieden, Matilde.«, hatte diese Freundin ruhig geantwortet. »Die Entscheidung ist lange durch. Nun wird sie nur noch gelebt. Das Schwerste hast du bereits hinter dir.«
Na, ich weiß ja nicht. Matilde kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, daß nicht dies hier das Schwerste ist, während sie ein weiteres Mal das WC ansteuert. Oder daß ihr das Allerschwerste noch bevorsteht. Das kommt ihr sehr viel wahrscheinlicher vor.
»Sieh zu, daß du fertig wirst.«, sagt Gabriel jetzt, indem er aufsteht und nach ihrer Tasche greift, die auf dem Plastiksitz liegengeblieben war. »Es geht los mit dem Einsteigen in unseren Airbus. Ich stelle mich schon mal an. Du kommst dann nach, ja?«
Sie nickt. Er wendet sich in die Richtung des Boarding-Schalters, vor dem sich bereits eine lange Menschenschlange bildet.
Verschiedene Gedanken sind ab diesem Augenblick verboten, befiehlt sich Matilde nun selbst, und zwar sehr ausdrücklich. Es ist nicht gestattet, zu denken: ‚Jetzt könnte ich noch zurück.‘ Genausowenig ist es erlaubt, zu denken: ‚Ich haue durch die Hintertür ab.‘ Und erst recht untersagt sie der Stimme in ihrem Inneren, sie zu quälen mit etwas in dieser Art: ‚Solltest du abstürzen, brauchst du nie wieder zum Zahnarzt zu gehen und keine Steuererklärung mehr abzuliefern.‘ Am liebsten würde sie sich ihr gesamtes nicht kontrollierbares Gedankengewitter verbieten, sich ‚blitzdingsen‘ lassen, gewissermaßen. Aber weder Will Smith noch Tommy Lee Jones lassen sich blicken, weit und breit nicht.
Matilde schafft es auch so. Vielleicht ist die Angst groß genug für einen kleinen Blackout zwischendurch. Nachdem sie sich erneut und gründlich erleichtert hat, blickt sie beim Händewaschen in ein völlig leeres Gesicht. Durch die Tür nach draußen Richtung Flugzeug tritt sie als eine Frau, die sich in ihr unvermeidliches Schicksal ergeben hat, die alle weiteren Schritte tut wie ferngesteuert und neben Gabriel in die Economy-Warteschlange findet. Es gibt keinen Bus, der sie zum Flugzeug gebracht hätte, es gibt auch keine ziehharmonikaartige Schleuse, die sie zu durchschreiten haben. Nein, in diesem Falle werden sie über das eisige, von Januarstürmen gepeitschte Flugfeld geschickt und über eine offene Treppe zum Eintreten in den A 330 gebeten.
Matilde schwebt diese metallenen Stufen hinauf wie ein Filmstar, nicht, ohne sich noch einmal umzudrehen. ‚Adé, Berlin!‘, hebt Marilyn Monroe huldvoll ihre behandschuhte Rechte: ‚Wenn die Götter mögen, sehen wir einander wieder.‘ Matilde hat ja keine Ahnung, wie rasch das geschehen sollte.
***
»Hast du gesehen, unser Gesundheitsminister ist auch eingestiegen. Vorn die Gangway rauf in die Business Class, natürlich.« Während er Taschen und Mäntel in das Gepäckfach über ihren Köpfen verstaut, erzählt Gabriel Matilde, was sie schon weiß. Wie immer hatte sie ihre Augen überall. Eine archaische Frauensache, hat sie mal gehört. Das Männchen steuert sein Ziel an, blendet alles andere aus, während das Weibchen ihm den Rücken, seine Flanken, die Umgebung sichert, indem sie sie mit Rundumblick genau abscannt. Matilde ist sich nicht sicher, ob man das verallgemeinern kann. Bei ihnen beiden stimmt es jedenfalls und hat sich schon mannigfach bewährt in ihrem gemeinsamen Leben.
»Meinst du, dadurch kann ich mich jetzt sicherer fühlen?«, fragt sie ihn mit bänglichem Blick. Er hat ihr den Fensterplatz überlassen, obwohl sie ihn gar nicht wollte. Lieber in die – hoffentlich – entspannt lächelnden Gesichter der Stewardessen schauen als nach unten, so tief unten. Am Gang könnte sie sich einreden, daß das alles ja vielleicht bloß eine Busfahrt ist, und daß sie sich gar nicht zehntausend Meter über festem Grund befindet – oder noch höher. Das ist das viel zitierte laute Pfeifen im Wald. ‚ Tirili, ich habe gar keine Angst, weil – tirili und tirila – das ganze nur ein Traum ist.Ob ich nun in der S-Bahn sitze oder im Flugzeug, raus kann ich so oder so nicht.‘ A propos: Das ist ja eine ihrer schlimmsten Ängste. Die dicken Türen gehen zu, und dann kann sie nicht mehr raus. Dann muß sie bleiben, ob sie will oder nicht. War es nicht neulich in den Nachrichten zu hören und zu lesen, daß Passagiere zwei Stunden lang in einem Flugzeug festsaßen und nicht raus durften, um dann elendiglich zu verbrennen, weil der zweite Startversuch schließlich in einer Katastrophe endete?! Angehörige klagten später bitter an, daß sie sogar noch von draußen mit ihren Verwandten drinnen in dem maroden Rumpf telefoniert hätten: ‚Sie wollten dringend aussteigen. Und die Flugbegleiterinnen, der Kapitän ließen sie nicht. Sie machten einfach die Türen nicht auf, und das war ihr sicherer Tod.‘
‚Hatte ich mir nicht Gedankenverbot auferlegt?‘, ermahnt Matilde sich im Stillen. Beziehungsweise, wenn schon denken, dann bitte etwas Günstiges. Als Gegengift gegen diese Angst, nicht raus zu können, hatte sie sich beispielsweise folgendes zurechtgelegt: Läge ich jetzt, statt mich auf einem Flugzeugsitz anzuschnallen, auf einem Operationstisch und hätte einen langen Eingriff vor mir, dann könnte ich ja auch nicht weg. Dann müßte ich ebenfalls ausharren, geduldig, patient, wie das englische Wort für ‚Patient‘ nicht ohne Grund heißt. Gut, ich bekäme eine Narkose und würde das meiste der verfließenden Zeit gar nicht mitbekommen. Aber flüchten könnte ich nicht, auch später nicht aus meinem Klinikbett. Im Umkehrschluß soll das aber nicht heißen, sie wünschte sich für jeden Flug eine Betäubungsspritze. Obwohl, wenn sie jetzt so darüber nachdenkt…
»Wie fühlst du dich, Matti?« Matti. Schon wieder verwendet Gabriel das Kosewort.
»Ganz gut. Danke der Nachfrage. Der weite Innenraum gefällt mir.« Tatsächlich flößt ihr das Geräumige des Airbus aus irgend einem Grund Vertrauen ein. Sie kann hier atmen. Links und rechts befinden sich Doppelsitze wie die beliebten Pärchenbänke im Kino. In der Mitte die Vierrereihen, nicht ganz voll besetzt, so daß geübte Reisende sich schon jetzt die Schlafbrillen, Kuscheldecken, Ohrstöpsel zurechtlegen und eine dieser Reihen als Nachtlager reservieren. Ein beruhigender Anblick für Matilde. Diese dort drüben, eine beige Frau, ein beiger Mann, sehen eher gelangweilt aus, einem Ritual gehorchend, das sie schon an sich ermüdet. Sie gähnen ungeniert. Von Adrenalin, von Angst gar keine Spur. Nicht die geringste. Wie machen sie das nur?
Der helle Anstrich des Flugzeugs (wird es überhaupt gestrichen?) wirkt ebenfalls tröstlich auf Matilde – und, daß so viele Kinder an Bord sind. Vor ihr rückt sich eine Dresdner Familie zurecht, mit zwei kleinen Mädchen, vielleicht drei und anderthalb. Die Kleine greint ein wenig. Ihre Schlafenszeit rückt näher. »Nu heul ämo nich«, sagt die junge Mama leise. »Bald flieschen mir. S wärd scheen.«
So viele Kinder. Da wird Matilde doch nicht die Nerven verlieren. Sie doch nicht! Der Mutterinstinkt ist eine starke Kraft. Auch, wenn es gar nicht um die leibliche Brut geht.
»Du siehst schön aus.«, sagt Gabriel leise. »Ein bißchen Aufregung steht dir gut.«
‚Auf einmal nimmt er mich wieder wahr‘, denkt Matilde. So oft hat er durch mich hindurch gesehen, über mich hinweg. ‚Männer wie du ermorden Frauenseelen -‘, das war das Schlimmste, was sie im Streit einmal zu ihm gesagt hatte, ‚indem sie sie einfach eingehen lassen.‘ An seiner Seite hatte sie sich zuletzt wie ein Möbelstück gefühlt, so selbstverständlich, seelenlos, meist gar nicht richtig wahrgenommen. Ihr doch egal, wenn das verdächtig nach Selbstmitleid klingt. Sie war einmal als Künstlerin gestartet, voller Hoffnung und Schaffenslust. Eine Sängerin, bestimmt mit vielversprechenden Aussichten. Geendet ist sie als Hausfrau. Die sich ihren Tag nach den Diensten, Schichten, Reisen ihres Ehemannes einteilt und es immer so einrichtet, daß sie da ist, wenn er kommt. Zuerst fand sie das noch in Ordnung so. Als sie sich aber eines Tages beim besten Willen nicht mehr daran erinnern konnte, wann sie eigentlich ihr letztes Lied gesungen hatte, da wurde sie mutlos. Wodurch war das geschehen? Wie hatte sie sich nur so aufgeben können? Und vor allem: Warum hatte er das aus ihr gemacht, so etwas auch nur zugelassen?!
Da sitzt er, lächelt sie vorsichtig an, wie um kein Porzellan vor der Zeit zu zerschlagen und sagt, daß ihr Aufregung prima stünde. Ja, hat er denn alles vergessen? Wie sie vor Lampenfieber fast umkam, vor jedem neuen Auftritt? Wie sie weder schlafen noch essen noch leben konnte und ihr Körper sich einmal komplett selbst ausräumte, wenn es wieder einmal so weit war und sie auf eine Bühne mußte, auf die sie doch gleichzeitig so sehnsüchtig hinauf wollte? Sie hätte getippt, ihr Anblick ähnelte dem, was der Berliner ‚Tod auf Latschen‘ nennt. Aber Videoaufzeichnungen ihrer Konzerte zeigten ihr später das kleine wahre Wunder: Strahlend schön hatte sie ausgesehen, ganz in ihrem Element. Kein Gedanke an die Qualen, die sie davor durchlitten hatte und immer wieder durchleiden mußte. Man sah es ihr nicht an, ganz im Gegenteil. ‚Ein bißchen Aufregung steht dir gut.‘ Ja doch, Gabriel, du weißt es selbst. Sag nicht, daß du dich nicht mehr daran erinnern kannst, wie du jedes und jedes Mal unten im Zuschauerraum gesessen hast, die Wangen rot vom Glück über deine Frau, die jetzt noch allen gehörte und später am Abend dann wieder nur dir. Nur dir allein.
Matilde läßt von ihrem inneren Dialog nichts nach außen dringen. So weit ist sie noch nicht. Das braucht Gabriel im Moment nicht zu wissen von ihr. Okay, sieht sie eben schön aus. Steht Ihr die Aufregung halt gut.
»Ich glaube, es geht los.« Gabriel will nach ihrer Hand greifen, aber sie zieht sie fort. Nein, jetzt noch nicht. Sie atmet tief, wie sie es beim Autogenen Training gelernt hat, versucht, sich in ihrem ganzen Körper zu entspannen. Matilde trainiert loszulassen.
Der beste Rat gegen das verzehrende Lampenfieber, den sie jemals bekam, war der: ‚Du gehst gar nicht auf die Bühne, ins Licht. Du gehst zu Gott. Versuch dir das vorzustellen. Und Gott geht ins Licht. An deiner Stelle.‘ Der beste Rat gegen die Flugangst, den sie jemals bekommen hatte, war der: ‚Habe Gottvertrauen. Laß alles, was geschieht, zu. Wenn du dran bist, bist du sowieso dran. Ob nun in einem Flugzeug oder in deiner eigenen Straße.‘ Das stimmte.
Letztes Jahr, als Gabriel in Dubai und sie als Strohwitwe zu Hause geblieben war, unruhig bis zu dem Moment, als sie hörte, er sei heil in seinem Hotel angekommen, da widerfuhr es ihr: Sie trat vor ihr Haus, wollte nur einkaufen gehen, wie immer, als ihr eine Glasflasche voller Fanta-Limonade um Millimeter an ihrer Nasenspitze vorüber flog. Sie hatte nicht einmal Zeit, sich zu erschrecken, so schnell war alles gegangen. Sie schaute nach oben. Zwei feixende junge Gesichter. Fünfzehnjährige Bengels, die in der Ödnis ihrer ungelenkten Energie nichts Besseres zu tun wußten, als aus einem Dachfenster mit voller Absicht Passanten mit Gegenständen zu bewerfen. Matildes Objekt war die Flasche gewesen. Als das endlich bei ihr ankam, kletterte sie die Treppe zu jener Wohnung hinauf und stellte die Knaben zur Rede. Die gaben sich überraschend wissend: ‚Wenn Sie uns verklagen wollen, ich war es nicht. Der war´s!‘ Schon zinkte der eine den anderen an. Ihr Früchtchen, dachte Matilde und hoffte auf ihre natürliche Autorität, an die sie von ihren eigenen Kindern her gewohnt war. ‚Ich will euch gar nicht verklagen. Ich will euch nur ins Gewissen reden.‘ Sie sagte ihnen, daß sie hätte tot sein können, wenn das Geschoß nur die richtige Stelle auf ihrem Schädeldach getroffen hätte. Und was dann?! Die Jungs schienen betroffen, entschuldigten sich gar. Aber Matilde war sich nicht sicher, ob das Kichern hinter ihrem Rücken nicht doch heißen konnte ‚…die Alte haben wir aber verarscht!‘. Als sie damals Gabriel abends am Telefon von dem Vorfall erzählte, da sagte er, mehr als sechstausend Kilometer von ihr entfernt: ‚Du lieber Himmel! Da hast du nun Angst um mich gehabt und ob ich gesund hier eintreffe, und in der Zwischenzeit verröchelst du dein junges Leben vor unserer Haustür, weil solche Idioten nichts mit sich anzufangen wissen!‘
Du bist dran, wenn du dran bist.
Matilde wünscht sich sehr, jetzt bitte noch nicht dran zu sein, denn im Grunde ihres Herzens liebt sie ihr Leben zusehends, jung oder nicht.
»Guten Abend, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän.« Während die Maschine über das Rollfeld fährt und langsam auf ihre Startbahn einbiegt, stellt sich ihr Pilot vor. Er heißt Harald Günther, ja, das seien ein Vor- und ein Nachname, Harald und Günther, hätte schon oft zu Verwirrung geführt. Ein launiger Mann offenbar, der es sich zutraut, einen so großen Vogel voller Menschen – und Menschenkinder! – die nächsten fünfeinhalb Stunden in ferne Welten zu steuern. ‚Versuchen Sie nicht, die Maschine selber zu fliegen!‘, steht ebenfalls in den einschlägigen Ratgebern gegen die Flugangst. Dennoch spürt Matilde, wie sie unwillkürlich ihre Gesäßmuskeln anspannt, damit sie gleich auch richtig vom Boden hoch kommen. Die nächsten fünfeinhalb Stunden. Manche OPs dauern auch so lange und länger, und dann könnte ich auch nicht so einfach raus. Anspannen, entspannen, sich selbst beschwichtigend zureden. So kommt Matilde über die nächsten Minuten, bis die Turbinen aufheulen, sie alle noch einmal ermahnt werden, auch angeschnallt zu sein und jetzt nicht mehr aufzustehen. ‚Ja doch, ich würde sogar meinen kleinen Finger anschnallen, wenn mir das eine Überlebensgarantie böte‘, denkt Matilde. Und: