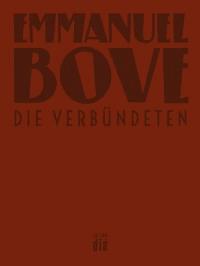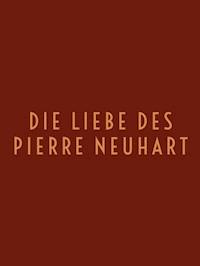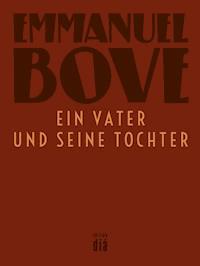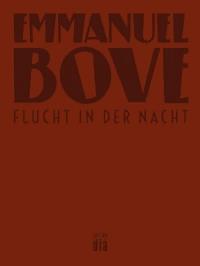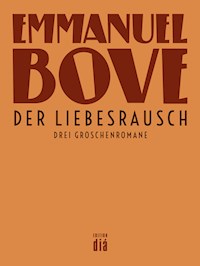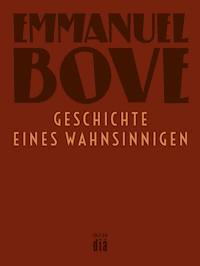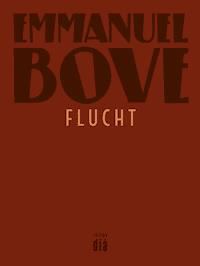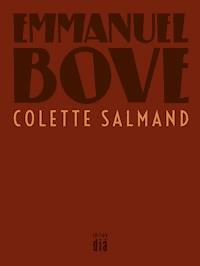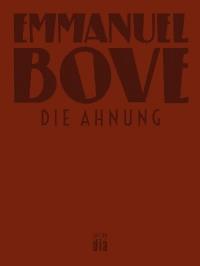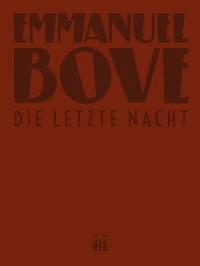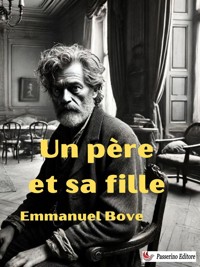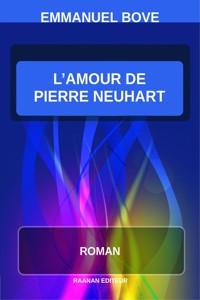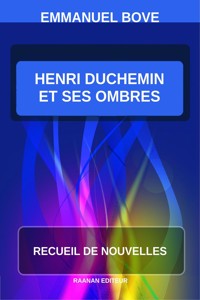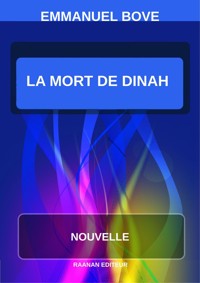14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"In seinem Roman schildert Bove einen Abschnitt aus dem Leben des Victor Baton, eines Kriegsinvaliden, der mit seiner niedrigen Rente im Paris der zwanziger Jahre lebt und sich nichts sehnsüchtiger wünscht, als einen Freund zu haben, um seiner Einsamkeit zu entrinnen. Die Versuche, die Baton in dieser Richtung; unternimmt, scheitern jedoch alle: am Ende lebt er, nachdem ihm sein Dachzimmer gekündigt wurde, in einem heruntergekommenen Hotel."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Emmanuel Bove, am 20. April 1898 in Paris geboren, starb dort am 13. Juli 1945.
Emmanuel Bove
Meine Freunde
Aus dem Französischen von Peter Handke
Suhrkamp Verlag
Titel der Originalausgabe: Mes Amis
Geschrieben 1921; erschienen 1924
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 10. Auflage der Ausgabe der Bibliothek Suhrkamp, Band 744.
© Flammarion, 1977
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1981
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Willy Fleckhaus
eISBN 978-3-518-74156-6
www.suhrkamp.de
Meine Freunde
I
Wenn ich aufwache, steht mir der Mund offen. Meine Zähne sind belegt: es wäre besser, sie am Abend zu putzen, aber das bringe ich nie über mich. In meinen Augenwinkeln eingetrocknete Tränen. Die Schultern tun mir nicht mehr weh. Ein Haarschwall bedeckt meine Stirn. Mit gespreizten Fingern streiche ich ihn zurück. Ohne Erfolg: wie die Seiten eines neuen Buches richtet er sich auf und fällt mir wieder über die Augen.
Den Kopf senkend, merke ich, daß mir der Bart gewachsen ist: er sticht am Hals.
Ein Wärmegefühl im Nacken, bleibe ich auf dem Rücken liegen, die Augen offen, die Leintücher bis zum Kinn, damit das Bett nicht auskühlt.
Der Plafond ist bedeckt mit Feuchtigkeitsflecken: er ist so nah am Dach. Die Papiertapete wirft sich hier und da. Meine Einrichtungsgegenstände gleichen jenen der Trödler auf den Trottoirs. Das Rohr meines kleinen Ofens ist umwickelt mit Lappen wie ein Knie. Am oberen Rand des Fensters hängt schief ein Rollvorhang, außer Funktion.
Indem ich mich ausstrecke, spüre ich an den Fußsohlen – ein bißchen wie ein Seiltänzer – die vertikalen Stangen des Gitterbetts.
Die Kleidungsstücke, die flach auf meinen Unterschenkeln liegen, sind nur auf einer Seite warm. Meine Schuhbänder haben keine Eisenstifte mehr.
Wenn es regnet, ist das Zimmer kalt. Es ist, als hätte niemand da gelegen. Das Wasser, das durch alle Fensterkaros eindringt, nagt am Kitt und bildet eine Lache auf dem Boden.
Wenn dann die Sonne – nichts sonst am Himmel – aufstrahlt, wirft sie ihr gelbes Licht mitten ins Zimmer. Jetzt ziehen die Fliegen auf der Diele tausend gerade Linien.
Jeden Morgen, beim Aufräumen, singt meine Nachbarin, ohne Worte. Ihre Stimme wird gedämpft durch die Mauer. Ich habe den Eindruck, mich hinter einem Grammophon zu befinden.
Oft begegne ich ihr auf der Stiege. Sie ist Milchfrau. Um neun Uhr kommt sie, Tropfen von Milch auf ihren Filzpantoffeln, und bringt ihr Zimmer in Ordnung.
Ich mag die Frauen in Pantoffeln: die Beine wirken nicht so unnahbar.
Im Sommer: die Träger ihres Hemds unter der Bluse, und eine Ahnung ihrer Brüste.
Ich habe ihr gesagt, daß ich sie liebe. Sie hat gelacht, sicher weil ich nichts gleich sehe und arm bin. Sie zieht die Männer vor, die eine Uniform tragen. Sie wurde beobachtet, wie sie die Hand unter dem weißen Koppel eines garde républicain hatte.
Ein anderes Zimmer ist belegt von einem alten Mann. Er ist schwer krank und hustet. Sein Stock hat unten einen Gummiaufsatz. Seine Schulterblätter bilden hinten zwei Höcker. Eine Ader läuft über seine Schläfe, zwischen der Haut und dem Knochen, reliefartig. Sein Rock reicht nicht mehr bis an die Hüften und flattert, als seien die Taschen leer. Dieser arme Kerl schleppt sich von einer Stapfe zur andern, ohne dabei das Geländer loszulassen. Kaum daß ich ihn bemerke, atme ich tief ein, um an ihm vorbeizukommen, ohne dabei Luft holen zu müssen.
Sonntags besucht ihn seine Tochter. Sie ist elegant. Das Futter ihres Mantels gleicht dem Federkleid eines Papageis. Es ist derart schön, daß ich mich frage, ob sie den Mantel nicht verkehrtherum trägt. Und ihr Hut muß viel wert sein, denn seinetwegen nimmt sie bei Regen ein Taxi. Diese Dame duftet nach Parfum, nach dem echten Parfum, nicht nach jenem, das in Glasröhrchen verkauft wird.
Meine Mitmieter schauen auf sie herab. Sie sagen: statt das große Leben zu führen, täte sie besser daran, ihrem Vater aus der Misere zu helfen.
Sonst wohnt auf der Etage noch die Familie Lecoin. Früh am Morgen schallt von dort ein Weckerrasseln.
Der Mann mag mich nicht, obwohl ich doch höflich zu ihm bin. Er hat etwas gegen mich, weil ich so spät aufstehe.
Seine Arbeitsmontur zusammengerollt unter dem Arm, kommt er jeden Abend gegen sieben nach Hause und raucht dabei eine Zigarette aus englischem Tabak – was die Leute sagen läßt, daß die Arbeiter gut verdienen.
Er ist groß und stark, und seine Kraft kann, so man zu einem entsprechenden Kompliment bereit ist, von Nutzen sein. Im letzten Jahr hat er den Reisekoffer einer Dame aus der dritten Etage hinuntergetragen, wenn auch unter Schwierigkeiten, denn der Deckel ging nicht zu.
Wenn jemand mit ihm redet, fixiert er ihn, weil er argwöhnt, der andre wolle sich über ihn lustig machen. Beim kleinsten Lächeln sagt er:
– Sie müssen wissen … vier Jahre Krieg … ich. Die Deutschen haben mich nicht gekriegt … Und auch Sie werden mich jetzt nicht drankriegen …
Eines Tages, im Vorbeigehen, hat er gemurmelt: »Nichtstuer!« Ich bin blaß geworden und habe keine Antwort gewußt. Die Angst, einen Feind zu haben, ließ mich eine Woche lang nicht schlafen. Ich bildete mir ein, daß er eine Gelegenheit suchte, mich zu schlagen; daß er mir ans Leben wollte.
Wenn doch M. Lecoin von meiner Zuneigung zu den Arbeitern wüßte, von meinem Erbarmen mit ihnen. Wenn er wüßte, mit wieviel Entbehrungen ich meine kleine Unabhängigkeit bezahle.
Er hat zwei Töchter. Wenn er sie schlägt, dann mit den bloßen Händen, zu ihrem Wohl. In ihren Kniekehlen zeigen sich die Sehnen. Ihre Hutbänder sind aus Gummi.
Ich mag Kinder. Auch wenn ich diesen zwei Mädchen begegne, spreche ich sie an. Dann weichen sie zurück, und flüchten plötzlich, ohne Antwort.
Jeden Dienstag wäscht Madame Lecoin im Flur die Wäsche. Der Wasserhahn rinnt den ganzen Tag. Das Geräusch wechselt, je nach dem, ob die Kessel voll oder leer sind. Mme. Lecoins Rock ist aus der Mode. Ihr Haarknoten ist so dürftig, daß man darin alle Haarnadeln sieht.
Oft starrt sie mich an, aber ich bin mißtrauisch, denn wahrscheinlich stellt sie mir eine Falle. Im übrigen hat sie keinen Busen.
Kaum habe ich die Leintücher zurückgeschlagen, setze ich mich auf die Kante. Meine Beine baumeln von den Knien abwärts. Die Poren meiner Schenkel sind schwärzlich. Meine langen, kantig-spitzen Zehennägel: ein Fremder fände sie häßlich.
Ich stehe auf. Mir dreht sich der Kopf, aber dieses Schwindelgefühl vergeht schnell. Wenn die Sonne scheint, steigt eine Staubwolke vom Bett auf und glänzt für kurze Zeit in den Strahlen, wie Regen.
Zuerst ziehe ich mir die Socken an; sonst würden Streichhölzer an meinen Sohlen haften. Mich an einem Stuhl festhaltend, steige ich in die Hose.
Bevor die Schuhe drankommen, prüfe ich ihr Unterleder: wird es noch eine Zeitlang halten?
Hernach stelle ich auf den Kübel die Wasserschüssel, die einen Ring zeigt vom schmutzigen Wasser des Vortags. Ich habe die Eigenart, mich gekrümmt zu waschen, mit gespreizten Beinen, die Hosenträger lose an den hinteren Knöpfen. Beim Regiment wusch ich mich so im engen Feldkessel. Meine Schüssel ist derart klein, daß, wenn ich beide Hände zugleich eintauche, das Wasser übergeht. Meine Seife schäumt nicht mehr: so winzig ist sie.
Für Gesicht und Hände habe ich ein einziges Tuch. Käme ich zu Reichtum, so wäre das nicht anders.
Einmal gewaschen, fühle ich mich besser. Ich atme durch die Nase. Meine Zähne können sich sehen lassen. Meine Hände werden sauber bleiben, bis zum Mittag.
Ich setze mir den Hut auf. Die Ränder sind gewellt vom Regen. Der Bandknoten befindet sich, gemäß der Mode, hinten.
Ich befestige den Spiegel am Fenster. Ich habe es gern, mich von vorn zu betrachten, im Licht. So gefalle ich mir besser. Meine Backenknochen, meine Nase, mein Kinn sind beleuchtet, das übrige ist im Schatten: als würde ich photographiert bei Sonnenschein.
Besser, sich nicht vom Spiegel zu entfernen, denn dieser taugt nicht viel. Wenn ich weiter weg stehe, verzerrt er mein Bild.
Ich überprüfe sorgfältig meine Nasenlöcher, meine Augenwinkel, meine Backenzähne. Diese sind kariös. Sie fallen nicht aus: sie brechen ab. Mit Hilfe eines anderen Spiegelscherbens erspähe ich mein Profil. Dabei habe ich das Gefühl einer Verdoppelung. Die Filmschauspieler dürften solch ein Vergnügen gut kennen.
Dann öffne ich mein Fenster. Die Tür rührt sich. Ein 1914/18-Druck schabt gegen die Wand. Teppiche, die ausgeschüttelt werden. Bläuliche Blechdächer, Rauchfänge, ein Nebelstreifen, der sich bewegt, wenn ihn ein Sonnenstrahl quert, und der Eiffelturm mit dem Aufzug in der Mitte.
Bevor ich gehe, ein kurzer Blick auf das Zimmer. Mein Bett ist schon kalt. Ein paar Federn schauen halb aus der Decke. In den Beinen meines Stuhls Löcher für Querstäbe. Die zwei Segmente eines Rundtisches hängen herab.
Dieses Mobiliar gehört mir. Ein Freund hat es mir geschenkt, vor seinem Tod. Ich habe es persönlich desinfiziert, mit Schwefel, denn ich fürchte die ansteckenden Krankheiten. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme habe ich lange Zeit Angst gehabt. Ich hänge am Leben.
Ich schlüpfe in den Überzieher; eine recht schwierige Angelegenheit, denn das Ärmelfutter ist zerrissen.
Ich stecke mein Dienstbuch, meinen Schlüssel, mein schmutziges Taschentuch, welches kracht, wenn ich es entfalte, in die linke Tasche. Meine Schultern sind schief: das Gewicht dieser Dinge soll das ausgleichen.
Die Tür läßt sich nicht ganz öffnen. Ich krümme mich zusammen und schlängele mich durch.
Die Kachelung des Flurs ist abgesplittert. Eine Eisenschiene, mit drei Löchern, hängt am Oberlichtfenster. Das Geländer endet an der Mauer, ohne Glaskugel als Abschluß.
Ich steige die Treppe hinunter, entlang der Wand, wo die Stapfen am breitesten sind. Ich halte mich nicht am Geländer fest, damit meine Hände nicht schmutzig werden. Hinter den Türschlössern klappern Schlüsselbünde.
Ich fühle mich leicht, wie sonst nur am ersten Tag des Ausgehens ohne Überzieher. Das Wasser aus der Schüssel befeuchtet noch meine Wimpern und das Innere meiner Ohren. Ich bedaure die, die noch schlafen.
Ich treffe jedesmal die Concierge. Sie hat die Strohmatten auf das Geländer gelegt, um eine Etage zu kehren, oder bearbeitet mit einer gelben Bürste einen Korridor. Ich grüße sie. Sie antwortet kaum, den Blick auf mein Schuhwerk gerichtet.
Nach acht möchte sie allein im Haus sein.
II
Ich wohne in Montrouge.
Die Neubauten in meiner Straße riechen noch nach den frisch gesägten Steinen.
Mein Haus ist freilich nicht neu. Der Fassadengips bröckelt und fällt ab. Brustlehnen queren die Fenster. Das Dach ist zugleich der Plafond der letzten Etage. Alle Fensterflügel sind befestigt an einem Haken in der Mauer, außer bei starkem Wind. Der Architekt hat es unterlassen, seinen Namen oberhalb der Nummer einzugravieren.
Am Morgen ist die Straße ruhig. Eine Concierge ist beim Kehren, ausschließlich vor ihrer Tür.
An ihr vorbeigehend, atme ich durch die Nase, wegen des Staubs.
Durch die halbgeöffneten Fenster spähe ich in die Erdgeschoßwohnungen. Ich sehe Zimmerpflanzen, die gerade begossen worden sind, Fassungen von Granaten, Weltkriegssouvenire, glänzendrot, und schmale Fußbodenbretter im Zickzackmuster, frischgewachst.
Wenn mein Blick dem eines Bewohners begegnet, werde ich verlegen.
Manchmal eine Bewegung weißer Wäsche hinter einem Vorhang, in Augenhöhe: jemand wäscht sich.
Meinen Café trinke ich nebenan, in einer Schankbude. Das Thekenblech ist am Rand gewellt. Eine Ahnung vom Alter des Fußbodenholzes, das gewaschen ist mit klarem Wasser. Ein Grammophon, das vor dem Krieg funktionierte, ist gegen die Wand gedreht. Man fragt sich, was es da soll, wenn es doch kaputt ist.
Der Patron ist liebenswürdig. Er ist klein wie ein Soldat am hinteren Ende der Reihe. Er hat ein Glasauge, das dem richtigen Auge so gleichschaut, daß ich nie weiß, welches das gute ist – was peinlich ist. Wie mir scheint, ärgert er sich, wenn ich in sein falsches Auge blicke.
Er hat mir versichert, er sei verwundet worden im Krieg: aber man erzählt, daß er schon 1914 einäugig war.
Der brave Mann beklagt sich ständig. Das Geschäft geht nicht mehr gut. Mag er auch vor den Kunden die Gläser abtrocknen, mag er auch sagen: »Danke, Monsieur; auf Wiedersehen, Monsieur; lassen Sie die Tür nur offen« – es kommt doch niemand.
Er möchte den Krieg wegdenken. Er sehnt sich zurück nach dem Jahr 1910.
Zu jener Zeit scheinen die Leute ehrenhaft und gesellig gewesen zu sein. Die Armee hatte Schwung. Man konnte Vertrauen zueinander haben und interessierte sich für die sozialen Probleme.
Wenn er von alldem redet, werden seine beiden Augen – das echte und das falsche – feucht, und seine Wimpern verdicken sich zu kleinen Stacheln.
Der Vorkrieg ist so rasch zu Ende gegangen, daß er nicht glauben kann, daß es sich bloß noch um Erinnerung handelt.
Auch wir sind jetzt eingedeckt mit sozialen Problemen, darauf besteht er, und das ist für ihn selber der Beweis, daß ihn der Krieg nicht verändert hat.
Er versichert mir jeden Tag, daß es in Deutschland, einem besser organisierten Land als dem unsren, keine Bettler gibt. Die französischen Minister sollten das Bettlertum verbieten.
– Aber es ist verboten!
– Wie? Und all das Gelumpe, das Schuhbänder verkauft! Die sind reicher als Sie und ich.
Als jemand, der keine Dispute mag, hüte ich mich, zu antworten. Ich schlucke meinen Café hinunter, den ein Tropfen Milch bräunlich gefärbt hat, zahle und gehe.
– Auf morgen! ruft er und stellt meine noch warme Tasse unter einen Wasserstrahl, den man nur im Keller abdrehen kann.
Etwas weiter weg ist ein kleines Lebensmittelgeschäft.
Der Inhaber kennt mich. Er ist so fett, daß seine Schürze vorn kürzer erscheint als hinten. Durch seine Bürstenfrisur sieht man die Haut. Sein Schnurrbart »à l’américaine« verstopft ihm die Nasenlöcher und hindert ihn daran, durch die Nase zu atmen.
Vor seinem Geschäft steht ein Schaugestell – klein, vorsichtshalber – mit Linsen- und Pflaumensäcken und Bonbonpokalen. Zum Bedienen kommt er heraus, aber das Wiegen geschieht dann im Innern.
Früher, wenn er gerade in der Tür stand, unterhielten wir uns. Er fragte mich, ob ich Erfolg gehabt und etwas gefunden hätte, oder aber versicherte mir, daß ich großartig aussähe. Dann trat er wieder hinein und gab mir dabei mit der Hand ein Zeichen, das besagte: »Bis zum nächsten Mal.«
Eines Tages bat er mich, ihm beim Tragen einer Kiste zu helfen. Das hätte ich gern getan, aber ich habe seit jeher Angst vor einem Bruch gehabt.
Ich lehnte ab, indem ich stammelte:
– Ich bin nicht stark, ich habe eine schwere Verwundung.
Seit jenem Vorfall spricht er nicht mehr mit mir.
In meiner Straße ist auch eine Metzgerei.
Stücke von Fleisch hängen an Stricken von silberfarbenen Haken. Der Arbeitstisch ist in der Mitte gemuldet wie eine Treppenstapfe. Blutige Rindsfiletstücke liegen Seite an Seite auf gelblichem Papier. Das Sägemehl haftet sich an das Schuhzeug der Kunden. Blankpolierte Gewichte sind nach ihrer Größe aufgereiht. Es gibt ein Gitter, so als ob man fürchtete, das Fleisch könnte entwischen.
Am Abend sehe ich durch dieses rot angestrichene Gitter Grünpflanzen auf dem blanken Marmor im Schaufenster.
Der Inhaber dieser Metzgerei erinnert sich meiner nicht: das einzige, was ich da gekauft habe, waren Abfälle für eine räudige Katze, für vier Sous, im letzten Jahr.
Die Bäckerei wird sehr in Ordnung gehalten. Jeden Morgen putzt ein junges Mädchen die Auslage. Kleine Wasserrinnsale, trottoirabwärts.
Durch das Fenster hat man einen Überblick auf den ganzen Laden, mit seinen Spiegeln, seiner Täfelung à la Louis xv, und seine Kuchen auf Drahttellern.
Mag diese Bäckerei auch nur von begüterten Leuten betreten werden, so gehöre ich doch zu ihrer Kundschaft – das Brot kostet überall gleich viel.
Oft bleibe ich stehen vor einem Kurzwarengeschäft, wo die Buben des Viertels Knallfrösche kaufen.
Draußen liegen auf einem Tisch Zeitungen gefaltet, von denen man kaum einen Teil des Titels lesen kann.
Nur der Excelsior hängt frei aus wie ein Tischtuch.
Ich betrachte die Bilder. Die übergroßen Klischees zeigen immer wieder das gleiche: einen Boxring, oder einen Revolver samt Hülsen.
Kaum sieht die Händlerin mich kommen, tritt sie aus ihrem Geschäft, in einem Geruch von bemaltem Spielzeug und frischem Baumwolltuch.
Sie ist mager und alt. Die Gläser ihrer Brille schauen aus wie Lupen. Ein Netz wie bei einem Kindermädchen hält ihren verdorrten Haarknoten zusammen. Die Lippen sind gleichsam ins Mundinnere verschwunden und kommen nicht mehr zum Vorschein. Ihre schwarze Schürze umgibt einen Bauch, der nicht an seinem Platz ist. Um auf fünf Francs herauszugeben, verschwindet sie im Hinterladen. Ich frage sie nach ihrem Befinden.
Überhaupt nicht zu antworten wäre gar zu unhöflich; so wackelt sie mit dem Kopf. Die Tür, die sie offen gelassen hat, ist das Zeichen für mich, zu verschwinden.
Eines Tages habe ich die Zeitung in die Hand genommen, um unter der Schlagzeile weiterzulesen.
Mit einer bösen Stimme hat sie zu mir gesagt:
– Der Preis ist drei Sous.
Ich wollte ihr beibringen, daß ich den Krieg mitgemacht habe, daß ich schwer verwundet worden bin, daß ich Inhaber der Tapferkeitsmedaille bin, daß ich eine Rente bekomme, aber es wurde mir sofort klar, daß das sinnlos war.
Im Weggehen habe ich gehört, wie die Tür geschlossen wurde, mit einem Geräusch, als ob ein Schutzblech schepperte.
Ich bin gezwungen, vor dem Milchgeschäft vorbeizugehen, wo meine Zimmernachbarin arbeitet. Das geniert mich, denn diese hat meine Liebeserklärung sicherlich ausgeplaudert, und man mokiert sich wahrscheinlich über mich.
So gehe ich schnell daran vorbei und bemerke aus den Augenwinkeln die großen Butterklumpen, geritzt von einem Faden, die Landschaftsbilder auf den Camembert-Deckeln und ein Maschennetz über den Eiern, wegen der Diebe.
III
Wenn mir nach Luxus zumute ist, mache ich einen Spaziergang rund um die Madeleine. Das ist ein reiches Viertel. Die Straßen riechen nach der hölzernen Pflasterung und nach Auspuffrohren. Der Windstoß, der den Autobussen und Taxis folgt, bläst mir ins Gesicht und auf die Hände. Die Rufe, die ich momentlang höre, beim Vorbeigehen an den Cafés, scheinen aus einem Megaphon zu kommen, das geschwenkt wird. Ich betrachte die stehenden Autos. Parfumluft hinter den Frauen. Ich überquere die Boulevards nur, wenn ein Wachmann den Verkehr stoppt.