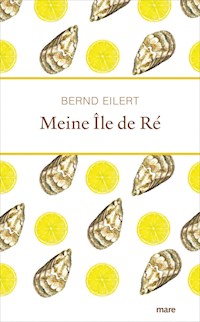
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wangerooge im Dauerregen, Eltern im Dauerstreit: Bernd Eilerts erster Kindheitsurlaub führte zunächst nicht zu einer Leidenschaft für Inseln. Erst viel später findet er in der Île de Ré doch noch »seine« Insel, die mit ihrem diskreten Charme und dem Mangel an offensichtlichen Sehenswürdigkeiten der ideale Ort für Müßiggänger und Entdeckungen ist. Als säßen wir mit ihm bei einer Portion Austern, unterhält uns der Autor mit Beobachtungen französischer Ferienroutine und Betrachtungen alter Inselorte. Er nimmt uns mit auf Radtouren entlang der Salzbecken, in denen die Pyramiden aus Fleur de Sel in der Morgensonne funkeln. Er präsentiert uns seine Apologie der Schickimickis oder sinniert über Rés Besucher und Besatzer – vor allem aber über ein Kunstwerk, das er von der Insel mitgebracht hat: das Porträt eines Knaben im Matrosenanzug, dessen rätselhafter Herkunft er schließlich auf die Spur zu kommen glaubt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERND EILERT
Meine Île de Ré
© 2022 by mareverlag, Hamburg
CovergestaltungNadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
CoverabbildungOlgers1 / Dreamstime.com
Datenkonvertierung E-BookBookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-814-4
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-653-9
www.mare.de
INHALT
Ein langer Weg
Annäherungen
Stimmen und Stimmungen
Anarchie in Ars
Plädoyer für eine bedrohte Unart
Zwei Fälle von Hochverrat
In gewissen Kreisen
Heimatkunde
Deutsche und Franzosen
Ré la Blanche
Quellen und weiterführende Literatur
»Meine Insel.«
Was für eine eigenartige Vorstellung.
Alastair Bonnett
Ein langer Weg
Eben frage ich mich, ob Menschen, die auf Inseln geboren wurden, mit dem Festland ähnlich tagträumerische Sehnsüchte verbinden, wie umgekehrt Festlandianer sie allgemein für Inseln empfinden. Vorstellen kann ich mir das nicht. Ich nehme an, dass sich geborene Insulaner auf dem Festland eher zurücksehnen nach ihrer Geburtsinsel, danach, wieder von Wasser umgeben und vom Festland abgesondert und damit etwas Besonderes zu sein. Nicht allein der sogenannte Brexit spricht für diese Vermutung.
Nächste Frage: Wie viele Inselbürtige mag es geben? Im Verhältnis zu uns, den gewöhnlichen Erdenbürgern, meine ich. Vermutlich kaum mehr als Blaublütige oder Rothaarige. Verhältnismäßig wenige also, wenn man bedenkt, dass es 8,8 Millionen Inseln und Inselchen geben soll, die eine Grundfläche von zwischen 10 und 10 000 Quadratmetern vorweisen können, die 627 Millionen Felsen, die irgendwo aus dem Wasser ragen, nicht mitgerechnet. Dabei bietet das Inselleben Vorteile: Die ältesten Menschen leben angeblich auf Inseln, ob nun in Asien oder der Ägäis.
Andererseits werden über Inseln Witze gemacht, zumindest wurden sie das regelmäßig zu der Zeit, als ich in der norddeutschen Tiefebene aufgewachsen bin, Luftlinie keine hundert Kilometer entfernt von der nächsten Inselgruppe. Zu der gehört auch die kleine Insel Baltrum, auf der immer noch alljährlich der Inselwitz groß gefeiert wird. Fünf Tage lang dauert das Treffen der Karikaturisten, die hier über alte und neue Inselwitze lachen müssen.
Ihre Witz-Inseln sehen aus wie früher: ein Sandhaufen im Ozean, gerade Platz genug für mindestens eine Palme und einen Schiffbrüchigen. Manchmal sind es derer zwei: Palmen, um eine Hängematte dazwischen aufzuhängen, Schiffbrüchige, um jemanden zum Streiten zu haben. Eigentlich sind es also Robinson-Witze, und tatsächlich scheint Daniel Defoes dreihundert Jahre alter Roman unser Verhältnis zu Inseln nachhaltig beeinflusst zu haben. Auf Inseln kleiden sich viele Feriengäste ganz anders als daheim, tendenziell leichter und abenteuerlicher, manche hausen in engen Wohnwagen, andere sogar in noch engeren Zelten. Lagerfeuer am Strand sind bei Alt und Jung beliebt.
Kurz geschlossen: Ältere Menschen fühlen sich auf Inseln jünger und benehmen sich auch so. Manchmal bleiben Erwachsene einfach bei den Gewohnheiten, die sie viel früher hier entwickelt haben: Sie buddeln im Sand, werfen sich in die Brandung und jauchzen dabei laut und ungehemmt. Sie fühlen sich wohl.
Wer nicht das Glück hatte, als Kind bereits einen fernen Ort zu finden – und als Kind liegt jeder Ort fern, der nicht zu Hause ist –, einen Ort, an dem das Kind sich so glücklich fühlt, dass es Jahr für Jahr wieder dorthin kommen möchte, wird später alle Jahre wieder vor der Frage stehen: Wohin?
Kindheitserinnerungen an ein solches Traumziel habe ich nicht, da meine Eltern nur in meinen frühesten Jahren mit mir gemeinsam Reisen unternahmen; nachdem sie sich endgültig getrennt hatten, war ans Verreisen schon aus finanziellen Gründen nicht mehr zu denken. Ich verbrachte die langen Sommerferien wohl mehr oder weniger im Freibad. Und da war ich nicht der Einzige.
Zum Flötenteich, so hieß der Tümpel, an dessen Stelle jetzt ein 25 Meter langes, gekacheltes Schwimmbecken hellblau leuchtet, brauchte ich per Fahrrad ungefähr fünf Minuten. Seltener fuhr ich ins zentrale alte Huntebad, benannt nach dem Fluss, der mitten durch meine Heimatstadt verläuft, da das Gerücht, am Grunde des toten Arms, verborgen unter der braunen Wasseroberfläche, verwesten Kadaver von Kühen und Pferden, mich abschreckte. Dafür roch es im Huntebad nach dem warmen Holz der Stege und Umkleidekabinen. Am Flötenteich roch es nach Chlor.
Im Gepäck hatte ich außer einem Handtuch meist das eine oder andere gelbe Reclam-Bändchen, häufig mit Unterstreichungen und Randbemerkungen in der lässig akkuraten Schönschrift meines Vaters versehen. Diese kleine Handbibliothek stammte aus seiner Schulzeit in den letzten Vorkriegs- und ersten Kriegsjahren. Glauben Sie mir, das war das Beste, was er mir hinterließ, es war auch das Einzige.
1943 hatte er sich als Siebzehnjähriger zur Wehrmacht gemeldet, mehr oder minder freiwillig, geködert mit einer Art Notabitur, das ihm die Oberprima ersparen sollte. Voraussetzung war, dass der Gymnasiast sich verpflichtete, Offizier zu werden. In den letzten Kriegsjahren gab es davon offenbar zu wenige. Was aus den anderen geworden war, danach fragte man damals besser nicht.
Mein Vater meldete sich zur Marine – eine Fotografie zeigt ihn in Ausgehuniform mit Zierdegen als stolzen Fähnrich zur See –, eine kluge Entscheidung, denn bei dieser Waffengattung dauerte die Ausbildung bedeutend länger als etwa bei der Infanterie. Zum Kanonenfutter brauchte es offenbar nicht viel Schliff – ein Schiff zu führen ist komplizierter. Schließlich waren Kanonenboote teuer.
Mein Vater – und hier könnte ich eine schicksalhafte Verbindung ziehen – wurde in La Rochelle stationiert, kaum drei Kilometer weiter liegt nun meine Insel: die Île de Ré. Ob er je dort gewesen ist, habe ich nie erfahren.
Über seine Kriegserlebnisse konnte ich ohnehin erst spät mit ihm sprechen, gut fünfzig Jahre nachdem er sich von meiner Mutter und mir getrennt hatte. Er erzählte davon mit einer naiven Fabulierfreude, die entfernt an die Berichte des Simplizius Simplizissimus aus dem Dreißigjährigen Krieg erinnerte. Noch während seiner Offiziersausbildung, der die alliierte Invasion in der Normandie ein jähes Ende setzte, erhielt er die Order, sich auf dem Landweg nach Flensburg durchzuschlagen, wo der Großadmiral Dönitz die Reste der deutschen Kriegsmarine versammelte.
In Flensburg war übrigens mein Großvater mütterlicherseits geboren worden, der gern von seiner Leichtmatrosenzeit erzählte. Bei einem Appell hatte ihn S. M. Wilhelm II. persönlich mit den Worten »Und du, mein Sohn?« nach seinem Alter gefragt. Für den damals Siebzehnjährigen war das der Höhepunkt seines Lebens. Das sollte er auch bleiben.
Den Befehl, sich bei Dönitz zu melden, verweigerte mein Vater zwar nicht, ließ sich bei dessen Ausführung aber so viel Zeit, dass er nach diversen Umwegen noch in Niedersachsen als britischer Kriegsgefangener den Rest des Zweiten Weltkriegs unbeschadet überleben konnte: Hans – so sein erster Vornamen – im Glück.
Seine Sammlung von Reclam-Heften umfasste den Kanon der Literatur, die den Nazis als Schullektüre geeignet schien: deutsche Klassik, deutsche Romantik, deutscher Realismus, deutsche Gedichte, deutsche Dramen, deutsche Novellen. Hauptsache deutsch.
Als Zwölfjähriger fing ich an, diesen Nachlass zu lesen, ein Heft nach dem anderen. Im Freibad las ich Schillers Dramen lieber als die von Goethe, ich mochte Fontanes Balladen lieber als Klopstocks Oden. Mit wachsender Begeisterung las ich Novellen, unerhörte Begebenheiten, erzählt von Heinrich von Kleist, E. T. A. Hoffmann, Annette von Droste-Hülshoff, Theodor Storm, Gottfried Keller, Wilhelm Raabe, Franz Grillparzer, Marie von Ebner-Eschenbach und Eduard Mörike. Meine Lieblingslektüre war von Joseph von Eichendorff, ein Sehnsuchtsbüchlein, angefangen beim vorbildlichen Titel: Aus dem Leben eines Taugenichts.
Dem Fernweh, das den Titelhelden unwiderstehlich über die Alpen nach Süden zieht, konnte ich erst viel später nachgeben. Vor dem kühnen Plan, von daheim fortzulaufen, warnten Jugendbücher aus dem Schneider Verlag, die es zum Geburtstag gab: Ein kleiner Ausreißer namens Sabine kommt nicht weit, und Käpt’n Konny schnuppert zwar Seeluft, doch am Ende ist er heilfroh, wieder in den Heimathafen einzulaufen.
Fernreisen wie die zu Stevensons Schatzinsel fanden in den Wirtschaftswunderjahren noch selten statt.
Da ich mit zwanzig Jahren die Gelegenheit bekam, als Autor selbst mein erstes Geld zu verdienen, was einerseits mit binnenländischer Reiserei verbunden war, andererseits die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit verfließen ließ, dauerte es noch Jahrzehnte, bis ich eher zufällig an den Ort kam, der mir so gut gefiel, dass ich seither ein Dutzend Mal wieder dorthin gefahren bin, auf die Insel mit dem kurzen Namen Ré.
Die 1,6 Seemeilen, die zwischen dem Festland und der Insel liegen, werden seit gut dreißig Jahren elegant überbrückt vom Pont de l’Île de Ré, mit knapp drei Kilometern angeblich die zweitlängste Brücke Frankreichs. Mir kommt sie jedes Mal länger vor.
Die Form der Insel ist schwer mit irgendetwas zu vergleichen, da sie keinem bekannten Körper ähnelt; mag sein, dass gewisse Gespensterfische dermaßen unorganisch aussehen, was erklären würde, dass sie nur in Tiefen leben, in die kein natürlicher Lichtstrahl mehr dringt. Ein wiedererkennbarer Autoaufkleber, wie etwa Sylt ihn rein äußerlich hergibt, lässt sich daraus kaum herleiten.
Sylt kann auf eine lange, wechselvolle Geschichte zurückblicken – heute sieht man davon wenig. Inzwischen ist die sogenannte Whiskeymeile in Kampen inklusive Gogärtchen und Ponyclub und des Flairs der süffigen 60er-Jahre schon fast das Geschichtsträchtigste, was die Insel zu bieten hat. Drei Dinge brauchte der Mann, und der herbe Geruch von Stanwell, Vat 69 und Old Spice weht noch durch die in die Jahre gekommenen Lokalitäten.
In einer Erdbeschreibung aus dem 7. Jahrhundert taucht meine Insel erstmals auf, damals unter dem Namen insula ratis, was wahlweise Floß, Ponton oder Brücke bedeuten kann.
Sogar Spuren steinzeitlichen Lebens hat man auf der Île de Ré gefunden, dazu eine antike Vase. Und wenn wir schon beim Buddeln sind: Die Entstehungslegende raunt von einem gewaltigen Erdbeben, das von einer sagenhaften antiken Großstadt namens Antiochia nur zwei Inseln übrig gelassen habe – neben der etwas größeren Île d’Oléron eben die Île de Ré.
Nun gab es zwar in antiker Zeit Dutzende von Orten, die Antiochia genannt wurden, doch gemeint sein konnte bloß eine: Antiochia, du Goldene, wie ein Zeitgenosse schwärmt, das Wohlleben gedeiht hier, nicht die Kunst oder gar Philosophie. Eine bedeutende Metropole, halb so groß wie Rom, doppelt so reich. Der Niedergang Antiochias begann tatsächlich mit einem Erdbeben, bei dem angeblich die Hälfte der Stadtbevölkerung ums Leben kam und das den Rest wohl so deprimierte, dass die stolze Stadt in der Versenkung verschwand. Nur dumm, dass sie am nordöstlichsten Zipfel des Mittelmeers gelegen war, Tausende von Seemeilen entfernt.
Geologen vermuten, dass Einzelstücke sich erst während der Römerzeit vom Festland gelöst haben und durch Ablagerung von Sedimenten zu einer einzigen Insel geworden sind; ob die Île de Ré zuvor aus drei oder vier Teilen bestand, darüber streiten die Gelehrten. Der Küste am nächsten ist ein größerer Brocken zu erkennen, mit Anhängseln sowohl im Norden als auch im Westen, von denen das längere durchaus noch zweigeteilt gewesen sein könnte. An einer der Klebestellen ist gerade genug Platz für eine Landstraße, einen Deich und ein schmales Stück Sandstrand, flankiert von zwei Meerengen, dem Pertuis Breton im Norden und dem von Antioche vor der Südküste. Von hier aus kann man bei guter Sicht eine flache Silhouette erahnen: die Nachbarinsel Oléron.
Der feine Unterschied zwischen diesen beiden Inseln entspricht, was die finanziellen Verhältnisse der Feriengäste betrifft, ungefähr dem zwischen Sylt und Föhr, wobei die Île de Ré wiederum im Vergleich zu Sylt mit seinen vielen Bausünden einen geradezu paradiesischen Eindruck macht.
Vor allem gegen Abend, wenn der Sonnenschein milchig geworden ist und angenehm warm über die Haut rieselt, die Luft nach Salz und Holzfeuer riecht und die Vögel sich langsam zur Ruhe begeben, an einem solchen Abend, wenn der brave Franzose noch am Esstisch sitzt, mit dem Rad über diese Insel zu fahren, mit kurzen Hosen und wehendem Hemdschoß, versteht sich, das kommt meiner Vorstellung vom Paradies jedenfalls bedenklich nahe.
Der biblische Vergleich hinkt natürlich, denn ein Garten Eden ist die Insel nicht. Eher eine Zwischenwelt aus Wasser und Land, die noch nicht deutlich voneinander geschieden wurden.
Diese Welt gehört den Vögeln: Möwen vor allen, filmreif gereiht auf Zaunpfählen, flotte Seeschwalben, gründelnde Enten, rüttelnde Falken, diebische Elstern, hochbeinige Regenpfeifer, kobolzende Kiebitze, Schwäne mit ihren vergleichsweise hässlichen Jungen, graue Fischreiher und kleinere weiße, die zum Schlafen hinüberfliegen in die Baumwipfel jenseits des Weges. Und komische Vögel mit überlangen Krummschnäbeln, die es dummerweise nicht auf die Schautafeln geschafft haben, die an günstigen Aussichtspunkten auf Birdwatcher warten. Auch Dragon- und Butterflywatcher sollten auf ihre Kosten kommen, angeblich schwirren und flattern hier 28 Libellen- und 41 Schmetterlingsarten herum.
Auf der Deichkrone führt der Radweg mal am Meer entlang, das je nach Tidenstand mehr oder weniger nahe kommt, mal durch bunt gemischte Waldstückchen, häufiger noch durch Felder und Wiesen und dann immer wieder durch die Salzbecken, auf deren Trenndämmen wogende Gräser und vermooste Sträucher wuchern, umgeben von Niederungen in den unterschiedlichsten Zuständen, manche opak, brackig braun, andere von flachem, wie ein Libellenflügel flirrendem Wasser bedeckt, auf dem sich die tief stehende Sonne blendend wie in Weißblech widerspiegelt.
Häufig ist die Oberfläche der Tümpel bedeckt mit giftig grünen Algen, die im Abendlicht quittengelb leuchten, selten ist das Wasser darin so glasklar, dass sich modernde Äste darunter abzeichnen. Wieder andere sind kultiviert, in rechteckige Becken unterteilt, in denen Seewasser verdunstet, bis das Salz abgeschöpft und zu weißen Pyramiden aufgeharkt werden kann, matt schimmernd wie bleiche Knochen oder tote Korallen. Manchmal schwebt ein Papierdrachen darüber, wohl um die Vögel zu vertreiben.
Auch in den Salzgärten spiegelt sich der weite Himmel, und wenn sich kurz nach Sonnenuntergang die Wolken im Westen rötlich färben, scheint die Erde noch einmal zu erglühen, bevor graue Dunstschleier die Nacht ankündigen. Hätte ich die leiseste Neigung, fromm zu werden – an einem solchen Abend im Juni wäre ich gefährdet. Und bevor ich die weltliche Alternative in Betracht ziehe und Lyriker werde, erinnere ich mich rechtzeitig an die warnenden Verse Heinrich Heines:
Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.
Mein Fräulein! sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück;
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück.
So radle ich lieber im Zwielicht heimwärts und tue gar nichts – außer einen langen Schatten zu werfen.
Aber so weit sind wir noch lange nicht. Denn zuvor war ich auf einigen anderen Inseln. Für alles, was man erlebt, gibt es ein erstes Mal, und dieser erste Eindruck ist manchmal prägend.
Zum ersten Mal auf einer Insel war ich im Jahr 1954, kurz vor dem Wunder von Bern und nach meinem fünften Geburtstag. Und mein Aufenthalt war nicht dazu angetan, mich zum Liebhaber dieser Insel werden zu lassen.
Die Insel hieß Wangerooge. Ursprünglich hieß sie Wangeroog, das Schluss-e wurde erst im 19. Jahrhundert auf Erlass der Oldenburgischen Verwaltung unter Protest der Insulaner, die jede Veränderung hassen, angehängt. Dennoch ein weiser Entschluss des Großherzogs, die Wellenbewegung wird von diesen vier Silben mit der Hebung auf der dritten wesentlich plastischer abgebildet.
Meine Überfahrt lief damals offenbar glatt, in Erinnerung geblieben sind mir nur die Möwen, die dem Fährschiff folgten und für Aufregung sorgten, da alle Passagiere in Deckung gingen, wenn eine über ihrem Kopf kreiste. Von einer Möwe beschissen zu werden ist keine schöne Vorstellung. Und Möwen sind in mancher Beziehung furchterregend, schon Hitchcock hat das gewusst.
Wangerooge ist die östlichste der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln, im Westen folgen Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum. In dieser Reihenfolge bisher zu merken über die folgende, eher fragwürdige Eselsbrücke: Welcher Seemann Liegt Bei Nacht Im Bett? Gegenfrage: Welcher nicht?
Aufgereiht von West nach Ost: Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge, klingt es nicht viel sinnreicher: Bei Jeder Nordseeinsel Buddeln Lustige Seemänner Wattlöcher. Auch diese Version wirft Fragen auf – wer würde wohl Löcher ins Watt buddeln und dabei noch lustig bleiben? Ein Seemann, der noch halbwegs bei Trost ist, sicher nicht. Wer jemals eine Wattwanderung gemacht hat, wird das bestätigen.
Für alle, die sich die Reihenfolge nicht auf Anhieb merken können, habe ich mir gerade deshalb folgende Eselsbrücke ausgedacht: Beinahe Jede Nacht Bekommt Ludwig Seine Wutanfälle. Wieso Ludwig jede Nacht so wütend wird? Weil er sich diesen Satz einfach nicht merken kann.
Streng genommen gehörte Wangerooge allerdings nicht mal mehr zu Ostfriesland, sondern war Teil des Großherzogtums Oldenburg, die Oldenburger Insel, eine andere hatten wir ja nicht. Auch deshalb verbrachten so viele Oldenburger auf Wangerooge ihre Sommerferien. Heute fahren meine Stadtleute eher nach Mallorca, Teneriffa, Kreta oder auf die Malediven, Inseln, die allesamt nie zu ihrem Großherzogtum gehört haben.
Soweit ich mich erinnern kann, war es der erste Urlaub, den sich meine Eltern leisten konnten. Und der letzte auf Wangerooge. Wir wohnten in einer Privatpension zu dritt in einem Zimmer, mein Bettchen stand quer zum Fußende des Ehebetts. Eine eindeutige Verschlechterung meiner gewohnten Wohnsituation gegenüber, denn zu Hause hatte ich eine eigene Kammer mit einer Luke, aus der ich angeblich einmal versucht hatte, aufs Dach zu klettern, um dort zu schlafwandeln. Eine Veranlagung, die man damals als »mondsüchtig« tadelte.
Schlafen konnte ich in dem Pensionszimmer ohnehin nicht, denn meine Eltern hatten mein Geburtstagsgeschenk daheim vergessen: den Teddybären, der heute noch auf dem Bücherregal neben meinem Bett sitzt und über meinen Schlaf wacht, den Arm zum Gruß erhoben oder zum Zeichen, dass er mir diese erste Lieblosigkeit verziehen hat.
Diese Fahrlässigkeit war längst nicht das Schlimmste. Jede Nacht, wenn ich meine Augen zugemacht hatte, stritten sich meine Eltern. Das taten sie daheim womöglich auch, doch hier konnte ich ihren Stimmen anhören, wie ernst dieser Streit war. Ich war froh, wenn die Nacht vorbeiging und goldenes Licht ins Zimmer fiel. Sonnenschein? Nein, die Illusion dauerte nur an, bis mein Vater die goldgelben Vorhänge aufzog und sagte: »Zur Abwechslung regnet es heute mal Bindfäden.«
Reiner Zynismus, denn der Regen regnete jeglichen Tag, zumindest in meiner Erinnerung. Einmal muss er aber doch nachgelassen haben, denn es gibt ein Foto von meinem Vater, wie er sich bei einem Strandsportfest im sogenannten Scherenstil – das eine Bein hat er fast bis unters Kinn hochgezogen – über eine Latte schwingt, die ungefähr in meiner damaligen Scheitelhöhe zwischen zwei Pfosten liegt. Mein Vater trägt eine dunkle Wollmütze, ein weißes Unterhemd und eine dunkle Badehose; im Hochsprung belegte er Platz 3, so steht es unter der Beweisaufnahme, weiß auf schwarz. Ein weiteres Foto zeigt mich am Strand, wie ich versuche, mit Eimerchen und Schäufelchen ausgerüstet, auf Knien einen Damm gegen das auflaufende Wasser zu errichten. Eine Sisyphusarbeit.
Das Allerschlimmste jedoch war jener Moment, als mich in der Brandung ein Brecher von den Füßen riss und ich nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Ein Holländer, der zufällig in der Nähe badete, packte mich am Arm und zog mich an die Oberfläche. »Rustig ademen«, sagte der Holländer.
Als ich wieder ruhiger atmete, erklärte mir mein Vater, wie das Salzwasser in meinem Ohr den Orientierungssinn gestört hatte. Er sagte das beinah vorwurfsvoll, was aus dem Schock eine traumatische Erfahrung hätte machen können, für die Kinder ja besonders empfänglich sein sollen. Das Gefühl vollkommener Ohnmacht und extremer Hilflosigkeit war vorhanden. Die Herzlosigkeit meines Vaters führte bei mir indes zu einer Trotzreaktion. Dass ich ihm nicht mehr vertrauen konnte, stand für mich nun endgültig fest.
Demnach dürfte es Sie nicht wundern, dass ich Inselaufenthalte von da an zunächst einmal vermieden habe. Gegen eine Woche Schullandheim auf der Insel Juist konnte ich mich allerdings nicht wehren.
All das änderte sich, als ich 1970 nach Frankfurt kam. Ich wohnte zunächst bei F. K. Waechter in seiner sogenannten Arbeitswohnung. Fritz Waechter war der beste Zeichner, dem ich je bei der Arbeit zugesehen habe. Wenn Außerirdische ihn als Prototyp des Menschen analysiert hätten, sie wären zu dem Schluss gekommen, dass es sich beim Zeichnen um eine ganz natürliche humane Funktion handeln müsse, dem Homo sapiens angeboren. So leicht ging ihm alles, was er zeichnete, von der Hand, dass es schien, als wäre die Feder unmittelbar mit dem Auge verbunden, und jeder optische Eindruck würde wie ein Positiv im Entwicklerbad automatisch auf dem Papier erscheinen. Zudem konnte Waechter jedes Sujet in jede gewünschte Stilrichtung wenden.
Waechter, der noch bei der satirischen Zeitschrift pardon als Layouter angestellt war, hatte die Idee für ein Kinderbuch, das er illustrieren wollte. Er suchte nur noch jemanden, der ihm den Text dazu schreiben konnte. Mir traute er das zu.
Um ungestört arbeiten zu können, flogen wir nach Mallorca. Dort trafen wir auf ein paar Tausend Rentner, die sich ausgerechnet hatten, dass sie den Winter auf Mallorca angenehmer und billiger verbringen könnten als daheim. Neckermann machte es möglich.
Mallorca kann sehr kalt sein, zumindest im Februar 1971 war es das. Uns blieb also gar nichts anderes übrig, als zu arbeiten und uns bisweilen das Vergnügen zu gönnen, 1000-Peseten-Scheine frühmorgens im Hotelpool schwimmen zu lassen, um dann vom Fenster aus zu beobachten, ob sich einer der Rentner ins ungeheizte Wasser stürzen würde. Meist warteten wir vergeblich.
Das war nicht die einzige Enttäuschung. Das Hotel war so hässlich, wie man es in dieser Preisklasse erwarten durfte. Durch unser Doppelzimmer verlief die Calle del horrendos, eine viel begangene Ameisenstraße, die mal schnurgerade, mal in serpentinenartigen Windungen über kaltes Linoleum ins Badezimmer führte, wo sie sich hinter schadhaften Kacheln verlor.
Immerhin inspirierte uns die Beobachtung zu einem Kurzfilm, der später im Taunus realisiert wurde. Denn Hotel- und Waldameisen verhalten sich ähnlich: Mal marschieren sie geradeaus, mal im Slalom um unsichtbare Hindernisse. An die Stelle, wo die Streckenführung wechselte, stellten wir nun ein von Fritz eigenhändig gefaltetes Häuschen aus Pappe auf, über dessen Eingang ein Schild mit der Aufschrift Zur fröhlichen Einkehr hing. Wenn man die Ameisen, die unbeirrt ihres einmal eingeschlagenen Weges trotteten, pfeilgerade dort hineingehen sah und sie zum Hintertürchen in Schlangenlinien heraustorkelten, war der Eindruck unzweideutig und rechtfertigte den Untertitel unseres Lehrfilms: Studie zum Alkoholismus unter Blauen Waldameisen.
Irgendwann erwachten wir morgens und fanden unser Zimmer nicht bloß voller Ameisen, sondern auch voller Menschen: ein Team, das Werbung für Sinalco Cola machte und mit Fritz schon in Frankfurt zu tun gehabt hatte. Wir waren überrascht von ihrem Auftauchen und mehr noch von der Antwort auf unsere Frage, wie sie uns denn auf dieser Insel gefunden hätten: »Wir haben einfach nach zwei langhaarigen Deutschen unter dreißig gefragt.«
Das erzähle ich nur, um Ihnen eine Vorstellung von der Trostlosigkeit Mallorcas in den frühen 70er-Jahren zu geben. Noch regierte der Generalissimus Franco – ob das die ganze Freudlosigkeit erklärt, weiß ich nicht. Der Diktator konnte unser Kinderbuch, das ihm gewiss missfallen hätte, nicht verhindern, es wurde termingerecht fertig.
Im Geist der Zeit waren Die Kronenklauer inhaltlich antiautoritär und experimentierfreudig, was die Form betrifft. Für mich war es eine Bestätigung, unter anderem dafür, dass das Schreiben mir wenig Mühe macht, und der Beginn meiner Autorenlaufbahn.
Auch Mallorca habe ich später von seiner ansehnlicheren Seite kennengelernt. Am prächtigsten in einem Stadtpalast, von dem es hieß, hier habe der spanische König früher einmal seine jeweilige Konkubine untergebracht. Wir arbeiteten dort im Terrassenviertel von Palma mit Blick auf den Jachthafen am Drehbuch für einen unserer 7 Zwerge-Filme, in denen Otto Waalkes Mitte der Nullerjahre das feiern konnte, was Kritiker sein »Leinwand-Comeback« nennen.
Für seine erste Rolle in Otto – Der Film hatte das Drehbuch seine drehfertige Form auf einer anderen Insel erhalten.
Korsika kann Anfang November recht warm sein, zumindest war es das 1983. Wir waren mit einem kleinen Flugzeug unterwegs und landeten in Calvi im Nordwesten der Insel; ein Badeort, angeblich wurde dort Christoph Kolumbus geboren. In der Nachsaison liegt hier allenfalls der Hund begraben. Überragt wird Calvi von einer braunen Zitadelle. Mit den Fremdenlegionären, die darin stationiert waren, spielten wir nach dem Abendessen ganz arglos Billard, bis ein Blick in ihre Käppis uns abschreckte. Im Innenfutter lasen wir die Namen ihrer Helden, Göring war noch der harmloseste, garniert mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Wir beeilten uns, das Drehbuch fertig zu machen.
Auch die Schlussszene des Films wurde auf einer Insel gedreht. Der Produzent hatte ausgerechnet, dass Dreharbeiten auf Jamaika billiger kämen als in einem deutschen Studio. Luxus war es, die Autoren mitzunehmen, Robert Gernhardt, Peter Knorr und mich. In der abschließenden polynesischen Polonaise, für die ein deutscher Tanzlehrer Dutzenden von Jamaikanern ihr natürliches Scham- und Rhythmusgefühl austreiben musste, können Sie uns dabei zusehen, wie wir uns mit Kappen auf dem Kopf zu Narren machen. Mein einziger Gedanke war: Hoffentlich sieht das keiner.
Der Wunsch ging nicht in Erfüllung.
Im vorletzten Jahrhundert galt man als reich, wenn man von den Zinseszinsen seines Vermögens so gut leben konnte, dass man sich ums Geldverdienen nie mehr zu kümmern hatte. Arm war man, das gilt noch heute, wenn man Hunger leiden musste. Dazwischen liegen viele Stufen von Mangel oder Überfluss.
Wenn man einige dieser Einkommensstufen überspringt, und zwar nach oben, hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man lebt weiter wie bisher, oder man wird zum Verschwender. Da Letzteres mehr Vergnügen verspricht, kann ich es nur empfehlen. Außerdem muss man sich keine neuen Freunde suchen – man lässt die alten einfach an den neuen Erfahrungen teilhaben.
Ich erkläre Ihnen das nicht nur, um mit frühen Erfolgen ein bisschen anzugeben, sondern auch zur Erklärung dafür, dass ich mir von da an meine Inseln selbst aussuchen konnte. Und damit fingen die Probleme erst richtig an.
Wohin? Welche Kriterien sind es, die eine solche Frage letztlich beantworten? Häufig höre ich Inselurlauber nach ihren Reisen von »traumhaften Stränden« erzählen, wobei für den einen die bloße Ausdehnung, für den anderen die Feinheit und Reinlichkeit des Sandes seine Wertschätzung rechtfertigt. Auch die Wucht der Brandung oder die Einsamkeit der Buchten können den Ausschlag geben.
All das interessiert mich wenig. Eigentlich zählt der Strand für mich zu den eher verzichtbaren Bestandteilen einer Insel. Insofern bot sich Madeira als Reiseziel an.
Die Insel liegt weit vor der Westküste Afrikas ungefähr auf der Breite von Casablanca und war in den 80er-Jahren nicht so einfach zu erreichen. Der einzige Flughafen wurde, nach einer Zwischenlandung in Lissabon, nur von der Transportes Aereos Portugueses, kurz TAP, angeflogen, denn kurz war auch die Landebahn; nur wenn die Maschine ganz vorn aufgesetzt wurde, rutschte sie hinten nicht ins Meer. In gewisser Weise steigerte das Bewusstsein dieser Gefahr den Wert des Aufenthalts.
Den Flughafen, der heute nach dem berühmtesten Sohn der Insel Cristiano Ronaldo, kurz CR7, benannt ist, gibt es erst seit 1964, zuvor, das erzählten mir ältere Reisende, war die Insel aus der Luft nur mit Wasserflugzeugen zu erreichen, die in der Bucht von Funchal landen konnten, oder eben klassisch per Schiff. Briten kamen gern hierher, meist kurz vor Silvester, das stets mit einem brillanten Feuerwerk gefeiert wurde.
Strände gibt es auf Madeira nicht. Attraktiv für mich war auf diesem Felsmassiv im Atlantik mit seinen steilen Küsten und dem milden Frühlingswetter – beides ganzjährig – vor allem ein altmodisches Hotel, dem ein gewisser Ruf vorauseilte. Zurück ging er auf berühmte Gäste, die im Reid’s





























