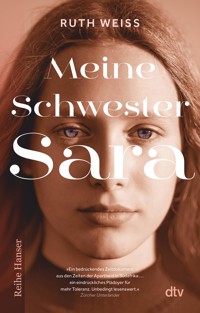7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bange, C., Verlag GmbH
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Königs Erläuterung Spezial zu Ruth Weiss: Meine Schwester Sara ist eine verlässliche und bewährte Textanalyse für Schüler und weiterführende Informationsquelle für Lehrer und andere Interessierte: verständlich, übersichtlich und prägnant. Mithilfe der Kurzzusammenfassung, Angaben zu Leben und Werk des Autors, Zeitgeschichtlicher Hintergrund der Romanhandlung, Textanalyse, ausführlichen Inhaltsangabe, Aufbau, Personenkonstellationen und Charakteristiken, Stil und Sprache, Interpretationsansätze, Rezeptionsgeschichte und Materialien sind Schüler fundiert und umfassend vorbereitet. Plus Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Ähnliche
KÖNIGS ERLÄUTERUNGEN SPEZIAL
Textanalyse und Interpretation zu
Ruth Weiss
MEINE SCHWESTER SARA
Sabine Hasenbach
Alle erforderlichen Infos für Abitur, Matura, Klausur und Referat plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen
Zitierte Ausgaben: Weiss, Ruth: Meine Schwester Sara. 10. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2016.
Über die Autorin dieser Erläuterung: Sabine Hasenbach hat Mineralogie (mit den Nebenfächern Mathematik, Physik und Chemie) an den Universitäten Köln und Bonn sowie Literaturwissenschaft (mit den Nebenfächern Psychologie und Soziologie) an der FernUniversität in Hagen studiert, wo sie mit einer Arbeit über Katherine Mansfield graduiert worden ist. Sie wohnt in Düsseldorf und arbeitet an der dortigen Heinrich-Heine-Universität. In ihrer Freizeit läuft sie Langstrecke.
Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52 a UrhG: Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.
2. Auflage 2018
ISBN 978-3-8044-4124-8
© 2017 by C. Bange Verlag, 96142 Hollfeld Alle Rechte vorbehalten! Titelabbildung: Nelson Mandela © picture-alliance/dpa
Hinweise zur Bedienung
Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig mit dem Inhalt dieses Buches verknüpft. Tippen Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zum entsprechenden Inhalt.
Fußnoten Fußnoten sind im Text in eckigen Klammern mit fortlaufender Nummerierung angegeben. Tippen Sie auf eine Fußnote und Sie gelangen zum entsprechenden Fußnotentext. Tippen Sie im aufgerufenen Fußnotentext auf die Ziffer zu Beginn der Zeile, und Sie gelangen wieder zum Ursprung. Sie können auch die Rücksprungfunktion Ihres ePub-Readers verwenden (sofern verfügbar).
Verknüpfungen zu Textstellen innerhalb des Textes (Querverweise) Querverweise, z. B. „s. S. 26 f.“, können durch Tippen auf den Verweis aufgerufen werden. Verwenden Sie die „Zurück“-Funktion Ihres ePub-Readers, um wieder zum Ursprung des Querverweises zu gelangen.
Verknüpfungen zu den Online-Aufgaben Im Abschnitt 6 „Prüfungsaufgaben“ finden Sie einen Hinweis zu zwei kostenlosen zusätzlichen Aufgaben. Diese Aufgaben können über die Webseite des Verlages aufgerufen werden. Tippen Sie auf die Verknüpfung und Sie werden direkt zu den Online-Aufgaben geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt.
Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet werden durch eine Webadresse gekennzeichnet, z.B. www.wikipedia.de. Tippen Sie auf die Webadresse und Sie werden direkt zu der Internetseite geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Webadressen nach Erscheinen dieses ePubs gegebenenfalls nicht mehr aufrufbar sind!
INHALT
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
2. Ruth Weiss: Leben und Werk
2.1 Biografie
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Südafrika unter dem Apartheidsregime
Jugendliteratur: Apartheid und Südafrika
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
Apartheid und Post-Apartheid
3. Textanalyse und -Interpretation
3.1 Entstehung und Quellen
Erfahrungen mit Antisemitismus und Apartheid
3.2 Inhaltsangabe
VOR DEM FRÜHSTÜCK (S. 7–13)
FRÜHSTÜCK (S. 14–46)
VORMITTAGSTEE (S. 47–72)
EINE KALTE TASSE TEE (S. 73–95)
MITTAGESSEN (S. 96–114)
NACHMITTAGSSPAZIERGANG (S. 115–148)
TEA FOR TWO (S. 149–204)
ABENDESSEN (S. 205–256)
ENDE DES TAGES (S. 257–287)
3.3 Aufbau
3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken
Hauptfiguren
Sara Lehmann/Leroux
Jo(hannes) Petrus Leroux
Dr. Zachariah Adriaan Leroux (Vater)
Maria Letitia Leroux (Mutter)
Nebenfiguren
Gisela Leroux
Hannah
Dr. Sam Morris
Adam Simunya
Greta Leroux
Lisa Leroux
Weitere Personen
3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen
3.6 Stil und Sprache
Erzählersprache
Figurensprache
Erzählform und Erzählverhalten
Themen und Motive
Stilmittel
3.7 Interpretationsansätze
Analogien Antisemitismus und Apartheid
Sara Lehmann zwischen Antisemitismus und Apartheid
4. Rezeptionsgeschichte
5. Materialien
Die Europäer in Südafrika
Jüdische Menschen im Nationalsozialismus
Nadine Gordimer über Ruth Weiss
6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
Aufgabe 1*
Aufgabe 2**
Aufgabe 3 ***
Literatur
Zitierte Ausgabe
Autobiografie und Biografisches
Über Meine Schwester Sara
Über Südafrika/Apartheid und Afrika
Nationalsozialismus/Antisemitismus
Damit sich jeder Leser in unserem Band rasch zurechtfindet und das für ihn Interessante gleich entdeckt, hier eine Übersicht.
Im 2. Kapitel beschreiben wir das Leben von Ruth Weiss und stellen den zeitgeschichtlichen Hintergrund dar:
Ruth Weiss wurde am 26. Juli 1924 in Fürth als Ruth Loewenthal geboren und lebte lange Zeit in Südafrika und Rhodesien.
Meine Schwester Sara, 2002 erschienen, ist vor dem Hintergrund des südafrikanischen Apartheidregimes (1948–1994) zu lesen und der Jugendliteratur zuzuordnen.
Im 3. Kapitel bieten wir eine Textanalyse und -interpretation.
Meine Schwester Sara – Entstehung und Quellen:
Inspiration durch Erfahrungen mit Antisemitismus und Apartheid sowie der Lebensgeschichte eines Freundes.
Meine Schwester Sara erscheint 2002 im Maro Verlag, Augsburg.
Inhalt:
1948 wird die vierjährige deutsche Kriegswaise Sara Lehmann von der südafrikanischen Burenfamilie Leroux adoptiert. Als der Adoptivvater Zachariah Leroux von ihrer jüdischen Abstammung erfährt, wendet er sich von ihr ab. Fortan wird sie von den übrigen Geschwistern gequält, nur ihre Adoptivmutter und der älteste Sohn Jo unterstützen Sara. Sara selbst weiß lange Zeit nicht, dass sie jüdischer Herkunft ist. Als Sara sich zu einer Gegnerin der Apartheid entwickelt, spitzt sich der Konflikt zwischen ihr und Zachariah Leroux zu. Er gipfelt 1965 in einem Prozess gegen Sara, in dem ihr Hochverrat sowie der Verstoß gegen die Sittengesetze (Immorality Act) vorgeworfen werden und der durch den Verrat Leroux’ zustande gekommen ist. Sara wird freigesprochen und verlässt vorübergehend das Land. 1976 wird sie während des Soweto-Aufstandes erschossen. Jo blickt im Jahr 2000 auf die Ereignisse zurück.
Aufbau, Chronologie und Schauplätze:
Schauplätze des Romans sind Südafrika, Rhodesien (heute Simbabwe), England, USA und Deutschland. Die Handlung spielt in den Jahren 1948 bis 2000.
Autorin Weiss hat ihren Roman mit einer
Rahmenerzählung (ein Tag im Leben von Jo Leroux im Jahr 2000) und einer
Binnenerzählung (historische Ereignisse, Apartheid in Südafrika, die Geschichte der Familie Leroux und Saras Lebensgeschichte)
strukturiert. Verknüpft werden Rahmen- und Binnenerzählung durch Dialoge sowie Erinnerungen des Ich-Erzählers.
Hauptpersonen
Sara Lehmann
jüdische Adoptivtochter der Familie Leroux
wird wegen ihrer Herkunft von der Familie ausgegrenzt
engagiert sich gegen die Apartheid
wird 1976 in Soweto erschossen
Jo(hannes) Petrus Leroux
ältester Adoptivbruder Saras
unterstützt Sara und verliebt sich in sie
erzählt im Jahr 2000 Saras Geschichte
Dr. Zachariah Adriaan Leroux
Saras Adoptivvater
Antisemit und Anhänger der Apartheid
diskriminiert Sara
kommt bei einem Schwarzenaufstand 1976 um
Maria Letitia Leroux
Saras Adoptivmutter
versucht Sara zu schützen
Auch wichtige Nebenfiguren werden ausführlich dargestellt.
Stil und Sprache
Die Erzählersprache ist klar und mit Parataxen durchsetzt. Die Autorin verwendet Figurensprache, zahlreiche Motive und ihre Wiederholungen. Der Roman ist in der Ich-Form geschrieben.
Folgende Interpretationsansätze bieten sich an:
Analogien zwischen Antisemitismus und Apartheid
Sara Lehmann zwischen Antisemitismus und Apartheid
Ruth Weiss (* 1924)© picturealliance/dpa
JAHR
ORT
EREIGNIS
ALTER
1924
Fürth
Ruth Weiss wird am 26. Juli als Ruth Loewenthal geboren.
1927
Hamburg
Umzug der Familie.
3
1931
Rückersdorf bei Nürnberg
Die Familie zieht erneut um.
7
1933
Fürth
Rückkehr nach Fürth. Der Vater verliert seine Arbeitsstelle und wandert zu Verwandten nach Südafrika aus.
9
1936
Johannesburg/Südafrika
Die Mutter Loewenthal emigriert mit den beiden Töchtern ebenfalls nach Südafrika, wo die Familie ein Lebensmittelgeschäft betreibt.
12
1936–1940
Johannesburg
Ruth besucht die High School.
12–16
1941–1943
Johannesburg
Sie arbeitet als Angestellte bei einem Rechtsanwalt.
17–19
1944–1948
Johannesburg
Ruth heiratet Hans Weiss und arbeitet als Buchhändlerin in dessen Geschäft.
20–24
1948–1952
Johannesburg
Ruth Weiss wechselt in ein Versicherungsbüro.
24–28
1952–1954
London
Weiss geht nach London und arbeitet im Verlag „Elek Books“.
28–30
1954
Johannesburg
Weiss kehrt nach Johannesburg zurück. Sie arbeitet erneut in einem Versicherungsbüro, anschließend für ihren Mann als Journalistin.
30
1960–1962
Johannesburg
Weiss wird Editor bei Newscheck.
36–38
1962
Johannesburg
Weiss lernt Nelson Mandela kennen.
38
1962–1965
Salisbury/Rhodesien (seit 1980 Harare/Simbabwe)
Weiss schreibt als Wirtschaftsjournalistin für die Financial Mail.
38–41
1966
Die südafrikanische Regierung erteilt Weiss ein Einreiseverbot und setzt sie auf die „schwarze Liste“.
42
Harare
Sohn Alexander (Sascha) wird geboren. Weiss erzieht ihn allein.
1966–1968
Harare
Bürochefin der Financial Mail.
42–44
1968–1971
London
Weiss siedelt nach London über, wird Korrespondentin des Guardian und schreibt für den Investors Chronicle.
44–47
1971–1975
Sambia
Weiss geht nach Sambia und ist bei der Times of Zambia als Business Editor tätig und als Korrespondentin der Financial Times. Sie führt ein Interview mit Willy Brandt (Bundeskanzler in Deutschland). 1975 begleitet sie Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher auf einer Afrika-Reise.
47–50
1975–1978
Köln
Weiss zieht mit ihrem Sohn nach Köln. Bei der Deutschen Welle wird sie Chefin vom Dienst der Afrika-Redaktion.
50–53
1978–1982
London
Weiss ist als freie Journalistin tätig. Sie gründet die Journalistengruppe „Link up“ und berichtet von den Lancaster-House- Gesprächen.[2] Sie lernt die spätere südafrikanische Literaturnobelpreisträgerin Nadine Gordimer kennen.
53–57
1980
Simbabwe
Für das Innenministerium des jetzt unabhängigen Staates organisiert Weiss das erste Medienseminar.
55
1982
Harare/Simbabwe
Weiss ist Mitarbeiterin des „Zimbabwe Mass Media Trust“[3] und Ausbilderin für Wirtschaftsjournalisten am dortigen Polytechnikum.
57
1983
Südafrika
Weiss gründet den Southern African Economist, verfasst Bücher und macht Filme über die politische Situation in Südafrika, verbunden mit Vortragsreisen und Seminaren in Europa.
58
1987
Simbabwe
Weiss initiiert ein Anti-Apartheids-Projekt.
63
1988
Wuppertal
Der Roman Feresia: ein Mädchen aus Simbabwe erzählt erscheint.
64
1989
Simbabwe
Für den „Cold Comfort Farm Trust” in Simbabwe baut sie das Forschungszentrum „Zimbabwe Institute for Southern Africa” auf.
65
1990
Johannesburg
Nelson Mandela kommt nach 27 Jahren Haft frei. Weiss, deren Name von der „schwarzen Liste“ getilgt wurde, besucht Johannesburg.
66
1992
Isle of Wight/Großbritannien
Weiss lässt sich auf der Isle of Wight nieder und arbeitet als Schriftstellerin.
68
1994
Wuppertal
Ihre Autobiografie Wege im harten Gras erscheint.
70
1997
Wuppertal
Publikation von Sascha und die neun alten Männer.
73
2000
Berlin
Der Roman Nacht des Verrats erscheint.
76
2002
Lüdinghausen/Westfalen
Um näher bei ihrem Sohn zu sein, der in Dänemark lebt, zieht Weiss nach Lüdinghausen.
78
Augsburg
Meine Schwester Sara erscheint.
2003
Augsburg
Blutsteine wird veröffentlicht.
79
2004
Berlin
Publikation von Der Judenweg.
80
2005
Berlin
Weiss wird für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.
81
2006
Berlin
Der Roman Nottaufe erscheint.
82
2007
Sambia; Südafrika
Weiss wird Großmutter. Reise nach Sambia und Südafrika.
83
2009
Johannesburg
Weiss hält am Goethe-Institut Südafrika einen Vortrag zum Thema Cracking Walls – 20 Jahre Mauerfall in Deutschland.
85
Berlin
Der Roman Memory‘s Tagebuch. Eine Geschichte aus Simbabwe erscheint.
2010
Simbabwe
Im Auftrag des Weltfriedensdienstes führt Weiss Interviews in Verbindung des von ihr 1987 initiierten Anti-Apartheidsprojekts.
86
Aschaffenburg
Eine Realschule benennt sich nach ihr.
2014
Lüdinghausen
Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz.
90
Kapstadt
Das South African Jewish Museum und die Holocaust Foundation ehren Ruth Weiss mit einer Ausstellung.
2015
Dänemark
Ruth Weiss zieht zu ihrem Sohn.
91
ZUSAMMENFASSUNG
Die Handlung des Romans Meine Schwester Sara vollzieht sich vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund des südafrikanischen Apartheidregimes 1948–1994. Dieses steht für die systematische Demütigung, Ausgrenzung und gewaltvolle Unterdrückung der nichtweißen Südafrikaner durch die Weißen.
Südafrika unter dem Apartheidsregime
1948 hatten die verunsicherten weißen Südafrikaner die rechtskonservative National Party unter Dr. Daniel François Malan (1874–1959) zur regierenden Partei gewählt. Dieser kreierte die Politik der Apartheid[4], die Politik der Rassentrennung, die Nelson Mandela so definierte: „Apartheid […] war die Kodifizierung aller Gesetze und Vorschriften, die über Jahrhunderte hinweg die Schwarzen gegenüber den Weißen in einer untergeordneten Position gehalten hatten.”[5] Dies bedeutete, dass in öffentlichen Einrichtungen Zonen für Weiße und Nichtweiße[6] eingerichtet wurden, dass es Bushaltestellen für Weiße und Nichtweiße gab, Strände für Weiße und Nichtweiße und so weiter.
1954 wurde Malan von Johannes Gerhardus Strijdom (1893–1958) als Premierminister abgelöst, ihm folgte 1958 Dr. Hendrik Frensch Verwoerd (1901–1966). Dieser intelligente und perfide Mann entwickelte die Ideologie, mit der die Apartheid sich legitimierte. Nach dieser Ideologie ist der Weiße der Träger der modernen Zivilisation in Afrika, also eine höherwertige Rasse. Eine Mischung der Rassen bei dem herrschenden quantitativen Verhältnis von Weißen und Nichtweißen (ca. 1/3 Weiße und 2/3 Nichtweiße) degeneriere die weiße Rasse, was gleichbedeutend sei mit dem Untergang der Zivilisation. Entsprechend wurde der sexuelle Verkehr bzw. Ehen zwischen den verschiedenen Rassen verboten (Immorality Act).
Verwoerd realisierte auch die Bantustanpolitik. Er ließ zehn pseudo-autonome Wohngebiete für Nichtweiße einrichten, die sogenannten Homelands. Sie waren jeweils für unterschiedliche Volksgruppen vorgesehen. Die Menschen, die in die Homelands eingewiesen wurden, verloren die südafrikanische Staatsbürgerschaft. Dadurch wurden sie Fremde im eigenen Land ohne die ihnen zustehenden Bürgerrechte. Allerdings schob man nicht alle Nichtweiße in die Homelands ab, denn es wurden billige Arbeitskräfte gebraucht, da sich die höherwertige weiße Rasse nicht gerne die Hände schmutzig machte. Entsprechend wurde den Schwarzen Bildung vorenthalten, so heißt es im Roman: „Bantu sollten nur das einfachste Rechnen, Lesen und Schreiben in Bantuschulen lernen. Genug für Jobs als Boten, Handlanger, Hauspersonal.“ (Roman S. 78)
Von den Verwaltungen der einzelnen Städte wurden Townships eingerichtet, in die die jeweilige Bevölkerungsgruppe zwangsumgesiedelt wurde. Aus diesen die Städte umgebenden Siedlungen, die häufig zu Slums verkamen, konnten bequem Arbeitskräfte rekrutiert werden. Das dazu passende Passgesetz regelte das Aufenthaltsrecht der schwarzen Südafrikaner in den Städten. Hatten sie keinen Pass, wurden sie außerhalb der ihnen zugewiesenen Wohngebiete nicht geduldet. Damit sollten in die Städte nur jene Schwarzen Zugang haben, die eine entsprechende Arbeitserlaubnis vorweisen konnten. Die Anzahl der Schwarzen in den Städten wurde so auf ein Minimum beschränkt.
Schwarze Frauen („Women’s March”) demonstrieren in Pretoria friedlich gegen die Passgesetze. © akg-images / Africa Media Online
Gegen diese sie diskriminierende Politik standen die Schwarzen auf. Am 9. August 1956 marschierten Tausende nichtweiße Frauen nach Pretoria, um eine Petition, in der die Abschaffung der Passgesetze gefordert wurde, an Premierminister Strijdom zu übergeben (vgl. Roman S. 130 f.). Im März 1960 demonstrierten Schwarze im bei Johannesburg gelegenen Township Sharpeville gegen die Passgesetze. Der Staat reagierte mit Gewalt, 69 Menschen wurden getötet (vgl. Roman S. 172). Außerdem wurde der ANC (African National Congress), der bisher mit friedlichen Mitteln die Rechte der Schwarzen zu sichern versuchte, verboten. Daraufhin gründete der ANC 1961 die militante Untergrundbewegung „Umkhonto we Sizwe“ (Speer der Nation) unter der Führung Nelson Mandelas. In der Folge führte diese Organisation Sabotageakte durch, auf die die Regierung mit weiteren Repressionen und Notstandsmaßnahmen antwortete. 1962 wurde Nelson Mandela verhaftet und nach mehreren Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt. An den Zuständen änderte sich jedoch nichts. 1966 wurde Verwoerd ermordet und durch Balthazar Johannes Vorster (1915–1983) ersetzt. In seine Regierungszeit fällt der Schüleraufstand von Soweto am 16. Juni 1976, bei dem rund 15.000 Schüler auf die Straße gingen, um gegen die Einführung von Afrikaans als Unterrichtssprache zu demonstrieren. Vorster ließ auf sie schießen, 600 Kinder und junge Erwachsene starben. Daraufhin erfassten die Unruhen das gesamte Land. 1977 wurde der Studentenführer Steve Biko in Polizeihaft totgeschlagen und Südafrika zunehmend zu einem Polizeistaat. Der ANC rief daraufhin zur totalen Anarchie auf und der Ruf wurde gehört. In den Townships herrschte der Ausnahmezustand, schwarze Angestellte töteten ihre weißen Arbeitgeber und deren Kinder. Mitte der 1980er-Jahre kam es zu Wirtschaftssanktionen durch die westliche Welt.[7]
1989 schließlich erklärte der zu dieser Zeit amtierende Premierminister Frederik Willem de Klerk (*1936) die Apartheidspolitik für gescheitert. In einer Rede im Februar 1990 sprach er sich für ein demokratisches Südafrika aus, hob das Verbot des ANC auf und entließ erste Oppositionelle aus der Haft, unter ihnen Nelson Mandela. In Verhandlungen einigten sich ANC und die südafrikanische Regierung auf einen Gewaltverzicht und begannen mit der Arbeit an einer neuen Verfassung mit einem Präsidenten an der Spitze. Im April 1994 fanden die ersten freien Wahlen in Südafrika statt. Sie wurden natürlich vom ANC gewonnen und im Mai 1994 wurde Nelson Mandela Präsident Südafrikas.
Dieser strebte im weiteren Verlauf eine Amnestie an für politische Verbrechen, die vor dem 12. Dezember 1996 begangen worden waren. Voraussetzung war, dass die Taten öffentlich zugegeben und bereut wurden. Zu diesem Zweck initiierte Mandela die „Truth and Reconciliation Commission” (Wahrheits- und Versöhnungskommission), kurz TRC, unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Südafrika und Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu. Ziel der Kommission war, Täter und Opfer in einen „Dialog” zu bringen und damit eine Grundlage für die Versöhnung der zerstrittenen Bevölkerungsgruppen zu schaffen sowie ein möglichst vollständiges Bild von den während der Apartheid verübten Verbrechen zu erhalten. Die Realität sah so aus, dass Angehörige von Polizei und Militär vor der Kommission Menschenrechtsverletzungen gestanden, selbstverständlich bereuten und dann häufig als freie Männer nach Hause gehen konnten. Sie waren danach sowohl vor Strafverfolgung geschützt als auch vor Schadensersatzansprüchen ihrer ehemaligen Opfer. Zu den Wahrheiten des „neuen“ Südafrika gehört also, dass viele der ehemals Diskriminierten erneut um ihre Rechte betrogen wurden.
1999 zog sich Mandela als Präsident zurück und wurde von Thabo Mbeki (*1942) ersetzt, der 2008 zugunsten von Jacob Zuma (*1942) zum Rücktritt gezwungen wurde. Mbeki ist verantwortlich für eine desaströse AIDS-Politik. Unter dem derzeitigen Präsidenten Jacob Zuma wurde Südafrika zu einer Kleptokratie.[8] Seinen aufwendigen Lebensstil finanziert er aus der Staatskasse, so spendierte er seinen vielen Frauen jeweils teure Autos und ließ sein Haus aufwendig ausstatten. Im Juli 2016 verurteilte ihn das Verfassungsgericht zur Rückzahlung von 500.000 €. Zuma ist angesichts der grassierenden Arbeitslosigkeit und anhaltenden sozialen Ungleichheit zunehmend umstritten. Bei den am 3.8.2016 stattgefundenen landesweiten Kommunalwahlen erlebte Zuma bzw. der ANC ein Debakel: Der Stimmenanteil sank von vorher über 60% auf 54%. Im November 2016 wurde ein Misstrauensantrag gegen Zuma gestellt, der jedoch scheiterte. Medien sprachen von Einschüchterungskampagnen gegen die Opposition.
Jugendliteratur: Apartheid und Südafrika
Meine Schwester Sara von Ruth Weiss, erschienen 2002.
Im Schatten des Zitronenbaums von Kagiso Lesego Molope, publiziert 2009. Erzählt wird die Geschichte eines schwarzen Mädchens, dass nach Aufhebung der Apartheid eine gemischtrassige Schule besucht.
Die Farben der Freundschaft