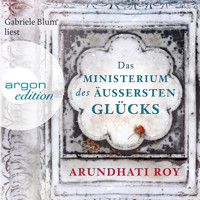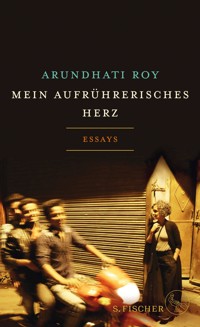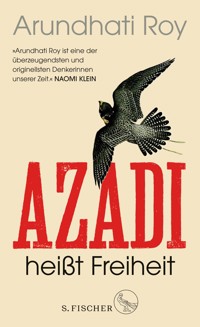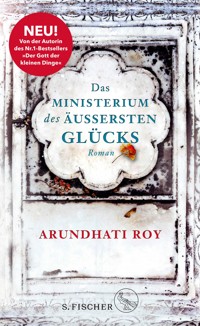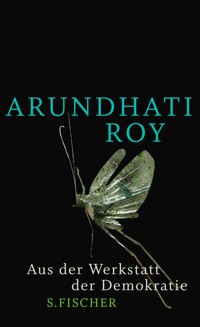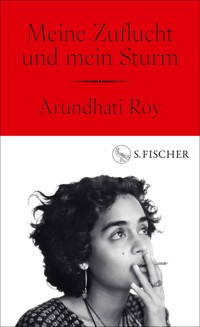
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Preisgekrönte Weltautorin, politische Kämpferin und eine der mutigsten Frauen unserer Zeit: Bewegt von dem Ansturm der Erinnerungen und Gefühle, die vom Tod der Mutter hervorgerufen werden, erzählt Arundhati Roy in »Meine Zuflucht und mein Sturm« die zutiefst beeindruckende und manchmal verstörende Geschichte ihres eigenen Lebens. Ein intimer, bedeutsamer und sensibel erzählter Blick auf Kindheit und Gegenwart, auf vererbten Widerstandsgeist und die Lebensrealität in Indien. Und eine Geschichte über Geschwister, die zusammenhalten gegen mütterliche Gewalt, sowie eine junge Frau, die ausbricht, um eine der unerschrockensten Stimmen unserer Zeit zu werden. »Auf diesen Seiten wird meine Mutter, meine Gangsterin leben. Sie war meine Zuflucht und mein Sturm.« - Arundhati Roy erzählt ihre Geschichte - Weltweit über 8 Millionen verkaufte Exemplare von »Der Gott der kleinen Dinge« - Für Leser*innen von Annie Ernaux und Siri Hustvedt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Arundhati Roy
Meine Zuflucht und mein Sturm
Über dieses Buch
Bewegt von dem Ansturm der Erinnerungen und Gefühle, die vom Tod der Mutter hervorgerufen werden, erzählt Arundhati Roy in »Meine Zuflucht und mein Sturm« die zutiefst beeindruckende und manchmal verstörende Geschichte ihres eigenen Lebens. Ein intimer, bedeutsamer und sensibel erzählter Blick auf Kindheit und Gegenwart, auf vererbten Widerstandsgeist und die Lebensrealität in Indien. Und eine Geschichte über Geschwister, die zusammenhalten gegen mütterliche Gewalt, sowie eine junge Frau, die ausbricht, um eine der unerschrockensten Stimmen unserer Zeit zu werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arundhati Roy wurde 1959 geboren, wuchs in Kerala auf und lebt in Neu-Delhi. Den internationalen Durchbruch schaffte sie mit ihrem Debütroman »Der Gott der kleinen Dinge«, für den sie 1997 den Booker Prize erhielt. Neben dem Schreiben widmete sie sich ihrem politischen und humanitären Engagement. Bei S. FISCHER erschienen »Das Ministerium des äußersten Glücks« und die Essaybände »Azadi heißt Freiheit« und »Mein aufrührerisches Herz«. 2024 wurde Arundhati Roy mit dem PEN Pinter Prize ausgezeichnet.
Anette Grube, 1954 in München geboren, hat Amerikanistik studiert. Sie hat u.a. Chimamanda Ngozi Adichie, T.C. Boyle, Vikram Seth und Mordecai Richler ins Deutsche übersetzt.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel »Mother Mary Comes to Me« bei Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc., New York.
Copyright © 2025 by Arundhati Roy
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: nach einer Idee von Scribner/Aditya Pande
Coverabbildung: Carlo Buldrini
ISBN 978-3-10-492240-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Inhaltsverzeichnis
Gangsterin
Auf der Flucht
Die Kosmopoliten
»Ich liebe dich doppelt«
Die verschiebbare-zusammenklappbare Schule
Federico Fellini und der Weihnachtsmann aus Kottayam
Kollateralschaden
Die Naxaliten
Für den nicht eroberten Mond
Laurie Baker und der kahle Hügel
Joe, Jimi, Janice und Jesus
»Wie geht es deiner verrückten Mutter?«
»Du bist ein Mühlstein um meinen Hals«
»Klingt sie nicht wie diese Person in Der Exorzist?«
Jesus heiratet ein japanisches Päckchen
Kuchenhändlerin
Im Schatten von Hazrat Nizamuddin Auliya
»Was ist so lustig?«
Sie stecken mich in einen Film
»Hast du je daran gedacht, Schriftstellerin zu werden?«
Mama-Bär, Papa-Bär
Die hohe Kunst des Scheiterns
Fliegende Nashörner und der Banyanbaum
Annie macht seinen üblichen Scheiß
Blasphemie
»Sie zeigen Indien nicht im richtigen Licht«
Die Band löst sich auf
Der große indische Vergewaltigungstrick
Der Gott der kleinen Dinge
Die Dinge lösen sich auf
Mobile Republik
Rally for the Valley
Mehr Ärger mit dem Gesetz
Knastschwester
Mein aufrührerisches Herz
Ein eigenes Zuhause
Äußerstes Glück
Madame Houdini und der Niemand
Unterwegs mit den Genossen
»Ihre Geburtsurkunde war eine Entschuldigung Gottes«
Rückzug
Eine Liebeserklärung
Dank
Für LKC
Gemeinsam haben wir es ans Ufer geschafft.
Für Mary Roy
Die nie sagte, lass es sein.
Die Gäste, als sie gingen,
küssten sie aufs Haupt,
und sie erkannte sie
an ihren Stimmen.
John Berger
Gangsterin
Um zu gehen, wählte sie den September, diesen höchst vortrefflichen Monat. Der Monsun war weitergezogen, und Kerala glänzte wie ein smaragdfarbener Streifen zwischen den Bergen und dem Meer. Als das Flugzeug sank und die Erde näherkam, um uns zu begrüßen, konnte ich kaum glauben, dass Topographie so spürbar körperlichen Schmerz verursachen konnte. Ich hatte diese geliebte Landschaft nie gekannt, sie mir nie vorgestellt, sie nie heraufbeschworen, ohne dass sie nicht Teil von ihr gewesen wäre. Jedes Mal, wenn ich an diese Hügel und Bäume dachte, an die grünen Flüsse, die schrumpfenden, zubetonierten Reisfelder, aus denen gigantische Reklametafeln mit Werbung für fürchterliche Hochzeitssaris und noch schrecklicheren Schmuck ragten, dachte ich auch an sie. Sie war in allem enthalten, in meinen Augen größer als die größte Reklametafel, gefährlicher als jeder Hochwasser führende Fluss, unbarmherziger als der Regen, präsenter sogar als das Meer. Wie hatte das geschehen können? Wie? Sie hatte ausgecheckt, ohne vorher Bescheid zu sagen. Typisch für sie – unberechenbar.
Die Kirche wollte sie nicht. Sie wollte die Kirche nicht. (Dort rumorte eine wilde Geschichte, die nichts mit Gott zu tun hatte.) Doch angesichts ihrer Stellung in unserer Stadt und angesichts unserer Stadt mussten wir ein angemessenes Begräbnis für sie organisieren. Die Lokalzeitungen berichteten auf der ersten Seite von ihrem Tod, die meisten überregionalen Zeitungen erwähnten ihn ebenfalls. Durch das Internet wogte eine Welle der Zuneigung von Generationen von Schülern, die in der von ihr gegründeten Schule gelernt hatten, deren Leben sie verändert hatte, von Menschen, die von dem legendären, juristischen Kampf wussten, den sie um die Erbansprüche christlicher Frauen in Kerala geführt und gewonnen hatte. Die Sintflut von Nachrufen machte es noch wichtiger, dass wir das Richtige taten und sie auf die Weise verabschiedeten, die sie verdiente. Aber was war das Richtige? Zum Glück war an dem Tag, als sie starb, die Schule geschlossen, und die Kinder waren zu Hause. Das Schulgelände gehörte uns. Das war eine große Erleichterung. Vielleicht hatte sie es so geplant.
Gespräche über ihren Tod und seine Konsequenzen für uns, insbesondere mich, gab es, seit ich drei Jahre alt war. Damals war sie dreißig, geschwächt von Asthma, völlig mittellos (ihr einziges Vermögen war ein Bachelor-Abschluss in Pädagogik), und sie hatte gerade ihren Mann verlassen – meinen Vater, sollte ich sagen, auch wenn es in meinen Ohren etwas komisch klingt. Sie war fast neunundachtzig, als sie starb, wir hatten demnach sechzig Jahre, um über ihren unmittelbar bevorstehenden Tod, ihren allerletzten Willen und ihr Testament zu sprechen, das sie aufgrund ihrer Beschäftigung mit Erbschaften und Hinterlassenschaften nahezu jede zweite Woche umschrieb. Die Häufigkeit der Fehlalarme, des gerade noch einmal glimpflich Davongekommen-Seins und der großen Fluchten hätte Houdini nachdenklich gemacht. Im Hinblick auf Katastrophen lullte sie uns in eine Art Nachlässigkeit ein. Ich glaubte allen Ernstes, dass sie mich überleben würde. Als sie es nicht tat, war ich am Boden zerstört, mein Herz gebrochen. Ich bin verwirrt und mehr als nur ein bisschen beschämt von der Heftigkeit meiner Reaktion.
Mein Bruder legte den Finger auf die wunde Stelle. »Ich verstehe deine Reaktion nicht. Niemanden hat sie so schlecht behandelt wie dich.« Er mochte recht haben, auch wenn meiner Meinung nach ihm diese Trophäe zustand. Ich verstehe seine Ansicht, dass ich mich selbst demütigte, indem ich mir nicht eingestand, was mit uns als Kindern passiert war. Doch das hatte ich vor langer Zeit hinter mir gelassen. Ich habe so großes Leid, so viele systematisch erzwungene Not, so absolute Bosheit und so facettenreiche Wiederholungen der Hölle gesehen und darüber geschrieben, dass ich mich nur zu den Allerglücklichsten zählen kann. Ich habe mein Leben immer als Fußnote zu den Dingen verstanden, die wirklich wichtig sind. Nie als tragisch, oft als lustig. Oder vielleicht ist das auch eine Lüge, die ich mir selbst erzähle? Vielleicht habe ich meine Zelte dort aufgeschlagen, wo der Wind am heftigsten weht in der Hoffnung, dass er mir mein Herz geradewegs aus meinem Körper bläst. Vielleicht ist das, was ich gerade schreibe, ein Verrat an meinem jüngeren Selbst, begangen von der Person, zu der ich geworden bin. Wenn ja, ist es keine geringe Sünde. Doch es ist nicht an mir, darüber zu richten.
Mit achtzehn verließ ich mein Zuhause endgültig – oder hörte vielmehr auf, nach Hause, oder was als solches galt, zurückzukehren. Ich studierte in Delhi gerade im dritten Jahr Architektur.
Damals schloss man die Highschool mit sechzehn ab. So alt war ich im Sommer 1976, als ich zum ersten Mal im Bahnhof Nizamuddin ankam, allein, praktisch ohne jegliche Hindi-Kenntnisse, um die Aufnahmeprüfung für das Studium zu machen. Ich hatte Angst, und in meiner Tasche steckte ein Messer. Delhi war damals mit dem Zug drei Tage und zwei Nächte entfernt von Cochin, das wiederum drei Stunden Fahrt von unserer Stadt, Kottayam, entfernt lag, die ihrerseits ein paar Kilometer von unserem Dorf, Ayemenem entfernt ist. In Ayemenem hatte ich meine frühe Kindheit verbracht. Mit anderen Worten, Delhi war ein anderes Land. Andere Sprache, anderes Essen, anderes Klima, alles anders. Die Größe der Stadt war jenseits meines Vorstellungsvermögens. Ich kam aus einem Ort, in dem alle wussten, wo jeder wohnte. Es war beschämend, aber ich fragte einen Autorikschafahrer, ob er mich zum Haus der älteren Schwester meiner Mutter, Mrs Joseph, fahren könne. Ich nahm an, dass er wusste, wo sie wohnte. Er zog heftig an seinem Beedi und wandte sich gelangweilt ab. Zwei Jahre später war ich es, die Beedis rauchte und diesen unvergleichlichen Blick gelangweilter Verachtung kultivierte. Irgendwann tauschte ich mein Messer gegen einen erheblichen Vorrat an Haschisch und ein paar Großstadtallüren ein. Ich war emigriert.
Ich verließ meine Mutter nicht, weil ich sie nicht liebte, sondern um sie weiterhin lieben zu können. Wäre ich geblieben, wäre das unmöglich geworden. Nachdem ich gegangen war, sah und sprach ich sie jahrelang nicht. Und sie suchte mich nicht. Sie fragte mich nie, warum ich gegangen war. Es war nicht nötig. Wir wussten es beide. Wir einigten uns auf eine Lüge. Eine gute Lüge. Ich formulierte sie – »sie liebte mich genug, um mich gehen zu lassen«. Das setzte ich meinem ersten Roman Der Gott der kleinen Dinge voran, den ich ihr widmete. Sie zitierte es oft, als wäre es Gottes Wahrheit. Einzig die Witze meines Bruders in dem Buch sind wirklich erfunden. Bis zum Ende ihrer Tage fragte sie mich nie, wie es mir während der sieben Jahre Funkstille ergangen war. Sie fragte nie, wo ich wohnte, wie ich mein Studium absolvierte und abschloss. Ich habe es ihr nie erzählt. Ich schaffte es ganz gut.
Nach einem ersten kühlen, unverbindlichen Wiedersehen kehrte ich zu ihr zurück, besuchte sie im Lauf der Jahre regelmäßig als unabhängige Erwachsene, als ausgebildete Architektin, als Bühnenbildnerin, als Schriftstellerin, doch vor allem als Frau, die nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Eigenschaften einer anderen Frau voller Liebe und Bewunderung – und nicht wenig Angst – beobachtete. In dieser konservativen, stickigen südindischen Kleinstadt, in der Frauen damals nur die Wahl zwischen übertriebener Tugendhaftigkeit oder deren Vortäuschung hatten, verhielt sich meine Mutter mit der Courage einer Gangsterin. Ich sah zu, wie vollkommen zügellos sie war, wie sie ihre Genialität, ihre Exzentrizität, ihre radikale Freundlichkeit, ihren militanten Mut, ihre Ruchlosigkeit, ihre Großzügigkeit, ihre Grausamkeit, ihre Heimtücke, ihren Geschäftssinn und ihr wildes, unberechenbares Temperament entfesselte, ohne auch nur einen Gedanken an unsere kleine, abgeschottete, syrisch-christliche Gemeinde zu verschwenden, die aufgrund ihres Bildungsniveaus und relativen Wohlstands von der virulenten Gewalt und kräftezehrenden Armut im Rest des Landes nicht betroffen war. Ich sah zu, wie sie in dieser kleinen Welt Raum für ihr ganzes Selbst schaffte, für alle Facetten ihrer selbst. Es war nichts weniger als ein Wunder – schrecklich und erstaunlich mitanzusehen.
Nachdem ich gelernt hatte, mich (etwas) vor ihrer die Seele zerrüttenden Gemeinheit zu schützen, faszinierte mich sogar ihr Zorn gegen Mutterschaft als solche. Manchmal musste ich über ihre schamlose Unverhohlenheit lachen. Nicht in Gesellschaft laut herauslachen, sondern erst, als ich allein war, leise vor mich hinlachen. Wenn ich einen Vorfall chirurgisch von seinen Umständen und seinem Kontext trennte und ihn leidenschaftslos betrachtete. Als wäre sie die Mutter von jemand anderem, und als wäre nicht ich, sondern jemand anders das Objekt ihres Zorns.
Als Kind konnte ich nicht anders, als sie zu lieben, irrational, bedingungslos und furchtlos, wie alle Kinder es tun. Als Erwachsene versuchte ich, sie kühl, rational und aus sicherer Distanz zu lieben, und scheiterte oft. Manchmal kläglich. Versionen von ihr fanden Eingang in meine Bücher, aber sie nie. Ihr gefielen diese Versionen, und sie identifizierte sich mit Ammu in Der Gott der kleinen Dinge und sprach über sie als »ich« und »mich«. Sie wollte Ammu sein, weil sie sehr wohl wusste, dass sie es nicht war. Als ein verschmitzter Journalist sie fragte, ob sie tatsächlich wie Ammu im Buch eine tragische Liebesaffäre gehabt hatte, blickte sie ihm in die Augen und sagte: »Warum? Bin ich etwa nicht sexy genug?« Sie war damals schon in ihren Sechzigern, eine selbst erschaffene Diva. Sie konnte sagen, was sie wollte.
Als das Buch erschien, sorgte sie sich um die Geheimnisse, die es womöglich preisgab. Um auf Nummer sicher zu gehen, wies sie sich ins Krankenhaus ein. Dort las sie es hastig und war höchst erleichtert, dass nichts enthüllt wurde. Anfänglich behauptete sie, das Theater um den Roman nicht zu begreifen. Dann las sie es genau. Nachdem sie es drei- oder viermal gelesen hatte – sie war jetzt wieder zu Hause –, rief sie mich an ihr Bett. Es war ein schöner Nachmittag, und das Licht, das durch die Vorhänge schimmerte, war bordellrot. Ihre Augen waren geschlossen. Sie sagte, sie halte es für ein gutes Buch. Gut geschrieben. Sie fragte nach einer bestimmten Passage, in der sich Ammus siebenjährige Zwillinge, Esthappen und Rahel, an einen Streit ihrer Eltern erinnern. Wie die Eltern groß wie Riesen wurden, die Kinder zwischen sich hin- und herstießen und sagten: »Du nimmst sie, ich will sie nicht.«
»Wer hat dir das erzählt? Du warst zu jung, um dich daran zu erinnern.«
»Es ist erfunden.«
»Nein, ist es nicht.«
Und dann drehte sie sich zur Wand.
Ich habe nie das Gewicht oder den Kummer dieser Erinnerung gespürt. Ich glaubte wirklich, dass ich es erfunden hätte. An diesem Tag lernte ich, dass die meisten von uns eine lebende, atmende Brühe aus Erinnerung und Phantasie sind – und nicht die besten Schiedsrichter darüber, was das eine und was das andere ist. Also lesen Sie dieses Buch, als wäre es ein Roman. Es will nichts Größeres sein. Doch andererseits kann es nichts Größeres geben. Literatur ist dieses seltsame, rauchartige Ding, das nicht allein den Autoren gehört, auch wenn sie es glauben. Woher kommt es? Aus unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart, unserer Lektüre, unserer Phantasie – ja. Aber vielleicht auch aus Ahnungen von unserer Zukunft? Wie sonst ist es möglich, dass auch ich mich jetzt wie Figuren in meinem zweiten Roman, Das Ministerium des äußersten Glücks, um ein Grab in einem Gästehaus kümmern muss? Es ist haarsträubend. Es hält mich nachts wach. Doch dann frage ich mich: Warum sollten wir alles wissen?
In meinem Bemühen, meine Mutter zu verstehen, die Dinge von ihrem Standpunkt aus zu sehen, ihr einen Platz einzuräumen, zu begreifen, was sie verletzt hat, was sie antrieb, was sie nicht lassen konnte, und um vorherzusagen, was sie als Nächstes tun oder nicht tun würde, betrat ich einen Irrgarten, ein Labyrinth aus Wegen, die unterirdisch im Zickzack verliefen und an den merkwürdigsten Orten an der Oberfläche auftauchten. Ich hoffte, eine andere Perspektive als meine eigene zu gewinnen. Sie durch eine Brille zu sehen, die nicht ausschließlich von meinen Erfahrungen gefärbt war, lehrte mich, sie als die Frau zu schätzen, die sie war. Es machte mich zur Schriftstellerin. Zu einer Romanautorin. Denn das sind Romanautoren – Labyrinthe. Und jetzt muss dieses Labyrinth aus seinem labyrinthischen Selbst ohne sie klug werden.
Ich schreibe dieses Buch, um die Kluft zu überbrücken zwischen ihrem Vermächtnis der Liebe für all diejenigen, deren Leben sie berührte, und den Dornen, mit denen sie meines spickte wie kleine Schwimmer in meinem Blutkreislauf – Angelhaken, die sich noch immer im weichen Gewebe verfangen, während mein Blut zu und von meinem Herzen fließt. Es ist ebenso schwer, es zu schreiben, wie es nicht zu schreiben.
Vielleicht mehr noch als Tochter, die den Tod ihrer Mutter betrauert, trauere ich um sie als Schriftstellerin, die ihr spannendstes Thema verloren hat. Auf diesen Seiten soll meine Mutter, meine Gangsterin, leben. Sie war meine Zuflucht und mein Sturm.
Auf der Flucht
Sie hatte nie etwas anderes als Lehrerin sein wollen, und dafür war sie qualifiziert. In den Jahren, als sie verheiratet mit unserem Vater auf einer abgelegenen Teeplantage in Assam lebte, wo er eine Stelle als Direktionsassistent hatte, verkümmerte ihr Traum von einem Beruf und erlosch. Er wurde (eher als Albtraum) neu entfacht, als ihr klar wurde, dass ihr Mann wie viele junge Männer, die auf einsam gelegenen Teeplantagen arbeiteten, hoffnungslos alkoholsüchtig war.
Mit Ausbruch des Krieges zwischen Indien und China im Oktober 1962 wurden Frauen und Kinder aus an der Grenze gelegenen Bundesstaaten evakuiert. Wir zogen nach Kalkutta. Kaum waren wir dort, beschloss meine Mutter, nicht nach Assam zurückzukehren. Von Kalkutta fuhren wir durchs Land nach Süden bis nach Ootacamund – Ooty –, ein kleiner Ort in den Bergen von Tamil Nadu. Mein Bruder LKC – Lalith Kumar Christopher Roy – war viereinhalb Jahre alt, und ich sollte in einem Monat drei werden. Kontakt mit unserem Vater hatten wir erst wieder in unseren Zwanzigern.
In Ooty wohnten wir in einer Hälfte eines »Ferienhäuschens«, das unserem Großvater mütterlicherseits gehört hatte. Er war ein hochrangiger Beamter der britischen Regierung in Delhi gewesen – ein Königlicher Entomologe. Er und meine Großmutter hatten sich entfremdet. Schon Jahre zuvor hatte er die Verbindung zu ihr und seinen Kindern gekappt. Er starb im Jahr meiner Geburt.
Ich weiß nicht, wie wir in das Häuschen kamen. Vielleicht hatte die Mieterin, die in der anderen Hälfte wohnte, einen Schlüssel. Vielleicht sind wir eingebrochen. Meine Mutter schien das Haus zu kennen. Und den Ort. Vielleicht war sie als Kind mit ihren Eltern hier gewesen. Das Häuschen war feucht und düster mit einem kalten, gesprungenen Betonboden und einer Decke aus Asbest. Eine Sperrholzplatte trennte unsere Hälfte von den Zimmern, die die Mieterin bewohnte. Sie war eine alte englische Dame namens Mrs Patmore. Sie trug das Haar bauschig hochgesteckt, und wir fragten uns, was darin versteckt war. Wespen glaubten wir, mein Bruder und ich. Nachts hatte sie Albträume und schrie und stöhnte. Ich weiß nicht, ob sie Miete bezahlte. Vielleicht wusste sie nicht, an wen sie sie entrichten sollte. Wir zahlten definitiv keine Miete. Wir waren Hausbesetzer, Eindringlinge – keine Mieter. Wir lebten wie Flüchtlinge zwischen riesigen, hölzernen Truhen, voll gepackt mit der opulenten Kleidung des Königlichen Entomologen – seidene Krawatten, Frackhemden, dreiteilige Anzüge. Wir fanden eine alte Keksdose voller Manschettenknöpfe. (Offenbar war er ein begeisterter Kollaborateur der Kolonialregierung gewesen und hatte das »Königlich« seiner Berufsbezeichnung sehr ernst genommen.) Später, als mein Bruder und ich alt genug waren, um sie zu verstehen, hörten wir die legendären Familiengeschichten über ihn; über seine Eitelkeit (er ließ sich in einem Fotoatelier in Hollywood fotografieren) und seine Gewalttätigkeit (er peitschte seine Kinder aus, warf sie regelmäßig aus dem Haus und schlug meiner Großmutter mit einer Messingvase ein Loch in den Kopf). Um ihm zu entkommen, erzählte uns unsere Mutter, heiratete sie den erstbesten Mann, der ihr einen Antrag machte.
Bald nach unserer Ankunft unterrichtete sie an einer örtlichen Schule namens Breeks. In Ooty gab es damals jede Menge Schulen, einige davon geleitet von britischen Missionarinnen, die sich nach der Unabhängigkeit für einen Verbleib in Indien entschieden hatten. Sie freundete sich mit einer Gruppe von ihnen an, die an einer Schule namens Lushington nur weiße Kinder britischer, in Indien tätiger Missionare unterrichtete. Sie überredete sie, in der Freizeit ihrem Unterricht beiwohnen zu dürfen. Hungrig saugte sie ihre innovativen Lehrmethoden für Grundschulkinder auf (Lernkarten für Lesen und Aussprache, bunte hölzerne Rechenstäbe für Mathematik), während sie gleichzeitig ihr freundlicher, wohlmeinender Rassismus gegenüber Indern und Indien verstörte. Arbeitete sie, ließ sie uns für ein paar Stunden bei einer missmutigen Frau oder gelegentlich bei freundlichen Nachbarn.
Nach ein paar Monaten dieses Flüchtlingslebens kamen meine Großmutter (die Witwe des Entomologen) und ihr ältester Sohn – der ältere Bruder meiner Mutter, G. Isaac, aus Kerala, um uns hinauszuwerfen. Ich hatte die beiden nie zuvor gesehen. Sie erklärten meiner Mutter, dass Töchter unter dem Travancore Christian Succession Act, der die Erbfolge in Kerala regelte, kein Anrecht auf das Eigentum ihres Vaters hatten und wir das Haus sofort verlassen sollten. Es war ihnen offenbar gleichgültig, dass wir nirgendwohin konnten. Meine Großmutter sagte nicht viel, aber sie jagte mir Angst ein. Sie litt unter einer kegelförmigen Hornhautvorwölbung und trug eine dunkle Brille. Ich erinnere mich, dass meine Mutter, mein Bruder und ich uns an den Händen hielten und in Panik auf der Suche nach einem Anwalt durch den Ort liefen. In meiner Erinnerung ist es Nacht, und die Straßen sind dunkel. Aber so konnte es nicht gewesen sein. Denn wir fanden einen Anwalt, der uns erklärte, dass der Travancore Act nur im Staat Kerala Gültigkeit hatte, nicht in Tamil Nadu, und dass auch Hausbesetzer Rechte hatten. Er riet uns, die Polizei zu rufen, sollte jemand versuchen, uns hinauszuwerfen. Wir kehrten zitternd, aber triumphierend zum Häuschen zurück. Mein Bruder und ich waren zu jung, um zu verstehen, was die Erwachsenen sagten. Doch die Gefühle, die im Spiel waren, verstanden wir nur zu gut: Einschüchterung, Angst, Wut, Panik, Beruhigung, Erleichterung, Triumph.
Unser Onkel G. Isaac konnte damals nicht ahnen, dass er mit dem Versuch, seine jüngere Schwester aus dem Häuschen seines Vaters zu werfen, den Boden für seinen eigenen Niedergang bereitete. Es sollten noch Jahre vergehen, bis meine Mutter die Mittel und die Stellung hatte, den Travancore Christian Succession Act anzufechten und den gleichen Anteil am Eigentum ihres Vaters in Kerala zu verlangen. Bis dahin bewahrte und hütete sie die Erinnerung an ihre Demütigung, als wäre sie ein wertvolles Familienerbstück, was sie auf gewisse Weise auch war.
Nach unserem juristischen Coup breiteten wir uns im Häuschen aus, verschafften uns mehr Platz. Meine Mutter verschenkte die Anzüge und Manschettenknöpfe des Königlichen Entomologen an die Chauffeure am Taxistand nahe dem Markt, und eine Zeitlang waren die Taxifahrer von Ooty die bestgekleideten der Welt.
Trotz unseres hart erkämpften, dennoch vorläufigen Gefühls der Sicherheit liefen die Dinge nicht wie erhofft. Das kalte, nasse Klima von Ooty verschlimmerte das Asthma meiner Mutter. Sie lag bisweilen unter einer dicken, metallisch-rosafarbenen Decke auf einem hohen Eisenbett, atmete schwer und laut und verließ das Bett manchmal tagelang nicht. Wir glaubten, sie würde sterben. Sie mochte nicht, wenn wir herumstanden und sie anstarrten, und schickte uns aus dem Zimmer. Mein Bruder und ich zogen los, um etwas anderes anzustarren. Meistens schwangen wir auf dem niedrigen, wackligen Tor in der Ecke des dreieckigen Hofes, beobachteten frisch verheiratete Paare in den Flitterwochen, die Händchen haltend an unserem Haus vorbeigingen, um sich in Ootys berühmtem botanischen Garten gegenseitig anzuhimmeln. Manchmal blieben sie stehen und unterhielten sich mit uns. Sie schenkten uns Süßigkeiten und Erdnüsse. Ein Mann gab uns eine Steinschleuder. Wir verbrachten Tage damit, zielen zu üben. Wir freundeten uns mit Fremden an. Einmal packte mich ein Mann an der Hand und marschierte mit mir ins Haus. Er sagte streng zu meiner Mutter, dass ihre Tochter Windpocken habe. Ich musste ihr die Blase auf meinem Bauch zeigen, mit der ich vor jedem angegeben hatte, der sie sehen wollte. Meine Mutter war außer sich. Nachdem er gegangen war, gab sie mir eine heftige Ohrfeige und sagte, dass ich nie wieder mein Kleid anheben und Fremden meinen Bauch zeigen solle. Vor allem nicht Männern.
Vielleicht lag es an ihrer Krankheit oder den Medikamenten, aber sie wurde extrem übellaunig und schlug uns immer öfter. Wenn das passierte, rannte mein Bruder davon und kehrte erst nach Einbruch der Dunkelheit zurück. Er war ein stiller Junge und weinte nie. Wenn er aufgebracht war, legte er den Kopf auf den Esstisch und gab vor zu schlafen. Wenn er – selten genug – glücklich war, tanzte er um mich herum, boxte in die Luft und behauptete, Cassius Clay zu sein. Ich hatte keine Ahnung, woher er wusste, wer das war. Ich kannte ihn nicht. Vielleicht hatte unser Vater es ihm erzählt.
Ich glaube, die Jahre in Ooty waren für ihn schwerer als für mich, denn er konnte sich erinnern. Er erinnerte sich an ein besseres Leben. Er erinnerte sich an unseren Vater und das große Haus, in dem wir auf der Teeplantage gewohnt hatten. Er erinnerte sich daran, geliebt worden zu sein. Ich konnte das glücklicherweise nicht.
Mein Bruder wurde vor mir eingeschult. Er ging ein paar Monate lang in die Lushington, die Schule für Weiße. (Die Missionarinnen müssen meiner Mutter einen Gefallen getan haben.) Doch als er anfing, Kinder wie uns aus dem Ort »diese kleinen Inder« zu nennen, nahm unsere Mutter ihn heraus und holte ihn in die Breeks, die Schule, in der sie arbeitete. Als ich fünf wurde, steckte sie mich in eine Vorschule (für kleine Inder), die von einer furchterregend aussehenden, australischen Missionarin namens Miss Mitten geführt wurde. Sie war eine grausame Frau mit Sommersprossen auf den Armen. Ihr Mund war ein Schlitz. Keine Lippen. Sie stellte klar, dass sie mich nicht mochte. Unser Schulzimmer war eine Hütte am Rand einer fleckigen Wiese, auf der magere Kühe mit vorstehenden Hüftknochen weideten.
An Tagen, an denen ihr Asthma wirklich schlimm war, schrieb meine Mutter eine Einkaufsliste mit Gemüse und Vorräten, legte sie in einen Korb und schickte uns damit in die Stadt. Ooty, damals eine kleine Stadt, war sicher, es gab nur wenig Verkehr. Die Polizisten kannten uns. Die Ladenbesitzer waren immer freundlich und ließen uns manchmal anschreiben. Die Netteste von allen war eine Dame namens Kurussammal, die im Wollladen arbeitete. Sie strickte uns Pullover mit Polokragen. Flaschengrün für meinen Bruder. Pflaume für mich.
Als meine Mutter für Wochen bettlägerig war, zog Kurussammal zu uns. Unser nervöser Lebensstil hatte ein Ende. Es war Kurussammal, die uns lehrte, was Liebe ist. Was Verlässlichkeit ist. Was es heißt, in den Arm genommen zu werden. Sie kochte für uns und wusch uns draußen in der bitteren Ooty-Kälte mit Wasser, das sie in einem großen Topf auf dem Holzfeuer erhitzt hatte. Bis zum heutigen Tag müssen mein Bruder und ich nahezu vom Wasser verbrüht werden, um uns richtig sauber zu fühlen. Bevor sie uns wusch, kämmte sie uns die Läuse aus den Haaren und zeigte uns, wie man sie tötete. Ich liebte es, sie platt zu machen. Es war ein befriedigender Laut, wenn ich sie mit meinem Daumennagel zerdrückte. Abgesehen davon, dass sie blitzschnell stricken konnte, war Kurussammal eine hervorragende Köchin. Ihre Spezialität war es, ein Essen fast ohne Zutaten zu kochen. Sogar gekochter Reis mit Salz und grünem Chili schmeckte gut, wenn sie ihn auf unsere Teller löffelte.
Kurussammals Name bedeutet »Mutter des Kreuzes« in Tamil. Ihr Mann, der uns oft besuchte, hieß Yesuratnam, »Jesus’ Juwel«, »Juwel der Juwelen«. Er hatte einen Kropf, den er unter seinem wollenen Schal versteckte. Er und wir rochen immer nach Holzrauch.
Schließlich war meine Mutter zu krank, um noch arbeiten zu können. Auch die massive Dosis Steroide, die sie nehmen musste, half nicht. Bald hatten wir kein Geld mehr. Mein Bruder und ich wurden unterernährt und hatten Primärtuberkulose.
Nach ein paar weiteren Monaten erbitterten Kampfes an allen Fronten, gab meine Mutter auf. Sie beschloss, ihren Stolz hinunterzuschlucken und nach Kerala zurückzukehren, nach Ayemenem, dem Dorf unserer Großmutter. Die Hitze des Streits mit ihrer Mutter und ihrem Bruder war abgekühlt. Auch wenn dem nicht so gewesen wäre, wäre ihr keine andere Wahl geblieben.
Es brach mir das Herz, Kurussammal zu verlassen. Doch ich sollte sie ein paar Jahre später wiedersehen, als sie nach Kerala zog, um bei uns zu leben.
Die Kosmopoliten
Als unser Zug über die Grenze zwischen Tamil Nadu und Kerala fuhr, veränderte sich die Landschaft von braun zu grün. Alles, einschließlich der Strommasten, war mit Pflanzen und Schlingpflanzen bewachsen. Alles glänzte. Fast alle Menschen, die an den Zugfenstern vorbeiglitten, Männer wie Frauen, trugen Weiß und hatten schwarze Regenschirme dabei.
Mein Herz jubilierte.
Und dann rutschte es mir in die Hose.
In Ayemenem kamen wir unaufgefordert an und waren deutlich nicht willkommen. Das Haus, auf dessen Schwelle wir mit unserer unsichtbaren Bettelschale standen, gehörte der älteren Schwester meiner Großmutter, Miss Kurien. Sie muss in ihren Sechzigern gewesen sein. Ihr dünnes, welliges Haar war in einem, wie man es damals nannte, Bubikopf geschnitten. Sie trug gestärkte, weiße Saris und große, weite Blusen. Miss Kurien war den meisten Frauen ihrer Zeit weit voraus. Sie war alleinstehend, hatte einen Master in Englischer Literatur und an einem College in Sri Lanka (damals Ceylon) unterrichtet. Sie hatte ein eigenes Haus. Sie verfügte über Ersparnisse, eine Pension und all die Klugheit und Unbeirrbarkeit einer unverheirateten, arbeitenden Frau, die wusste, dass sie für sich selbst sorgen musste. Es ist unwahrscheinlich, dass sie hatte vorhersehen können, für wie viele andere sie würde aufkommen müssen.
Meine Mutter versicherte ihr, dass wir nur so lange bleiben würden, bis sie Arbeit gefunden hätte. Miss Kurien, die stolz war, eine gute Christin zu sein, nahm uns auf, verhehlte jedoch nicht, wie sehr sie uns und unsere Lage missbilligte. Sie tat es, indem sie uns ignorierte und Kinder anderer Verwandter, die sie besuchten, mit ihrer feinfühligen Zuneigung überschüttete. Sie machte ihnen Geschenke, spielte auf dem Klavier und sang für sie mit zittriger Stimme. Auch wenn sie klarstellte, dass sie uns nicht mochte (was uns veranlasste, sie nicht zu mögen), war sie doch die einzige Person, die uns half und uns ein Dach über dem Kopf verschaffte, als wir es am dringendsten brauchten.
Meine Großmutter lebte ebenfalls bei ihr. Ihre kegelförmige Hornhautvorwölbung hatte sich verschlimmert, und sie war mittlerweile fast blind. Sie trug noch immer ihre dunkle Brille. Sogar nachts. Über ihren Kopf verlief eine Furche – ihre berühmte Messingvasennarbe. Manchmal ließ sie mich mit dem Finger darüberstreichen. Und manchmal durfte ich ihr dünnes Haar zu einem Rattenschwanz flechten, bevor sie ins Bett ging.
Jeden Abend saß sie auf der Veranda und spielte Geige.
Sie war eine ausgezeichnete Geigerin und hatte Musikunterricht genommen, als ihr Königlicher-Entomologen-Mann in Wien stationiert war. Als ihr Lehrer ihm erzählte, dass seine Frau das Potenzial hatte, eine Konzertgeigerin zu werden, beendete er den Unterricht und zertrümmerte in einem Anfall von Eifersucht und Wut die erste Geige, die sie je besaß.
Ich war zu klein, um beurteilen zu können, wie gut sie spielte, doch wenn es in Ayemenem dunkel wurde und die Grillen lauter zirpten, machte ihre Musik die Abende und die stockdunklen Nächte noch melancholischer, als sie es ohnehin schon waren.
Mein Onkel G. Isaac lebte in einem Anbau des Haupthauses. Anfänglich hatte ich schreckliche Angst vor ihm. Ich kannte ihn nur als den großen, dicken, wütenden Mann, der uns in Ooty aus dem Haus hatte werfen wollen. In Ayemenem jedoch begann ich, ihn in einem anderen Licht zu sehen. Er wirkte interessanter und weniger bedrohlich. Ich fing an, ihn zu lieben, als er mit meinem Bruder und mir zum Fluss ging und mir das Schwimmen beibrachte, indem er mich im Kreis um seinen Bauch paddeln ließ.
G. Isaac war einer der ersten indischen Rhodes-Stipendiaten. Sein Fach war griechische und römische Mythologie. Am Esstisch sagte er unvermittelt Dinge wie: »Ist es nicht wunderbar, dass es einen Gott des Weins und der Ekstase gibt?« Alle sahen ihn verständnislos an. Und er erzählte uns von Dionysos oder wer immer gerade sein Gott des Tages war.
Nachdem er ein paar wenige Jahre an einem College in Madras unterrichtet hatte, gab er seine akademische Karriere auf, kehrte zu seinen Wurzeln zurück und gründete mit seiner Mutter eine Pickle-, Marmelade- und Currypulverfabrik. Sie nannte sich Malabar Coast Products. Sie leiteten sie aus dem Haus der Familie des Königlichen Entomologen in der Stadt Kottayam, die eine kurze Fahrt mit dem Bus entfernt war. (Es war das Haus, das zum Gegenstand des Streits werden sollte, als meine Mutter den Travancore Christian Succession Act anfocht.) G. Isaac war trotz seines starken Interesses an Erbe und Privatbesitz Marxist. Er sagte, er habe seine Karriere aufgegeben und die Fabrik gegründet, um mittelständische Industrien voranzubringen und im Ort Arbeitsplätze zu schaffen. Als sie von seinem Unsinn die Nase voll hatte, verließ ihn seine schwedische Frau Cecilia, die er in Oxford kennengelernt hatte, und kehrte mit ihren drei kleinen Söhnen nach Schweden zurück.
Auf diese seltsame und mannigfaltige Weise fand in dem winzigen Dorf Ayemenem eine Konstellation außergewöhnlicher, exzentrischer, kosmopolitischer, vom Leben gebeutelter Menschen zusammen.
Das heiße, feuchte Klima tat meiner Mutter gut. Ihr Asthma wurde ein wenig besser, blieb jedoch heftig und chronisch. Während sie überlegte, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte, unterrichtete sie uns zu Hause. Alle anderen ignorierten uns weitgehend – außer G. Isaac, wenn er gut gelaunt war.
In Ayemenem lebten wir wie auf einer Klippe, von der wir jeden Augenblick gestoßen werden konnten. Sogar Kochu Maria, die Köchin, erklärte mir, dass wir kein Recht hatten, hier zu wohnen. Sie murrte und nörgelte, es sei eine Schande, dass vaterlose Kinder unter demselben Dach lebten wie anständige Menschen. Alle paar Tage kam es zu einem heftigen Streit zwischen den Kosmopoliten. Wenn sie stritten, bebte das ganze Haus. Teller gingen zu Bruch, Türen wurden eingetreten. Es war schwierig, mit der Beziehung zwischen G. Isaac und meiner Mutter Schritt zu halten. Manchmal waren sie beste Freunde, und plötzlich waren sie ohne Vorwarnung Todfeinde. Meist wurde – keine Überraschung – wegen Geld gestritten. Dass meine Mutter nichts zu den Ausgaben des Haushalts beitrug, ihren Lebensunterhalt nicht verdiente. G. Isaac war darauf bedacht, meinen Bruder und mich nicht in die Auseinandersetzungen einzubeziehen.
Sobald das Geschrei einsetzte, floh ich. Der Fluss war meine Zuflucht. Er glich alles aus, was mit meinem Leben nicht stimmte. Ich verbrachte Stunden an seinem Ufer und wurde mit den Vornamen der Fische, Würmer, Vögel und Pflanzen vertraut. Ich freundete mich mit anderen Kindern (und manchen Erwachsenen) aus dem Dorf an. Malayalam lernte ich schnell und konnte mich bald mühelos mit ihnen verständigen. Sie lebten in einem anderen Universum als ich. Die meisten ihrer Eltern arbeiteten auf nahen Reisfeldern oder Kautschukplantagen oder bei großen Landbesitzern, pflückten Kokosnüsse oder halfen im Haushalt. Sie wohnten in Lehmhütten mit Strohdach. Viele von ihnen gehörten Kasten an, die als »unberührbar« galten. Damals wusste ich nicht viel über diesen Horror, weil im Ayemenem-Haus alle zu sehr damit beschäftigt waren, miteinander zu streiten, und sich nicht die Mühe machten, mich zu indoktrinieren.
Einer von ihnen, ein junger Mann, der in Ayemenem lebte und in Kottayam bei Malabar Coast Products arbeitete, wurde mein am meisten geliebter Freund. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Aus einem Bambusstecken machte er eine Angel für mich und zeigte mir, wo ich die besten Regenwürmer als Köder fand. Er brachte mir bei, wie man angelte und still und ruhig war. Er briet die kleinen Fische, die ich fing, und wir aßen sie zusammen, als wäre es ein festliches Bankett. Er inspirierte mich zu der Figur des Velutha – Ammus Liebhaber in Der Gott der kleinen Dinge. Wäre ich sechzehn statt sechs Jahre alt gewesen und hätte Glück gehabt, wäre er vielleicht mein Freund geworden. Er war der freundlichste, bestaussehende Mann, dem ich je begegnet war.
Innerhalb von Monaten wurde ich Teil von Ayemenems Landschaft – ein wildes Kind mit Hornhaut an den Füßen, das jeden versteckten Weg und jede Abkürzung kannte, die zum Fluss führten. Ich lebte im Freien und ging so selten wie möglich nach Hause. In der Kategorie Nicht-Mensch wurde ein Palmenhörnchen meine beste Freundin, das auf meiner Schulter lebte und mir ins Ohr wisperte. Wir tauschten Geheimnisse aus. Sie war nicht mein Haustier. Sie hatte ihr eigenes Leben, doch sie teilte es mit mir. Oft verschwand sie, weil sie Dinge zu erledigen hatte. Zu den Essenszeiten tauchte sie auf, saß neben meinem Teller und knabberte an meinem Essen. Am liebsten mochte sie Ananas. Sie war ständig auf der Hut, achtete stets auf alle möglichen lauernden Gefahren. Sie lehrte mich Dinge.
Palmenhörnchen-Überlebensstrategien waren von Vorteil für jeden, der versuchte, sich durch das Leben auf der Klippe von Ayemenem zu lavieren.
»Ich liebe dich doppelt«
Meine Mutter wälzte die Last der Streitigkeiten und der täglich zu ertragenden Dosis Demütigung auf meinen Bruder und mich ab. Wir waren ihr einziger, sicherer Hafen. Ihre Stimmung, die sowieso schon schlecht war, wurde irrational und unkontrollierbar. Es war mir unmöglich, vorherzusagen oder einzuschätzen, was sie ärgern oder was ihr gefallen würde. Ich musste mir ohne Landkarte einen Weg durch dieses Minenfeld bahnen. Meine Füße und Finger und sogar mein Kopf wurden oft weggesprengt, doch nachdem sie eine Weile frei herumgeschwebt waren, wuchsen sie wundersamerweise wieder an.
Wenn sie auf mich zornig war, ahmte sie meine Sprechweise nach. Sie war darin so gut, dass ich mir auch in meinen Ohren lächerlich vorkam. Ich erinnere mich deutlich an jedes einzelne Mal. Sogar daran, wie ich angezogen war. Es fühlte sich an, als hätte sie mich – meine Gestalt – mit einer scharfen Schere aus einem Bilderbuch ausgeschnitten und dann zerrissen.
Zum ersten Mal passierte es auf dem Nachhauseweg von Madras, wo wir zwei Wochen verbracht hatten. Ihre ältere Schwester, Mrs Joseph, hatte meine Mutter gebeten, ihre drei Kinder zu hüten, während sie und ihr Mann Urlaub machten. (Dieselbe Mrs Joseph, zu der mich Jahre später der Rikschafahrer in Delhi bringen sollte.) Meine Mutter war einverstanden. Sie musste das Gefühl haben, dass sie – zumindest nominell – solange sie dort war, ihren Lebensunterhalt selbst verdiente.
Im Gegensatz zu den streitlustigen Kosmopoliten in Ayemenem war Mrs Joseph anständig verheiratet mit einem Mann, der Pilot bei Indian Airlines war, sie hatte anständige Kinder und ein anständiges Haus mit Dienstboten. Mrs Joseph war sich akut der Tatsache bewusst, dass sie Dinge erfolgreich gemeistert hatte, an denen ihre Geschwister gescheitert waren. Sie war eine gut aussehende Frau mit einer hohen, blasierten Stimme, die zu ihren gestärkten und gebügelten Saris und ihrer ordentlichen Frisur passte. Sie hatte ein verkniffenes, wissendes Lächeln und klang immer so, als würde sie sich der Person, mit der sie gerade sprach, anvertrauen. Zwischen ihr und meiner Mutter gab es keinerlei Ähnlichkeit, weder im Aussehen noch im Temperament.
Als Mrs Joseph aus dem Urlaub zurückkam, stritten sich die Schwestern wegen irgendetwas fürchterlich. Am nächsten Tag kehrten wir mit dem Flugzeug nach Kerala zurück. Der Pilotenmann meiner Tante hatte ein Kontingent an Freiflügen.
Wir hatten noch nie in einem Flugzeug gesessen. Kaum hatten wir unsere Plätze eingenommen, beabsichtigte ich, ein vernünftiges, erwachsenes Gespräch zu führen, wie es Passagiere in einem Flugzeug tun sollten, und fragte meine Mutter, warum Mrs Joseph, wenn sie ihre echte Schwester war, so dünn war. Sie wandte sich mir wütend zu und äffte mich nach. Ich spürte, wie ich in meiner eigenen Haut schrumpfte und dahinschwand wie wirbelndes Wasser in einem Abfluss, bis ich nicht mehr da war. Dann sagte sie: »Wenn du so alt bist wie ich, wirst du dreimal so dick sein.« Ich wusste, dass ich etwas Schreckliches gesagt hatte, aber ich war mir nicht sicher, was. (Ich war zu jung, um »dick« und »dünn« als Werturteile zu begreifen.) Erst Jahre später, als ich über den Vorfall wieder einmal nachdachte und es schaffte, meine eigenen Gefühle außer Acht zu lassen, wurde mir endlich klar, wie kränkend meine Worte für sie gewesen sein mussten.
Die Steroide, die meine Mutter nehmen musste, hatten zu einer plötzlichen Gewichtszunahme geführt. Sie hatte das typische, von Kortison verursachte Mondgesicht. Ihr apartes Gesicht mit den feinen Zügen war hinter Pausbacken und einem Doppelkinn verschwunden. Sie musste sich nach dem Besuch im perfekten Zuhause ihrer schlanken Schwester hoffnungslos verloren gefühlt haben. Ihre triumphale Karriere stand ihr noch bevor, doch damals konnte niemand etwas davon ahnen. (Später würde sie ihr Gewicht und ihre Gestalt akzeptieren. Und sie würde ihren Schülerinnen beibringen, es ebenfalls zu tun. In ihren Fünfzigern führte sie bei einer Modenschau in der Schule einen Badeanzug vor und zeigte den Kindern, wie man sich in den Hüften wiegt.) Meine Frage nach ihrer schlanken Schwester musste sich wie Essig in einer offenen Wunde angefühlt haben. Unvorsichtige Worte von einem unvorsichtigen Kind. Deswegen ging sie auf mich los und ahmte meine sechsjährige Sprechweise nach. Und ich wandte mich gegen mich selbst. Ich erinnere mich an die Luft im Flugzeug – es gab keine. Ich erinnere mich an die Farbe meines Kleids. Himmelblau mit Punkten. Ein perfekt abgetragenes Kleid meiner perfekten Cousine mit dem glatten Haar und den großen Rehaugen. Ich sah, dass das Kleid nicht zu meinen Knien passte, die voller Narben und Schnitte waren – ein umfassendes Logbuch meines wilden, nicht perfekten, vaterlosen, pilotenlosen Lebens an den Ufern des Meenachil-Flusses in Ayemenem. Ich veranstaltete einen imaginären Wettbewerb mit meiner perfekten Cousine, den ich mit Links gewann. Sie hatte einen Pilotenvater. Sie hatte wunderschönes Haar. Aber ich hatte einen grünen Fluss. (Mit Fischen darin, mit dem Himmel und den Bäumen und nachts mit einem zerbrochenen gelben Mond.) Und ein Palmenhörnchen. Ich schaute hinunter auf meine Füße und erkannte, dass sie in Sandalen steckten, in die sie nicht gehörten.
Es war ein schreckliches Flugzeug voller schrecklicher Leute an einem schrecklichen Himmel. Ich wünschte, es würde abstürzen und wir alle würden sterben. Besonders hasste ich die verwöhnten Kinder mit ihren liebevollen Eltern. Ich war absolut für Kollektivstrafe. Doch nach einer Weile sagte meine Mutter: »Ich bin deine Mutter und dein Vater, und ich liebe dich doppelt.«
Und da war das Flugzeug in Ordnung. Der Himmel war in Ordnung. Doch meine Füße waren noch immer Fremde in den Sandalen, die sie trugen. Und es gab noch immer ein paar ungelöste Probleme:
Wenn ich dreimal so dick wäre wie sie, bräuchte ich drei Sitze. Das hieß, drei kostenlose Tickets.
Doppelt. Dreifach. Matheunterricht. Eine Summe, die zu berechnen war.
Was ist doppelte Liebe geteilt durch dreimal-meine-Größe multipliziert mit kostenlosen Tickets geteilt durch unvorsichtige Worte? Ein kalter, pelziger Falter auf einem ängstlichen Herz. Dieser Falter war mein ständiger Begleiter.
Ich lernte früh, dass der sicherste Ort der gefährlichste sein kann. Und dass ich ihn dazu machen kann, auch wenn er es nicht ist.
Jahre später, als ich in meinen Dreißigern war, eine erwachsene Frau und Autorin mit veröffentlichten Büchern, besuchte ich eine Freundin, die gerade geheiratet hatte. Das glückliche Paar turtelte und sprach nur in Babysprache miteinander und das tagelang. Am dritten Tag lief ich aus dem Haus und beinahe in den mir entgegenkommenden Verkehr, völlig außer mir. Ich wusste nicht, was mich so aufgebracht hatte. Erst jetzt, da ich darüber schreibe, glaube ich zu verstehen. Sie hatten nichts Schlimmes getan – es lag an mir. Mein alter Freund, der kalte Falter, hatte mir einen unangekündigten Besuch abgestattet.
(Dennoch, ich persönlich wüsste es zu schätzen, wenn in Babysprache sprechende Erwachsene mit gesetzlich vorgeschriebenen Beipackzetteln daherkämen.)
Die verschiebbare-zusammenklappbare Schule
Nach der unglückseligen Reise zu Mrs Joseph in Madras kehrten wir zu unserem heiklen Leben auf der Klippe Ayemenems zurück.
Doch dann – kam die Erlösung.
Sie kam in der strengen Form und Gestalt einer britischen Dame mittleren Alters, die Schuhe und geblümte Kleider trug. Mrs Mathews war eine der Missionarinnen, die sich in Ooty mit meiner Mutter angefreundet hatten. Sie waren in Kontakt geblieben und hatten einen Plan ausgeheckt.
Gemeinsam gründeten sie 1967 eine Schule in Kottayam. Ich war sieben, mein Bruder achteinhalb.
Sie mieteten zwei Räume, die dem Kottayam Rotary Club gehörten und die Mitglieder nur abends nutzten. Die Schule begann mit sieben Schülern, darunter mein Bruder und ich. Es klingt einfach, doch allein wäre meine Mutter nicht dazu in der Lage gewesen. Es war Mrs Mathews – eine weiße, jungfräuliche, christliche Missionarin –, die den ersten Eltern Vertrauen einflößte, so dass sie ihre Kinder in der neuen Schule anmeldeten. Ohne sie ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand die Erziehung ihrer Kinder einer unberechenbaren Frau aus dem Dorf, die einen Ortsfremden geheiratet und sich dann von ihm hatte scheiden lassen, anvertraut hätte.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es wahrscheinlich G. Isaac, der den Rotary Club überredete, die Räume seiner Schwester zu vermieten. Denn er war Mitglied des Clubs. Es war typisch für die Beziehung zwischen Bruder und Schwester: Hilfe und Harm in gleichem Maße.
Jeden Morgen fuhren Mrs Mathews, meine Mutter, mein Bruder und ich mit dem Bus in die Stadt zur Schule. An manchen Tagen gingen G. Isaac, mein Bruder und ich zu Fuß, quer durch die Reisfelder und Gummibaumwäldchen, die sich alle der Sonne zuwandten. Wenn die Straßen vom Monsun überflutet waren, ruderten wir in kleinen Booten darüber. Wir hielten mehrmals an den Häusern junger Frauen an, die in der Fabrik arbeiteten, Frauen, denen G. Isaac entweder den Hof oder einen Heiratsantrag machte. Wir waren seine Anstandspersonen. Unsere Anwesenheit sollte den Familien der Mädchen versichern, dass seine Absichten ehrenhaft waren.
In der Stadt brachte er uns zur neu gegründeten Schule und ging weiter zu seiner Pickles-Fabrik. In den Ferien erlaubte er meinem Bruder und mir dort am Fließband zu arbeiten. Wir verpackten Currypulver und klebten Etiketten auf Pickles-Gläser. Wir trugen königsblaue Schürzen und weiße Kopftücher. Und wir rochen nach Salzlake und Essig.