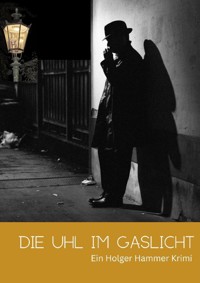Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehr als zwei Jahre sind vergangenen, seit Seuchen einen Teil der Weltbevölkerung ausgelöscht haben. Und noch immer klammern sich die früheren Machthaber an Geld und Einfluss. Je weiter die Erde auf den Abgrund zusteuert, desto mehr spitzt sich der Kampf um sie zu. Während die Fremden aus den Tiefen des Alls unter den Menschen immer mehr Verbündete für die Rettung es Planeten gewinnen, mobilisieren die früheren Regierungen ihre Truppen und verschärfen den globalen Bürgerkrieg. Erhalt und Erneuerung der alten Welt stehen sich unversöhnlich gegenüber und fordern auf beiden Seiten große, persönliche Opfer. Widerstandskämpfer, wie die ehemalige Bundeskanzlerin Henriette Hartkamp, der afrikanische Präsident Keita und der Amerikaner Mason Perkins kämpfen gegen die Reste der einst mächtiger Regierungen. Während durch die Ermordung des russischen Präsidenten ein gefährliches Macht-Vakuum entstanden ist, rüsten die USA massiv gegen die Fremden auf. Doch die wollen nach wie vor nicht in die Konflikte auf der Erde eingreifen. Dabei wächst der Druck, je kritischer die Lage des Planeten wird. Ein "Krieg" scheint der einzige Ausweg zu sein. Der vierte Teil der packenden Roman-Reihe "Menschendämmerung".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1: Im Jahre 3
Deutschland / Hessen, Frankfurt am Main
Lautlos glitt das schwere, schwarze Motorrad durch die leeren, dämmrigen Straßen der Metropole. Kaum ein Auto war unterwegs, geschweige denn Fußgänger. Die Maschine glitt sanft zwischen den gläsernen Hochhäusern entlang, bog schließlich in eine schmale Nebenstraße und kam am Fahrbahnrand zum Stehen.
Die schwarz gekleidete Person stieg mit einer schwungvollen Bewegung herunter und nahm den Helm ab. Rotblondes, welliges Haar, das bis auf die Schultern fiel, bahnte sich seinen Weg. Das Gesicht der Fahrerin war schmal. Die schrägliegenden Augen glänzten hellblau und die blasse Gesichtshaut war von Sommersprossen übersät.
Sie verstaute den Helm zusammen mit ihrer Lederjacke unter dem Sitz. Darunter trug sie ein schlichtes Shirt. Doch trotz der schnellen Fahrt und der Abendstunde schwitzte sie. Es war immer noch unerträglich heiß.
Die junge Frau nahm aus dem Fach einen kleinen Koffer, schloss die Maschine ab und lief über die breite leere Straße auf den Eingang einer Tiefgarage zu. Dort, neben der rot-weißen Schranke, wartete ein Mann auf sie. Er war ein Stück größer, hatte krauses, braunes Haar und große traurige Augen mit Tränensäcken darunter. Seine Ohren standen leicht ab und auf den geschwungenen Lippen lag ein verträumtes Lächeln.
Die junge Frau sah ihn unsicher an.
„Gordon Black?“, fragte sie vorsichtig.
Er nickte, ohne die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen.
„Dann sind sie Ricarda Schmidt?“
Sie nickte und sah sich um. „Ist es hier?“
Ihr Gegenüber nickte. „Wir können runter in die Tiefgarage gehen. Er wird jeden Moment auftauchen.“
Ricarda nickte und folgte Black an der Schranke vorbei ins erste Untergeschoss der Garage.
Sie seufzte leicht, als die Kühle des Kellers über ihre Haut strich. „Tut ziemlich gut nach der Hitze, oder?“
„Hmm“, machte Black nur, während er mit der Hand auf einen Wagen deutete, der direkt neben der Tür zum Treppenhaus stand.
Nachdem sie sich in dessen Nähe platziert hatten und Gordon sicher war, dass sie von der Tür aus nicht gesehen werden konnten, öffnete er die kleine Umhängetasche, die er über der Sommerjacke trug und schraubte einen Schalldämpfer auf die Waffe, die er herausholte.
Ricarda beobachtete ihn mit großen Augen. Sie hatte den Mann nie zuvor gesehen, wusste aber, dass er ein sogenannter „Executor“ war – jemand, der im Auftrag der Fremden Menschen tötete. Und obwohl ihr versichert worden war, dass an diesem Abend niemand sterben würde, machte ihr der Mann Angst.
Gordon bemerkte es und lächelte.
„Nur keine Sorge, Miss Schmidt. Ich bin lediglich die Verstärkung. Das überzeugende Argument, wenn sie so wollen.“
Ricarda lächelte nervös. Das hier war nicht ihre Welt. Aber sie war fest entschlossen, den Auftrag zu Ende zu bringen.
Black legte den Kopf auf die Seite und musterte die 23-Jährige.
„Wie lange sind sie schon beim... Widerstand?“
Die junge Frau musste sich fast gewaltsam vom Anblick der Waffe in Gordon Blacks Hand losreißen. „Oh... von Anfang an, würde ich sagen. Ich war damals gerade mit der Schule fertig, hatte ein bisschen gejobbt und wollte im Sommer mit dem Studium anfangen. Und dann kamen... sie... und ihre Leute. Und alles war plötzlich anders.“
Gordon lächelte. „Und jetzt ist alles sogar... noch mehr... anders, richtig?“
Ricarda nickte traurig, als sie die Ereignisse der letzten Monate und Jahre Revue passieren ließ.
„Ja. Die Welt in der ich aufgewachsen bin, gibt es nicht mehr...“
„Sein sie nicht traurig“, sagte Gordon ohne Emotionen in der Stimme. „Die neue Welt wird eine bessere sein. Wir müssen nur ein bisschen ausmisten und aufräumen. Dann werden sie sehen, was dieser Planet alles hervorbringen kann.“
Ricarda nickte, doch das Lächeln auf ihren Lippen war nicht überzeugend.
Sie schwiegen, bis sie hinter der Tür den Lift hörten.
Gordon sah auf seine Uhr. „Das wird unser Freund sein. Sind sie bereit?“
Sie hob die Schultern. „Das hoffe ich.“
Gordon warf ihr ein aufmunterndes Lächeln zu und duckte sich hinter den Wagen.
Ricarda räusperte sich, fischte eine Zigarettenpackung aus ihrem kleinen Koffer und ging in den Schatten einer Säule gegenüber der Tür.
Sie wartete und hatte das Gefühl, die Zeit würde stillstehen.
Dann endlich...
Die Metalltür wurde knarzend aufgedrückt und ein junger Mann Ende 20 betrat die Garage. Er trug enge Röhrenjeans, ein enges, hellblaues Hemd und einen Rucksack in der Hand. Die blonden Haare waren zu einer aufwendigen Tolle frisiert, der Vollbart ordentlich gestutzt und die Hornbrille glänzte.
„Entschuldigung“, rief Ricarda und kam mit der Zigarette in der Hand hinter der Säule hervor.
Steven Schlenzer, der gerade zu seinem Wagen gehen wollte, blieb stehen und sah sie fragend an, während sie näherkam.
„Hätten sie vielleicht Feuer für mich?“
Steven hob die sorgfältig gezupften Augenbrauen und suchte nach einer Antwort. „Äh... nein. Rauchen ist total scheiße, wissen sie?“
Ricarda überlegte sich noch eine Erwiderung, kam aber nicht mehr in die Verlegenheit, sie zu brauchen. Die kurze Ablenkung hatte Gordon bereits gereicht, sich lautlos in Schlenzers Rücken zu bewegen und ihm den Schalldämpfer an den Hals zu drücken. Als der Bedrohte schreien wollte, schnitt der Executor ihm das Wort ab.
„Sie können natürlich schreien, aber dann sind sie auf der Stelle tot. Was sie in ihrem Nacken spüren, ist der Lauf einer Waffe und ich bin darauf geschult, sie einzusetzen. Wenn sie ruhig bleiben, mir zuhören und anschließend tun, was ich sage, können sie diese Begegnung überleben.“
Steven musste nicht lange nachdenken. „Was wollen sie?“
„Ich möchte, dass wir drei zurück in ihr Büro im 20. Stock fahren. Dort werden sie ihren Rechner starten und meiner jungen Freundin Zugriff auf die Server ihrer Kunden geben. Sie versorgen sie mit den Passwörtern, lassen uns eine halbe Stunde arbeiten und können noch zeitig genug zur Happy Hour in ihrer Lieblings-Cocktailbar sein...“
Steven zitterte. „Wissen sie eigentlich, was sie da von mir verlangen?“
„Davon dürfen sie wohl ausgehen, wenn ich ihnen sogar eine geladene Waffe an den Kopf halte.“
„Meine Kunden sind die größten Imperien in der globalen TECH-Branche!“
„Mit anderen würden wir uns auch nicht abgeben. Können wir dann gehen?“
Steven überlegte kurz, dann beschloss er mitzuspielen, um Zeit zu gewinnen.
Eigentlich hätte er damit rechnen müssen, dass früher oder später so etwas passierte. Er war die Marketing-Schnittstelle der größten IT-Player weltweit. Unternehmen, die sämtliche relevanten Social Media Kanäle und Suchmaschinen kontrollierten. Und sie alle waren daran beteiligt, für ein ebenso weitreichendes Netz von Wirtschafts-Giganten die öffentliche Meinung gegen die Außerirdischen zu drehen. Seit drei Jahren schon kontrollierten sie Gruppen, Influencer, Messenger-Dienste und Social Media Netzwerke. Sie versorgten ihre weltweiten Nutzer mit gezielten Kampagnen gegen die Außerirdischen und lancierten auch einen aggressiven, kontrollierten Widerstand gegen sie, so dass die Verbündeten der Fremden wie radikale Terroristen aussahen. Damit kontrollierten sie nicht nur das Internet, sondern auch die traditionellen Medien, die ihre Ausrichtung ebenfalls an den Themen im Netz orientierten, um „am Puls der Zeit“ zu bleiben.
Zwar machte der echte Widerstand in letzter Zeit mehr Probleme, doch das erhöhte auch den Reiz des Spiels und sorgte dafür, dass die Programmierer der Algorithmen immer auf dem Laufenden sein und ihre Arbeit anpassen mussten.
Unter diesem Gesichtspunkt war Steven Schlenzer die perfekte Zielscheibe.
Ein Schlüssel für das Fahrstuhlschloss sorgte dafür, dass er zusammen mit seinen beiden Begleitern direkt im Großraumbüro seiner Marketingfirma landete. Er war gewohnheitsmäßig der Letzte, der das Büro verließ, weil er die Stunde nach Feierabend regelmäßig damit verbrachte, die Computer seiner Mitarbeiter auf verdächtige Aktivitäten zu kontrollieren. Wenn er sich etwas nicht leisten konnte, dann war es ein Maulwurf. Jetzt sollte er selber einer werden...
Schlenzer schaltete die Deckenbeleuchtung ein und ging mit vorsichtigen Schritten den Mittelkorridor zwischen den abgetrennten Arbeitsplätzen entlang zu seinem eigenen Büro, einem separaten Glaspavillon, der leicht erhöht am Ende des Raumes stand. Er schloss auch hier die Tür auf, legte die Tasche ab und setzte sich hinter seinen Schreibtisch, um den Rechner zu starten.
Bevor er die Tastatur berühren konnte, legte Ricarda ihm ihre dünnen, blassen Finger auf die Hand.
Er hob erschrocken den Kopf und sah ihr schüchternes Lächeln.
„Wenn sie versuchen, einen Bot oder ein verstecktes Alarmsystem zu starten, dann sehe ich das. Und mein Kollege würde sie dann ohne Umschweife erschießen.“
Zitternd starrte Steven auf den noch schwarzen Bildschirm.
„Was versprechen sie sich denn überhaupt vom Zugang? Das hier ist nur eine von vielen Marketingabteilungen. Ich bin ein kleines Licht.“
Gordon hatte sich vor dem Schreibtisch aufgebaut und hielt die Waffe im angewinkelten Arm auf Steven gerichtet.
„Wenn dem so wäre, wären wir ganz sicher nicht hier, Mr. Schlenzer.“
„Aber ich kann nichts tun von hier aus.“
Gordon lächelte und seine Augen wurden schmaler. „Müssen sie auch nicht. Das erledigt meine reizende Kollegin. Wir wissen, dass sie von hier aus Zugriff auf die Hauptserver der Unternehmen haben, für die sie arbeiten.“
„Ich habe mich da noch nie eingeklinkt! Ich wüsste gar nicht, wie das geht.“
„Zerbrechen sie sich nicht unseren Kopf. Schalten sie ihren Rechner an, geben sie die erforderlichen Passwörter ein, um ins System zu kommen und den Rest erledigen wir.“
Stevens Lippen zitterten. „Wenn sie dort irgendwas anstellen, dann wissen die, von welchem Rechner es kam! Ich bin erledigt! Die bringen mich um.“
Gordon wiegte den Kopf. „Ja, das kann sein. Aber bis es soweit ist, hätten sie auf jeden Fall noch einen Vorsprung. Den haben sie aber nicht, wenn sie sich weigern. Ist eine einfache Rechnung.“
Steven Schlenzer schluckte. Er wusste, dass dieser Mann nicht bluffte. Sicher war er ein Außerirdischer. Und die kannten keine Gefühle.
Er schloss kurz die Augen, dann loggte er sich ein und öffnete mit dem Administrator-Zugang das Netzwerk.
Langsam stand er auf und trat hinter den Stuhl. Ricarda lächelte, bedankte sich leise und setzte sich. Hastig glitten ihre Finger über die Tastatur und fischten gleichzeitig einen USB-Stick aus dem kleinen Koffer, den sie dabei hatte. Sie schob ihn ins vorgesehene Slot und tippte weiter. Ein Teil des Erfolgs hing von ihrer Schnelligkeit ab. Gordon konnte nicht sehen, was sie tat, und es interessierte ihn auch nicht. Sie hatte ihre Aufgabe, er hatte seine. Also konzentrierte er sich darauf, Schlenzer im Auge zu behalten, der mit betretenem Ausdruck hinter dem Schreibtisch stand und den Blick gesenkt hielt. Nach 20 Minuten zog Ricarda den Stick wieder ab, lächelte und stand auf.
„Fertig“, sagte sie und sah die Männer an.
Gordon schraubte zufrieden den Schalldämpfer seiner Waffe ab und verstaute beides wieder in der Jacke.
„Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ich danke ihnen für die Zusammenarbeit und wünsche ihnen noch einen angenehmen Abend und ein schönes Wochenende, Mr. Schlenzer. Bemühen sie sich nicht, wir finden alleine raus. Und zwar bevor sie einen Wachschutz alarmiert haben, was aber sowieso nicht in ihrem Interesse liegen dürfte.“
Gordon nickte ihm zu, gab Ricarda ein Zeichen und steuerte dann den Fahrstuhl an. Während die beiden das Hochhaus wieder durch die Parkgarage verließen, sich draußen verabschiedeten und dann getrennte Wege gingen, blieb Steven Schlenzer wie versteinert in seinem Büro stehen und versuchte zu begreifen, was in den letzten 40 Minuten geschehen war.
Als seine Knie zu weich wurden, ließ er sich auf seinen Bürostuhl sinken und starrte auf den schwarzen Bildschirm. Der Computer war aus und nichts deutete darauf hin, dass irgendetwas anders war als vor dem Besuch dieser beiden unheimlichen Personen.
Was Steven Schlenzer nicht sehen konnte, war die kleine Einheit von Bots, die sich wie ein Überfallkommando durch das Netzwerk fraß und an verschiedenen Stellen andockte. Die einzelnen Viren sammelten dabei Informationen, die sie beim Weiterkommen benötigten, verschafften sich Passwörter und studierten dabei Algorithmen und Verschlüsselungs-Sequenzen. Mit diesen Informationen drangen sie tief in das Herz der Netzwerke vor, über die sämtliche Social Media Plattformen und Angebote der Unternehmen gesteuert wurden. Von den Hauptservern aus verbreiteten sie sich weiter zu den Anbietern, in die App Stores und die Datenspeicher. Mit ihrem gesammelten Wissen fraßen sie alles auf, was ihnen in den Weg kam. Sie löschten keine Daten, sie zersetzten sie, wie eine digitale Seuche – unwiederbringlich getilgt. Sämtliche gespeicherten Nutzerdaten, Anmeldeinformationen, Historien und Verläufe in den Konten und alle hochgeladenen Informationen und Daten verschwanden in dieser Nacht von den Servern und von den Nutzerkonten.
Es war die größte Datenvernichtung in der Geschichte des digitalen Zeitalters. Millionen Menschen würden in den nächsten Stunden ihre Rechner, Smartphones und andere Mobile Devices starten und vor einem schwarzen Display sitzen.
Sie hätten keine Fotos mehr...
Keine Verläufe...
Keine Videos...
Keine Adressen....
Keine Passwörter und Nutzernamen...
Keine Freunde, Abonnenten und Follower...
Keine Likes...
Keine Persönlichkeit...
Und ein Großteil von ihnen auch keinen Sinn mehr für ihr Leben.
Die Mission von Gordon Black und Ricarda Schmidt war ein voller Erfolg und ein Sieg im Krieg um die Erde.
USA / Pennsylvania, Deer Lake
Ungeduldig lehnte Mason Perkins am Kotflügel des altersschwachen Ford. Am liebsten hätte er geraucht, aber wegen ein bisschen Nervosität kam es nicht in Frage, mit dem Laster wieder anzufangen.
Er war Anfang 30, hatte welliges, hellbraunes Haar, das er im Nacken etwas länger trug, und einen Dreitagebart. Er trug nur ein helles T-Shirt und eine Jeans. Obwohl es Morgen war, drückte die Hitze bereits.
Immer wieder wandte sich Mason zu der großen, mehrgeschossigen Villa um, die in der Nähe des Sees, außerhalb des kleinen Ortes lag. Niemand wusste wirklich, was hinter diesen Mauern geschah. Niemand außer ihm und den Eingeweihten.
Immer wieder sah er unruhig auf seine Uhr. Er hätte darauf bestehen sollen, seinen Gast vom Flughafen abzuholen, doch sie wollte allein kommen. Viel hing von diesem Besuch ab. Mason sah darin die letzte Chance, das Ruder noch herumzureißen.
Er spannte sich an, als er das noch entfernte Motorengeräusch zu hören glaubte. Es kam näher und schließlich hielt ein schwarzer Sportwagen vor dem vergitterten Tor zu dem Gelände.
Gespannt beobachtete Mason, wie es schließlich aufglitt und der Wagen näher rollte, bis er neben seinem zum Stehen kam.
Die Frau, die ausstieg, war ungefähr in seinem Alter, ein ganzes Stück kleiner und hatte eine kräftige, sinnliche Figur.
Das kastanienbraune Haar war dick, schulterlang und zusammengebunden. In den dunklen Augen lag ein leichter Silberblick und der kleine Mund schien die Form eines Herzens zu haben. Sie lächelte Mason müde an und streckte ihm eine schlanke Hand entgegen.
„Ich bin Jasmine.“
„Mason. Freut mich, sie kennenzulernen.“
Die junge Frau blickte unsicher an der schlossähnlichen Fassade des Anwesen hinauf.
„Und da ist er drin?“
Mason nickte. „Ja. Schon viel zu lange...“
„Ihr Anruf hat mich sehr überrascht. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass er überhaupt noch am Leben ist. Ich dachte, er sei damals auch...“
Mason nickte. „Wir haben es bewusst geheimgehalten, solange sein Zustand auf der Kippe stand. Und wir hängen es auch jetzt nicht an die große Glocke. Er ist zu wichtig für unsere Organisation. Deshalb ist es gut, dass sie hier sind.“
Sie seufzte. „Ich hoffe, sie versprechen sich nicht allzuviel von meinem Besuch. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Wir hatten auch keinen Kontakt mehr, bevor... das passiert ist.“
Mason verzog den Mund zu einem schiefen, gequälten Lächeln. „Ich habe nicht mehr viele Optionen, Jasmine. Wir haben alles versucht. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Sie und ein kleiner Trumpf, den ich noch aus dem Ärmel ziehen kann. Wir müssen Erfolg haben.“
Sie holte tief Luft und strich das leichte Sommerkleid glatt.
„Na, dann wollen wir es mal hinter uns bringen.“
„Hatten sie einen guten Flug?“, fragte Mason, während sie auf das große Portal zugingen.
Jasmine hob die Schultern. „War ja nur eine knappe Stunde. Und da war es wenigstens kühl.“
„Ja, die Erde beginnt zu kochen...“
Er hielt ihr die Tür auf und sie betraten die große Halle, in deren Mitte ein breiter Holztisch stand, hinter dem eine freundliche Frau in Schwestern-Uniform Wache hielt.
Es war kein gewöhnliches Krankenhaus, das die Besucher betraten. Eine Spezial-Klinik, betrieben von loyalen Ärzten und Fremden, in der nur „ausgesuchte“ Patienten behandelt wurden. Solche, die dem Widerstand angehörten und sich bewusst waren, was auf dem Spiel stand, wenn die Existenz dieser Einrichtung den offiziellen Stellen und der Regierung bekannt würde. Sie mussten auf der Hut sein und sich nach außen hin als Spezial-Sanatorium für besonders „sensible Klienten“ tarnen. Da seitens der Fremden immer wieder Anstrengungen unternommen wurden, dieses Image aufrecht zu erhalten, konnten sie im Verborgenen ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen. Und die bestand darin, menschliche Ärzte zu schulen und in die Medizin der Außerirdischen einzuarbeiten. Gleichzeitig wurden hier Opfer des Widerstands behandelt, die zu wichtig waren, um sie der Gefahr öffentlicher Krankenhäuser auszusetzen.
Die Schwester sah zu den Besuchern auf.
„Mason Perkins – Dr. Scott erwartet uns.“
Sie drückte einen Knopf auf einem kleinen Display, das in den Tisch eingelassen war und sah dann wieder zu den Gästen.
„Er wird gleich bei ihnen sein.“
Mason und Jasmine traten einen Schritt zurück und für einen Moment entstand eine peinliche Pause.
„Haben sie vor, länger in der Gegend zu bleiben?“, fragte Mason schließlich etwas ungeschickt.
Jasmine hob die Schultern. „Ich weiß es noch nicht. Im Moment bin ich... sagen wir... flexibel. Meinen Job als Lehrerin habe ich schon vor ein paar Jahren verloren. Kurz nachdem... na, sie wissen schon. Und seitdem hangele ich mich von einem Nebenjob zum nächsten. Im Moment bin ich gerade wieder auf der Suche.“
„Vielleicht findet sich hier bei uns ja etwas?“
Sie hob die Schultern und Mason lächelte. „Zumindest wären sie unter Freunden.“
„Und in Gefahr“, ergänzte Jasmine mit einem schiefen Lächeln.
Sie wurden unterbrochen, als ein schlanker Mann aus dem Korridor hinter der Anmeldung auf sie zukam. Er trug einen weißen Kittel und hatte dichtes, schwarzes Haar, das bis über die Ohren reichte und seitlich gescheitelt war. Eine Frisur wie aus den 80er Jahren. Er hatte dunkle Augen und eine schmale gebogene Nase. Das Lächeln war offen und freundlich.
Mason stellte Jasmine vor.
Dr. Vincent Scott reichte ihr die Hand, bevor er sich an Mason wandte. „Es gibt leider kaum Veränderungen. Alles ist wie gehabt und wir haben getan, was wir tun konnten.“
Mason hatte nichts anderes erwartet. Sein letzter Besuch lag zwar schon ein paar Monate zurück, doch auch da war die eigentliche Behandlung bereits abgeschlossen. Schon damals hatte ihm Dr. Scott erklärt, dass der Wille zur Genesung fehle.
Vielleicht sogar der zu leben.
„Er ist draußen im Park“, erklärte der Mediziner. „Ich bringe sie zu ihm.“
Sie gingen zu dritt durch einen Flur, der sich links erstreckte und an mehreren Zimmertüren vorbeiführte. Am Ende weitete er sich zu einem Wintergarten, an dessen Glasfront eine große Tür nach draußen führte.
Unter einer breiten, schattenspendenden Kastanie sahen sie eine Sitzgruppe mit einem kleinen Sofa, zwei Sesseln und einem Tisch. Ein einzelner Mann saß dort, fast bewegungslos.
„Rufen sie mich, wenn sie etwas brauchen“, erklärte Scott und zog sich zurück, während Mason und Jasmine zu dem Mann gingen, der sie erst bemerkte, als sie ihn erreicht hatten.
Er hob den Kopf und sah Mason ausdruckslos an.
Sein Haar war lang geworden und früher einmal dunkel gewesen. Jetzt nahmen die grauen Strähnen zu. Das schmale Gesicht mit den spitzen Lippen lag unter einem Vollbart und von den graublauen Augen mit dem stechenden Blick sah nur noch eins den Besucher an.
Über dem rechten lag eine schwarze Augenklappe, die einen Teil des vernarbten Gesichts verdeckte. Die komplette rechte Seite war einem Feuer zum Opfer gefallen. Nicht nur das Gesicht. Den Arm konnte der Verletzte mittlerweile wieder bewegen, das Bein blieb steif und erforderte einen Stock. Von der smarten Attraktivität, die der 44-Jährige einmal ausgestrahlt hatte, war nichts mehr übrig geblieben. Sein Blick war leer und stumpf. Er würdigte Mason nur eines kurzen Blickes und drehte dann das Gesicht wieder zum sonnendurchfluteten Park. Von Jasmine hatte er nicht mal Notiz genommen.
Mason seufzte und bemühte sich um ein Lächeln.
„Hallo, Preston...“
Preston Vale sah ihn nicht an. „Was willst du, Mason?“
„Dich besuchen, nachsehen, wie es dir geht...“
„Es geht mir wie immer. Und wenn du mich in Ruhe lässt, kann es auch so bleiben.“
„Willst du das denn?“
Er erwartete keine Antwort. Preston Vale vermied es zu reden, wann immer es ging.
Für den ehemaligen Journalisten eine ungewöhnliche Haltung. Doch das Trauma vor zwei Jahren hatte alles verändert. Preston hatte damals die Hauptstadt verlassen, um sich dem Widerstand anzuschließen und seine Popularität und sein Wissen gegen die Manipulationen der Regierung einzusetzen. Niemand hatte den Maulwurf bemerkt, der sich in Masons Team in Uniontown eingenistet hatte. Und niemand hatte die Sprengsätze entdeckt, die Lauren Boyd, in Einzelteile zerlegt, mitgebracht hatte.
Es hätte schlimmer kommen können...
Als der Anschlag erfolgte, war Mason mit einem Teil des Teams bei einer Demonstration in Pittsburgh. Doch 14 Personen waren noch auf dem Gelände, als die Detonationen erfolgten. Neun starben sofort, zwei weitere innerhalb der darauffolgenden Tage und nur drei überlebten. Preston war einer von ihnen.
Seine Partnerin Rebecca Mars gehörte nicht dazu...
Ihr Tod war es, der Preson den Lebenswillen geraubt hatte. Lange lag er mit schweren Verbrennungen im Koma und die Ärzte der Fremden rangen um sein Leben. Durch ihr Wissen und ihre Technologie waren sie besser als menschliche Mediziner in der Lage, Preston zu retten. Doch es gab auch Dinge, die sie nicht reparieren konnten.
„Der Überlebenswille ist entscheidend für eine Genesung“, hatte Dr. Vincent Scott immer wieder betont. „Wir aktivieren die Selbstheilungs-Mechanismen des Körpers. Doch wenn der Körper die Heilung verweigert, können wir auch nicht mehr machen, als Menschen.“
Als Preston zu sich gekommen war und von Rebeccas Tod erfuhr, war ihm sein eigenes Schicksal egal geworden. Die Brüche verheilten, die Transplantationen waren erfolgreich, doch der innere Bruch griff auch auf den Körper über. Die Narben manifestierten sich auf der Haut, die Lähmung des Geistes griff auf das Bein über und der Wunsch, vor der Wirklichkeit die Augen zu verschließen, ließ ihn halbblind bleiben.
Er hatte damals alles aufgegeben, um das Richtige zu tun. Und er hatte Rebecca überredet, mit ihm zu gehen. Darum war es für Preston klar, dass er mitverantwortlich war für ihren Tod.
Es gab nichts mehr, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Also konnte er genausogut hier sitzen bleiben und darauf warten, dass sein langsamer Tod zu Ende ging.
„Ich habe Besuch mitgebracht“, sagte Mason und warf Jasmine einen Blick zu.
Unsicher ging sie um den Stuhl herum und hockte sich vor Preston auf den Boden.
Sein Blick flackerte, seine Lippen zitterten leicht und eine Träne lief über die Wange.
„Jasmine...“, hauchte er.
Sie nickte und nahm die vernarbte Hand, die den Stock hielt.
Mit seiner anderen Hand strich er ihr über die Wange.
„Ihr habt euch nie besonders ähnlich gesehen. Aber jetzt... bist du alles, was von ihr übrig ist...“
Jasmine nickte nur.
„Warst du... bei ihrer Beerdigung?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich konnte nicht. Ich war eh schon auf der Schwarzen Liste.“
„Und ich war im Koma“, erklärte Preston abwesend. „Als ich aufwachte, war alles vorbei. Aber Mason hat gesagt, dass sich um alles gekümmert wurde. Ich war nicht mal an ihrem... Grab.“
„Meine Schwester wusste, dass du sie geliebt hast.“
„Das hoffe ich. Mir war oft nicht klar, wie sehr. Erst als ich sie verloren habe... Sie könnte noch leben, wenn...“
Jasmine schüttelte energisch den Kopf und drückte Prestons Hand fester. „Es war ihre Entscheidung, mit dir zu gehen. Vielleicht war es keine leichte Entscheidung, aber sie hat sie getroffen.“
„Sie ist meinetwegen mitgegangen.“
„Nein. Sie wusste, dass es das Richtige war. Sie wollte es so.“
Preston senkte den Blick, als er die Tränen nicht mehr aufhalten konnte. Jasmine zog seinen Kopf auf ihre Schultern und ließ ihn weinen. Das Verhältnis zu ihrer Schwester war in den letzten Jahren nicht mehr besonders eng gewesen. Sie waren unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Auffassungen vom Leben. Während Rebecca ihre Karriere immer am wichtigsten war, hatte Jasmine nach Möglichkeiten gesucht, Menschen zu helfen. Als Kinder hatte sie immer im Schatten der großen Schwester gestanden, nie ihren Ehrgeiz besessen. Um sich abzugrenzen hatte sie schon aus Prinzip einen anderen Weg eingeschlagen, als Rebecca. Doch nachdem die Fremden gelandet waren und jedes Wertesystem plötzlich in Frage stand, hatten sie sich wieder angenähert. Ihre Eltern waren schon lange tot und sie waren die einzige Familie, die sie hatten.
Jasmine hatte Rebecca und Preston ein paar Mal in Washington besucht. Zuerst war ihr der Partner ihrer Schwester zuwider. Zu selbstverliebt, zu egoistisch. Aber er hatte sich verändert. Nachdem Preston beschlossen hatte, sich dem Widerstand anzuschließen, hatte Rebecca lange Gespräche mit ihrer Schwester am Telefon geführt. Sie waren sich endlich einmal nahe gewesen.
Leider viel zu spät...
„Sie kommt nie mehr zurück“, schluchzte Preston, als er sich aus der Umarmung löste, um die Tränen zu trocknen.
„Aber sie lebt in uns weiter“, entgegnete Jasmine, der nichts Besseres einfiel. „Und es ist wichtig, dass wir in ihrem Sinne weitermachen.“
Prestons Lippen verzogen sich zu einem schiefen Lächeln. „Wirst du mir jetzt sagen, dass sie nicht gewollt hätte, dass ich mich eingrabe und den Kopf in den Sand stecke?“
Jasmine lächelte zurück. „Brauche ich gar nicht – du weißt es ja schon.“
Er drehte den Kopf zur Seite, als suche er zwischen den Bäumen nach Antworten. „Ich kann das nicht, Jasmine. Ich kann nicht einfach so weitermachen wie vorher und so tun, als wenn nichts wäre.“
„Das verlangt auch keiner. Aber du kannst dein Leben auch nicht wegwerfen. Du hast eine Aufgabe, Preston. Und die musst du jetzt für dich und für Beck mit erledigen. Das war euer Ding. Ihr habt daran geglaubt. Und es ist wichtiger, als sich selber leid zu tun.“
Er verzog kurz schmerzhaft das Gesicht und senkte dann den Blick.
„Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen.“
„Du bist wichtig für uns“, schaltete sich Mason in das Gespräch ein.
Für einen Moment herrschte Schweigen. Dann entschloss sich Mason, den letzten Trumpf zu ziehen. „Außerdem gibt es Neuigkeiten. Wir wissen, wo Lauren steckt.“
Prestons Kopf zuckte herum und er starrte Mason an.
„Sag es mir“, flüsterte er.
Doch Mason schüttelte den Kopf. „Erst musst du wieder auf die Beine kommen. Dann können wir weitere Schritte planen.“
Preston sah wieder zu Boden. Der Kampf mit sich war ihm anzusehen.
„Ich werde darüber nachdenken.“
„Und ich werde wiederkommen.“
Als Mason und Jasmine sich verabschieden wollten, griff Preston nach dem Arm der jungen Frau.
„Bleibst du jetzt hier?“, fragte er mit fast flehendem Ton.
Sie sah zu Mason, dann zu Preston und lächelte. „Wenn es dir hilft, bleibe ich eine Weile.“
Er ließ sie gehen und sie kehrten zurück zum Klinikgebäude, wo Vincent Scott sie erwartete. Sie brachten den Arzt auf den neuesten Stand und gingen zu ihren Autos.
„Vielen Dank für ihre Unterstützung, Jasmine“, sagte Mason, als sie sich gegenüberstanden. Die junge Frau hob die Schultern. „Ich habe ja nichts getan. Aber ich muss mir jetzt überlegen, wie es weitergeht.“
Mason zögerte. Er wollte sie nicht überfallen. „Ich denke, es wäre wirklich hilfreich, wenn sie in der Nähe blieben, um Preston zu unterstützen. Wir haben ein neues Domizil, nicht weit von hier. Ist sogar ein ehemaliges Internat. Dort leben zur Zeit um die 60 Personen. Es wäre noch Platz...“
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und zog die Stirn kraus. „Und was soll ich da? Ich kann nichts von dem, was sie den ganzen Tag so machen.“
Mason grinste schief. „Was glauben sie denn, was wir tun? Flugblätter drucken und Bomben basteln?“
Jasmine gönnte sich ein Lächeln. „Ja, sowas in der Art.“
„Kommen sie einfach mit und sehen es sich an. Sie haben nichts zu verlieren, oder?“
Sie senkte den Blick, lächelte aber. „Na schön. Sie fahren vor.“
Russland, Moskau
Die Maschine aus Berlin landete am frühen Samstagnachmittag auf dem Internationalen Flughafen Scheremetjewo.
Die großen Hallen in den Terminals waren fast ausgestorben. Es kamen nur noch wenige Flüge an und auch die Sicherheitskontrollen waren kaum noch vorhanden.
Die zierliche Frau mit dem breiten Gesicht und den schmalen Augen lächelte, wobei sich ein Grübchen in ihrem kantigen Kinn zeigte. Sie hatte eine kleine Nase, geschwungene Lippen und blondes, dünnes Haar, das sie kurzgeschnitten trug.
Mit festen Schritten ging Uljana Sokolowa durch die fast menschenleere Abfertigung. Niemals hätte sie sich träumen lassen, dass es für sie so einfach wäre, nach Russland zurückzukehren. Die letzten Jahre hatte sie in Deutschland verbracht. Nach ihrer Flucht war sie bei ihrer Bekannten Saskia Gauers untergekommen, die ihr einen Job in ihrer Sicherheitsfirma gegeben hatte. Hauptsächlich war Uljana für den Schutz der ehemaligen Bundeskanzlerin Henriette Hartkamp zuständig, die zu einer zentralen Figur des Widerstands gegen die Regierung geworden war.
Uljana fühlte sich wohl in ihrer neuen Welt und hatte endlich eine Aufgabe gefunden, hinter der sie stehen konnte und von der sie überzeugt war. Mit Russland hatte sie abgeschlossen. Nach dem Attentat auf Präsident Fjodor Kusmin, war ihre Arbeit hier beendet. Würde das alte System noch existieren, wäre sie immer noch eine der meistgesuchten Personen der Welt. Doch dieses System war durch den Tod von Kusmin und die Seuchen, die sich in der Welt ausgebreitet hatten, längst zerstört.
Und so konnte sie unbehelligt in die alte Heimat zurückkehren und genoss es, dass niemand sie aufhielt oder nach ihrer Identität fragte, obwohl sie für den Tod eines Staatsoberhauptes mitverantwortlich war.
Vor der Halle parkten nur wenige Autos und es fiel ihr nicht schwer, die Frau mit der blonden Lockenmähne zu erblicken, die in einem knappen Sommerkleid an einem altersschwachen Skoda lehnte und ihr zuwinkte.
Sie hatte volle, sinnliche Lippen und schmale, dunkle Augen. Sie strahlte Uljana entgegen und schloss sie in die Arme.
„Es tut so gut, dich zu sehen, Genossin!“, lachte Merima Zaric. Die Kontinentalbeauftragte für Osteuropa war zu einer engen Vertrauten geworden, seit Uljana vor mehr als drei Jahren in einem Wald an der finnischen Grenze niedergeschossen worden war. Doch das schien in einem anderen Leben gewesen zu sein.
„Bitte, nenn mich nicht Genossin“, jammerte Uljana gespielt. „Dann fühle ich mich so als... Russin.“
„Ich bin froh, dass du gekommen bist.“
„Hatte ich denn eine Wahl? Du hast es äußerst dringend gemacht.“
Jetzt wurde Merimas Lächeln etwas dünner. „Das ist es auch, meine Liebe. Es geht um unseren gemeinsamen Freund: Semjon.“
Uljana legte die Stirn in Falten. Sie hatte seit ihrem Weggang aus Russland nichts mehr von dem ehemaligen Waldarbeiter gehört, der einer der ersten war, die einen bewussten Kontakt mit den Fremden hatten. Doch es hatte ihm nur Unglück gebracht. Eine lange, schmerzhafte Flucht und der Verlust seiner Familie lagen hinter ihm. Nachdem er den Abzug der Waffe betätigt hatte, durch die Fjodor Kusmin den Tod fand, hätte sein Leben ruhiger verlaufen sollen. Merima hatte ihn in Sicherheit gebracht. Doch sie ließ schon damals durchblicken, dass sie noch Pläne mit ihm hatte. Offenbar schienen die nicht aufgegangen zu sein.
„In welchen Schwierigkeiten steckt er denn jetzt?“
Merima hielt ihr die Beifahrertür des Wagens auf. „In den vielleicht größten seines Lebens. Derzeit sitzt er im Gefängnis – und wartet dort auf seine Hinrichtung.“
Uljana bekam große Augen. „Was? Wie konnte das passieren?“
„Steig ein. Ich erkläre dir alles, während wir zu mir fahren. Vor uns liegt eine Menge Arbeit.“
Afrika / Sambia, Nähe Solwezi
Der große Schriftzug „SamAg“ prangte über dem vergitterten Tor, das in die zehn Meter hohe Betonmauer eingelassen war. Dahinter lag das bestgeschützte Gelände des Landes. Vor etwas mehr als zwei Jahren war es nur ein 20.000 Quadratmeter großes Gelände mit Zelten, Containern und Zäunen.
Jetzt erstreckte sich das Gebiet über mehrere Kilometer, hatte die Größe einer kleinen Stadt und verfügte über gemauerte Gebäude, künstliche Seen, Felder und Labore.
Angefangen hatte es als Projekt der Fremden, um die trockene Erde der Steppe zu kultivieren. Nach zahlreichen Rückschlägen und Attentaten wurde vor zwei Jahren die erste Ernte eingefahren. Danach explodierte das ehemalige Landwirtschafts-Projekt. Als Sambias Präsident Jonathan Keita nach einem Putsch wieder an die Macht kam, setzte er alles daran, das Projekt auszuweiten und zu festigen. Ein Energieschutzschirm hatte das Gebiet vor Angriffen geschützt. Keita ließ kilomenterweit Mauern errichten und ersetzte die Behelfs-Unterkünfte durch Häuser. Er stattete das Projekt mit allem aus, was es brauchte.
Auch wenn es dem Land nach den Ereignissen der letzten Jahre noch schlechter ergangen war, musste er sich über die Finanzen keine Gedanken machen. Das Geld kam von den Fremden, die über unbeschränkte Mittel zu verfügen schienen. Das Problem war eher, jemanden zu finden, der bereit war, die Roh- und Baustoffe an ihn zu verkaufen.
Aber Keita wusste, dass die Zukunft seines Landes davon abhing und dass es nichts Wichtigeres geben konnte, als dieses Projekt.
Nach der Ausweitung hatte es im letzten Jahr endlich einen Namen bekommen: Sambia Agriculture – kurz SamAg.
Die administrative Leitung teilten sich zwei Menschen, die von Anfang an dabei gewesen waren: Die frühere Krankenschwester Tahiya Madaki und Keitas ehemaliger Sicherheits-Offizier Enyama Solarin.
Gasira Nenge, Regional-Beauftragte der Fremden, hatte die Wissenschaftliche Leitung und koordinierte die Einarbeitung der menschlichen Mitarbeiter, sowie die Anbau-Struktur auf dem Gelände. Niemand musste für die Erzeugnisse der SamAg bezahlen. Was immer an Ernte ankam, wurde unentgeltlich an die Menschen weitergegeben, die ihrerseits den Ertrag verteilten, so dass er möglichst vielen zugute kam.
In der näheren Umgebung schien das gut zu funktionieren. Doch je weiter die Mauern von SamAg zurücklagen, desto häufiger wurden die Transporte überfallen und die Ernte gestohlen, um sie weiter zu verkaufen. Nicht jeder war bereit, auf einen finanziellen Gewinn zu verzichten.
Ein Problem, für das Gasira und ihre Mitarbeiter bisher noch keine Lösung gefunden hatten. Auch etwas, das sie an diesem Samstag mit dem Präsidenten besprechen wollten.
Mit einem Flugzeug hatte Jonathan Keita die rund 400 Kilometer zwischen der Hauptstadt Lusaka und Solwezi zurückgelegt. Von dort war er mit einem Jeep die restlichen 40 Kilometer durch die Steppe gefahren.
Als das schwere Tor aufglitt, um das Staatsoberhaupt durchzulassen, stand die dreiköpfige Betriebsleitung parat, um ihn zu begrüßen.
Die Haut von Gasira Nenge war heller als die ihrer Landsleute. Sie hatte schmale, helle Augen und lange Rasta-Zöpfe.
Tahiya Madaki war ein Stück kleiner und trug das Haar kurzgeschnitten. Sie wirkte müde und abgespannt, lächelte aber, als der Wagen des Präsidenten auf das Gelände rollte.
Enyama Solarin war ein drahtiger Typ, mittelgroß mit einem sehnigen Körper und wachen Augen. Er grüßte militärisch, wie er es von seiner früheren Aufgabe gewohnt war.
Jonathan Keita schob seinen massigen Körper aus dem Wagen, nahm die Mütze ab und wischte sich über den kahlen Schädel, bevor er mit einem breiten Lächeln die anderen begrüßte.
„Es tut gut, wieder persönlich hier zu sein. Es ist unglaublich, wie dieses Projekt gewachsen ist.“
Gasira lächelte spöttisch. „Sie sollten nicht erstaunt sein, Herr Präsident. Immerhin haben sie das alles möglich gemacht.“
„Möchten sie erst eine Erfrischung oder erst eine Führung?“, fragte Tahiya.
Keita klatschte in die Hände. „Eine Führung natürlich! Ich kann es kaum abwarten.“
Über ein Funkgerät ließ Gasira einen kleinen Elektrowagen von der Größe eines Golf-Caddy kommen.
Sie selbst setzte sich hinter das Steuer und Enyama nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Tahiya setzte sich mit Keita auf die Rückbank.
Sie fuhren über die künstlich angelegten Wege zwischen den großen Gewächshaus-Reihen entlang. Tahiya erklärte, dass hier der Boden kultiviert und die Samen für die neuen Gegebenheiten angepasst würden. Der Boden sei mit biologisch reinen Wertstoffen angereichert, die auch in kargen und trockenen Gegenden ein gutes Wachstum garantierten. Gleichzeitig sei das Saatgut genetisch verändert worden, ohne das eigentliche Wesen der Pflanze oder den Nährgehalt ihrer Früchte zu beeinflussen – die wohl schwierigste Arbeit bei dem Projekt. Die Technologie der Außerirdischen verfügte über diese Möglichkeiten, deren Nutzen auch an die menschlichen Mitarbeiter von SamAg weitergegeben wurden. Schon jetzt sei ein Großteil der Arbeiten am Saatgut an Kollegen von der Erde delegiert worden. Außerdem würde es nicht mehr lange dauern, bis die Samen-Generationen weit genug vorangeschritten seien um eine dauerhafte Veränderung der Pflanzen ohne eine ständige Neu-Sequenzierung zu erreichen. Die Pflanzen würde dann gelernt haben, sich anzupassen und die Bedingungen für ein optimales Überleben selber reproduzieren.
Mehrere Getreidearten und auch Früchte gediehen bereits erfolgreich.
„Es ist aber geplant, die Diversität noch zu erhöhen, um den Fruchtwechsel auf den Feldern zu optimieren“, erläuterte Tahiya.
Nach den Gewächshäusern folgten die Felder, die stetig wuchsen und in deren Umgebung auch andere Vegetation gedieh.
Das wiederum sorgte für mehr Feuchtigkeit, die zum Anlegen künstlicher Seen genutzt wurde, in denen es Fischzucht gab.
Auch Ställe für Rinder und Geflügel fanden sich auf dem Gelände, das nach allen Seiten gewachsen war.
Am ehemaligen südlichen Rand erreichte die Gruppe eine Parzelle mit einer niedrigen Mauer von etwa 50 mal 50 Metern.
Zahlreiche kleine Bäume und Sträucher wuchsen hinter den Steinen und gaben dem künstlichen Quadrat den Anstrich einer Oase.
Eigentlich hatte Gasira daran vorbeifahren wollen, doch Keita zeigte direkt mit dem Finger darauf.
„Was ist das dort? Ein Garten?“
Gasira warf über den Rückspiegel einen kurzen Blick zu Tahiya. Als sie nickte, lenkte sie den Wagen zu dem kleinen Durchlass an der Mauer und stoppte ihn dort.
„Kommen sie, Herr Präsident. Ich zeige es ihnen.“
Jonathan Keita folgte Gasira durch das Tor in den schattigen, kleinen Garten. Zumindest hielt er es für einen. Doch dann sah er die schlichten Kreuze in den unterteilten Parzellen mit den Namen darauf.
Keita schluckte. „Sind das...?“
„Ja“, sagte Gasira. „Die Opfer des Anschlags von Hekima und Amaru Balewa vor zwei Jahren.“
Er ließ seinen Blick über die Grabreihen gleiten. „Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele waren.“
Gasira hob traurig die Schultern. „Es war wohl nicht die Absicht unserer Angreifer, jemanden zu töten. Es handelte sich um... Kollateralschäden.“
„Ein furchtbares Opfer.“
Er ging an den Kreuzen entlang, von denen eines hervorstach. Es war größer als die übrigen und die Grabstätte war gepflegter. Noch bevor der Präsident den Namen auf dem Kreuz las, wusste er, wer hier lag.
Ehrfürchtig ging er auf die Knie.
Gasira stellte sich hinter ihn.
„Ein mutiger Mann“, sagte Keita.
Sie nickte. „Er hat sich sein Schicksal nicht ausgesucht. Aber er hat es angenommen und seine Aufgabe ergefüllt. Wir alle hier werden Idrissa Okoye nie vergessen.“
„Ich weiß noch genau, wie erleichtert ich damals war, als er diese Krebserkrankung überstanden hatte.“
„Es hat ihm nie Gefahr von unserer Seite gedroht.“
„Das weiß ich. Es waren die Menschen, die ihn umgebracht haben.“
Gasira legte dem massigen Mann eine Hand auf die Schulter. „Seine Seele ist gereift. Er hat viel gelernt und ist gewachsen. Und wenn er wiederkehrt, dann vielleicht sogar als einer von uns. Mit dem Bewusstsein über alles, was vorher geschah. Dann war das Ende dieses Lebens sogar eine segensreiche Abkürzung seines Weges und hat ihn früher zur Erkenntnis gebracht.“
Jonathan Keita nickte langsam. „Eine schöne Vorstellung.“
„So wie die, dass wir alle unseren Weg selber bestimmen können. Und das Maß, in dem wir reifen. Wir müssen nur die Möglichkeit zulassen und akzeptieren, dass das Menschsein noch lange nicht das Ende unserer Entwicklung ist. Je mehr wir uns öffnen, desto mehr Raum schaffen wir für unsere Reifung.“
Mit leisem Stöhnen wuchtete sich Keita wieder auf die Beine und bekreuzigte sich.
Er lächelte zu dem Grab hinunter und verabschiedete sich in Gedanken von Idrissa Okoye. Er ließ sich von Gasira mehr über die übrigen Opfer des Anschlags erzählen, dann kehrten sie zum Wagen zurück.
Tahiya und Enyama hatten schweigend gewartet. Die Krankenschwester vermied es in letzter Zeit, das Grab allzu häufig aufzusuchen. War sie bis letztes Jahr noch täglich auf den Friedhof gegangen, um in der Nähe von Idrissa zu sein, so hatte sie ihre Besuche jetzt auf einen pro Woche beschränkt. Und sie spürte, wie der Schmerz langsam nachließ und Raum für andere, positive Gefühle machte. Sie nahm Abschied, aber sie wollte diesen Prozess nicht mit anderen teilen. Wenn sie bei Idrissa war, dann wollte sie mit ihm allein sein.
„Können wir weiter?“, fragte Gasira, als auch Keita seinen Platz wieder eingenommen hatte. Nach dem einhelligen Nicken lächelte sie.
„Sehr gut. Es gibt auch noch eine Menge zu sehen.“
Kapitel 2: Was geblieben ist
Drei Milliarden Menschen – das war die Zahl der Todesopfer, die das sogenannte Regenwaldfieber zusammen mit dem künstlichen Virus ETV-1 gefordert hatte.
Schon damals, vor fast vier Jahren, als die Fremden auf der Erde offiziell auftauchten und fünf Menschen als Botschafter zu sich holten, war der Widerstand gegen sie massiv gewesen. Und als sie von ihren Plänen berichteten, die Katastrophe zu verhindern, auf die der Planet zusteuerte, wurde er sogar noch größer. Denn den Klimawandel aufzuhalten, das Sterben der Meere zu verhindern, die Atmosphäre zum Atmen zu erhalten und die Ausbeutung der Rohstoffe zu beenden... bedeutete zu viel Verlust für zu viele Menschen, die zu gut damit verdienten.
Lief der Krieg gegen die Fremden in den ersten Monaten über eine gut geölte Marketing-Maschinerie, wurden im ersten Jahr nach der Ankunft die Waffen schärfer und tödlicher. Eine internationale Allianz aus global agierenden Unternehmen hatte ein künstliches Virus in Umlauf gebracht, das einen Magen-Darm-Infekt auslöste. Ziel war es, die Ursache den Außerirdischen zuzuschieben um den Kontakt zu Menschen einzudämmen und gleichzeitig die Gefährlichkeit der Fremden zu untermauern.
Doch das Virus geriet außer Kontrolle und vermischte sich mit einer weiteren, tödlichen Infektionskrankheit aus dem Regenwald zwischen Brasilien und Suriname.
Viel zu spät brachten die beteiligten Pharma-Unternehmen ihre Medikamente und Impfstoffe auf den Markt, die ebenfalls eine teils tödliche Wirkung hatten. Wer nicht von der Krankheit umgebracht oder geschädigt wurde, hatte gute Chancen, den Mitteln dagegen zum Opfer zu fallen.
Die Fremden selber waren auf den Anschlag vorbereitet und konnten nicht nur ihre eigenen menschlichen Körper effizient schützen, sondern auch die ihrer Verbündeten. Obwohl die Existenz des fremden Vakzins nicht an die große Glocke gehängt wurde, bekamen auch die ängstlichen Kritiker Wind davon und fanden Mittel und Wege sich damit zu immunisieren – was niemals jemand erfahren durfte.
Mit aller Macht wurde die Legende vom Außerirdischen Ursprung der Krankheit aufrechterhalten. Und sogar im Angesicht eines globalen Massensterbens hielten die Verursacher an der Schuldfrage fest.
Der deutsche Virologe Eike Erhardt hatte nicht an den außerirdischen Ursprung der Krankheit geglaubt und zusammen mit der Onkologin Ebru Turan war es ihm gelungen, die künstliche Genese des Virus nachzuweisen. Die Publikation der Ergebnisse führte zu Erhardts Ermordung – eine Tat, die selbstverständlich nie aufgeklärt wurde. Ebru Turan flüchtete danach Richtung Berlin in den Schutz der ehemaligen Bundeskanzlerin Henriette Hartkamp, die zu einer Galionsfigur des Widerstands gegen den Regierungskurs geworden war.
Unter ihrer Schirmherrschaft gingen die Untersuchungsergebnisse viral und lösten zusätzlich zur tödlichen Seuche bürgerkriegsähnliche Zustände weltweit aus. Die Menschen gingen in ihrer Todesangst auf die Barrikaden, griffen sich gegenseitig, die Regierungen und die Außerirdischen an. Die menschliche Natur war endgültig außer Kontrolle geraten.
Bundeskanzler Harald Blöhme, der erste Regierungschef der neuen künstlichen Partei Freie Erdenbürger musste wegen dieses Skandals zurücktreten. Einige Wochen später beklagte die Interims-Regierung sein überraschendes Ableben. Offiziell war auch er der heimtückischen Krankheit zum Opfer gefallen.
Im Hintergrund war ein neuer Stern am Polithimmel aufgegangen: Phillip Reimbacher war ein Shooting-Star der FEB. Er war vor drei Jahren als Abgeordneter für Gelsenkirchen aus dem Stand heraus in den Landtag gewählt worden. Knappe zwei Jahre später ersetzte er einen ausgeschiedenen Minister und galt schon damals als politischer Ziehsohn von Harald Blöhme. Jetzt war er 44 und ehrgeiziger denn je. Blondes, kurzes Haar, Dreitagebart, stechende Augen, durchtrainierte Figur. Bei Reimbacher stimmte alles: Das Aussehen, die Ausstrahlung, die Rhetorik und die politische Gesinnung. Was dem schwerfälligen Blöhme noch mühsam hatte eingeimpft werden müssen, erledigte Reimbacher intuitiv. Und dennoch war er nicht so vermessen, seine Herkunft zu leugnen. Er wusste, wer ihn nährte und den Kurs bestimmte. So kämpferisch und selbstbewusst er sich in der Öffentlichkeit gab, so folgsam und gelehrig war er hinter den Kulissen bei jenen, die ihn mit Macht und Geld ausstatteten.
Von Blöhme hatte Reimbacher nicht nur das Amt, sondern auch die Wadenbeißerin Britta Starke geerbt. Eine fleißige Untertanin, deren ganzer Gehorsam dem Unternehmer Stefan Langner gehörte, Sprecher eines Interessenverbandes der mächtigsten Wirtschaftsgrößen des Landes, der sich zum Zeitpunkt des Seuchen-Ausbruchs rechtzeitig nach Venezuela abgesetzt hatte und dort vom Hintergrund aus dirigierte. Da Britta Starke nicht mehr auf einen Bundeskanzler aufpassen musste, galt ihre ganze Aufmerksamkeit der Aufgabe, es ihrem neuen Boss recht zu machen. Wenn es nach ihr gegangen wäre, in jedem Lebensbereich.
Doch auch wenn das Ego von Phillip Reimbacher exorbitante Maße hatte, musste er sich um andere Dinge kümmern, als seine Eitelkeit zu pflegen.
Der Kampf gegen die Außerirdischen wurde jeden Tag erbitterter.
Es war ihm gelungen den Image-Schaden, den die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse bedeutete, abzuwenden.
Doch es gab noch mehr Fronten: Da waren die Fluggesellschaften, die noch unter der Regierung von Blöhme die Fronten gewechselt hatten und sich von den Fremden neue Antriebe in ihre Maschinen bauen ließen, um künftig auf Kerosin zu verzichten. Dadurch genossen sie nicht nur Wettbewerbsvorteile gegenüber ausländischen Airlines, sie gefährdeten auch Lieferabkommen mit einflussreichen arabischen Staaten. Reimbachers Partei arbeitete darum mit Hochdruck an einer Gesetzesvorlage, die den Einsatz außerirdischer Technologie unterbinden sollte.
Auch ein französischer Autokonzern hatte sich entschlossen, Alien-Technik zu verwenden, woraufhin die USA ein generelles Import-Verbot für sämtliche europäischen Automobile verhängte. Die Hoffnung von Präsident Alistair Renton war, dass die betroffenen „unschuldigen“ Konzerne den „Verräter“ bestrafen würden. Doch es gab kein EU-Recht auf dessen Basis das möglich gewesen wäre.
Für Phillip Reimbacher – wie für viele andere Staatsoberhäupter – stellten die demokratischen Systeme in dieser Zeit hauptsächlich Hürden dar, die der Wandel der Zeit eigentlich nicht mehr zulassen durfte. Er war gebunden an Anhörungen und komplexe Gesetzgebungsverfahren, die der dramatischen Schnelllebigkeit nicht mehr gerecht wurden. Immer wieder drängten ihn Britta Starke und ihre Hintermänner, die Sonderbefugnisse der Regierung auszuweiten oder sogar das Kriegsrecht zu verhängen, so wie es Amerika bereits getan hatte.
Die zerstörerische Seuche spielte den Anti-Demokraten in die Hände. Auf dem Höhepunkt starben zu viele Menschen, darunter auch Regierungsangehörige, so dass das System sowieso nicht mehr aufrechterhalten werden konnte.
Als erstes kippten in Deutschland die Landesregierungen. Die Landräte und Bürgermeister bekamen mehr Befugnisse und unterstanden direkt dem Bund. Bayern protestierte erwartungsgemäß und drohte mit dem Durchsetzen staatlicher Souveränität. Reimbacher erstickte den Aufstand und setzte Leute aus seinem Dunstkreis in die entscheidenden Positionen. Als nächstes fielen der Bundesrat und verschiedene gesetzgebende Institutionen, deren Aufgaben ebenfalls auf die sich immer weiter verschlankende Regierung überging. „Alles aus einer Hand für kurze Wege und schnelle Entscheidungen“ lautete Reimbachers Devise. Die Polizei bekam eine übergeordnete Behörde zur Verfolgung anti-menschlicher Verbrechen. Dazu zählte auch die Verletzung der Kennzeichnungspflicht für Außerirdische. Wenn sie nicht gerade ihre außergewöhnlichen Augen zeigten, waren sie nicht von Menschen zu unterscheiden.
Da sie jedoch die Erfahrung gemacht hatten, dass die Kennzeichnung zu Diskriminierung und sogar Gewalt führte, verzichteten sie darauf. Wer als Fremder ohne entsprechende Armbinde erwischt wurde, musste mit einer Haftstrafe rechnen.
Das Gesetz galt in den meisten Ländern und führte wiederum zu einer Überfüllung der Gefängnisse. In Amerika trat dieses Problem zuerst auf. Renton löste es mit einer General-Amnestie für alle Insassen, wenn sie sich zu ihrer Regierung bekannten und ihre wiedergewonnene Freiheit dem Kampf gegen die außerirdischen Invasoren widmeten. Dadurch konnte er sich auf eine wütende Meute hungriger Schakale verlassen, die bereit war, sich über alle Gesetze hinwegzusetzen, um ihre aufgestauten Aggressionen jetzt an „legitimen Zielen“ auszulassen.
Viele Regierungen setzten zudem auf weitere „Anreize“ für Menschen, die bereit waren, das „Richtige“ zu tun. Urlaubsreisen, Geschenke und Sonderbehandlungen für Denunzianten oder Gewalttäter, die sich gegen Fremde wandten.
Die finanziellen Mittel waren da...
Durch das Massensterben gab es auch weniger Menschen, die Anspruch auf eine Erbschaft hatten. Per Gesetz hatten sich die meisten Staaten in die Lage versetzt, diese „herrenlosen“ Privatvermögen unbürokratisch einzuziehen, um sie für den „Kampf um die Menschlichkeit“ einzusetzen. Und selbst legitime Erbschaftsansprüche konnten per Gesetz für ungültig erklärt werden, wenn die Erbmasse als „systemrelevant“ eingestuft wurde.
Die Staaten zogen ein, was sie konnten und finanzierten damit den Kampf gegen die Fremden.
Auch auf der anderen Seite waren die finanziellen Mittel unbegrenzt. Schnell hatten die Fremden erkannt, dass sie das System am besten bekämpften, wenn sie es überfütterten. Sie überschwemmten den Geldmarkt mit Hilfen für ihre Anhänger, dass die Zentralbanken schon bald den Überblick verloren. Niemand wusste, wie viel Geld im Umlauf war und welchen realen Gegenwert es noch hatte.
Geld verlor zunehmend an Bedeutung.
Durch das Massensterben gab es weniger Produkte zu kaufen. Ganze Wirtschaftszweige verschwanden und andere blühten. Dazu gehörten die Produzenten der essenziellen Dinge: Lebensmittel rückten wieder in den Fokus der Begehrlichkeiten. Es gab keine Überfälle mehr auf Juweliere, dafür auf Bäckereien und Schlachthöfe.
Das Handwerk hingegen hatte in einer Krise erstmals das Nachsehen. Es gab zu viele Möbel und zu viele leer stehende Immobilien, als dass es sich in dieser Krise eine goldene Nase hätte verdienen können. Eine logische Konsequenz war die Forderung nach einem globalen Rettungsschirm mit enormen Ausgleichszahlungen. Die Regierungen ignorierten die Drohgebärden und verwiesen auf die Eigenverantwortlichkeit.
Was ebenfalls verschwand waren große Teile der Online-Communitys. Für Influencer und Blogger hatte niemand mehr Zeit, wenn es ums Überleben ging. Statt Beauty-Tipps gingen Tutorien über das Brotbacken und Suppekochen viral. Viele gerade junge Menschen, die ihre Existenz ausschließlich auf ihre relative Internet-Berühmtheit bauten, stürzten in Depressionen, die bis zum Suizid gingen. Nicht wenige inszenierten ihren Selbstmord sogar online, in der Hoffnung auf eine letzte, große „Like“-Welle. Auch wenn sie selbst nichts mehr davon hatten...
Wer sich in psychotherapeutische Behandlung begeben musste, konnte sich in den meisten Fällen aber staatlicher Unterstützung sicher sein. Denn noch immer hatten die Regierenden nicht ihren Glauben an die Wichtigkeit der Online-Stars und deren Rückkehr verloren.
Die Gesetzlosigkeit, die sich unter den mächtiger werdenden Regierungen ausbreitete, griff auch auf die Menschen über. Gewalt gegen Außerirdische war nicht nur geduldet, sondern sogar gern gesehen. Aber wer wollte auf den ersten Blick feststellen, wer ein Fremder war und wer nicht? Einbrüche, Überfälle, Vergewaltigungen und sogar Hinrichtungen gehörten zum Alltag und wurden von den Behörden lediglich zur Kenntnis genommen. Um jeder Tat nachzugehen, fehlte längst das Personal. Und was verblieben war, musste für den „großen Kampf“ zusammengezogen werden. Was auf den Straßen im Einzelnen passierte, wurde dem überlassen, was von der Gesellschaft noch übrig geblieben war.
Die Regierungen hatten die Maske der Zivilisation von den Gesichtern der Menschen gerissen und blickten nun in die hässlichen Fratzen dahinter. Es gab nomadenhafte Gruppen, die von Haus zu Haus zogen, sich überall niederließen, die Einrichtungen zerstörten, das Essen stahlen und ein Schlachtfeld hinterließen. Der Kampf um Nahrungsmittel wurde von den Regierungen immer noch nicht ernst genommen. „Das ist doch nur Essen“... Und sie verkannten lange, welche wachsende Bedeutung die Nahrung bekam.
In den Schulen wurden die Lehrpläne der veränderten Bevölkerungsstruktur angepasst. Die Gefahren einer Außerirdischen Invasion hatte in allen Fächern Einzug gehalten, sei es in Geschichte oder in Biologie. Es galt, den Nachwuchs möglichst früh und möglichst umfassend zu prägen und im Sinne des Überlebens der menschlichen Spezies zu prägen.
Und obwohl alle Regierungen ähnliche Ziele mit ähnlichen Mitteln verfolgten, nahm die Internationale Zusammenarbeit im Lauf der ersten Jahre kontinuierlich ab. Handelsbeziehungen verloren ihre Bedeutung, denn jedes Land kämpfte um sein eigenes Überleben und es war keine Zeit für Abkommen oder Geschäftsabschlüsse. Jedes Land versuchte für sich, die Bedürfnisse seiner verbliebenen Bevölkerung zu befriedigen. Und die verlagerten sich immer stärker auf das, was essenziell zum Überleben notwendig war. Abgesehen von wenigen Ausnahmen verschwanden Kultur und Unterhaltungselektronik. Die Menschen mussten lernen, über mehrere Jahre mit einem Laptop oder einem einzigen Smartphone auszukommen. Viele verzweifelten darüber, wurden gewalttätig oder depressiv. Auch wenn sich die Masse der Online-Medien dramatisch ausdünnte, gewannen die übriggebliebenen an Bedeutung und wurden für Medienkonsumenten zum letzten Ankerpunkt. Das erleichterte es den Regierungen wiederum, diese zu kontrollieren. Es fand eine Konzentration statt und das Verbliebene wurde gehütet, wie ein Schatz. Wer vorher vielleicht nur sporadisch Videos und Bilder postete und in der Masse untergegangen war, der gehörte jetzt zu den letzten verbliebenen Online-Helden, wurde verehrt und entdeckte seine Verantwortung und Aufgabe darin, die übrigen Menschen in einem noch größeren Umfang an seinem Leben teilhaben zu lassen.
Das globale Wirtschaftswachstum, das immer als Motor der Welt beschworen wurde und für dessen Erhalt dieser ganze Krieg begonnen hatte, verschwand, ohne dass es jemand bemerkte...
Damit hatten die Fremden ein wichtiges Ziel ihrer Mission erreicht – und die Menschen hatten sie ganz allein dorthin geführt.
Manche Regierungen schotteten sich unbewusst und zufällig von ihren Nachbarn ab. Andere setzten bewusst und massiv auf Territorialität.
So wie Alistair Renton. Der US-Präsident war überzeugt davon, dass Amerika aus sich heraus überleben würde. Dass das Amerikanische Volk nach wie vor alles besäße und auf niemanden angewiesen sei. Als erstes machte er die Grenzen zu Südamerika dicht, wo das Regenwaldfieber ausgebrochen war und am stärksten wütete. Ganze Städte und Landstriche wurden entvölkert. Renton ließ die Krankheit ihre Arbeit machen und wartete geduldig darauf, im Anschluss Besitzansprüche anmelden zu können. Von Südamerika aus breitete sich die Seuche auch auf die Küstenstaaten Afrikas aus und wütete unter der Bevölkerung. Kein Land blieb verschont. Manche traf es härter, andere weniger.
Auch in Asien starben Millionen Menschen. Durch die extrem hohe Bevölkerungsdichte hatten die Viren gute Chancen, sich zu verbreiten. Medizinische Versorgung gab es nur für „systemrelevante Bevölkerungsgruppen“ und natürlich für die politischen und wirtschaftlichen Eliten. Als die Menschen in Massen starben, wuchs die Wut von Chinas Präsident Ning Sun auf die Außerirdischen erneut und er startete einen weiteren, massiven Raketenangriff auf die Station in Yunnan. Als auch dieser ohne Ergebnis blieb, entschied er sich, das Objekt einzumauern. Er übergoss es mit Massen von flüssigem Stahlbeton, bis es darunter verschwunden war. Jetzt musste Ning Sun es nicht mehr sehen – aber er wusste, dass es noch da war.
Die meisten Staatschefs rissen größere Kontrolle an sich, hebelten Oppositionen und Gewaltenteilung aus und beriefen sich auf Notstandsgesetze. Alistair Renton ließ sogar an einer neuen Version der Verfassung arbeiten. Er schlug sich schon lange nicht mehr mit einem Parlament oder Abgeordneten herum. Er war der Präsident und es gab die Gouverneure und Minister, die ihm unterstanden. Mehr Politik war seiner Ansicht nach nicht nötig. Und mehr Politiker waren in den meisten Regierungen auch nicht mehr am Leben...
Anfang des dritten Jahres wurden die Fremden in zahlreichen Ländern zu Staatsfeinden erklärt, was die Jagd auf sie noch massiver machte und gleichzeitig den Mord an ihnen legitimierte. Es bestand noch immer ein reger und vielleicht sogar intensiverer Austausch zwischen den Staatsoberhäuptern. Denn auch wenn die Handelsbeziehungen weitgehend zusammengebrochen waren, war doch jeder daran interessiert zu erfahren, was sein Nachbar tat. Sei es, um die eigenen Handlungsgrenzen entsprechend zu erweitern oder um zu erfahren, wo sich ein System destabilisierte, um dann selber die Scherben und Überbleibsel aufzusammeln oder möglicherweise sogar unbewachte Bodenschätze auszubeuten und Technologien und Rohstoffe zu stehlen. Jeder schielte auf den anderen und schottete sich gleichzeitig so gut wie möglich selber ab.
Russland hatte diese Chance nicht.
Nach der Ermordung von Präsident Fjodor Kusmin war das Land weiter zerfallen. Warlords und Lokalfürsten stritten um Macht und Einfluss. Sie teilten Flächen, Dörfer, Regionen und Städte untereinander auf, kontrollierten die Bevölkerung und riefen ihre Souveränität aus. Der Großraum Moskau wurde abgeriegelt, um Menschen und Regierung zu schützen. Auch wenn die übrigen Regionen die ehemalige Hauptstadt als solche nicht mehr anerkannten, galt sie noch immer als Zentrum Russlands und als Symbol für die Macht.
Nach Kusmins Tod kehrten sein ehemaliger Privatsekretär Danilo Iljin und der Botschafter der Fremden, Semjon Lasarew, zurück. Iljin wurde vor allem von den bisherigen Regime-Gegnern stürmisch begrüßt. Er hatte in seinem Video die Machenschaften des Präsidenten enthüllt und Lasarew rehabilitiert – wenn auch nicht freiwillig...
Die ehemaligen Kreml-Treuen wurden entlassen und eine Notstands-Regierung gegründet, die sich aus bisherigen Gegnern und Erneuerern zusammensetzte. Mit diesem kleinen Kreis an neuen Verbündeten erreichte Iljin die größtmögliche Akzeptanz und wurde zum Statthalter und Gouverneur von Moskau und Umgebung ernannt. Lasarew sollte ihm als Berater zur Seite stehen.
So war aus einem der größten Feinde der Fremden ein wertvoller Verbündeter geworden.
Dass Danilo Iljin nicht mit Überzeugung hinter seiner neuen Aufgabe stand, war unwichtig. Schließlich hatte er nie eine eigene Überzeugung besessen. Und er wusste, dass dies der beste Job war, den er bekommen konnte. Wahrscheinlich sogar die einzige Chance, sein Leben zu retten. In den zweieinhalb Jahren seit dem Ausbruch der Seuchen hatte sich die Welt grundlegend verändert – auch wenn es Kräfte gab, die das nach wie vor leugneten.
Die Triebfedern der alten Welt waren immer noch aktiv und versuchten um jeden Preis zu retten, was nicht mehr zu retten war.
Wer in früheren Zeiten große Vermögen angehäuft hatte, setzte sie jetzt ein, um die Vergangenheit nicht sterben zu lassen – statt sie in den Dienst der neuen Welt zu stellen.
Profiteure der umwälzenden Veränderungen waren Menschen wie der amerikanische Waffenfabrikant Gerald Conway, der zahlreiche kleinere Unternehmen aufkaufte und sein Imperium immer weiter expandieren ließ.
Auch der ehemalige Geschäftsführende Vorstand eines Automobilkonzerns, Stefan Langner, diversifizierte sein Investment-Portfolio. Von einer entlegenen Hazienda in Venezuela, nahe der brasilianischen Grenze, schob er Unternehmen und Politiker nach wie vor wie Schachfiguren, um aus seinen Zügen den maximalen Gewinn zu schöpfen.
Als das brasilianische Holzunternehmen Rainwood nach dem Ausbruch des Regenwaldfiebers finanziell am Boden lag, erkannte Langner die Gunst der Stunde und kaufte massenhaft Anteile. Zusammen mit den Aktienkäufen von weiteren Strohfirmen wurde er zu einem der Hauptaktionäre und führte das Unternehmen in eine neue, ertragreichere Richtung: Die Rüstungsindustrie. Holz wurde im Krieg immer gebraucht. Um Maschinen zu befeuern, um Transportwege herzustellen oder sogar als Teil der Waffe selbst.
Gleichzeitig bot er der gebeutelten und kopflosen Regierung Brasiliens erhebliche Summen, um weitere Abholzungsrechte am tropischen Regenwald zu erwerben. Nicht mehr lange, und Rainwood wäre wieder ganz oben – und er ebenfalls.
Stefan Langner hätte sehr zufrieden sein können, hätte er nicht eine „Laus im Pelz“ gehabt. Ferdinand Braunbichler, Sohn seines ehemaligen PR-Managers Josef Braunbichler, hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Fremden im Alleingang zu bekämpfen. Und ein irriger Glaube suggerierte ihm, dass Langner auf seiner Seite stand. Er hatte sich seit dem Tod seines Vaters eine wilde kleine Miliz von Söldnern und Kopfgeldjägern aufgebaut, die er jedem zur Verfügung stellte, der sich mit Anschlägen gegen die Außerirdischen nicht selber die Hände schmutzig machen wollte.
Obwohl er ein unüberschaubares Vermögen von seinem Vater vererbt bekommen hatte und mit seinen Schlägern ebenfalls Geld verdiente, musste Langner ihn unterstützen. Ferdinand sah darin weniger eine finanzielle Notwendigkeit, als ein Bekenntnis. Und weil er eine Menge kompromittierender Unterlagen über Langner und seine Verbindungen besaß, war dieser gezwungen, ihm nachzugeben.
Doch auch auf der Seite der Fremden kämpften Menschen unermüdlich für eine neue, gesündere Welt. Mit Hilfe einer großen Finanzspritze war es gelungen in der Nähe von Berlin ein Forschungsinstitut einzurichten, in dem die Onkologin Ebru Turan und die Zoologin Yamila Jimenez eng mit den Außerirdischen zusammenarbeiteten. Sie studierten die Medizin der Fremden und gewannen wichtige Erkenntnisse über den Verlauf von Krankheiten und die Möglichkeiten, diese zu bekämpfen.
Für Yamila Jimenez ging es auch darum, die Veränderungen in der Welt in ihren Auswirkungen auf Tiere zu untersuchen. In den eigenen Medien des Widerstands und in denen, die sich nicht den Regierungen verschrieben hatten, klärte sie über Bedrohungen auf, die auch die Menschen betreffen konnten. Sie war eine der ersten, die mit dem Regenwald-Fieber in Berührung gekommen war und es dank einer natürlichen Immunität intensiv untersuchen konnte. Und sie war sicher: In den verborgenen Regionen Südamerikas und Asiens lauerten noch mehr Viren, die sie nicht kannten, und die in der Lage waren, die Menschheit weiter zu dezimieren.
Beide Wissenschaftlerinnen standen unter ständiger Bewachung, denn sie waren öffentliche Ziele der Alien-Kritiker. Ihre Argumentationsketten waren schlüssig und belegbar, die Art ihrer Präsentation traf einen Nerv und stellte die „Experten“ der Regierungen oft genug in den Schatten.
Überhaupt musste der Widerstand in ständiger Angst vor Entdeckung und Anschlägen leben.
Sie in Deutschland zu vereiteln gehörte zu den Aufgaben von Saskia Gauers. Die ehemalige Regierungsbeamtin war nach der Absetzung von Bundeskanzlerin Hartkamp ebenfalls entlassen worden und hatte eine private Sicherheitsfirma gegründet, die sich nach und nach auf den Schutz des Widerstandes spezialisiert hatte.
Eine Aufgabe, die ihr täglich alles abverlangte. Die Ressourcen und Befugnisse der Regierung waren groß und reichten weit.
Während die Menschen selbst mit viel Energie die Welt und ihren eigenen Lebensraum veränderten, leistete die Natur auch ihren Beitrag.
Gewaltige Tsunamis hatten in den letzten Jahren ganze Inselgruppen von den Landkarten gespült. Die fortschreitende Gletscherschmelze sorgte für einen schleichenden Anstieg des Meeresspiegels, dem die Menschen mit höheren Deichen oder Umzügen ins Landesinnere begegneten. Das Versiegen des Golfstroms brachte einen Wetterstillstand mit sich. Hitze- und Dürreperioden hielten sich länger, die Meere kippten weiter und brachten immer weniger Leben hervor. Und die dezimierten Regenwälder produzierten mehr CO2 als sie binden konnten. Gleichzeitig tauten in der russischen Tundra und in anderen Gegenden fast unbemerkt die Permafrostböden auf und stießen mehr des tödlichen Gases aus, das über Jahrmillionen im Eis gebunden war.