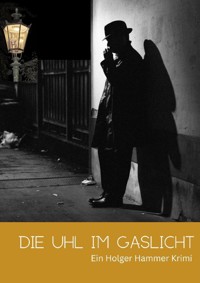Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwanzig Jahre sind vergangenen, seit die fremden Wesen auf der Erde erschienen, um den Planeten zu retten. Weil die Menschen aber lieber an ihren Gewohnheiten festhielten, statt die Hilfe anzunehmen, haben Kriege und Seuchen den größten Teil der Bevölkerung ausgerottet. Die Überlebenden arbeiten mit den Fremden Hand in Hand, um die Erde wieder aufzubauen. Doch es gibt noch immer Strömungen, die am Alten festzuhalten versuchen. Die Machthaber von früher träumen davon, die Welt wieder zu dem Ort zu machen, der er einmal war. In der festen Überzeugung das Richtige zu tun, formieren sie sich, um die Fremden und ihre Einflüsse ein für alle Male zu vertreiben. Und so bäumt sich die untergegangene Zivilisation ein letztes Mal auf, um die Welt zurück in die alten Strukturen zu zwingen. In diesem finalen Kampf wird sich zeigen, ob der Rest der überlebenden Menschheit sich nach den Katastrophen weit genug entwickelt hat, um endlich Verantwortung für die Erde zu übernehmen. "Auferstehung" ist der fünfte Teil und das große Finale des Romanzyklus "Menschendämmerung".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kapitel 1: Weckruf
„Erzähl uns mehr von früher!“
„Ja, wie war das, als es noch mehr Menschen gab?“
„Haben die sich wirklich nicht um den Planeten gekümmert?“
„Warum haben sie nicht aufgehört, alles kaputt zu machen?“
Der Mann mit dem dichten grauen Haar lächelte und sah in die fragenden Gesichter der Kinder und Jugendlichen um sich herum.
Er seufzte und strich sich über den gestutzten Vollbart.
„Das sind eine Menge Fragen. Und es sind sehr kluge Fragen...“
Der Blick seines gesunden Auges blieb auf einem etwa dreizehnjährigen Mädchen haften, das mit trauriger Stimme die letzte Frage gestellt hatte.
„Ich denke, es hatte viele Gründe. Zum einen wollten die Menschen nicht glauben, dass sie tatsächlich etwas kaputtmachten...“
„Aber sie konnten es doch sehen. Das Eis, das es früher einmal gab. Die Wälder, die Tiere, die verschwunden sind. Das ist doch alles nicht von einem Tag auf den anderen passiert...“
„Natürlich nicht. Und das ist einer der Gründe, warum sie es nicht glauben wollten. Was nicht unmittelbar passiert, passiert vielleicht gar nicht...“
„Warum dieser Selbstbetrug?“, wollte ein 15-Jähriger wissen.
Der Mann hob die Schultern. „Weil es bequem ist. Und die Menschen lieben es bequem. Sie wollen nicht aus ihrer Gewohnheit heraus. Damals nannten sie es Komfortzone – und sie liebten diesen Bereich ihres Lebens. Vor dem Zusammenbruch der alten Welt waren die Menschen oftmals getrieben. Sie hatten sich von der Realität entfernt und lebten in einer virtuellen Welt aus Digitalität und kompletter Vernetzung. In dieser Welt ging es vor allem um Schnelligkeit. Die Menschen waren gehetzt, obwohl es keinen realen Zwang dafür gab. Es war nicht so, dass sie hätten Hunger leiden müssen.. Oder kein Dach mehr über dem Kopf gehabt hätten. Jedenfalls nicht die Menschen in den sogenannten Industrienationen. Die Bewegung in der irrealen, digitalen Welt gab ihnen aber das Gefühl, ETWAS zu tun. Die meisten hatten verlernt, sich durch bestimmte Fertigkeiten oder durch Wissen selber zu erfahren. Sie konnten nicht einmal mehr die einfachsten Mahlzeiten für sich zubereiten. Hatten keinerlei Kontakt mehr zu ihrer Umwelt oder zu anderen Menschen. Ihr Leben fand am Bildschirm statt. Dort entstanden irreale Notwendigkeiten und Abhängigkeiten von ausgedachten Umständen.“
Der Mann sah, dass der Ausdruck auf den Gesichtern fragend wurde.
Er seufzte. „Stellt euch vor, ihr wüsstet nicht mehr, wie Getreide angebaut oder eine Kuh gemolken wird. Alles ist einfach immer da, darum kümmert sich schon irgendwer. Was macht ihr den ganzen Tag? Ihr denkt euch Spiele aus, in denen ihr gegeneinander antretet. Und jeder hat seine eigenen Regeln. Und ihr habt nichts anderes zu tun, als diese Spiele zu gewinnen. Irgendwann werden sie zu eurem einzigen Inhalt. Denn das, was wirklich zählt – ist selbstverständlich.“
„Das heißt, die Menschen haben nur noch gespielt?“
Der Mann wiegte den Kopf. „So in etwa. Sie haben Videos gedreht, anderen ihre Fotos gezeigt und wieder anderen beim Auspacken ihrer Post oder dem Haarekämmen zugesehen.“
„Warum?“, fragte ein Mädchen irritiert.
Der Mann hob die Schultern. „Das weiß niemand. Und weil in dieser unwirklichen Welt ständig etwas Neues entstand und jeder überall dabei sein musste, waren die Menschen oft... ausgebrannt. Sie fühlten sich gehetzt und sehnten sich nach Ruhe. Darum wollten sie nichts von der wirklichen Welt wissen. Denn das hätte ihnen auch noch das Gefühl gegeben, etwas tun zu müssen. Das könnte ein Grund sein, weshalb sie bis zuletzt leugneten, dass der Planet vor die Hunde ging. Vielleicht war es ihnen auch egal, denn sie hatten sich ja schon von ihm entfremdet.“
„Aber sie brauchten doch die Luft zum Atmen, und das Wasser und das Essen.“
Der Mann lächelte. „Sicher, aber das wussten sie schon nicht mehr. All das war immer da. Und sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass es einmal nicht mehr da sein würde.“
„Nicht alle waren blind und dumm“, warf der 15-Jährige ein.
„Das stimmt. Es gab Menschen, die wussten, was passierte und die auch Ideen hatten, etwas zu verändern.“
„Und warum haben sie es nicht getan?“
„Weil die, die keine Veränderung wollten, stärker waren.“
„Wie kann jemand keine Veränderung wollen, wenn die Alternative in die Katastrophe führt?“
„Diesen Menschen waren andere Dinge wichtiger – Einfluss, Geld, Wohlstand.“
„Aber was nützt das, wenn der Planet stirbt?“
„Da sind wir wieder bei den unmittelbaren Folgen. Warum sollte ich etwas aufgeben, das ich als schön und gut empfinde, solange ich nicht spüre, dass das Festhalten daran schädlich ist? Und selbst wenn ich es spüre: Ich will nicht loslassen. Es fühlt sich für mich einfach zu gut an. Wird schon nicht so schlimm werden. Sie erfanden Ausreden. Nehmen wir das Beispiel der sogenannten Energiewende von damals. Sicher habt ihr davon gehört. Die Menschen beuteten die Erde aus, um es warm zu haben und genügend Strom für ihre Geräte. Dazu verwendeten sie etwas, das Öl und Kohle hieß. Es kam aus dem Boden, und die Gewinnung dieser Stoffe setzte giftige Gase frei, genau wie ihre Verwendung. Einige Menschen kamen damals auf die Idee, Energie aus der Luft oder der Sonne zu ziehen. Doch diese Initiativen wurden ausgebremst.“
„Wieso, wenn es doch richtig war?“
„Es gab einflussreiche Personen, die mit Öl und Kohle Geld verdienten. Sie sagten zum Beispiel, dass andere Quellen nie genug liefern könnten, um den Bedarf zu decken. Die Menschen fürchteten, sich einschränken zu müssen und waren darum dagegen. Genauso bei den alten Autos. Damals sollten Fahrzeuge auf den Markt kommen, die mit Strom betrieben wurden. Die Gegner sagten, dass die Batterien genauso die Umwelt verschmutzen würden und der Strombedarf noch mehr steigen würde. Sowas hörten die Menschen gerne, denn es beruhigte ihr Gewissen. Sie mussten sich nicht mehr schlecht fühlen, an alten Gewohnheiten festzuhalten, wenn neue Ideen anscheinend auch nicht besser waren. Wie gesagt, sie liebten es, bequem zu sein. Andere Energiequellen zu nutzen, bedeutete vielleicht auch, Dinge am eigenen Haus umzubauen, sich um etwas kümmern zu müssen. Das war den meisten einfach zu lästig, denn sie waren zu sehr mit ihrem Leben im Internet beschäftigt. Also glaubten sie jede Ausrede, die ihnen angeboten wurde. Sätze wie Bringt doch eh alles nichts waren sehr beliebt damals. Genau wie mit den Fingern auf andere zu zeigen, die gefälligst selbst erstmal anfangen sollten, etwas zu verändern, bevor ich es selber tue.“
„Stimmt es, dass die Leute sich früher Videos angesehen haben, in denen überhaupt nichts passiert ist?“, fragte ein Junge ungläubig.
„Wie gesagt: Viele Menschen haben sich Filme angesehen, in denen andere ihre Post auspacken, oder sich die Haare kämmen. Das war wichtiger, als sich um den eigenen Anteil zur Rettung der Welt zu kümmern.“
Er sah die Betroffenheit auf den Gesichtern seiner Zuhörer und wusste, dass sie sich schämten, ein Mensch zu sein und Angst davor hatten, dieselben Fehler ebenfalls zu begehen. Und er hoffte, dass diese Angst nie ganz verschwand. Denn sie war eine Versicherung dafür, es in Zukunft anders zu machen.
Dennoch lächelte er nachsichtig. „Dazu müssen wir aber auch anerkennen, dass mit dem Verlust praktischer Fähigkeiten auch ein intellektueller Verlust einhergegangen ist. Weil die meisten Tätigkeiten, die die Menschen ausführten, immer die gleichen waren, verlernten sie das Lernen. Der Geist verkümmerte und viele waren nicht mehr in der Lage, Dinge zu begreifen oder zu durchschauen. Manche arbeiteten gar nicht mehr, lebten von dem, was der Staat ihnen gab und waren zufrieden. Und das gaben sie an ihre Kinder weiter, die oft sehr zahlreich waren. So wuchsen gleich mehrere Generationen heran, die einfache Dinge nicht mehr begreifen konnten. Die auch nicht mehr lesen und richtig schreiben konnten. Und damit meine ich nicht Menschen in den Ländern, die damals die Dritte Welt hießen. Sondern in Amerika, in Zentral-Europa – in Ländern, in denen es die Möglichkeit für eine gute Bildung gab. Aber das interessierte damals viele nicht.“
„Warum haben sich die Menschen nicht zusammengetan, um etwas zu bewegen?“
Der alte Mann seufzte und dachte an eine Zeit zurück, als die Menschen sich tatsächlich noch zusammentaten und gemeinsam sogar Kriege beenden konnten.
„Es gab keine Gemeinsamkeit mehr“, erklärte er schließlich. „Damals spielte der sogenannte Individualismus eine große Rolle, die sogenannte singuläre Gesellschaft.“
„Was bedeutet das?“, fragte ein junges Mädchen.
„Das bedeutet, dass jeder alles machen kann, darf und soll, was er selber möchte. Dass für ihn nur seine eigenen Wünsche zählen. Und obwohl die Welt zwar vernetzt war, gab es nichts Verbindendes mehr.“
„Klingt nach einem Widerspruch“, sagte eine 16-Jährige.
Der Mann lächelte. „Ist es aber nicht. Die Welt damals war virtuell und sie war schnell. Jeder wollte überall sein und alles sehen. Aber sich nicht mehr die Zeit nehmen, zu verstehen. Jeder hatte seine eigenen Vorlieben und es war fast schon abstoßend, etwas zu mögen, was jemand anderes auch mochte. Nur Individualismus, keine Aufmerksamkeit im Netz. Originalität zählte, auch wenn sie nicht originell war. Darum gab es nichts mehr, was die Menschen wirklich verband. Keine gemeinsamen Ziele, keine gemeinsamen Anschauungen. Klar, wurde alles geteilt und gelikt... Aber es verging so schnell wieder, wie es gekommen war. Und weil die Menschen sich nicht mehr trafen, um sich auszutauschen, gab es auch keine gemeinsamen Ziele mehr. Und auch keine Auseinandersetzung. Sie redeten in der Sicherheit ihrer Bildschirme, wo sie sich jederzeit wegducken konnten, wenn es unbequem wurde. Oder wenn jemand etwas sagte, das den eigenen Anschauungen nicht entsprach. Sie verlernten es, Fremdes anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen. Und sie verlernten es auch, weil das Internet ihnen nur die Dinge zeigte, die zu ihnen passten.“
„Aber warum?“
„Weil damit Geld zu verdienen war. Die Zeit, die ein Mensch auf einer Webseite verbrachte, war ein Wert für Unternehmen. Und auf welchen Seiten verbrachten die Menschen wohl ihre Zeit? Auf denen, die sie kannten und die ihnen angenehm waren. Denkt an die Komfortzonen.“
„Und dennoch waren sie gehetzt?“
Der Mann nickte. „Sie mussten ja viele Seiten besuchen und sie mit eigenen Beiträgen bedienen.“
„Klingt nicht nach einem erfüllten Leben...“
„Für die Menschen war es das. Und darum fanden sie nicht zusammen. Es gab keine gemeinsame Identität mehr, die eine Bewegung vorausgesetzt hätte. Nur noch eine schier unüberschaubare Anzahl von Individuen. Und diese Nebelkerze des Individualismus war auch gewollt. Denn so konnten andere in Ruhe und ungestört über die Geschicke des Planeten bestimmen.“
„Warst du genauso?“, fragte der 15-Jährige.
Der Mann senkte den Blick. „Ja, ich war ein Teil des Systems. Auch ich habe nur an mich gedacht. Selbst als die Fremden kamen und uns den Spiegel vor Augen hielten. Ich habe aber gelernt. Und darum geht es. Nicht festzuhalten um des Festhaltens willen. Sondern zu erkennen. Und sich zu trauen, Fehler einzugestehen und sie zu korrigieren.“
„Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.“
Von den rund 20 Zuhörern hatte kaum jemand die Frau bemerkt, die den großen, runden Raum betreten hatte. Sie hatte volles, dunkles Haar mit einigen grauen Strähnen darin, eine kräftige, sinnliche Figur und leuchtende, dunkle Augen. Als sie in die Runde lächelte, zeichneten sich kleine Falten in ihrem Gesicht ab.
„Raus mit euch, der Unterricht ist beendet.“
Die Kinder packten ihre Sachen zusammen und verließen das kuppelartige Gebäude, dessen rundes Dach transparent war.
Auch der Mann erhob sich und trat mit der Frau vor die Tür. Von dem sandfarbenen Gebäude gab es noch mehr auf dem Gelände. Dazwischen alte Farmhäuser, die kaum noch bewohnt waren und hauptsächlich dem Geschichtsunterricht dienten.
Es war ein milder Frühlingsnachmittag im Mai.
Die Frau hakte sich bei dem Mann unter und blinzelte in die Sonne. „Es ist immer noch wie ein Traum, oder?“
Der Mann nickte und kniff das noch sehende Auge zusammen.
„Ja, Jasmine. Es ist eine neue Welt – jeden Tag wieder.“
Dann drehte Preston Vale den Kopf und sah die Lehrerin mit einer Mischung aus Erleichterung und Traurigkeit an. „Aber es gibt immer noch viel zu tun.“
*
Als das Fahrrad die schmale Straße ins Dorf hinunterrauschte, kühlte der Fahrtwind ihr Gesicht und ein verträumtes Lächeln legte sich auf ihre Lippen.
Sie sog die kühle Luft tief in ihre Lungen und genoss die Geräusche der Natur um sich herum. Die Welt gehörte ihr und sie war der letzte Mensch auf ihr. Das leichte Ruckeln durch die Schlaglöcher machte ihr nichts aus. Sie hielt den Lenker fest und ließ die Räder rollen, während die Geschwindigkeit immer mehr zunahm. Am Fuß des Hügels musste das Dorf liegen. Nur noch ein paar hundert Meter und sie hatte ein weiteres Etappenziel auf ihrer Reise erreicht. Sie hatte es nicht eilig, ans Ziel zu kommen. Es war das erste Mal, dass sie das kleine Dorf im County Kildare verlassen hatte. Und gleich ihre erste Reise sollte sie bis in die Nähe von London führen.
Die Veränderungen in der Welt hatte Roisin Fagan nur aus der Ferne beobachtet. Als die Fremden landeten, war sie noch ein Kind und hatte die Aufregung nicht verstanden. Die folgende Gewalt, die politischen Verwicklungen und die Umwälzungen auf der Erde kannte sie nur aus dem Fernsehen und den Medien. In ihrem kleinen Dorf war die Welt immer so geblieben, wie ihre Eltern sie kannten. Und wäre es nach ihnen gegangen, dann wäre es auch heute noch so. Obwohl das Massensterben durch die Seuchen sie nur am Rand gestreift hatte, machten die Veränderungen der Welt irgendwann keinen Halt mehr vor dem kleinen Ort im irischen County Kildare.
Viele ihrer Nachbarn waren fortgezogen oder gestorben und Roisin wuchs fast allein auf. Eine Handvoll weiterer Kinder war dem Dorf geblieben, ihr letzter Freund war vor zwei Jahren gegangen. Danach war sie allein und sorgte für ihre Eltern.
Doch jetzt waren auch sie tot und es hatte nichts mehr gegeben, was Roisin gehalten hätte. Sie hatte zusammengepackt, was sie brauchte, sich auf ihr altes Fahrrad gesetzt und war losgefahren. Dorthin, wo die Welt sich wirklich verändert hatte.
Sie hatte gesehen, wie die Fremden nach der letzten großen Seuche mit der Neustrukturierung auf dem Planeten begonnen hatten. Wo es keine Menschen mehr gab, waren die Reste der Zivilisation beseitigt worden. Sie hatten die Möglichkeit, ganze Städte zu zersetzen und Straßen vom Erdboden verschwinden zu lassen. Sie stellten die ursprüngliche Natur wieder her und bauten aus den gewonnenen Rohstoffen diese neuen Behausungen. Kuppelbauten mit durchsichtigen Dächern, die sich selbst dem Wetter anpassten. Sich im Winter aufheizen und im Sommer Wärme absorbieren und speichern konnten. Ein Material, das tatsächlich aus den Stoffen auf der Erde gewonnen wurde. Es gab bisher nur wenige Kommunen weltweit, die so aufgebaut waren. Eine davon sollte es sogar im Südosten von England geben, in der Nähe einer kleinen Hafenstadt, die damals überschwemmt worden war. Sie war eine der ersten, die auf diese Weise entstanden war.
Dort wo viele Menschen überlebt hatten, gab es noch die alten Häuser und die alten Straßen. Auch wenn die Autos nicht mehr mit Benzin fuhren, sondern mit den neuen Energiespendern der Fremden. Es war eine Zeit des Übergangs, und das schon seit vielen Jahren. Doch die Menschen brauchten eine lange Zeit der Anpassung, das hatte Roisin gelernt. Jetzt wollte sie das alles nicht nur am Fernseher und am Computer sehen, sie wollte es erleben, dabeisein! Ein Teil davon...
Sie wollte diese neuen Fortbewegungsmittel sehen. Schwebegleiter, die sich über dem Boden bewegten und keine Straße mehr brauchten. Sie wollte die Landwirtschaft kennenlernen, die so viele Menschen versorgen konnte, ohne den Planeten zu schädigen. Sie wollte die großen Wasseraufbereitungsanlagen sehen und beobachten, wie es den Fremden gelang, den Kreislauf der Natur wieder in Gang zu bringen. Und sie wollte die Fremden selber sehen – in ihrer ursprünglichen Form.
Zu lange hatte sie jenseits der neuen Realität in einer Blase der Vergangenheit gelebt. Jetzt, mit 24, wollte sie endlich ein Teil davon sein.
Als Roisin an all die Wunder dachte, die dort draußen auf sie warteten, trat sie noch einmal in die Pedale und beschleunigte die Abfahrt ihres Rades auf der schmalen Straße. Hinter der letzten Biegung sah sie dann die lange Gerade, die direkt ins Dorf führte. Die von Steinmauern begrenzte Asphaltspur weitete sich auf und mündete in eine von Häusern gesäumte Hauptstraße.
Roisin freute sich immer, wenn sie in ein Dorf kam. Hier fand sie auf ihrer mehr als 600 Kilometer langen Reise ein Dach über dem Kopf, meist sogar noch Strom und fließend Wasser und konnte sich ausruhen. Wenn es noch Menschen gab, dann waren dort auch immer helfende Hände gewesen, die sie unterstützten. Menschen waren auf ihrer Reise allerdings eine Seltenheit geworden - zumindest am Anfang. Doch je näher sie London kam, desto öfter traf sie auf andere. Sie hatte Towcester am Morgen hinter sich gelassen und näherte sich ihrem Ziel. Dort, in der Nähe der Hauptstadt sollte eine der gigantischen, ufoartigen Stationen der Fremden stehen, die nach der letzten Seuche in jedem Land aufgetaucht waren. Wie aus dem Nichts – so wie die ersten fünf damals.
Roisin gab noch einmal Gas und raste mit lautem Lachen an dem Ortsschild vorbei auf die Hauptstraße.
Es war nur ein kleiner Stein, der ihre Schussfahrt beendete. Der Vorderreifen streifte ihn, glitt daran ab und brachte das Fahrrad zum Schlingern. Wäre sie langsamer gewesen, wäre der Unfall sicher glimpflicher ausgegangen. So aber geriet das Rad aus der Spur, rutschte weg und schleuderte Roisin über die Straße, während es über den Asphalt schlitterte. Sie wusste für einen Moment nicht, wo oben und wo unten war und als sie endlich still lag, hatte sie für einen Augenblick das Gefühl, ihren Körper nicht mehr zu spüren. Doch dann meldete sich der Schmerz und gab ihr eindeutig zu verstehen, dass sie noch am Leben war.
Stöhnend erhob sich Roisin und blickte an sich herab. Die Jeans war zerrissen, die Ärmel ihrer Jacke aufgeschürft und ihr Gesicht brannte. Aber es schien nichts gebrochen zu sein. Glück im Unglück – was nicht auf ihr Fahrrad zutraf...
Es lag ein paar Meter weiter, das Vorderrad völlig verbogen, mehrere Speichen gebrochen. Da gab es nichts mehr zu reparieren.
„Shit“, fluchte Roisin und humpelte zu ihrem großen Rucksack, der den Sturz offenbar unbeschadet überstanden hatte, aber meterweit über die Straße gerollt war. Sie hob ihn auf und sah sich um. Erst jetzt stellte sie fest, dass kein Mensch auf der Straße zu sehen war. Sie ging zu ein paar Geschäften, doch die Türen waren verschlossen. Und wo sie offenstanden, war niemand im Innern. Ein Geisterort, wie so viele in diesen Tagen. Sie rief ein paar Mal, erhielt aber nie eine Antwort.
Die Erfahrung hatte gezeigt, dass, wenn ihr bei der Ankunft nicht jemand begegnete, auch niemand mehr kommen würde. Entweder lebten Menschen in größerer Anzahl in den Siedlungen oder sie waren ganz verlassen. Oder aber, die wenigen Bewohner versteckten sich vor Fremden...
Roisin seufzte und beschloss, das Beste aus der Situation zu machen. Sie wollte sich verarzten, ausruhen, etwas essen und sich dann auf die Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz machen. Die junge Frau steuerte eine Apotheke an, die schon lange verlassen war – so roch es auch im Innern. Doch ein Teil des Inventars war noch vorhanden und brauchbar. Sie wischte mit dem Ärmel einen stumpf gewordenen Spiegel hinter dem Tresen ab und betrachtete sich.
Roisin Fagan hatte sich nie für eine Schönheit gehalten. Ihr Gesicht war rund und flach. Sie hatte eine kleine Stupsnase, einen kleinen Mund, Sommersprossen und große, braune Augen. Dazu widerspenstiges, braunes Haar, das bis in ihre Stirn wuchs. Die helle Haut neigte dazu, bei Sonne schnell zu verbrennen und die Adern durchscheinen zu lassen. Auch an ihrem Körper konnte sie nichts Aufreizendes finden. Sie war nicht besonders groß, dafür schlank und drahtig. Ihre Brüste fand sie zu klein und ihre Hände zu groß. Aber es hatte ja auch keine Jungs gegeben, denen sie hätte gefallen müssen. Ein Mädchen zu sein, hatte im Dorf schon gereicht, um das Interesse zu wecken. Roisin hatte wie alle anderen auch ihre Erfahrungen gesammelt. Doch um Liebe war es dabei nur selten gegangen. Eher um Neugierde und Langeweile.
Sie knöpfte sich das zerrissene Hemd auf, das sie trug und wusch sich die Wunden sauber, bevor sie eine Heilsalbe auftrug und ein paar Pflaster platzierte. Das musste reichen. Als nächstes müsste sie sich um was zu Essen kümmern und vielleicht einen alten Klamottenladen finden, in dem sie sich was Neues zum Anziehen besorgen konnte.
Als sie wieder auf die Straße trat, sah sie den Wagen.
Ein alter Lieferwagen stand mitten auf der Fahrbahn, direkt vor ihrem kaputten Rad. Über das Wrack hatte sich ein Mann gebeugt, die Schirmmütze in den Nacken geschoben. Als Roisin sich vorsichtig näherte, hob er den Kopf.
Sie schätzte ihn auf Ende 50, ein raues, aber freundliches Gesicht, kräftige Statur. Er lächelte und deutete auf das Fahrrad.
„Deins?“
Roisin nickte und ging langsam näher. „War wohl etwas zu schnell unterwegs.“
Der Mann musterte sie unverhohlen, was ihr unangenehm war. „Wohin soll es denn gehen?“
„London.“
Er lachte heiser. „Was willst du denn da? Aliens gucken?“
Sie hob die Schultern. Wenn er das so sagte, klang es albern. „Ja, ich denke schon.“
Er schüttelte den Kopf und nahm die Mütze ab. „Na ja, ich kann das ja verstehen. Die sind halt immer noch was Besonderes für die Jugend. Woher kommst du? Irland?“
„Kildare. Bin mit dem Fahrrad rübergekommen.“
Er hob beeindruckt die Augenbrauen. „Alle Achtung. Bist der sportliche Typ, wie? Oh Verzeihung, habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Dan Murphy.“
Sie ergriff zögernd die ausgestreckte Hand. „Roisin Fagan. Leben sie hier?“
Er winkte ab. „Nein, nein. Ich lebe in einer kleinen Community, ein paar Meilen südlich. Wir kommen nur zum... Einkaufen her, wenn du verstehst.“
Er sah sie noch einmal an, diesmal mit Sorge im Blick. „Bist du verletzt?“
„Halb so schlimm. Das mit dem Fahrrad ist ärgerlicher.“
„Ich kann dich mit ins Dorf nehmen. Da gibt es ein Bett und eine warme Mahlzeit. Und bestimmt finden wir auch eine Lösung für dein Fahrrad.“
Als er sah, dass Roisin zögerte, lachte er und klopfte ihr auf den Arm. „Keine Sorge, Mädchen. Ich tu dir schon nichts. Aber ich kann verstehen, wenn du keinem Fremden traust. War auch nur ein Angebot.“
Als er Anstalten machte, zum Wagen zurückzugehen, rief Roisin ihm nach. Der Gedanke allein in dieser Geisterstadt zu bleiben, wenn in unmittelbarer Nähe Menschen lebten, erschien ihr plötzlich nicht mehr so verlockend. Und Murphy machte eigentlich einen recht harmlosen Eindruck.
„Warten sie, Mr. Murphy! Ich glaube, ich würde doch gerne mitkommen...“
Er nickte lächelnd, als hätte er nichts anderes erwartet.
Er ging zurück, schnappte sich, was von Roisins Fahrrad übriggeblieben war, und warf es auf die Ladefläche seines Wagens.
„Na dann, spring mal rein, Mädchen“, rief er ihr zu. „Wirst dich bei uns schon wohlfühlen. Versprochen.“
*
Es war das warme Sonnenlicht, das ihn schließlich weckte. Es breitete sich angenehm auf seinem Gesicht aus und streichelte seine Haut.
Er blinzelte und streckte sich. Er fühlte sich ausgeruht. Dabei hatte Arne Fröhlich nicht die geringste Ahnung, wie lange er „geschlafen“ hatte.
Die Erinnerung an die letzten wachen Momente war noch lebendig. Wie er und seine Frau aufgeregt den Hof in Harburg verlassen hatten – an diesem Freitag im Februar, knapp ein Jahr nach dem Auftauchen der Fremden.
Er stützte sich auf die Ellenbogen und sah sich um. Der Raum schien rund zu sein und vollkommen weiß. So wie das Innere der Station, in die er damals gebracht worden war. Er lag auf einer Liege, ähnlich der, auf der er konserviert worden war. Aber er konnte unmöglich die ganze Zeit hier gelegen haben. Wie viel Zeit mochte vergangen sein?
Es war niemand im Raum, der ihm diese Fragen hätte beantworten können. Er war allein, fühlte sich plötzlich ängstlich und hilflos.
Arne schwang die Beine von der weichen Liege und sah aus dem großen, gebogenen Fenster neben sich. Er sah ein endloses Feld mit hohem Gras. Weiter hinten Bäume. War er zu Hause? In dem kleinen Dorf im Kreis Harburg, wo alles begonnen hatte?
„Hallo?“, rief er und fühlte ein Kratzen in seinem Hals. „Ist da jemand?“
Es dauerte nicht lange, bis eine Tür aufglitt, die er vorher nicht bemerkt hatte.
Ein Strahlen breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er die Frau mit den langen, blonden Haaren erblickte. Sie war zwar etwas fülliger geworden, hatte Fältchen bekommen und trug eine Brille, aber es war immer noch seine Tochter.
Mit etwas wackligen Beinen lief er auf sie zu und schlang seine Arme um sie.
„Hannah! Wie schön! Ich bin so froh, wieder wach zu sein.“
Er schob sie ein Stück zurück und betrachtete sie eingehend. „Geht es dir gut? Was ist alles passiert? Wo ist deine Mutter?“
Hannah lächelte, doch diese Geste konnte die Trauer in ihren Augen nicht verbergen. Sie war auf diesen Moment vorbereitet worden, doch sie hätte nicht gedacht, dass es wirklich so schwer werden würde.
„Setzen wir uns doch einen Moment, Papa. Es gibt einiges, was ich dir erzählen muss.“
Arne spürte Unruhe in sich aufsteigen. Er hatte sich seit dem Auftauchen der Fremden angewöhnt, das Schlimmste zu befürchten. Denn meistens war genau das eingetreten...
Sie setzten sich beide auf die Liege, von der er gerade aufgestanden war und Arne begann nervös an seinen Fingern zu spielen. Hektisch sah er sich um.
„Warum ist deine Mutter nicht hier?“
Hannah hob eine Hand. „Eins nach dem anderen, Papa. Zunächst mal: Es ist viel Zeit vergangen.“
Arne schluckte und ließ seinen Blick wieder über das Gesicht seiner Tochter gleiten.
„Du bist älter geworden“, sagte er vorsichtig.
Hannah nickte und seufzte. „Ich bin jetzt... 47.“
Arne Fröhlich begann zu zittern. Er war nur noch vier Jahre älter als seine eigene Tochter...
„Fast 20 Jahre?“, fragte er ungläubig. „Du willst mir tatsächlich sagen, dass ich... 20 Jahre weg war?“
Sie nickte.
Tränen füllten die Augen von Arne Fröhlich. „Aber wieso? Warum so lange?“
„Weil so unglaublich viel passiert ist. Es war keine Zeit, euch zurückzuholen. Zumindest nicht die, die erst nach dem Auftauchen der Fremden konserviert wurden. Die Welt... sie ist nicht mehr dieselbe. Es gibt ganz neue Technologien. Es gibt... eben eine ganz neue Welt... Und sehr viel weniger Menschen.“
Arnes Gedanken kreisten. Er hatte das Gefühl, immer noch zu schlafen. Die Worte seiner Tochter drangen zwar an sein Bewusstsein, aber er konnte keinerlei Bilder dazu sehen, sich nichts davon vorstellen.
„Dann haben... Karmann und Cato und die anderen also doch die Menschen angegriffen?“
Hannah schüttelte den Kopf. „Nein. Das haben die Menschen ganz allein hinbekommen. Es gab zwei schreckliche Seuchen. Die erste kurz nachdem du konserviert worden warst. Fast drei Milliarden Menschen sind dabei gestorben.“
Arnes Augen weiteten sich. „Mein Gott, so viele?“
Hannah nickte. „Die zweite Seuche, knapp zwei Jahre später war noch schlimmer. Derzeit leben auf der Erde gerade mal 300 Millionen Menschen.“
„Soviel gab es damals nur allein in den USA...“
„Etwas weniger, aber ja – es sind nicht mehr viele übrig. Knapp zwei Millionen wurde konserviert. So wie du.“
Arne versuchte noch immer, die Informationen zu verarbeiten. Er spürte kaum, wie Hannah ihre Hand auf seine legte.
„Die ersten Menschen wurden unmittelbar nach der zweiten Seuche aufgeweckt. Es waren die, die konserviert worden waren, als die Fremden noch die Menschheit auslöschen wollten. Damals war die Konservierung auf fünf Jahre programmiert. Bei den späteren war der Zeitpunkt offen gelassen worden. Es gab so viel zu tun. Die neuen Technologien, die Ausbildung der Überlebenden, das Anpassen an die neue Welt – eine Welt ohne Großindustrie. Ohne Autos und ohne Umweltzerstörung.“
Arne sah sie ängstlich an. „Ist es eine schöne Welt?“
Hannah lächelte und nickte. „Wunderschön. Aber man muss sich an sie gewöhnen. So vieles, was uns selbstverständlich erschien, gibt es nicht mehr. Die Häuser sind anders, die Kommunikation, die Fortbewegung. Sogar die Energie. Aber es gibt immer noch die Landwirtschaft – mehr denn je sogar. Aber sie dient nicht mehr der Massenproduktion von Nahrungsmitteln. Wozu auch? Aus Wüsten sind ertragreiche Felder geworden und es gibt so unglaublich viele Tiere. Die meisten Menschen bewegen sich in Gleitmobilen, die bis zu 15 Meter über der Erde fliegen können. Mit den großen Stationen kannst du jede Distanz zurücklegen. Du steigst hier in eine ein und in Afrika wieder aus – innerhalb von Sekunden. Es gibt so viel zu entdecken, Papa.“
Arne Fröhlich nickte, doch er hörte kaum noch zu. Er brauchte jetzt etwas Vertrautes um sich, einen Anker. Also ließ er Hannahs Hand los und ging zu der Tür, die sich hinter seiner Tochter wieder geschlossen hatte.
„Ich möchte jetzt zu deiner Mutter.“
Hannah schluckte. Auch auf diesen Moment war sie vorbereitet worden. Doch das ersparte ihr nicht die Tränen.
Sie senkte den Blick und klopfte auf den Platz neben sich. „Setz dich wieder, Papa.“
Als Arne Fröhlich zögernd auf sie zukam und die Tränen in ihren Augen sah, wusste er, dass er die folgenden Worte nicht hören wollte.
„Wo ist Marion?“, fragte er noch einmal mit zitternder Stimme und hoffte, dass seine Tochter ihm niemals antworten würde.
Doch sie sprach die Worte aus, die er am wenigsten hören wollte.
„Mama ist tot.“
Arne presste die Augen zusammen, als die Tränen hineinschossen. Es dauerte eine Weile, bis er es schaffte, zu sprechen.
„Die Konservierung. Da ist was schiefgegangen, oder?“
Hannah schüttelte den Kopf. „Nein, Papa. Es waren diese Leute. Erinnerst du dich? Die uns beschimpft und die Wände beschmiert haben. Sie haben den Hof angezündet, kurz nachdem ihr abgefahren ward. Mama wollte die Kühe aus dem Stall befreien. Sie selber ist nicht mehr herausgekommen.“
Arne Fröhlich brach schluchzend zusammen, als er sich vorstellte, wie seine Frau bei lebendigem Leib verbrannte, im selben Moment als er die Narkose erhielt, die sein Leben retten und verlängern sollte. Warum war sie nicht mitgekommen mit ihm? Wieso musste sie unbedingt noch da bleiben, um irgendwelche unsinnigen Sachen zu erledigen, die jede Bedeutung verloren hatten? Sie könnte jetzt hier sein und mit ihm gemeinsam diese neue Welt entdecken! Sie hätten ein zweites Leben führen können...
Hannah strich ihm beruhigend über den Rücken und wartete geduldig, bis der Tränenfluss langsam versiegte und Arne Fröhlich den Kopf hob.
„Ich habe geschlafen. Während Marion...“
„Nein, Papa, so darfst du nicht denken. Es war ihre Entscheidung.“
„Warst du dabei?“
Hannah nickte. „Ich konnte nichts tun. Und es hat lange gedauert, bis ich das eingesehen habe. Ich habe mir viele Jahre Vorwürfe gemacht.“
„Der Hof?“
Sie schüttelte den Kopf. „Er ist abgebrannt. Und das Land gibt es nicht mehr. Harburg ist größtenteils Marschland geworden. Die Polkappen...“
„Sind sie ganz geschmolzen?“
„Nein, ein Teil der Katastrophe konnte verhindert werden. Dennoch ist der Meeresspiegel signifikant gestiegen. Viele Küstenregionen gibt es nicht mehr, vor allem die flachen. Sogar Hamburg ist... fast verschwunden. Niemand lebt dort mehr. Aber das gilt auch für andere Länder und Landstriche.“
„Wo sind wir jetzt?“
„In der Nähe, bei Bremen. Die Station ist hierhin versetzt worden.“
„Ich habe alles verloren...“
Hannah drückte seine Hand. „Vielleicht kommt es dir jetzt so vor. Aber es ist nicht so. Es gibt etwas Neues da draußen.“
„Ohne Marion...“
„Ich weiß.“
„Was ist mit Frau Gauers? Sie hat so viel für uns getan, damals…“
Hannah schluckte. „Sie ist auch schon lange tot. Sie ist bei einem Anschlag auf Henriette Hartkamp ums Leben gekommen.“
Arne schwieg eine Weile.
„Jetzt gibt es nur noch uns beide.“
Hannah lächelte und sie war froh, endlich von den guten Dingen erzählen zu können. „Ganz so ist es nicht.“
Sie stand auf und zog ihn mit sich hoch. Unsicher folgte Arne ihr zu der Tür. Als Hannah gegen das Material klopfte, schwang sie auf und gab den Weg in einen Korridor frei. Er führte direkt nach draußen ins Freie.
Frische, warme Luft schlug Arne Fröhlich entgegen. Er blinzelte in die Sonne und schirmte die Augen mit der Hand ab. Jetzt sah er die beiden Gestalten, die auf dem freien Platz vor dem runden Gebäude warteten.
Ein Mann mit leicht grauen Haaren, der in einer Art schwebendem Stuhl saß, der ruhig in der Luft hing, einen halben Meter über dem Boden.
Und ein junger, schlaksiger Mann, ein Teenager mit funkelnden, tiefliegenden Augen und dichtem, krausen, dunkelblondem Haar.
Arne erkannte den älteren Mann und ging auf ihn zu.
„Herr Spengler? Sind sie das?“
Der ehemalige Pressesprecher der ehemaligen Bundeskanzlerin nickte.
„Ich bin es, Herr Fröhlich. Hannah und ich haben geheiratet.“
Arne bekam große Augen, sah erst zu seiner Tochter und dann zu dem Jungen.
„Und das ist...“
„Unser Sohn“, sagte Hannah. „Oliver. Er ist gerade 18 geworden.“
„Mein Enkel“, hauchte Arne und ergriff zögernd die ausgestreckte Hand.
„Ich kann das alles nicht fassen.“
„Das musst du auch nicht. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir werden dich mit nach Hause nehmen. Und der Rest wird sich finden.“
Oliver Spengler steuerte auf den Schwebegleiter zu. Ein zigarrenförmiges Gebilde mit einem breiten Bauch, das knapp über dem Boden schwebte.
Arne schluckte. „Das sind eure... Autos?“
Hannah lächelte. „Sie sind völlig ungefährlich und lassen sich intuitiv steuern. Ich zeige dir alles.“
„Ich weiß nicht, ob ich da einsteigen kann...“
„Gib ihm eine Chance“, lächelte Oliver. „Das Ding beißt nicht. Und ist sicherer als ein Auto.“
Zögernd folgte Arne ihnen und warf noch einen letzten Blick auf den Kuppelbau, der in einer ganzen Reihe ähnlicher Gebilde stand. Auch von diesen Schwebedingern gab es noch mehr.
Das also war die neue Welt, in der er jetzt lebte.
Doch er war sich nicht sicher, ob es auch SEINE Welt werden würde...
*
„Er ist jetzt wach.“
Knapp 7500 Kilometer entfernt spielte sich eine ähnliche Szene ab. Doch die Frau vor dem Kuppelgebäude hatte sich geweigert, hineinzugehen.
„Erklären sie ihm, was passiert ist“, hatte sie zu dem Fremden in Menschengestalt gesagt, der das Aufwachen der Konservierten betreute und kontrollierte.
Der junge Mann wusste, dass es für viele Nahestehenden und Angehörigen eine Belastung war, ihren Liebsten zu erzählen, dass bis zu 20 Jahre ihres Lebens vergangen waren, ohne dass sie etwas davon gemerkt hatten. Dass Menschen gegangen oder gestorben waren und sich die Welt radikal verändert hatte.
Genauso wie Beziehungen.
Sie hatte nicht kommen wollen. Doch sie war die einzige Bezugsperson, die der Konservierte angegeben hatte. Viele andere, die hätten kommen sollen, um ihre Liebsten zu empfangen waren der Seuche zum Opfer gefallen. Oder der Zeit des Umbruchs danach. Sie war alles was er hatte. Oder noch zu haben glaubte.
Der Fremde war beim Erwachen bei ihm gewesen und hatte ihm in groben Zügen erklärt, was in den letzten fast 20 Jahren geschehen war. Auf die Begegnung hatte er ihn nur theoretisch vorbereiten können.
Die Frau kaute auf ihren Nägeln. „Kommt er jetzt raus?“
Der Mann nickte. „Er weiß, dass sie hier sind.“
„Und was erwartet er?“, fragte sie fast aggressiv.
„Nichts. Nur, dass sie da sind.“
Der Fremde wartete noch einen Moment, dann trat er wieder zum Eingang in den Korridor der Kuppel und löste einen Mechanismus aus. Im Innern öffnete sich die Tür und ein Schatten erschien. Als er langsam ins Licht trat, zuckte die Frau zusammen und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Es war, als würde sie einen Traum erleben.
All die Jahre...
Und er war nicht einen Tag älter geworden. Sein Gesicht, seine Statur waren noch genauso, wie sie beides in Erinnerung hatte. Die lockigen, dunklen Haare, das jungenhafte Gesicht, in dem sich langsam die männlichen Züge eingegraben hatten. Er war noch immer 31 und sah genauso aus, wie an dem Tag, an dem sie ihn zuletzt gesehen hatte – damals durch das Fenster des kleinen Flugzeugs. Als er unter ihr zurückblieb und immer kleiner wurde, bis er verschwunden war.
Und sie erinnerte sich, wie sehr ihr Herz geblutet hatte.
Die Wunde war verheilt. Seit vielen Jahren.
Sie sah das Strahlen auf seinem Gesicht und es versetzte ihr einen Stich.
„Skylar“, hauchte Corin Wells, kam auf sie zu und wollte sie in den Arm nehmen. Doch er sah den entsetzten Ausdruck auf ihrem Gesicht und bemerkte, wie sie zurückwich.
Erschrocken blieb er stehen und ließ die Arme sinken, als ihm bewusst wurde, dass ein ganzes Leben zwischen ihnen lag. Sie war ein Teil des Hier und Jetzt. Er war nur Vergangenheit...
Dennoch konnte Corin nicht aufhören, sie anzustarren. Natürlich war Skylar Rhodes nicht mehr die 18-Jährige, die er zurückgelassen hatte. Sie war eine Frau. Das Leben hatte Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Sie trug Falten um den Mund und am Hals. Ihre Lippen waren schmal, ihr Körper drahtig und noch immer schlank. Und ihre Augen leuchteten. Sie besaß eine reife, kraftvolle Schönheit. Sie strahlte und Corin spürte, wie sehr er sie immer noch liebte. Und wie weit entfernt sie voneinander waren.
Ein unsicheres Lächeln zuckte um seine Lippen. „Um den Altersunterschied müssen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen“, sagte er leise.
Skylars Mundwinkel zuckten. „Doch. Ich bin jetzt sechs Jahre älter als du.“
Er schlug die Augen nieder und wagte es plötzlich nicht mehr, sie anzusehen. Er spürte die Barriere zwischen ihnen. Eine Barriere, für die er ganz alleine verantwortlich war.
„Wie ist es dir ergangen?“
Skylar hob die Augenbrauen und verschränkte die Arme vor der Brust. „Wo soll ich anfangen? Es war ein Kampf. Die meiste Zeit. Wir haben die Erde umgekrempelt. Jedenfalls die, die überlebt haben. Was nicht viele waren. Wir habe gelernt zu arbeiten, mit unseren Händen. Wir sind Bauern. Kümmern uns um Trinkwasseraufbereitung, um Ernten, Aussaat, um neue Technologien. Keine Zeit mehr für Beauty-Tipps auf Social Media Kanälen, oder Selfies zum liken. Das ganze Leben ist anders. Es ist anstrengend. Es laugt einen aus. Und es lässt einen früher altern.“
Corin hob vorsichtig den Kopf. „Du siehst nicht viel älter aus.“
Das Kompliment erreichte Skylar nicht. „Spar dir das. Ich weiß, wer ich bin. Und das hat nicht mehr viel mit dem Mädchen von damals zu tun.“
„Ich weiß, dass du nichts mehr für mich empfindest, falls du mir das sagen wolltest...“
Skylar wich seinem Blick aus. „Ich weiß nicht, was ich empfinde. Ich hatte keine Zeit für so etwas.“
„Das heißt... du warst die ganze Zeit... allein?“
Ihre Lippen zitterten und sie konnte sich nicht erklären, warum sie sich schuldig fühlte – wie eine Verräterin...
„Nein, das heißt es nicht. Im Gegenteil. Ich war sogar... verlobt. Ich habe ein Kind. Eine Tochter. Sie ist jetzt sechs Jahre alt. Ihr Name ist Lydia.“
Corin versuchte, sich keine Reaktion anmerken zu lassen. Auch wenn ihm die Nachricht einen Stich ins Herz gab.
„Und ihr Vater?“
„Ist gestorben. Vor zwei Jahren. Bei einem Anschlag.“
„Das tut mir leid.“
„Wie gesagt: Es ist kaum Zeit für Gefühle. Und wenn, dann hebe ich sie für meine Tochter auf.“
„Es gibt also immer noch Terrorismus?“, versuchte Corin das Thema zu wechseln.
„Aber natürlich. Es haben noch genug überlebt, die an der alten Welt festhalten. Der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Darum sollten wir auch aufbrechen. Du wirst gebraucht. Es gibt einen Mann, Mason Perkins. Er war ein führender Kopf im Widerstand damals. Jetzt organisiert er den Kampf gegen den Terrorismus. Ich werde dich zu ihm bringen.“
Sie wandte sich schon ab, doch Corin hielt sie instinktiv am Arm fest. Skylar erschrak bei der Berührung und riss sich sofort los.
Für einen Moment starrten die beiden sich an. Und auch wenn Corin noch nach den richtigen Worten suchte, wusste er, dass ihm keine Zeit blieb, sie sich zurechtzulegen.
„Ich weiß, dass alles anders ist“, begann er hastig. „Und dass du mich nicht mehr liebst, weil für dich soviel Zeit vergangen ist. Sicher ist es nicht leicht, mich wiederzusehen. Aber für mich auch nicht. Das Letzte, was ich sehe, ist dein Gesicht hinter der Scheibe im Flugzeug. Und es ist, als wäre es gestern.“
„Was erwartest du?“, fragte Skylar und bemühte sich, ihre zitternde Stimme möglichst fest klingen zu lassen. „Dass du nach 20 Jahren wieder auftauchst und alles ist wie früher?“
„Nein“, antwortete Corin hastig. „Ich will nur, dass du auch verstehst, dass es für mich kein FRÜHER gibt. Für mich ist das Damals... auch das Jetzt...“
Skylars Atem ging schneller und sie wischte sich über die feuchte Stirn. „Ich kann das nicht, Corin. Ich wollte nicht mal hierher kommen. Das ist alles so – irreal...“
„Das weiß ich. Aber das ist es auch für mich. Ich verlange nichts, Skylar. Zumal es meine Entscheidung war, mich konservieren zu lassen. Aber ich wusste ja auch nicht, wie lange es dauern würde.“
„Das hat nie eine Rolle gespielt. Alles was zählte, war, dass du mich alleine gelassen hast.“
Jetzt sah sie ihn an und es war ihr egal, dass ihre Augen voller Tränen waren. Der Schmerz war bis jetzt nur vergessen, nicht vergangen.
„Es tut mir leid“, hauchte Corin schließlich. „Und ich weiß, dass das nichts wieder gut macht. Zwischen uns liegt ein ganzes Leben. Eins, das ich nicht hatte. Bitte, hass mich nicht dafür.“
Sie wischte sich die Tränen aus den Augen. „Wie gesagt: Es ist wenig Zeit für Gefühle. Und jetzt lass uns aufbrechen. Die Zeit drängt.“
Er folgte ihr zu dem zigarrenförmigen Körper, der knapp über dem Boden schwebte. Eine durchsichtige Scheibe zog sich zurück, nachdem Skylar einen Mechanismus betätigt hatte, und beide stiegen in das Cockpit. Der Gleiter bot Platz für vier Personen, fast wie ein Auto...
Unsicher setzte sich Corin neben Skylar, die mit routinierten Griffen ein paar Knöpfe drückte, woraufhin sich die Scheibe schloss und die Düsen im Boden aktiviert wurden. Sie hoben das Fluggerät auf eine Höhe von ungefähr vier Metern und stabilisierten es. Dann aktivierte Skylar die Heckdüsen und es setzte sich vorwärts in Bewegung.
„Einfach fantastisch“, hauchte Corin.
Sie antwortete, ohne ihn anzusehen. „Ist nur für kürzere Inlandsstrecken.“
„Und hat jeder so ein Gerät?“
„Jeder kann es benutzen, der eingewiesen ist. Wer eine Genehmigung hat, wird gespeichert und an eine zentrale Datenbank übermittelt. Der Gleiter erkennt dann anhand der Fingerabdrücke, ob du berechtigt bist, oder nicht.“
„Und wie kommen diese... Gleiter in Umlauf? Ich meine, werden sie verkauft?“
„Wie gesagt, es gibt genug und jeder kann sie nutzen. Sie gehören... allen.“
„Es hat sich wirklich viel verändert“, antwortete Corin mit Wehmut in der Stimme.
Skylar gestattete sich ein Lächeln. „Es gibt auch noch Autos. Und die Hardliner fahren sogar noch mit Benzin. Aber sie sterben Gott sei Dank aus. Niemand hält mehr die Straßen instand. Über kurz oder lang werden also auch die Autos verschwinden.“
Sie flogen quer über das Land, an kleinen, alten Dörfern vorbei, die verlassen und überwuchert von Gras und Bäumen waren. Ein friedliches, aber auch trauriges Bild. Die Natur dehnte sich wieder aus und holte sich zurück, was ihr genommen worden war.
„Woher weißt du, wohin du fliegen musst, wenn es keine Straßen mehr gibt?“, fragte Corin irgendwann.
„Muss ich nicht. Ich gebe ein Ziel ein und der Gleiter bringt mich hin. Er erkennt auch Hindernisse auf dem Kurs und weicht ihnen automatisch aus, egal ob feste oder welche, die sich bewegen. So gibt es keine Unfälle. Wenn ich Lust habe, kann ich einen Teil der Automatik deaktivieren. Dann bestimme ich selber Richtung, oder Geschwindigkeit. Aber die Kollisionskontrolle lässt sich nicht abschalten.“
„Und wie schnell ist so ein Ding?“
„Wie ein Auto, maximal 80 Meilen. Und es kann bis zu 15 Meter hoch steigen.“
Corin schüttelte den Kopf. „Es ist immer noch wie ein Traum.“
„Warte, bis du in einer Station warst und den Transporter benutzt hast.“
Als er sie fragend ansah, lachte sie leise. „Eins nach dem Anderen.“
Er lächelte sie an und für einen Moment spürte er einen Teil der alten Verbundenheit zu Skylar, die so viel für ihn getan hatte – die sein Leben gerettet hatte...
Aber er wusste, dass es nur eine Erinnerung an etwas längst Vergangenes war. Zumindest für sie. Für ihn war das alles noch real. Doch je mehr er von der neuen Welt sah, desto mehr wurde ihm bewusst, welche Kluft zwischen ihm und Skylar lag. Und dass sie so groß war, dass er sie wohl nicht mehr überbrücken konnte
Und so begann seine Rückkehr ins Leben mit einem Abschied.
*
Über vierhundert Menschen an einem Ort zu versammeln war in diesen Zeiten eine Leistung, auf die er stolz sein konnte.
Sie waren hergekommen, um IHN zu sehen. Weil sie wussten, dass es etwas gab, dass nur ER ihnen geben konnte. Und wonach sie sich mehr sehnten, als nach irgendetwas anderem: Normalität.
Er hatte in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, um zu zeigen, auf wessen Seite er stand und was er bereit war zu tun, um seine Ziele zu erreichen. Seine und die der ganzen Menschheit...
Er hatte in der ersten halben Stunde bereits den Saal zum Kochen gebracht und begeisterten Applaus geerntet. Die Menge folgte ihm. Er durfte sie nur nicht wieder vom Haken lassen. Jetzt galt es, den Weg für einen neuen Anführer zu bereiten. Das war nicht er, das wollte er auch gar nicht. Er war ein Macher, kein Politiker. Die Menschen brauchten jetzt eine Galionsfigur, einen Leitwolf. Und den sollten sie bekommen.
„Freunde“, rief er in die Menge und hob die Arme, um den letzten Applaus abebben zu lassen.
„Die Natur lässt sich nicht betrügen, sagen unsere vermeintlichen Freunde von den Sternen immer. Und das Leben wird sich durchsetzen. Wahre Worte, das kann ich nur bestätigen. Aber was ist denn die Natur auf diesem Planeten? Was ist das Leben, das er hervorgebracht hat? Das sind WIR, meine Freunde!“
Wieder tosender Applaus und zustimmende Rufe.
„Wir unterscheiden uns von allem, was es sonst auf dieser Welt gibt! Denn wir haben die Kraft, sie zu formen und sie zu NUTZEN! Wir stehen über der Natur, denn der Mensch ist noch immer die Krone der Schöpfung! Durch seine Fähigkeiten, durch sein Bewusstsein! Und dieses Bewusstsein sagt ihm, dass er allein die Kontrolle auf diesem Planeten hat! Die Welt gehört den Menschen und es ist an der Zeit, dass er sie sich zurückholt!“
Seine Stimme war während der letzten Sätze immer lauter geworden und riss die Menschen im Saal mit.
„Seht euch diese Stadt an! Unser wunderschönes, historisches Köln am Rhein! Die Straßen sind leer, viele unserer Freunde und Bekannten sind gestorben! Aber wir haben diese Stadt nicht aufgegeben. Wir haben sie wieder bevölkert! Aus allein Teilen und Ecken Deutschlands sind die Menschen zu uns gekommen, weil sie wussten, dass sie hier genau das sein dürfen: MENSCHEN! Wir haben uns hier eine Enklave des Vertrauten inmitten der fremden Herrschaft aufgebaut. Wir haben die alten Berufe gepflegt, wir haben die Ordnung wieder hergestellt. Wir sorgen für uns, wir sind mobil, wir haben noch Geschäfte und wir haben GELD! Die Zivilisation hat sich genauso wenig auslöschen lassen, wie die Menschheit. Und ich sage euch, Freunde: Was hier möglich ist, das ist im ganzen Land möglich! Und wenn Deutschland der Welt zeigt, wozu die Menschen fähig sind, wenn sie nur zusammenhalten, dann wird die Welt folgen! Mit Mut und Entschlossenheit wird es uns gelingen, das Joch der Fremdbestimmung abzuwerfen und wieder zu dem zu werden, wozu wir von der Natur höchstselbst ausersehen sind: Die Herrscher dieses Planeten!“
Er riss in einer siegessicheren Geste die Faust in die Luft und die Menschen im Saal folgten seinem Beispiel. Der Höhepunkt des Abends war gekommen und er badete im Applaus.
Er sah auch zu seiner Frau und den beiden Kindern, die mit unbewegten Mienen den Auftritt teilnahmslos verfolgt hatten.
Doch das störte ihn nicht. Es gab Wichtigeres als ihre Unterstützung.
Es ging um die Menge, denn nur sie konnte schließlich etwas bewegen.
Er bedankte sich bei seinem Publikum, bat noch einmal, die Kontaktdaten am Eingang zu hinterlassen und entließ sie mit dem Versprechen, dass es bald wieder eine Bundesregierung geben würde, die alle Menschen im Land einte.
Der nächste Schritt...
Und er war schon vorbereitet.
Nach und nach verließen die Zuhörer die ehemalige Studiohalle auf einem Fernseh-Produktionsgelände in Hürth-Kalscheuren und strömten zu ihren Autos und Gleitern. Es war nicht verwerflich, sich der fremden Technologie zu bedienen... Im Gegenteil: So würde sich der angebliche Segen für die Menschheit letztlich gegen die Aliens selber richten. Ein Stück Göttliche Gerechtigkeit.
Er selber wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Die lockigen Haare hingen in Strähnen herab, die kleinen Augen mit den Krähenfüßen funkelten und um die schmalen Lippen zuckte ein Lächeln. Er sah zu seiner Frau, die mit den Kindern noch immer in der Halle wartete, um gemeinsam mit ihm nach Hause zu fahren.
Ein kleines und bedeutungsloses Zuhause, das nur Mittel zum Zweck war.
Er war schließlich zu Höherem bestimmt.
Er – Ferdinand Braunbichler!
*
Die Fahrt mit dem Lieferwagen hatte eine knappe halbe Stunde gedauert und führte über Seitenstraßen und Feldwege zu einem Gelände, das früher einmal eine Militärstation gewesen sein musste.
Als Roisin die zahlreichen Baracken hinter dem zweieinhalb Meter hohen Zaun und dem gesicherten, eisernen Tor sah, begann sie daran zu zweifeln, dass es eine gute Idee gewesen war, in Dan Murphys Auto einzusteigen.
Zwei bewaffnete Männer öffneten das Tor und ließen den Wagen passieren. Murphy sah den ängstlichen Ausdruck auf Roisins Gesicht. „Keine Sorge, Mädchen. Das ist nur für unsere eigene Sicherheit.“
„Sicherheit? Vor wem oder was?“
Murphy hob die Schultern. „Man kann nie wissen. Wir leben in unruhigen Zeiten. Es gibt keine Regierungen und keine Gesetze mehr. Und nicht jeder ist so freundlich gesinnt, wie wir.“
Murphy parkte den Lieferwagen zwischen ein paar anderen Autos, stieg aus und unterhielt sich leise mit einem Wachmann, während Roisin ihre Sachen zusammensuchte.
Als sie ausstieg, kam Murphy auf sie zu, begleitet vom Wachmann. Er war ein junger Kerl mit schwarzen Haaren und einem blassen Gesicht. Sie sah, dass er das Gewehr ungeschickt im Arm hielt und ein Bein leicht nachzog.
„Das ist Darragh, ein Landsmann von dir. Er wird dir deine Unterkunft zeigen und bringt dich danach zu Mr. Callaghan. Er ist der Boss hier. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt, Miss. Wir sehen uns sicher noch wieder.“
Etwas in dem Grinsen und dem musternden Blick gefiel Roisin gar nicht. Aber sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn der junge Wachmann drängte zum Aufbruch. So schnell es seine Gehbehinderung zuließ, eilte er zwischen den Baracken hindurch und Roisin hatte Mühe, Schritt zu halten.
„Was ist das hier?“, fragte sie unterwegs.
„Ein Dorf. Ein Zuhause.“
„Und was macht ihr hier?“
„Leben.“
„Du redest nicht gerne, oder?“
„Es gibt nichts zu reden.“
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her und Roisin versuchte vergeblich, sich ein Bild von ihrer Umgebung und ihrem Begleiter zu machen. Beides wirkte düster, erdrückend. Dabei war Darragh nicht mal unattraktiv. Er hatte weiche, ebenmäßige Züge. Doch der verkniffene Ausdruck in seinem Gesicht verzerrte sie. Er hatte den Blick stur geradeaus gerichtet, so als müsse er sich zwingen, Roisin nicht anzusehen.
„Woher kommst du? Ursprünglich, meine ich.“
„Galway.“
„Oh... tut mir leid. Es ist überschwemmt worden, oder?“
„So wie die meisten Küstenregionen.“
„Ich bin aus Kildare...“
„Wir sind da.“
Darragh war vor einer der Baracken stehengeblieben und hielt die Tür auf. „Richte dich ein. Wenn du fertig bist, komm raus. Ich warte hier.“
„Wozu? Und wozu die Waffe?“
„Zur Sicherheit“, antwortete er tonlos und richtete seinen Blick ins Leere, um Roisin zu zeigen, dass das Gespräch beendet war.
Sie trat in die Holzhütte und schaltete das Licht an. Es gab zwei Etagenbetten, die unbenutzt waren. Dazu zwei Kleiderschränke und ein angrenzendes, kleines Bad. Roisin warf ihren Rucksack aufs Bett und zog sich aus. Sie nahm eine ausgiebige Dusche und hatte keine Ambitionen, sich zu beeilen. Als sie nach einer Weile geduscht und frisch angezogen ins Freie trat, stand Darragh noch immer dort. Wortlos setzte er sich in Bewegung. Die Dämmerung setzte ein und die Dunkelheit kam schnell. Als sie ein großes, zweistöckiges Backsteinhaus erreichten, das früher mal die Verwaltung gewesen sein musste, gingen die Scheinwerfer und Flutlichter bereits an. Darragh führte sie in ein Büro im Erdgeschoss, in dem ein hochgewachsener Mann Ende Vierzig mit schmalen, freundlichen Augen saß. Das braune Haar trug er sorgfältig gescheitelt. Er stand auf und streckte Roisin eine große, kräftige Hand entgegen, während Darragh sich zurückzog und die Tür leise hinter sich schloss.
„Ich bin Reginald Callaghan – willkommen in unserem kleinen Dorf.“
Roisin ergriff zögernd die Hand und setzte sich auf den angebotenen Holzstuhl vor dem Schreibtisch.
„Vielen Dank für ihre Gastfreundschaft“, begann sie unsicher. „Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. Ich werde also nicht lange bleiben.“
Callaghan musterte sie auf die gleiche, seltsame Weise wie Murphy...
„Das sollten sie sich noch mal überlegen, Miss...“ Er warf einen Blick auf einen Notizzettel. „Miss Fagan. Hier haben sie alles, was ein Mensch zum Glücklichsein braucht. Und wir freuen uns über jedes neue Mitglied unserer kleinen Gemeinde.“
Sie rutschte unruhig auf ihrem Stuhl herum. „Das mag sein, aber ich möchte doch lieber weiterziehen. Es gibt so viel zu sehen, was ich noch nicht kenne...“
Callaghan nickte. „Ich kann ihren Wunsch gut verstehen. Aber wir leben in schwierigen Zeiten. Und vor allem in gefährlichen! Für eine junge Frau ganz alleine dort draußen kann es schnell... unangenehm werden. Wir haben viele verirrte Frauen und Mädchen bei uns aufgenommen, die dort draußen großen Gefahren ausgesetzt waren. Hier haben sie Sicherheit und Zuflucht gefunden.“
„Ich habe gar keine Frauen gesehen“, platzte es aus Roisin heraus. „Nur Männer mit Gewehren.“
Callaghan lächelte nachsichtig.
„Die hier sind, um genau diese Frauen zu beschützen. Wir achten sehr auf sie. Jetzt sind die meisten in ihren Unterkünften und ruhen sich aus. Tagsüber gibt es eine Menge zu tun.“
Roisin musste unwillkürlich an ein Arbeitslager denken. „Und gibt es denn auch Ausgang?“, fragte sie mit einem Trotz in der Stimme, den sie gar nicht beabsichtigt hatte.
Callagahn lehnte sich zurück und musterte sie noch eingehender. Er schien sie regelrecht zu studieren.
„Sie sind eine kampflustige, junge Frau – nicht wahr, Miss Fagan?“
„Sagen wir, dass ich meine Freiheit liebe.“
Callaghan nickte nachdenklich. „Jeder liebt seine Freiheit. Doch Freiheit bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Freiheit funktioniert nur in der Gemeinschaft. Wir hier sind eine Gemeinschaft. Wir halten zusammen und übernehmen Verantwortung für das Allgemeinwohl. Gemeinsam machen wir die Welt wieder zu einem besseren Ort.“
„Ich finde, dass sie im Moment ziemlich gut ist“, gab Roisin zu bedenken.
Callaghan legte den Kopf schief. „Haben sie die Außerirdischen schon einmal gesehen? Ich meine so, wie sie wirklich aussehen? Nicht in ihrer menschlichen Verkleidung...“
Zögernd schüttelte Roisin den Kopf. Callaghan zog eine Schreibtischschublade auf und nahm einen dünnen Aktendeckel heraus, in dem mehrere, großformatige Bilder lagen, die er Roisin zuschob. Sie zeigten Wesen, die eine Mischung aus Tintenfisch und Elefant darstellten. Schmale Körper mit acht langen Gliedmaßen. Vier dienten als Beine, die anderen als Arme. Sie hatten kleine Augen und einen kaum wahrnehmbaren Mund. Kopffüßler mit einer lederartigen Haut, die eine Größe von mehr als drei Metern hatten.
„So sehen sie wirklich aus – unsere Wohltäter. Können sie sich vorstellen, neben solchen Wesen... zu leben? Vielleicht sogar eins zu lieben? Sie sind Tiere, meine Liebe. Ich will nicht in Abrede stellen, dass sie viel für diesen Planeten getan haben. Vielleicht haben sie uns sogar gerettet. Aber sie gehören nicht hierher. Sie werden irgendwann wieder gehen. Eher bald als später. Ihre Mission ist beendet. Und was dann? Diese Erde ist praktisch entvölkert. 300 Millionen auf dem ganzen Planeten, wo früher acht Milliarden gelebt haben. Und die Sterblichkeit steigt. Unser Organismus ist an die elementaren Veränderungen der letzten 15 Jahre gar nicht angepasst. Und wir wissen nicht, was die Natur noch an Menschenfeindlichem hervorbringt, wenn wir sie sich selbst überlassen. Wir müssen die Menschheit wieder aufbauen, um zu überleben.“
„Und das wollen sie... hier machen? Mit Gewehren?“ Roisin schob die Bilder zurück. Sie konnte nicht leugnen, dass ihr der Anblick Angst machte.
„Wir fangen im Kleinen an. Überall. Wie immer beginnen Veränderungen im Kleinen. Denken sie über meine Worte nach, Miss Fagan. Und möglicherweise werden sie sich dann doch entschließen, ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Sie werden hier gebraucht. Die Welt braucht sie.“
Roisin wich seinem Blick aus. „Mal sehen. Kann ich jetzt gehen?“
Callagahn lächelte und erhob sich. „Darragh wird sie in den Speisesaal bringen. Unsere gemeinsame Mahlzeit ist zwar schon vorbei, aber sie können sich satt essen. Später kommt dann unser Dorfarzt Dr. Byrne zu ihnen, um sie zu untersuchen.“
Roisin zog die Stirn kraus. „Wieso? Ich fühle mich wohl.“
„Das heißt aber nicht, dass sie auch wirklich gesund sind. Sehen sie es als freundschaftlichen Service an. Wir lassen jedem unserer Gäste diesen Check-Up zuteil werden. Egal, wie lange er oder sie bei uns ist. Gesundheit ist doch schließlich das Wichtigste, oder? Wir sehen uns morgen wieder.“
Er reichte ihr noch einmal die Hand und hielt ihr die Tür auf.
Als Roisin nach draußen trat und von ihrem Bewacher empfangen wurde, fühlte sie sich noch unwohler als bei ihrer Ankunft. Und alles andere als frei...
Erneut versuchte sie, mit Darragh Schritt zu halten. Er schien vor ihr wegzulaufen. Nichts an diesem Ort ergab irgendeinen Sinn. Jedenfalls keinen, der Roisin das Gefühl vermittelte, hier in Sicherheit zu sein. Irgendwann griff sie nach Darraghs Arm, und riss ihn an sich heran. Der junge Mann war so überrascht, dass er fast sein Gewehr hätte fallenlassen.
„Was zur Hölle geht hier vor?“, zischte sie und ihre Augen funkelten wütend. „Was ist das für ein Ort?“
Für einen Moment bekam Darraghs düstere Fassade einen Riss und in seinen Augen leuchtete Angst – und etwas wie Schuld...
Dann fing er sich wieder und umklammerte sein Gewehr fester. „Du solltest dankbar sein, dass du hier in Sicherheit bist. Du hast ein Dach über dem Kopf, zu essen und Leute, die auf dich aufpassen.“
„Und wenn ich das nicht will? Kann ich dann auch einfach wieder gehen?“
Darragh presste die Kiefer zusammen. „So eine unsinnige Frage. Komm jetzt – das Essen wartet.“
Er ging weiter und für einen Moment überlegte Roisin, ob sie sich einfach umdrehen und weglaufen sollte. Doch dann sah sie die hohen Zäune und die Schatten der bewaffneten Männer. Die Dunkelheit kam und sie wusste nicht einmal genau, wo sie war. Sicher schadete es nicht, eine Nacht hierzubleiben und sich in einem richtigen Bett auszuschlafen. Unsicher trottete sie hinter Darragh her. Morgen würde sie auf jeden Fall von hier verschwinden. Niemand konnte sie schließlich hier einsperren, sagte sie sich. Doch es gelang ihr nicht, sich davon auch zu überzeugen.
*
„Willkommen in der Neuen Welt.“