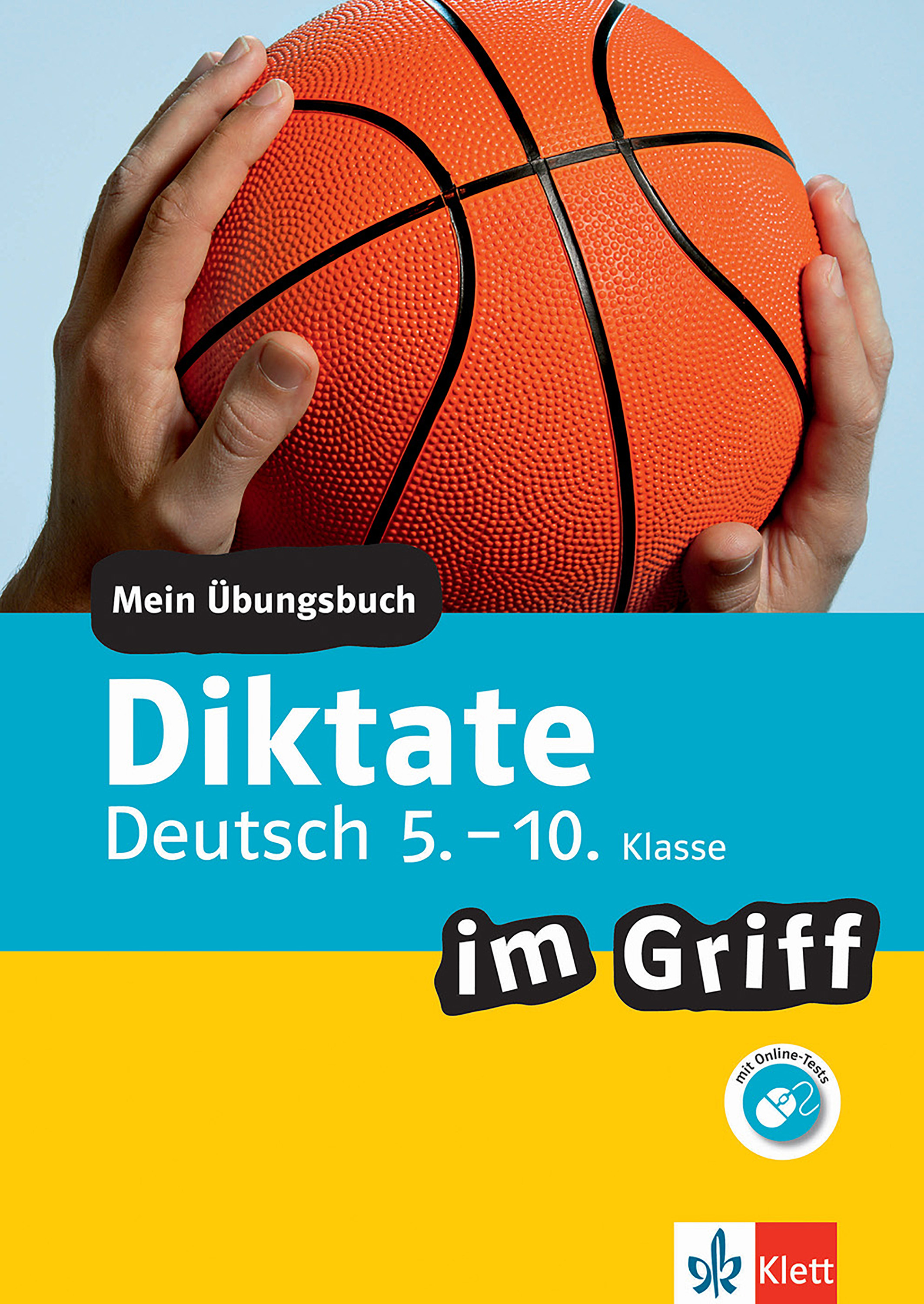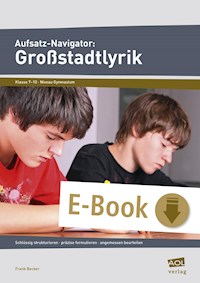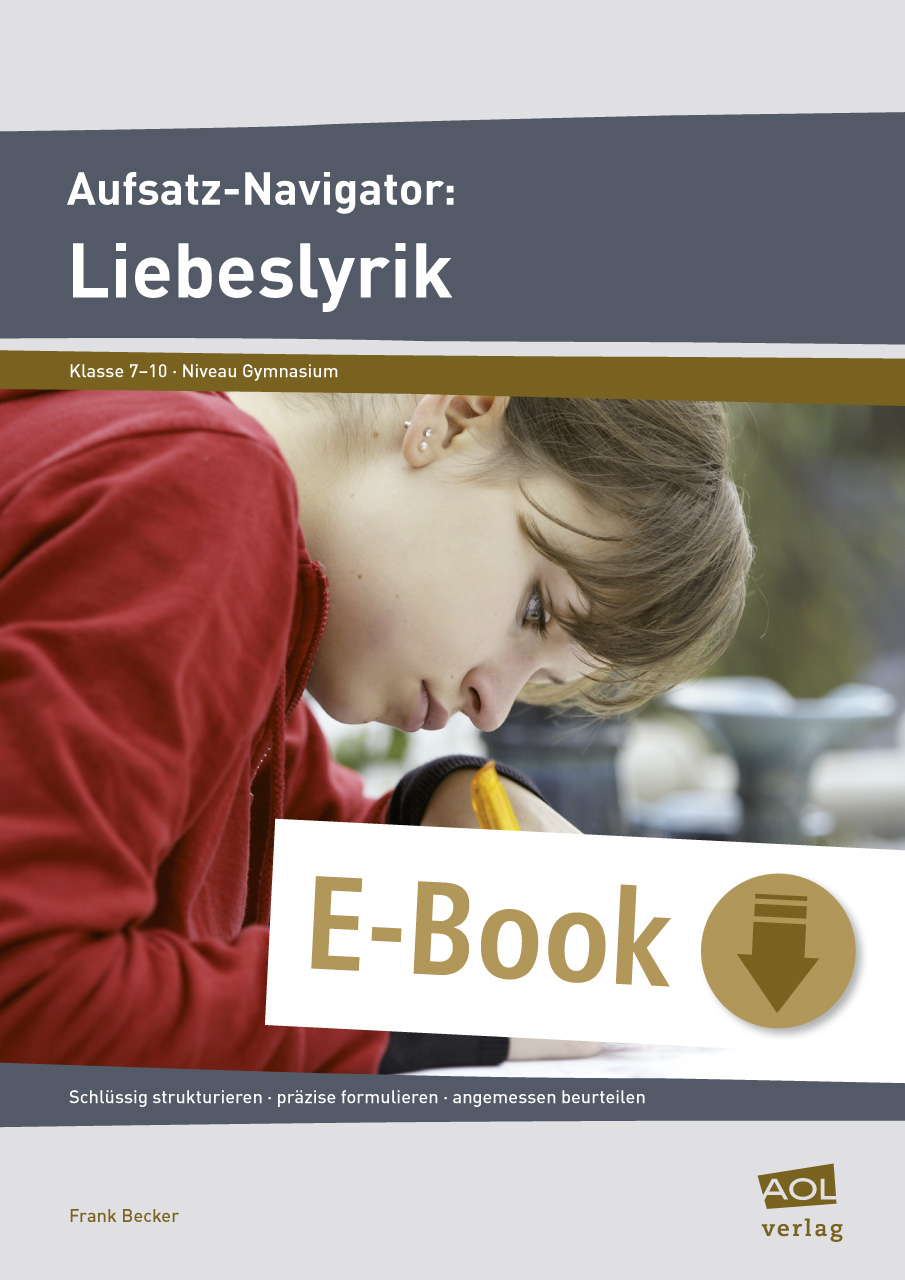Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Als die Revolution von 1918/19 in Deutschland der kaiserzeitlichen Sozialpatronage ein Ende setzte, suchten die Industriellen nach einer neuen Strategie, um die Arbeiter an sich zu binden und dem Einfluss der Gewerkschaften zu entziehen. Abhilfe versprachen hier die Arbeitswissenschaften: Bei nachhaltiger Bewirtschaftung könne Arbeitsenergie bis ins Alter erhalten bleiben, durch positive Gemeinschaftserlebnisse und ein verbessertes Verstehen des eigenen Tuns könne die Arbeitsfreude gesteigert werden. Um solche Erkenntnisse in die Praxis zu überführen, wurde 1925 das »Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung« (DINTA) gegründet. Nach 1933 wurde das DINTA in die Deutsche Arbeitsfront integriert und prägte als »Amt für Berufserziehung und Betriebsführung« das Erwerbsleben im NS-Staat entscheidend mit. Die Gestaltung der Arbeitswelt gehörte in der NS-Diktatur zu den maßgeblichen Feldern, auf denen die »Volksgemeinschaft« verwirklicht werden sollte; in der »Betriebsgemeinschaft« wurde sie wie in einem Mikrokosmos erfahrbar. Doch das »Wohlbefinden«, das der Betrieb unter Nutzung der neuesten Erkenntnisse der Arbeitswissenschaften sicherzustellen versprach, musste mit einer angepassten Lebensweise und dauerhafter Leistungsbereitschaft vergolten werden. Frank Becker erschließt in diesem Buch auf breiter Quellenbasis völlig neue Aspekte der nationalsozialistischen Gestaltung der Arbeitswelt und legt deren Wurzeln in der Weimarer Republik frei.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Becker
»Menschenökonomie«
Arbeitswissen und Arbeitspraktiken in Deutschland 1925–1945
Campus Verlag Frankfurt / New York
Über das Buch
Als die Revolution von 1918/19 in Deutschland der kaiserzeitlichen Sozialpatronage ein Ende setzte, suchten die Industriellen nach einer neuen Strategie, um die Arbeiter an sich zu binden und dem Einfluss der Gewerkschaften zu entziehen. Abhilfe versprachen hier die Arbeitswissenschaften: Bei nachhaltiger Bewirtschaftung könne Arbeitsenergie bis ins Alter erhalten bleiben, durch positive Gemeinschaftserlebnisse und ein verbessertes Verstehen des eigenen Tuns könne die Arbeitsfreude gesteigert werden. Um solche Erkenntnisse in die Praxis zu überführen, wurde 1925 das »Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung« (DINTA) gegründet. Nach 1933 wurde das DINTA in die Deutsche Arbeitsfront integriert und prägte als »Amt für Berufserziehung und Betriebsführung« das Erwerbsleben im NS-Staat entscheidend mit. Die Gestaltung der Arbeitswelt gehörte in der NS-Diktatur zu den maßgeblichen Feldern, auf denen die »Volksgemeinschaft« verwirklicht werden sollte; in der »Betriebsgemeinschaft« wurde sie wie in einem Mikrokosmos erfahrbar. Doch das »Wohlbefinden«, das der Betrieb unter Nutzung der neuesten Erkenntnisse der Arbeitswissenschaften sicherzustellen versprach, musste mit einer angepassten Lebensweise und dauerhafter Leistungsbereitschaft vergolten werden. Frank Becker erschließt in diesem Buch auf breiter Quellenbasis völlig neue Aspekte der nationalsozialistischen Gestaltung der Arbeitswelt und legt deren Wurzeln in der Weimarer Republik frei.
Vita
Frank Becker ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Institut der Universität Duisburg-Essen. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der politischen Kultur, intellectual history, Nationalismus und Krieg, Wissenschafts- und Wissensgeschichte der Arbeit sowie Theorie- und Methodenfragen.
Inhalt
Vorwort
1. Einleitung
2. Vom DINTA zum AfBuB – Institute als Strahlungszentren
3. Die Arbeitsidee
4. Arbeitswissenschaft – Arbeitswissen
4.1 Arbeitsphysiologie
4.2. Arbeitspsychologie
5. Kommunikation und Veranschaulichung
6. Instrumente der Arbeitsgestaltung
6.1 Lehrwerkstatt
6.2 Werkschule
6.3 Die Berufserziehung der Erwachsenen
6.4 Alters- und Invalidenwerk
6.5 Führung und Gemeinschaft
7. Arbeitserziehung und Sport
7.1 Der Aufbau eines Sportbetriebs
7.2 Die Verbesserung des Arbeitens
7.3 Die Erhaltung der Gesundheit
8. Arbeit und Geschlecht
9. Schluss
Anhang
Abkürzungen
Quellen- und Literaturverzeichnis
Publizierte Quellen
Anregungen, Anleitungen
Arbeit und Betrieb
Arbeitsschulung
Das Werk. Monatsschrift der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft
Dinta Mitteilungen
GHH. Werkszeitung der Gutehoffnungshütte in Oberhausen
Hütten-Zeitung der Abteilung Schalke der Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft
Hütten-Zeitung des Bochumer Vereins
Lehrwerkstatt
Werksbote. Zeitschrift für die Belegschaften der industriellen Werke Benrath, Reisholz und Hilden; 1936 umbenannt in Werksbote. Zeitschrift für die Betriebsgemeinschaften der industriellen Werke von Benrath, Reisholz und Hilden
Werkzeitschrift Deutsche Eisenwerke AG – Werk Schalker Verein
Archivquellen
Bergbauarchiv Bochum
Montanhistorisches Dokumentationszentrum
Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv Köln
Stadtarchiv Düsseldorf
Stadtarchiv Essen
Stadtarchiv Gelsenkirchen
Thyssen Archiv Duisburg
Forschungsliteratur
Vorwort
Heute gehört der »Burn-out« zu den bekanntesten Krankheiten, die – auch und vor allem – aus Überarbeitung und Überanstrengung resultieren. Die breite gesellschaftliche Debatte, die mittlerweile zu diesem Thema geführt wird, vermittelt den Eindruck, die Krankheit – und das zugrundeliegende Problem – gebe es erst seit kürzester Zeit; es sei primär eine Folge des Gebots der ständigen Erreichbarkeit und der gestiegenen Anforderungen an die Aufmerksamkeit, die mit den neuen Kommunikationsmedien einhergingen. In Übereinstimmung damit gilt der »Burn-out« als psychische Krankheit. Zieht man die Geschichte der Arbeit zu Rate, so zeigt sich ein völlig anderes Bild. Das Problem der strukturellen Erschöpfung – der Begriff »Burn-out« wurde noch nicht verwendet – kam schon zusammen mit dem Entstehen der Arbeitswissenschaften kurz vor dem Ersten Weltkrieg in den Blick. Der Versuch, dieses Problem zu lösen, gehörte sogar zu den Leistungen, von denen die Arbeitswissenschaften lange Zeit ihre Existenzberechtigung herleiteten. Die Ursachen der dauerhaften Ermüdung wurden allerdings zunächst auf der körperlichen Ebene verortet. Aber schon bald zog man auch psychische und soziale Faktoren in Betracht. Die folgenden Jahrzehnte waren von großen Anstrengungen geprägt, das Wissen auf diesem Feld zu vermehren und Arbeits-, Freizeit- und Erholungspraktiken zu entwickeln, die den gewonnenen Erkenntnissen entsprachen – und die strukturelle Erschöpfung der Arbeitenden verhindern konnten. In Deutschland waren es die Arbeitswissenschaftler und -pädagogen der Weimarer Republik, die hier entscheidende Grundlagen schufen; Grundlagen freilich, die in der NS-Zeit, wenn auch vielfältig transformiert, aufgegriffen wurden, um dort eine wichtige Säule der Arbeitssemantik und -gestaltung zu bilden. Damit hat sich die Forschung bislang noch kaum befasst. Dieses Buch soll einen Schritt dahin tun.
Oft haben Bücher Ähnlichkeit mit Flüssen – mit Flüssen, die weniger durch den Raum, als vielmehr durch die Zeit fließen. Die Nebenflüsse, die den Hauptfluss mit ihrem Wasser speisen, tun dies nicht in räumlicher, sondern in zeitlicher Abfolge. So entstand auch die vorliegende Darstellung. Einer ihrer Quellflüsse war die 2011 ausgesprochene Einladung von Hans-Ulrich Thamer (Münster) und Theo Plesser (Dortmund), an einer Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Max-Planck-Instituts für molekulare Physiologie und Leibniz Instituts für Arbeitsforschung in Dortmund, vormals Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie in Berlin, mitzuwirken. Schon bald kam es zu einem weiteren Zufluss: Seit 2013 gehöre ich dem Leitungsgremium des DFG-Graduiertenkollegs 1919 »Vorsorge, Voraussicht, Vorhersage. Kontingenzbewältigung durch Zukunftshandeln« an der Universität Duisburg-Essen an. Da dieses Kolleg auch die Vorsorge im Hinblick auf knappe Ressourcen behandelt, bot es eine ideale Plattform für die Diskussion der Frage, seit wann und inwiefern die Arbeitswissenschaften auch die menschliche Arbeitsenergie als eine Ressource aufzufassen lernten, die nachhaltig zu bewirtschaften sei. 2015 trat ich der von Stefan Berger (Bochum) initiierten Plattform »Wissenschaftsgeschichte des Ruhrgebiets« bei, die Institute und andere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen der Rhein-Ruhr-Region in den Blick nahm. 2017 schließlich organisierte ich mit Daniel Schmidt (Gelsenkirchen) die Konferenz »Industrielle Arbeitswelt und Nationalsozialismus. Der Betrieb als Laboratorium der ›Volksgemeinschaft‹ 1920–1960«, die die Geschichte von Arbeit und Arbeitswissenschaften in den Kontext der NS-Konzepte von »Betriebs«- und »Volksgemeinschaft« stellte. Profitierte der Fluss meiner Untersuchung von solchen Zuflüssen, so wurde er aber auch immer wieder von sonstigen Pflichten und Aufgaben zurückgestaut. So hat es bis heute gedauert, bis er endlich in das feste Bett einer Buchveröffentlichung strömte.
Profitiert habe ich auf dieser langen Strecke von mehreren Vorträgen in Forschungskolloquien, in denen ich erste Überlegungen und Zwischenergebnisse, später dann Thesen präsentieren konnte. Für entsprechende Einladungen danke ich Ute Daniel, Herbert Mehrtens und Thomas Scharff (Braunschweig), Heike Bungert, Thomas Großbölting und Christian Jansen (Münster), Bärbel Kuhn, Claudia Kraft und Angela Schwarz (Siegen), Rainer Liedtke (Regensburg) und Ewald Frie (Tübingen). Bei der Recherche haben mich Dr. Antonia Gießmann-Konrads und Dr. Darius Harwardt, bei der Redaktion Dr. Anna Michaelis und Torben Trellenkamp (alle Duisburg-Essen) in hervorragender Weise unterstützt. Die Zusammenarbeit mit Jürgen Hotz vom Campus Verlag ist zum wiederholten Male eine Freude gewesen.
Frank Becker, Duisburg-Essen, im Dezember 2020
1. Einleitung
»Menschenökonomie« – dieser Begriff bündelte zwei Jahrzehnte lang die Anstrengungen von deutschen Arbeitswissenschaftlern und Arbeitserziehern zur Veränderung der Arbeitswelt. »Menschenökonomen« gründeten 1925 in Düsseldorf das Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (DINTA) und erhielten in der NS-Zeit die Gelegenheit, ihre Konzepte in großem Maßstab zu implementieren. »Menschenökonomie« war dabei ein mehrdeutiger Begriff: Gemeint war eine Ökonomie, die sich am vermeintlichen Wesen des Menschen orientierte, ja auf dieses Wesen in besonderer Weise Rücksicht nahm, aber auch eine ökonomische Auffassung des Menschen selbst, das heißt ein ökonomischer Umgang mit seinen Kräften und Fähigkeiten. In diesem Sinne definierte der Arbeitswissenschaftler Johannes Riedel die Menschenökonomie im Gründungsjahr des DINTA programmatisch als eine Ökonomie der Wirksamkeit des Menschen.1 Vor allem mit den Energiereserven des Werktätigen musste nach wirtschaftlichen Kriterien verfahren werden: Die Arbeitsenergie galt als Ressource, die nicht übernutzt werden durfte, sondern nachhaltig zu bewirtschaften war – was konkret bedeutete, dass Energie, die durch Arbeit verbraucht worden war, wieder ersetzt werden musste. Weil solche Prozesse von den unterschiedlichsten physiologischen, psychologischen und arbeitspraktischen Faktoren beeinflusst wurden, forderten sie auf dem Feld der Arbeitsgestaltung zu hochkomplexen Problemlösungsstrategien heraus.
Deren historische Rekonstruktion macht die Verknüpfung mehrerer Forschungsstränge nötig. Zuerst sind Studien zur Geschichte von Leistung und Ermüdung zu nennen. Das Arbeitsethos der Moderne, das in der Arbeit nicht nur den universellen Schlüssel zur Umgestaltung aller Verhältnisse erblickte, sondern auch die Währung, die dem Individuum seinen gesellschaftlichen Status zuordnete, machte das Leistungsvermögen – bzw. dessen Nachlassen oder sogar vollständigen Verlust – zu einer basalen Kategorie. Vor diesem Hintergrund entstanden in den letzten Jahren Studien zur Genese des Leistungsbegriffs, der Leistungspraktiken und Leistungswissenschaften;2 als Pendant dazu gerieten aber auch Schwäche und Ermüdung in den Blick.3 Da sich diese Forschungen zumeist auf den Zeitraum vom späten 19. bis zum mittleren 20. Jahrhundert beziehen, stecken sie für die vorliegende Untersuchung einen Rahmen ab, wobei die Engführung auf das Feld der Arbeitsgestaltung allerdings manche Konkretisierung erlauben wird. Zudem werden die Begriffe Leistung und Ermüdung durch Gesundheit und Wohlbefinden ergänzt,4 was auch auf semantischer Ebene für neue Perspektiven sorgt.
Der zweite Forschungsstrang bezieht sich auf die Rationalisierungsbestrebungen, die vor dem Ersten Weltkrieg einsetzten, aber in den 1920er Jahren breitenwirksam wurden. Sie erfassten sämtliche Industriestaaten; die Grundidee bestand darin, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu zu nutzen, Arbeitsprozesse effizienter und damit für den Unternehmer profitabler zu gestalten, aber auch zu »humanisieren«, also für den arbeitenden Menschen erträglicher zu machen. Hierbei wurden unterschiedliche Wege beschritten – von der »humanen Betriebsführung« in den USA5 bis zu Lenins Parole »Sowjetmacht plus Elektrifizierung«, also der Einführung neuer Arbeitsmethoden unter sozialistischem Vorzeichen.6 In vielen Ländern entstanden »Musterbetriebe«, die fortschrittliche Formen der Arbeitsgestaltung modellhaft verkörperten; beispielhaft seien die Ford-Werke in Detroit, die Schuhfabrik von Thomas Bata in der Tschechoslowakei und der Schreibmaschinenhersteller Olivetti im norditalienischen Ivrea genannt. Diese Fertigungsstätten wurden – ebenso wie die Fortschritte in den Arbeitswissenschaften – international beobachtet und gaben auch außerhalb der jeweiligen Landesgrenzen viele Anstöße zur Nachahmung oder zur abwandelnden Integration in die eigenen Konzepte und Formen von Arbeitspolitik.7
Darüber hinaus spielten Rationalisierungsagenturen eine wichtige Rolle. Hierbei handelte es sich um Körperschaften, die Teilaspekte der Rationalisierung in besonderer Weise unterstützten. Um für Deutschland die wichtigsten zu nennen: Den Anfang machte 1908 der Deutsche Ausschuss für Technisches Schulwesen (DATSCH), eine vom Verein Deutscher Ingenieure und dem Verband Deutscher Maschinenbauanstalten gegründete Vereinigung zur Vereinheitlichung der industriellen Berufsausbildung;8 1913 folgte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie (KWIfA), das den Energieverbrauch im Arbeitsprozess untersuchte;9 1921 entstand das Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit in Industrie und Handwerk (RKW),10 1924 der Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlungen (REFA).11
Gewiss ist die Gründung des DINTA 1925 auch in diesem Kontext zu sehen, doch zu den Rationalisierungsagenturen bestanden einige gravierende Unterschiede. Dem Düsseldorfer Haus ging es nicht nur um die Verbesserung von Technik und Organisation, sondern – im Sinne der Menschenökonomie – auch um die Rolle des Werktätigen. Deshalb setzte es sich in erster Linie mit den direkt auf den Menschen bezogenen Teildisziplinen der Arbeitswissenschaft, Arbeitsphysiologie und Arbeitspsychologie auseinander. Überdies bettete es sein Tun in eine umfassende Weltanschauung ein. So galt es die Arbeiterschaft in neuer Weise zu integrieren, weil der Paternalismus des Kaiserreichs nicht über die Revolution von 1918/19 hatte hinübergerettet werden können. Die sozialistische Arbeiterbewegung erklärte den Betrieb zur Keimzelle des Klassenkonflikts – das DINTA dagegen stilisierte ihn zum Modell für neue Arbeitsbeziehungen und eine neue Arbeitskultur, die dafür sorgten, dass der Beschäftigte durch die Garantie seines Wohlbefindens an das Unternehmen gebunden wurde. Oberstes Ziel dabei war die dauerhafte Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit – um nicht noch einmal erleben zu müssen, was gegen Ende des Ersten Weltkriegs eingetreten war: ein kollektives Ausbrennen der Menschen an der Front und in der Heimat, ein Erschöpfungszustand, der bis in die Weimarer Jahre hinein fortwirkte.
Die Bedeutung des DINTA, das sich also durchaus einem umfassenden »Social Engineering« verpflichtet sah,12 ist in der Forschung schon verschiedentlich hervorgehoben worden, hat sich aber noch nicht in einer monografischen Darstellung der Geschichte des Hauses und seiner vielfältigen Aktivitäten niedergeschlagen. Stattdessen finden sich nur verstreute Aufsätze auf der einen,13 Kapitel bzw. Abschnitte in Büchern zur Industrie- und Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Republik auf der anderen Seite.14 Auch die vorliegende Untersuchung leistet keine Gesamtdarstellung, schon gar nicht im Sinne einer Institutionengeschichte. Sie will aber den Wissensstand zum DINTA durch die Analyse der in Düsseldorf entwickelten Konzepte zur Arbeitsgestaltung unter Einbeziehung von deren kurz- wie mittelfristiger Wirkung erweitern.
Die Einschätzung der älteren Forschung, den Arbeitsphysiologen und Arbeitspsychologen sei es in den Jahren der Weimarer Republik kaum gelungen, die deutsche Industrie zur Implementierung ihrer Forschungsergebnisse zu bewegen,15 muss dabei deutlich eingeschränkt werden. Für das gesamte Selbstverständnis des DINTA spielte es eine maßgebliche Rolle, dass die Erkenntnisse der Arbeitswissenschaften nicht nur rezipiert, sondern auch in die Praxis überführt wurden. Das Institut war geradezu als Scharnier zwischen Theorie und Praxis, zwischen Forschung und betrieblicher Anwendung konzipiert; sein Leiter Carl Arnhold, ein praxiserprobter Betriebsingenieur, der gleichzeitig Kontakte zu fast allen zeitgenössisch führenden Arbeitswissenschaftlern pflegte und deren Ideen in zahllosen eigenen Vorträgen und Publikationen aufgriff und verbreitete, personifizierte dieses Konzept.
Ein zentrales Instrument zur Überführung von arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen in die betriebliche Praxis war die Arbeitserziehung. Das DINTA griff die Idee der Berufsausbildung in eigenen »Lehrwerkstätten« auf und goss sie in eine neue Form. Diese Initiative hat schon seit den 1960er Jahren das Interesse historisch arbeitender Pädagogen bzw. der historischen Bildungsforschung geweckt;16 die einschlägigen Studien konzentrieren sich folglich auf die Erziehungsziele und -maßnahmen, legen jedoch auf Fragen von Industriepolitik und Arbeitsgestaltung, Wissenschafts- und Wissensgeschichte weniger Gewicht. Hier kann eine geschichtswissenschaftliche Untersuchung noch Neuland betreten.
Mit dem dritten Forschungsstrang sind Studien zur Geschichte der Arbeit in der nationalsozialistischen Ära gemeint. Seit einiger Zeit wird dem Bereich »Arbeit« von der NS-Forschung besondere Aufmerksamkeit gewidmet.17 Die Organisation der Arbeit war ein entscheidender Faktor bei der Konstruktion jener »Volksgemeinschaft«, die, so der Tenor zahlreicher neuer Untersuchungen,18 im Mittelpunkt von Ideologie und Herrschaftsaufbau des »Dritten Reiches« stand.
Trotz mancher Kritik19 hat sich dieser Ansatz in der NS-Forschung mittlerweile durchgesetzt. Im Kern geht es darum, den im Nationalsozialismus omnipräsenten Begriff der »Volksgemeinschaft« nicht von vornherein als Propagandaformel abzutun, sondern als zentrale Zielsetzung des Regimes ernst zu nehmen, die auf allen Politikfeldern als Gestaltungsprinzip und Legitimationsgrund diente. Weite Teile der Bevölkerung haben das Konzept offenbar goutiert und sich zur Deutung der eigenen Lebenssituation angeeignet; hieraus resultierte eine affektive Integration, die eine hohe Mobilisierungskraft entfaltete, auch wenn die Versprechen, die das Regime im Zeichen der »Volksgemeinschaft« machte, oftmals nur in Ansätzen sicht- und greifbar eingelöst wurden.20
Dennoch hat auch die Frage ihre Berechtigung, ob nicht die Forderung nach völkischer Vergemeinschaftung tatsächlich zum Abbau traditioneller Hierarchien geführt hat. Der Hinweis darauf, dass jedermann in erster Linie »Volksgenosse« sei, delegitimierte Privilegien und knüpfte dabei an die Egalisierungstendenz an, die mit der nationalen Idee schon seit ihren Ursprüngen einhergegangen war. Konkrete Aufstiegsmöglichkeiten schufen die zahlreichen neu gegründeten Organisationen und Institutionen des NS-Staates, die das Fortkommen weniger vom Herkommen als von der politischen Gesinnung, aber auch von persönlichem Einsatzwillen und erbrachter Leistung abhängig machten. Und das Führerprinzip, wie es der Nationalsozialismus definierte, war mit der Idee des Konsenses hinsichtlich der verfolgten Ziele zwischen Führer und Gefolgschaft verknüpft; für das Erreichen der Ziele trug der Führer die Verantwortung. All dies hatte vor dem Hintergrund einer miteinander geteilten Weltanschauung zu geschehen. Ein so definiertes Verhältnis konnte schnell brüchig werden, wenn die Gefolgschaft zu der Ansicht kam, dass der Führer seiner Verantwortung nicht mehr gerecht wurde oder der Konsens sich verflüchtigte. Auch hiermit erklären sich die großen Anstrengungen des Regimes, permanent die Stimmungslage in der eigenen Bevölkerung zu erfassen.
In der Welt von Arbeit und Erwerb bestand eine enge Verbindung zwischen der »Volks-« und der »Betriebsgemeinschaft«. Die »Betriebsgemeinschaft« sollte der Mikrokosmos sein, der auf den Makrokosmos »Volksgemeinschaft« verwies – und umgekehrt. In der »Betriebsgemeinschaft« ließ sich täglich einüben, was auch im Großen und Ganzen gelten sollte. Die bisherige Forschung hat hierbei vor allem an die – wie auch immer inszenierte – Überwindung des Klassengegensatzes gedacht. Der zum Betriebsführer umgedeutete Unternehmer sollte zwar auch weiterhin Leitungsaufgaben wahrnehmen, aber dabei Teil einer Gemeinschaft von Arbeitenden sein, die im Interesse der Daseinserhaltung des Volkes Güter erzeugten.
Die vorliegende Studie will die Analyse der NS-Arbeitsgestaltung nutzen, um zu einer genaueren Bestimmung dessen zu kommen, was den Erfahrungsraum »Betriebsgemeinschaft« ausmachte – und damit auch weitere Dimensionen des Wechselspiels von »Betriebs«- und »Volksgemeinschaft« in den Blick bekommen. Treten Gestalt, Funktionsweise und Ansprüche der »Betriebsgemeinschaft« in ein neues Licht, resultieren daraus möglicherweise auch neue Erkenntnisse zu den verschiedenen Ausprägungen des Konzepts der »Volksgemeinschaft«. So konnte das Versprechen, dass in Deutschland eine Arbeitskultur etabliert werden würde, die Erschöpfung ebenso vermiede, wie sie Gesundheit und Wohlbefinden förderte, als eine wesentliche Hilfestellung durch die »Volksgemeinschaft« begriffen werden, die im Betrieb gleichsam abgerufen wurde. Dafür mussten freilich auch Gegenleistungen erbracht werden – vor allem dauerhafte Arbeitswilligkeit und politische Anpassung waren die Voraussetzungen für Teilhabe. In »Betriebs«- und »Volksgemeinschaft« etablierte sich ein System des Gebens und Nehmens: Nur wer nach bestem Können und Wissen arbeitete, erhielt Hilfestellungen im Betrieb, und nur wer sein Dasein insgesamt in den Dienst der Nation stellte, profitierte von den Leistungen der »Volksgemeinschaft«.
Ebenso war die »Betriebsgemeinschaft« ein Laboratorium,21 in dem manches erprobt wurde, was anschließend auf den umfassenderen Rahmen der »Volksgemeinschaft« bezogen werden sollte. Und auch die Unterscheidung zwischen Inkludierten und Exkludierten, über die sich, wie die Forschung schon oft betont hat, die »Volksgemeinschaft« konstituierte, konnte an der Arbeit festgemacht werden. Die enormen Ressourcen, die der Nationalsozialismus in die Etablierung einer neuen Arbeitskultur investierte, kamen vollumfänglich nur den deutschen »Volksgenossen« zugute. Für andere Gruppen galt, dass sie nach Maßgabe ihrer Position in der vom Nationalsozialismus konstruierten Rassenhierarchie behandelt wurden: Wer relativ weit oben stand, wie zum Beispiel die Fremdarbeiter aus dem westlichen Ausland, konnte immerhin noch mit Schwundformen dieser Arbeitskultur rechnen;22 wer unten eingeordnet wurde, musste hingegen härteste Arbeitsbedingungen ertragen, wenn er nicht sogar als vom Regime verfolgte Person dem Programm der »Vernichtung durch Arbeit« zum Opfer fiel.23 »Sage mir, wie Du arbeitest«, könnte die Formel lauten, in der sich diese Vorgehensweise pointiert zusammenfassen ließe, »und ich sage Dir, wer Du bist.«
Das DINTA, das nach 1933 fortbestand und – nach einer Übergangszeit – als Amt für Berufserziehung und Betriebsführung (AfBuB) in die Deutsche Arbeitsfront (DAF) eingegliedert wurde, war für diese Form der Arbeitsgestaltung gewiss nicht allein verantwortlich, aber es hatte einen großen Anteil daran. Umso bemerkenswerter ist, dass es von der NS-Forschung bisher kaum beachtet wurde.24 Die wenigen Erwähnungen heben darauf ab, dass die Entwicklung des DINTA über das Jahr 1933 hinaus von einer starken Kontinuität geprägt gewesen sei.25 Diese These wird aber nur pauschal formuliert und nicht anhand der Programmatik und Vorgehensweise des Instituts auf seinen unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern konkret begründet. Im Übrigen standen den Kontinuitäten auch Veränderungen gegenüber, die ebenfalls noch herauszuarbeiten sind – vor dem Hintergrund der Frage, wie es gelang, die DINTA-Konzepte so abzuwandeln, dass sie zu Ideologie und Herrschaftspraxis des »Dritten Reiches« kompatibel wurden. Damit ordnet sich die Untersuchung von DINTA und AfBuB der komplexen Forschungsfrage nach den Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen Weimarer Republik und NS-Zeit zu – und nach der Fähigkeit des Nationalsozialismus, bereits existente Ideen und Praktiken mithilfe gezielter Transformationen zu Bausteinen des eigenen Herrschaftssystems zu machen. Diese Grundproblematik schlägt sich im Aufbau der vorliegenden Untersuchung nieder, in der alle Themenfelder – und Kapitel – über die Achse 1933 gespiegelt sind.
Dabei wird, wie oben bereits erwähnt, kein institutionengeschichtlicher Zugriff gewählt;26 auch politik-, wirtschafts-, sozial- und unternehmensgeschichtliche Ansätze, die selbstverständlich allesamt für eine »Geschichte der Arbeit« relevant sein können, werden zwar verschiedentlich aufgegriffen, aber nicht zentral gesetzt. Stattdessen wirft die Studie einen gleichsam »ethnografischen« Blick auf historische Formen des Arbeitens,27 rekonstruiert eine Arbeitssemantik,28 nimmt die »Mikrologik« des Arbeitens in den Blick – was genau geschah im Vollzug der Arbeit, welche Praktiken begleiteten den Arbeitsprozess, und aus welchem Wissen heraus wurde dabei agiert? Als theoretischer Referenzpunkt für eine solche Herangehensweise soll das Zentrum »Geschichte des Wissens« in Zürich genannt werden – das methodische Offenheit propagiert, aber auf der Basis von Grundannahmen wie derjenigen fußt, dass Wissensformationen nicht isoliert und kontextlos, sondern in Verbindung mit den Praktiken ihrer Erzeugung und Speicherung, Aneignung und Anwendung zu untersuchen sind.29
Darüber hinaus wird der Anschluss an Forschungen hergestellt, die sich mittlerweile unter dem Etikett einer Neuen Geschichte der Arbeit subsumieren lassen.30 Entscheidende Anstöße verdankt dieses Konzept dem Sozial- und Alltagshistoriker Alf Lüdtke, der den Begriff des »Eigen-Sinns« einführte und damit die subjektiven Bedeutungen, die Werktätige ihrem Tun zuschreiben, in die Analyse einbezog.31 Ihm nachfolgende Arbeiten erweiterten das Untersuchungsspektrum zusätzlich, wobei die jeweils gesetzten Schwerpunkte mit den turns identifiziert werden können, welche die Geschichtswissenschaft der letzten Jahrzehnte geprägt haben: Der linguistic turn lenkte die Aufmerksamkeit auf die Diskursivierung von Arbeit; der cultural turn fragte nach der Deutung von Arbeitsprozessen und der Erfahrungswelt des arbeitenden Subjekts;32 der spatial turn nach den Räumen, in denen gearbeitet wird, wobei diese als sozialkulturelle Räume aufgefasst werden, in denen Sinnzusammenhänge hergestellt und Interaktionen geformt werden;33 der emotional turn nach den Gefühlen, die bei der Arbeit entstehen und für den Arbeitserfolg bedeutsam sind;34 und der material turn schließlich hob auf die materielle Objektwelt ab, auf die Artefakte also, die bei der Arbeit benutzt werden.35 Terminologisch nicht mit einem turn verknüpft, aber keineswegs minder wichtig sind die Geschlechtergeschichte, die historische Definitionen männlicher und weiblicher Arbeit ebenso untersucht wie die geschlechtsspezifische Ausformung von Arbeitsplätzen,36 und die Körpergeschichte, welche die Involvierung des Körpers in alle Dimensionen des Arbeitens analysiert und dadurch mit den meisten der oben genannten Ansätze verknüpft ist.37
Für eine Rekonstruktion solcher Aspekte38 im Hinblick auf diejenigen Formen der Arbeitsgestaltung, die von DINTA und AfBuB zwischen 1925 und 1945 entwickelt wurden, steht ein breites Spektrum von Quellen zur Verfügung. Der oft beklagte Umstand, dass die Akten beider Häuser weitgehend verschollen seien,39 spielt in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle. Die Mitarbeiter der Institute haben ihre Überlegungen ständig verschriftlicht, und diese Texte sind entweder in Fachzeitschriften oder in internen Mitteilungsblättern abgedruckt worden, die fast vollständig erhalten sind. Ihre Produktion ging nur in der Schlussphase des Krieges zurück, sodass sich hier die Informationslage verschlechtert. Bis dahin berichtete die Fachzeitschrift Arbeitsschulung, die von den Instituten herausgegeben wurde, breit über deren Aktivitäten; 1940 erfolgte eine Namensänderung in Arbeit und Betrieb. Speziell der Arbeitserziehung widmete sich ab 1938 Die Lehrwerkstatt. Zeitschrift für betriebliche Berufserziehung in Industrie und Handwerk. Als internes Kommunikationsmedium, das u.a. Tätigkeitsberichte, statistisches Material, Listen von Kooperationspartnern und Presseberichte brachte, standen in den Weimarer Jahren die Dinta Mitteilungen zur Verfügung, an deren Stelle 1935 die Anregungen, Anleitungen für Berufserziehung und Betriebsführung traten, die ihren Lesern auch praktische Hinweise für den betrieblichen Alltag gaben.40
Weitere Informationen sind den Büchern und Artikeln zu entnehmen, die von Institutsmitarbeitern außerhalb der hauseigenen Medien veröffentlicht wurden. Solche Publikationen waren Teil öffentlicher und wissenschaftlicher Debatten, zu denen DINTA und AfBuB beitrugen, die aber auch auf die Häuser zurückwirkten. Folglich wird auch das diskursive Umfeld der Institute und ihrer Schwerpunktsetzungen behandelt, das Schrifttum auf den einschlägigen Themenfeldern, von dem viele Impulse ausgingen. Um die Umsetzung der Konzepte von DINTA und AfBuB in der betrieblichen Praxis – zumindest exemplarisch – zu erfassen, bieten sich die Werkszeitungen von kooperierenden Unternehmen als Quelle an.41
Selbstzeugnisse von Akteuren, die sich konkret auf die Arbeit der Institute und ihre Wirkung beziehen, sind leider kaum vorhanden. Die wenigen überlieferten Zeugnisse werden im Fortgang der Darstellung an geeigneter Stelle genutzt, allerdings ohne den Anspruch der Systematisierbarkeit. Trotzdem wäre es voreilig, aus diesem Dilemma die Schlussfolgerung zu ziehen, man könne über die »tatsächliche Umsetzung« der Konzepte beider Häuser keine Aussagen treffen. In der Institutspublizistik finden sich nicht nur normative Aussagen, sondern auch Zahlen, Fakten und Berichte zu sämtlichen Aktivitäten. Dazu kommen Berichte über die Gegebenheiten in den Betrieben, die teilweise von Institutsmitarbeitern verfasst waren, teils aber auch aus den Unternehmen selbst stammten. Gerade in den institutsinternen Medien wurden auch Probleme angesprochen und Enttäuschungen thematisiert; hier bestand keine Veranlassung zur Beschönigung, wie man sie den auf die Öffentlichkeit gerichteten Zeitschriften und den Werkszeitungen unterstellen kann – wobei auch dort die bestehenden Unzulänglichkeiten nicht gänzlich verschwiegen wurden.
Hinzu kommt ein grundsätzliches Argument: Die Publizistik beider Institute und ihrer Mitarbeiter war ausgesprochen praxisnah angelegt; das jeweils aufbereitete Wissen, die jeweils formulierte normative Vorgabe sollten unmittelbar praxisanleitend wirken. Hätte es Widerstand gegen die Umsetzung gegeben oder diese sich als sachlich unmöglich erwiesen, wäre es zu einer Rückmeldung an die Häuser gekommen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit zur Anpassung der Vorgaben geführt hätte.42 Anders formuliert: Theorie und Praxis waren aneinander gekoppelt; die Normen waren Teil der Praxis, die Praxis war Teil der Normsetzung.43
2. Vom DINTA zum AfBuB – Institute als Strahlungszentren
Das Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (DINTA) wurde 1925 auf Betreiben der Schwerindustrie an Rhein und Ruhr in Düsseldorf gegründet. Die Aufgabe des Instituts bestand in der Erforschung und Bestgestaltung von Arbeitsprozessen in technischen Berufen, wobei die fortschreitende Industrialisierung dafür sorgte, dass es kaum noch Berufe gab, in denen Technik keine Rolle spielte. Im Prinzip war der Anspruch des DINTA also geradezu universell – de facto arbeiteten zunächst vor allem Betriebe der metallverarbeitenden und der Textilindustrie mit dem Institut zusammen.44
Maßgebliche Akteure waren Albert Vögler, von dem die Initiative zur Gründung ausging und der in diesem Zeitraum zu einem der mächtigsten Manager in der westdeutschen Montanindustrie aufstieg, sowie Carl Arnhold, Betriebsingenieur beim Gelsenkirchener Hüttenwerk Schalker Verein, der die Leitung des Instituts übernahm. Deutlich weniger Einfluss hatte der Geschäftsführer Paul Osthold (1894–1979), ein promovierter Staatswissenschaftler, der sich politisch für die DNVP engagierte.
Die Biografien von Vögler und Arnhold verdienen genauere Beachtung. Vögler wurde 1877 in Dellwig, später nach Essen eingemeindet, als zweites von acht Kindern in eine Bergarbeiterfamilie geboren.45 Der Vater stieg vom einfachen Bergmann zum Steiger und später sogar zum Betriebsführer der Zeche Hugo in Buer bei Gelsenkirchen auf. Derselbe Aufstiegswille kennzeichnete auch die Lebensläufe der Söhne Albert und Eugen. Während Eugen es bis zum Vorstandsvorsitzenden der Hochtief AG brachte, führte Alberts Weg über eine zweijährige Ausbildung in einer Maschinenfabrik in Isselburg zum Ingenieurstudium an der TH Karlsruhe; seine Karriere in der rheinisch-westfälischen Montanindustrie wurde ab 1910 massiv durch Hugo Stinnes gefördert, der ihn 1917 zum Generaldirektor der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-AG (Deutsch-Lux) machte. Nach Stinnes’ Tod 1924 übernahm Vögler mehrere von dessen Aufsichtsratsmandaten, was seine Kontakte zu führenden Industriellenkreisen weiter vermehrte. Als 1926 aus zahlreichen westdeutschen Montankonzernen der Trust Vereinigte Stahlwerke AG gebildet wurde, erhielt Vögler das Amt des Vorstandsvorsitzenden. Damit leitete er den größten Stahlkonzern Europas und den zweitgrößten Stahlkonzern der Welt. Bis 1935 behielt er diese Stellung bei, dann wechselte er in den Aufsichtsrat des Unternehmens, zunächst als stellvertretender Vorsitzender, ab 1940 als Vorsitzender. Im April 1945 nahm er sich bei der Gefangennahme durch US-amerikanische Soldaten das Leben.
Politisch trat Vögler erstmals im Ersten Weltkrieg hervor, indem er Annexionsforderungen erhob, Aufrufe der Deutschen Vaterlandspartei unterzeichnete und am Ziel des »Siegfriedens« bis 1918 festhielt. 1919 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der liberalkonservativen und nationalen Deutschen Volkspartei (DVP), für die er 1919 in die Nationalversammlung einzog und von 1920 bis 1924 im Reichstag saß. Innerhalb der DVP gehörte Vögler dem rechten Flügel an, der sich 1924 als Nationalliberale Vereinigung von der Partei abspaltete. In der Endphase der Weimarer Republik sympathisierte er mit der DNVP, pflegte aber auch Kontakte zur NSDAP, ja zu Hitler persönlich. Ab dem 15. März 1933 gehörte er als parteiloser Reichstagsabgeordneter zur Fraktion der NSDAP.46 Die industrie- und rüstungspolitischen Ziele des Regimes unterstützte er mit Nachdruck; 1941 übernahm er zusätzlich zu seinen Aufgaben als Wirtschaftsführer die Präsidentschaft der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft (KWG), der größten außeruniversitären Forschungsinstitution in Deutschland. Hier engagierte er sich insbesondere für die Arbeitswissenschaften, denen er seit seinen beruflichen Anfängen stark verbunden war.
Insgesamt zeigt sich das Profil eines Mannes, der die Interessen von Nation und Industrie vertrat und dabei durchaus für autoritäre Strukturen plädierte, gleichzeitig aber auch an einer Einbindung und Förderung der Arbeiterschaft interessiert war. Einerseits hatte Vögler früh erkannt, dass motivierte und leistungsstarke Belegschaften auch für die Unternehmen von Vorteil waren; andererseits vermittelten ihm sein eigener Lebensweg und die Karrieren seines Vaters und Bruders die Einsicht in das Potenzial, das »kleine Leute« besaßen, wenn man ihnen Bildungschancen eröffnete und die richtige Einstellung vermittelte. Überdies lehrten die Arbeitswissenschaften, die Vögler intensiv rezipierte, wie sträflich die Vernachlässigung des »Produktionsfaktors Mensch« war – nicht nur für den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes, sondern auch in allgemeinpolitischer Hinsicht, denn die »Arbeitermassen« gewannen in der Weimarer Demokratie an Gewicht, und Vögler, der sich als politischer Akteur auch mit Fragen der Gestaltung des Gemeinwesens befasste, war sich über diese Entwicklung vollständig im Klaren. Nur wenn die Arbeiter den Eindruck gewannen, dass sich ihre Lebenslage verbesserte, bestand Aussicht, sie von den Arbeiterparteien und freien Gewerkschaften, die Vögler mit Nachdruck bekämpfte, wegzuziehen.
Ein Mann, der vielleicht nicht ganz »von der Pike auf« gelernt hatte, aber über große Erfahrung in verschiedenen Tätigkeitsbereichen verfügte, war auch Carl Arnhold, ab 1925 Leiter des DINTA.47 1884 in Elberfeld geboren, besuchte er nach der Realschule zunächst eine Maschinenbauschule, bevor er mit 19 Jahren als Konstrukteur im technischen Büro eines Eisenwerkes zu arbeiten begann. Schnell stieg Arnhold zum Betriebsingenieur auf; 1909 wechselt er jedoch als Lehrer an die gewerbliche Fortbildungsschule der Stadt Elberfeld. Parallel bildete er sich mit Ingenieurkursen an den Technischen Hochschulen Aachen und Braunschweig sowie mit Fachkursen für Gewerbelehrer weiter. 1914 wurde Arnhold Soldat und kämpfte vier Jahre lang an der Westfront. In dieser Zeit absolvierte er eine steile militärische Karriere – über den Leutnantsrang zum Adjutanten, dann zum Generalstabsoffizier einer Division. Seine pädagogischen Fähigkeiten nutzte er als Leiter des »vaterländischen Unterrichts«, der die Kampfmoral der Soldaten stärken sollte. Demselben Zweck diente die Divisionszeitung Graben-Post, die Arnhold herausgab.
Nach dem Krieg verblieb Arnhold noch bis 1920 in der Reichswehr und engagierte sich als »Antibolschewist« in der Elberfelder Kommunalpolitik. Erst 1921 kehrte er ins Berufsleben zurück, indem er eine Stelle als Ingenieur und Leiter der Werkschulbetriebe beim Gelsenkirchener Hüttenwerk Schalker Verein annahm. In den Folgejahren profilierte er sich als Experte für Berufserziehung und industrielle Menschenführung, deren Wert gerade in der metallverarbeitenden Industrie erkannt wurde, wo die Anforderungen an den Facharbeiter besonders hoch waren. Während der Ruhrbesetzung wurde Arnhold von der französischen Militärverwaltung, die ihm die Beteiligung an Sabotageakten vorwarf, festgenommen und zu viereinhalb Monaten Haft verurteilt.
Den Karrieresprung an die Spitze des DINTA verdankte Arnhold vor allem der Förderung durch den Generaldirektor des Schalker Vereins, Franz Burgers, und durch Albert Vögler, der ein großes Interesse daran hatte, die in Gelsenkirchen erprobten Konzepte zur allgemeinen Richtschnur für die Facharbeiter-Ausbildung in Deutschland zu machen. Auf diesem Weg schritt Arnhold bis 1933 erfolgreich voran; in der NS-Zeit setzte er seine Karriere als erklärter Sympathisant des Regimes und Parteimitglied fort. Auch zusätzliche akademische Meriten winkten; nachdem er schon 1931 die Ehrendoktorwürde der Technischen Hochschule Dresden erhalten hatte, wurde er dort 1936 zum Professor e.h. ernannt und mit einem Lehrauftrag für »Menschenführung« ausgestattet.48 Offenbar verdankte er diese Würdigung seinem Kontakt zu dem Dresdner Arbeitswissenschaftler Ewald Sachsenberg. Zur Mitte des Krieges geriet Arnhold allerdings – wohl aufgrund von Differenzen mit anderen NS-Granden – ins Abseits (s.u.). 1945 wurde er zunächst von den Alliierten in Haft genommen, wirkte dann aber noch bis ins hohe Alter an der Spitze eines Ablegers des DINTA, der Gesellschaft für Arbeitspädagogik (GefA) in Witten an der Ruhr, als erfolgreicher Berater mittelständischer Unternehmen. 1960 erhielt er das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse; 1970 verstarb er in Witten.
Ähnlich national eingestellt und von der Notwendigkeit von Autorität und Ordnung überzeugt wie Vögler, verband Arnhold mit diesem auch der Glaube an die Notwendigkeit einer besseren Förderung und Integration der Arbeiterschaft. Das paternalistische System des Kaiserreichs, das Zuckerbrot und Peitsche, konkret: Wohltätigkeit und Vorgesetztenschikane, miteinander verbunden hatte, war in beider Augen nicht mehr zeitgemäß; mehr zu erreichen war mit intrinsisch motivierten Arbeitern, die man überdies gegen eine politische Radikalisierung nach links immunisierte. Arnholds Biografie verrät, dass er für eine solche Tätigkeit bestens vorbereitet war: Gleichzeitig als Ingenieur und Pädagoge ausgebildet, hatte er sich zudem während des Krieges darin geübt, Soldaten einerseits durch Unterricht und mündlichen Vortrag, andererseits durch Artikel in Frontzeitungen von der Notwendigkeit des vollen Einsatzes zu überzeugen. Im Grunde musste er diese Fähigkeiten nur auf die Kommunikationsformen in der Industrie – Berufsausbildung und Werkszeitungen – sowie auf den Umgang mit Arbeitern übertragen.
Arnhold entwickelte, wie oben erwähnt, sein industriepädagogisches Konzept als Angestellter des Hüttenwerks Schalker Verein. Dieses Werk war in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg in raschem Tempo auf- und ausgebaut worden. Seine Gründer hatten es ursprünglich für den Gelsenkirchener Stadtteil Schalke vorgesehen, was die Namensgebung erklärt; tatsächlich errichtet wurde es einige Kilometer entfernt im Stadtteil Bulmke-Hüllen, wo 1874 der erste Hochofen angeblasen wurde. 1890 hatte das Werk bereits 1.200 Beschäftigte; 1901 erhöhte sich die Zahl der Hochöfen auf sechs. Vor dem Ersten Weltkrieg wuchs der Schalker Verein zur größten Eisengießerei Europas auf. Auch in der Weimarer Republik blieb das Werk erfolgreich, vor allem seine Gussrohre waren stark nachgefragt. Nachdem der Schalker Verein schon 1907 im Zuge der industriellen Verflechtungen im Ruhrgebiet eine Fusion mit der Gelsenkirchener Bergwerks-AG eingegangen war, wurde er 1926 Teil der Vereinigten Stahlwerke. 1934 erfolgte eine neuerliche Umstrukturierung: Nun gehörte der Schalker Verein zur Deutschen Eisenwerke AG Mülheim. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das zerbombte Werk wieder aufgebaut und im Zuge der politisch motivierten Entflechtung der deutschen Wirtschaft durch die Alliierten zunächst auf eigene Füße gestellt. Schon bald legten ökonomische Interessen jedoch eine Rückverflechtung nahe, diesmal mit dem Rheinstahl-Konzern. In den 1960er Jahren läutete die Bergbaukrise mit der sinkenden Nachfrage nach Gießstücken auch das Ende des Schalker Vereins ein. 1982 wurde der letzte Hochofen stillgelegt.49
Das Verbesserungsstreben der DINTA-Verantwortlichen entzündete sich naheliegender Weise an der Diagnose schwerer Mängel im Bestehenden. Die meisten Arbeiter, so meinten Vögler, Arnhold und andere erkannt zu haben, hatten – auch unter dem Einfluss der freien Gewerkschaften – eine ausschließlich negative Einstellung zu ihrer Berufstätigkeit entwickelt. Man fühlte sich missachtet und ausgebeutet und nahm dies nur hin, weil man seinen Lebensunterhalt verdienen musste und insofern keine andere Wahl hatte. Auch der Gesundheitszustand vieler Arbeiter war besorgniserregend – nicht so sehr im Hinblick auf konkrete Erkrankungen, sondern in dem viel fundamentaleren Sinne, dass viele Werktätige schon früh, nämlich in der Lebensmitte, buchstäblich die Kraft zur Arbeit verloren, also in einen Zustand dauerhafter Erschöpfung gerieten.50
Solche Erschöpfungszustände waren in der Industrie traditionell nicht sonderlich ernst genommen worden. Das 19. Jahrhundert hatte die Frage von Müdigkeit auf der einen, der Bereitschaft zur Arbeit auf der anderen Seite noch zu einem moralischen Problem erklärt: Wenn der Arbeiter nur wolle, könne er auch fleißig sein. Gegebenenfalls galt es diesen Willen durch Drohungen oder (finanzielle) Anreize zu stimulieren. Die vor dem Ersten Weltkrieg entstehenden Arbeitswissenschaften fassten das Problem völlig anders auf. Für sie stand jedem Menschen nur eine bestimmte Menge an Arbeitsenergie zur Verfügung. War diese verbraucht, setzte eine Erschöpfung ein, der nur die Zuführung neuer Energie entgegenwirken konnte.51 Die Arbeitsenergie musste also regelrecht bewirtschaftet werden, es war darauf zu achten, dass Abflüsse durch hinreichende Zuflüsse kompensiert wurden. Dies zu tun, lag ebenso im Interesse der Arbeiter wie der Unternehmer: Werktätige, die bis zum Eintritt in die Rente arbeitsfrisch blieben, erzielten eine höhere Lebensqualität und lieferten dauerhaft bessere Leistungen ab. Das DINTA begriff diesen Zusammenhang als eine Win-win-Situation.52
Bemerkenswert ist, dass diese Reform der Industriearbeit mit dem Ziel der Etablierung einer neuen Arbeitskultur nicht direkt durch Einflussnahme auf politische Entscheider, durch eine von den Betriebsleitungen ausgehende Umgestaltung der Unternehmensorganisation oder durch Überzeugungsarbeit gegenüber der Öffentlichkeit auf den Weg gebracht wurde – dies wären mögliche Alternativen gewesen –, sondern im Wesentlichen durch die Schaffung einer speziell diesem Zweck dienenden Institution. Die Industrie lagerte die gewünschte Reform gleichsam in ein Institut aus, dessen gesamte raison d’être in der Wahrnehmung dieser Funktion bestand. Für das DINTA bedeutete dies einerseits einen hohen Erfolgsdruck; das Nicht-Gelingen der gewünschten Reform konnte nicht durch Erfolge in anderen Bereichen kompensiert werden. Andererseits brachte die Verkörperung der gesteckten Ziele durch ein konkretes Haus, ja deren Personifizierung durch die DINTA-Mitarbeiter eine Tendenz zur Stilisierung mit sich – das Institut sollte Charisma besitzen.
Dafür sorgte schon der Gründungsmythos, den Vögler und Arnhold der neuen Einrichtung an die Seite strickten. Tief besorgt um die Zukunft der Industriearbeit in Deutschland, hätten die beiden immer wieder um Lösungen gerungen, bis sie schließlich auf die Idee gekommen seien, sich von berufener Seite beraten zu lassen. Sie traten aber nicht an einen Ökonomen oder Ingenieur heran, sondern an einen Philosophen – offenbar wollten sie eine Person hören, die das Große und Ganze von Politik und Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur im Blick hatte und sich gleichzeitig noch als Zeitdiagnostiker mit Fragen der Gegenwart und Perspektiven für künftige Entwicklungen auseinandersetzte. All diese Kriterien erfüllte in den Augen der Ratsuchenden der Münchner Philosoph Oswald Spengler (1880–1936). Seit der Veröffentlichung seines Werkes Der Untergang des Abendlandes im Jahr 1918 galt Spengler als neuer Stern am Himmel der deutschen Philosophie; nicht so sehr als Schulphilosoph, sondern als origineller Kopf, der auch gegen die Tendenzen seiner Zeit zu denken wagte – Spengler lehrte nicht an der Universität, sondern lebte als Privatgelehrter. Arnhold reiste im Auftrag von Vögler nach München, um den Philosophen in seiner Wohnung aufzusuchen. Das dort geführte Gespräch, so behauptete er später, vermittelte ihm wichtige Grundgedanken des DINTA-Programms.53 Später wurde Spengler eingeladen, zur Eröffnung des DINTA ein »Geleitwort« beizutragen,54 und auch in den Folgejahren brach sein Kontakt zu Vögler und anderen institutsnahen Industriellen nicht ab.55
Von diesem Gründungsmythos, der das Haus in den Kontext stark beachteter Neuansätze in der zeitgenössischen Philosophie stellte, leitete sich beim DINTA ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein ab – was wiederum zu einem hochgradig stilisierten Selbstverständnis als Organisation führte. Beliebt war der Vergleich mit den christlichen Orden; so wie diese von ihren festen Niederlassungen aus das Land missioniert hätten, sollten die Mitarbeiter des DINTA von Düsseldorf aus eine neue Lehre in der deutschen Industrie verbreiten. Wer zum Institut gehörte, war damit Teil einer verschworenen Gemeinschaft, die um einer Idee und ihrer Verbreitung willen zu einem Höchstmaß an persönlichem Einsatz bereit war.56 Eine andere Parallele bezog sich auf das preußisch-deutsche Offizierskorps, das ebenfalls von hohem Pflichtgefühl und eiserner Disziplin geprägt sei. Jeder Offizier wisse, dass er immer das gesamte Korps repräsentiere und er sich deshalb stets untadelig verhalten müsse, um nicht auch den Ruf seiner Kameraden zu beschädigen; und jeder Offizier handele jederzeit und an jedem Ort im Interesse der Zielsetzungen der gesamten Streitkräfte, auch wenn er nicht durch direkte Befehle dazu angehalten werde.57
Ingenieure, die sich an solchen Leitbildern orientierten, verkörperten überdies ein Männlichkeitsideal, das seit Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewann: Obwohl akademisch geschult, waren sie doch keine reinen »Wissenskrämer«, sondern »Männer der Tat«, die ihre Überzeugungen in die Realität überführten. Die wachsende Bedeutung der Industrie für die Machtentfaltung des Staates – von der prosperierenden Volkswirtschaft bis zur Bewaffnung der Streitkräfte – machte sie darüber hinaus zu einer »nationalen Machtressource«.58 Dieser Imagegewinn spiegelte sich auch darin, dass der Ingenieur und sein Schaffen in der Weimarer Republik zu einem beliebten Thema von Literatur und Kunst wurden.59
Aus dem Selbstverständnis des DINTA leitete sich die konkrete fachliche Aufgabe ab, sich die neuesten Erkenntnisse der Arbeitswissenschaften anzueignen, sie in die Programmatik des Hauses zu integrieren und in dieser Form an die Unternehmen weiterzugeben – also sie in die betriebliche Praxis zu überführen. Interessierte Werke konnten Kooperationsverträge mit dem DINTA abschließen; kurz nach der Gründung lag deren Zahl bei 78, im Berichtsjahr 1929/30 war sie bereits auf 212 gestiegen.60 Eigene Forschungen betrieb das DINTA anfänglich nicht, was sich allerdings 1929 insofern änderte, als eine feste Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle für industrielle Schwerarbeit in Gelsenkirchen vereinbart wurde.61 Überwiegend griffen Arnhold und seine Mitarbeiter aber auf Erkenntnisse zurück, die von Arbeitswissenschaftlern gewonnen wurden, die an freien Forschungsinstituten oder aber an Universitäten bzw. Technischen Hochschulen tätig waren.
Auch wenn der Schwerpunkt der DINTA-Arbeit anfangs in der Rhein-Ruhr-Region lag, fehlte es nicht an Anstrengungen, den Aktionsradius des Instituts zu erweitern. Nachdem etliche Unternehmen in Mittel- und Süddeutschland, aber zum Beispiel auch in Schlesien zur Mitarbeit gewonnen werden konnten, kam es 1927 sogar zur Gründung eines »Österreichischen Vereins für technische Arbeitsschulung« in Wien, der quasi als Filiale des Düsseldorfer Hauses agierte. Dieser Coup gelang, weil die Vereinigten Stahlwerke zuvor die Aktienmehrheit bei der Österreichisch-Alpinen Montangesellschaft erworben hatten.62 Um die Kontakte des Instituts zur Industrie, aber auch zu öffentlicher Verwaltung und Wissenschaft weiter zu verbessern, rief Vögler zudem 1929 eine Gesellschaft der Freunde des DINTA ins Leben.63
Das DINTA sah, wie oben erwähnt, seine Aufgabe darin, wissenschaftliche Erkenntnisse in die betriebliche Praxis zu überführen. Arbeiter sollten so geschult werden, dass sie im Sinne der Arbeitsphysiologie ihre Arbeitsweise und im Sinne der Arbeitspsychologie ihre Arbeitseinstellung optimierten. Diese Schulung nahm das DINTA aber nicht direkt, sondern indirekt in Angriff: durch die Ausbildung der Ausbilder. Die Unternehmen konnten Ingenieure an das Institut entsenden, das anschließend für deren Gehälter aufkam, sich das Geld aber vom vorherigen Arbeitgeber zurückholte.64 Bei der Auswahl der – ausschließlich männlichen – Kandidaten spielte das technische Können durchaus eine Rolle, die größere aber spielten Führungsqualitäten und pädagogisches Talent.65 15 Ausbildungsplätze standen zur Verfügung;66 die Schulung sollte zunächst ein ganzes Jahr dauern, doch schon bald reduzierte man ihren zeitlichen Umfang auf sechs Monate.67 Während dieser Zeit hielt sich der künftige DINTA-Ingenieur abwechselnd in Düsseldorf und Gelsenkirchen auf.68 Das Haupthaus in Düsseldorf bot den Kursteilnehmern auch Übernachtungsmöglichkeiten.69 Es handelte sich um ein Gebäude auf dem Rheinmetall-Gelände,70 das vom DINTA bezogen worden war, nachdem sich Pläne für die Anmietung einer vormaligen Kaserne des Niederrheinischen Füsilierregiments Nr. 39 an der Roßstraße zerschlagen hatten.71 Die Nebenstelle in Gelsenkirchen befand sich in direkter Nähe zum Schalker Verein und wurde von einem Bergassessor geleitet.72 Während das Haupthaus sogar mit Vortragssälen aufwarten konnte, wich man in der Nebenstelle allerdings in das Werksgasthaus des Schalker Vereins aus, wenn man größere Zusammenkünfte durchführen oder Referenten einladen wollte.73
Von montags bis donnerstags wurde der angehende Ausbilder in Gelsenkirchen geschult, und zwar einerseits in der Forschungsstelle für industrielle Schwerarbeit,74 andererseits beim Schalker Verein, dessen Einrichtungen, wie oben bereits erwähnt, in den Augen des DINTA Modellcharakter hatten – und von den Ingenieuren später in vergleichbarer Form in anderen Unternehmen eingeführt werden sollten.75 Das Wochenende einschließlich des Freitags wurde dagegen in Düsseldorf verbracht.76 Dort hörten und diskutierten die Kursteilnehmer Vorträge, die von den festen Mitarbeitern des DINTA, aber auch von auswärtigen Experten gehalten wurden und die sich sowohl den verschiedenen Feldern der Arbeitswissenschaften als auch politisch-sozialen und pädagogischen Problemen widmeten.77 Für einige Themenschwerpunkte wich man an das Gewerbelehrerseminar in Köln aus.78 Ein weiteres Ausbildungselement waren Exkursionen, so etwa an das Dortmunder Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie, das für diesen Zweig der Arbeitswissenschaften die bedeutendste Forschungsstätte in Deutschland war.79 Hinzu kamen Leibesübungen, für die eigens ein Turn- und Sportlehrer engagiert wurde.80 Da die Ausbilder künftig ihre Lehrlinge auch auf diesem Gebiet begleiten und unterstützen sollten, wurde es als notwendig angesehen, ihnen eine zumindest grundlegende Sportlichkeit zu vermitteln.81 Erwünscht war es, dass die DINTA-Ingenieure das Reichssportabzeichen erwarben.82
Nach Beendigung ihrer Ausbildung konnten die Ingenieure auf eigenen Wunsch zu einwöchigen Schulungskursen nach Düsseldorf zurückkehren, um ihr Wissen aufzufrischen bzw. auf den neuesten Stand zu bringen – vergleichbar mit den Reserveübungen, zu denen Militärpersonen, auch die vom DINTA als Rollenvorbilder genutzten preußisch-deutschen Offiziere, regelmäßig zur Fahne zurückkehrten.83 Diese Kurzlehrgänge wurden nach und nach auch für andere Personengruppen geöffnet, die an der Lehrlingsausbildung beteiligt waren oder aus sonstigen Gründen vom Knowhow des DINTA profitieren sollten, so etwa Werkstattmeister, aber auch Vorarbeiter.84 Die konkrete Ausgestaltung der Kurse wurde in einigen Punkten auf die jeweilige Klientel abgestimmt, folgte im Großen und Ganzen aber demselben Muster. Den Schwerpunkt bildeten Vorträge zu den Aufgaben und Ausbildungsmethoden des DINTA, Besichtigungen von Musterbetrieben und ein Besuch im Düsseldorfer Reichsmuseum für Gesellschafts- und Wirtschaftskunde (kurz Reichswirtschaftsmuseum), wo man sich vor allem den Abteilungen »Versailler Diktat« und »Die deutsche Rationalisierungsbewegung« widmete.85 Gerade die Wahl der Abteilung »Versailler Diktat« macht deutlich, wie stark das DINTA trotz gegenteiliger Beteuerungen auch einer (unterschwelligen) politischen Agenda verpflichtet war.86
Die Initiative, den Ingenieur als Erzieher zu etablieren, stellte durchaus eine Provokation dar. Konnte jemand, der in der Welt der Maschinen zu Hause war, Experte für die Belange des Menschen sein? War eine Person, die für das zweckbestimmte Arbeiten in der Industrie stand, als Pädagoge vermittelbar, der den ganzen Menschen im Blick haben sollte? Gerade eine solche Figur konnte und sollte als Erzieher auftreten, lautete die Antwort des DINTA. Im 20. Jahrhundert, im Zeitalter von Wissenschaft und Technik, war die Interaktion des Menschen mit der Maschine zentraler Bestandteil seines Lebens. Für diese Interaktion geeignete Formen zu finden, stellte die große Herausforderung der Gegenwart dar; niemand konnte hier kompetenter sein als der Ingenieur, für den der Umgang mit Technik tägliche Erfahrung war.
Dafür musste der Ingenieur freilich beide Interaktionspartner sehen, die Maschine und den Menschen. In der Vergangenheit hatte es Vertreter dieses Fachs gegeben, die über der Faszination an der Maschine den Menschen vergessen hatten – oder, noch kritikwürdiger, vom Menschen die vollständige Unterwerfung unter die Anforderungen der Technik verlangten. Stattdessen sollte ein neuer Ingenieurtypus erkennen, dass die Maschinen keine unstrittigen Sachzwänge schufen, sondern es sehr verschiedene Formen des Umgangs mit ihnen gab. Der Mensch war nicht Objekt der Industrie, sondern blieb deren Gestalter, und er konnte sich dabei an den unterschiedlichsten Maximen orientieren.
Als 1933 der NSDAP die Macht übergeben wurde, passte sich das DINTA schnell den neuen Gegebenheiten an. Das Konzept des Hauses fügte sich nach einigen Modifikationen, die es stärker rassifizierten, fast bruchlos in den »reactionary modernism« (Jeffrey Herf) des Nationalsozialismus ein.87 Anders formuliert: Das Institut stellte den neuen Machthabern ein industriepädagogisches Konzept zur Verfügung, das diese als Baustein für ihre eigene Politik der Arbeitsgestaltung verwenden konnten. So gehörte auch das DINTA zu jenen Institutionen, die – mit Ian Kershaw gesprochen – »dem Führer entgegenarbeiteten«,88 die dort ihre Ideen und ihr Knowhow anboten, wo die Nationalsozialisten keine eigenen Konzepte besaßen oder sich über den einzuschlagenden Weg aufgrund widerstreitender Ansichten noch unklar waren.
Bei genauerer Betrachtung lässt sich sogar sagen, dass der Machtwechsel von 1933 das DINTA keineswegs unvorbereitet traf. Bereits in den Jahren zuvor war in den Publikationen des Instituts über Führertum und Gefolgschaft debattiert worden, und auch die Begriffe »Betriebs«- und »Volksgemeinschaft« hatten sich bereits eingebürgert.89 Überdies war es schon im Frühjahr 1932 in Bad Godesberg zu einem Treffen von Arnhold und Hitler gekommen. Dort habe er, so erinnerte sich Arnhold im Folgejahr, »vom Führer die Weisung bekommen […], Gewehr bei Fuß zu verharren«. Nach der Regierungsübernahme durch die NSDAP sei der Boden dann dafür bereitet gewesen, dass »die Dintaarbeit als Nationalerziehung praktischer Nationalsozialismus«90 werden konnte. 1934 gab Arnhold sogar an, schon in der »Freikorpszeit« mit den »Ideen des Nationalsozialismus in Berührung gekommen zu sein«; persönliche Kontakte bestanden seit
»meiner Verbindung zur Parteileitung in München, wohin man mich rief, wenn etwas über Erziehung oder Arbeitsdienst zu besprechen war, bis zu dem Augenblick vor zwei Jahren, wo der Führer mich zu sich rief, um sich von mir Vortrag halten zu lassen. Er stellte damals fest, daß die Dinge, die wir auf der Insel der Wirtschaft machten, aus der gleichen Ideenwelt stammten wie sein großes Werk, und daß wie der Ursprung, so auch das Ziel unserer Arbeit das gleiche sei. Er gab mir ausdrücklich den Auftrag, dafür zu sorgen, daß die Dintaarbeit während der Zeit des Kampfes, die noch bevorstand, nicht zerstört würde, und daß sie sauber bliebe, damit man sie einbauen könne, wenn die Zeit gekommen wäre. Das haben wir getan.«91
Auch wenn Arnhold die Neigung verspürt haben mag, die Nähe des DINTA zum Nationalsozialismus je stärker hervorzukehren, desto mehr das NS-Regime seinen Machtanspruch durchgesetzt hatte – es steht außer Frage, dass die Konzepte des DINTA mit zentralen Ideologemen des Hitlerstaates vereinbar waren. Arnhold stilisierte diesen Zusammenhang in einem Vortrag vor Münchner Lehrlingen aus dem September 1934 zu einer Romanze, zu einer Erzählung von einem heimlich beschrittenen, auch gefahrvollen Weg, der am Schluss aufgrund einer »glücklichen Wendung« ans ersehnte Ziel geführt habe:
»In aller Stille hat sich dann unsere Arbeit über ganz Deutschland ausgebreitet. Lehrwerkstatt entstand neben Lehrwerkstatt, Werkzeitung neben Werkzeitung und viele andere Dinge mehr, die das Dinta ins Leben rief. Als dann die nationale Revolution alles Kranke, Faule und Ungesunde hinwegfegte, konnte ich dem Führer und der Deutschen Arbeitsfront einen gut funktionierenden und schon praktisch erprobten Ausbildungs- und Führerapparat vorweisen. Aber erst im Zeichen des Hakenkreuzes konnten wir die vor vierzehn Jahren in aller Stille begonnene Arbeit vollenden.«92
Was hier pathetisch überhöht wurde, drückte sich aber auch ganz praktisch in der institutionellen Entwicklung aus. Schon im Sommer 1933 wurde das DINTA zum Deutschen Institut für nationalsozialistische technische Arbeitsforschung und -schulung umbenannt und der Deutschen Arbeitsfront (DAF) angegliedert;93 zwei Jahre später ging es im Amt für Arbeitsführung und Berufserziehung (AfAuB) auf, einem in Berlin-Zehlendorf94 ansässigen Führungsamt im Zentralbüro der DAF,95 das ab 1936 als Amt für Berufserziehung und Betriebsführung (AfBuB) firmierte.96 Dessen Leitung lag in den Händen von Arnhold, bis dieser, obwohl seit Kriegsbeginn bei der Wehrmacht dienend,97 im Mai 1940 als »Generalreferent für Berufserziehung und Leistungssteigerung« ins Reichswirtschaftsministerium berufen wurde;98 schon die Benennung des Referats zeigte, dass DINTA-Ideen die politische Agenda längst auf höchster Ebene mitbestimmten. 1938 hatte auch das Arbeitswissenschaftliche Institut der DAF seine Aufgabe mit den Worten beschrieben, es gehe um die »Führung des Kräftehaushaltes des deutschen Volkes«.99 Zu Arnholds wichtigsten Initiativen im Wirtschaftsministerium gehörten die Einführung von Berufserziehungswerken auch im Handwerk und die sogenannte »Ostaktion«, also die Übertragung des Systems der Lehrlingsausbildung und Berufserziehung auf die von Hitlerdeutschland einverleibten Gebiete im Osten.100
Im AfBuB trat Albert Bremhorst die Nachfolge von Arnhold an.101 Bremhorst amtierte freilich nur bis zum Februar 1942, als sein Vorgänger erneut mit der Leitung des Hauses betraut wurde, die er nun parallel zu seiner ministeriellen Tätigkeit wahrnahm.102 Im weiteren Verlauf des Jahres 1942 kam es zu einer neuerlichen Umbenennung des Hauses in »Amt für Leistungsertüchtigung, Berufserziehung und Betriebsführung«103 – offenbar sollte der Aspekt der in allen Bereichen des Arbeitslebens gewünschten Leistungssteigerung noch stärker akzentuiert werden.
Der Herbst 1942 brachte auch das jähe Ende von Arnholds Karriere in der Arbeitspolitik. Im November verlor er gleichzeitig die Leitung des AfBuB – diese Bezeichnung wird hier durchgehend verwendet, weil sie im Vergleich zu den anderen Namen des Amtes am längsten Bestand hatte – und den Posten im Wirtschaftsministerium. Über die genauen Hintergründe ist wenig bekannt. Wahrscheinlich stürzte er, weil er eigenmächtig versucht hatte, weitere Kompetenzen an sich zu ziehen und dadurch in Streit mit dem DAF-Leiter Robert Ley geraten war.104 Arnhold musste sich in die Privatwirtschaft zurückziehen, wo er bis Kriegsende als Flugzeugkonstrukteur arbeitete.105 Die Leitung des Amtes wurde von Herbert Steinwarz übernommen.106
Das AfBuB widmete sich, wie es schon für das DINTA gegolten hatte, vor allem der Berufserziehung. Hatte dieser Begriff in den Weimarer Jahren in erster Linie die Nachwuchsschulung gemeint, so erweiterte er sich in der NS-Zeit: Hinzu kamen die Schulung von Führungskräften und – ab 1937 im Rahmen des »Berufserziehungswerkes« – die Fortbildung von Ausgelernten. Das erste »Berufserziehungswerk« wurde am 27. Oktober 1937 beim Bochumer Verein gegründet. Der Artikel in den Anregungen, Anleitungen für Berufserziehung und Betriebsführung, der hiervon berichtete, verwies ausdrücklich darauf, dass wieder ein Eisen- und Stahlwerk des Ruhrgebiets an der Wiege eines neuen Konzepts in der Berufsausbildung gestanden habe, so wie die Idee für die Lehrwerkstätten 1921 beim Schalker Verein entstanden sei.107 Sowohl das Gelsenkirchener als auch das Bochumer Werk wurden im »Dritten Reich« zu NS-Musterbetrieben ernannt.
Das »Kerngeschäft« dieser mehrdimensionalen Berufserziehung konnte vom AfBuB bis zum Untergang des Regimes in der Konkurrenz zu anderen Institutionen der NS-Arbeitsgestaltung behauptet werden. Nur die Bereiche Freizeit auf der einen sowie Gestaltung der Arbeitsräume auf der anderen Seite mussten 1936 an die NS-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« (KdF) und deren Amt »Schönheit der Arbeit« abgegeben werden, die allerdings ebenfalls der DAF angehörten und insofern eng mit dem AfBuB kooperierten.108 Für eine anerkannte Position des AfBuB im Machtgefüge des NS-Staates spricht auch, dass das Amt wiederholt Besuch durch NS-Prominenz erhielt: 1938 wurden nicht nur Erhard Milch und Ernst Udet als Vertreter des Luftfahrtministeriums,109 sondern auch Hermann Göring von Arnhold (im Beisein von Ley) empfangen110 – von einer internationalen Ausstrahlung des Hauses zeugt, dass sich auch der Atlantikflieger Charles Lindbergh in Zehlendorf einfand.111 1941 trug sich Rudolf Hess, Stellvertreter des »Führers«, ebenfalls auf der Gästeliste ein.112
Wie es bereits für das DINTA gegolten hatte, suchte auch das AfBuB den Austausch mit vergleichbaren Instituten im Ausland. Zumindest in der Vorkriegszeit, in der der Wissenstransfer noch weniger restriktiv gehandhabt wurde, spielten solche Aktivitäten eine gewisse Rolle. NS-Arbeitswissenschaftler veranstalteten113 und besuchten114 internationale Kongresse, und sie besichtigten berufserziehende Einrichtungen im Ausland. So brachen, um ein Beispiel zu geben, Arnhold und neun Mitarbeiter des AfBuB 1938 zu einer Reise nach Ivrea in Norditalien auf, wo sie die Lehrwerkstatt mit Werkschule der Schreibmaschinenfabrik Olivetti einer genauen Inspektion unterzogen.115 Solche Kontakte erlaubten es dem Amt auch, die eigene Position im internationalen Wettbewerb zu bestimmen. 1942 schrieb Arnhold, Deutschland habe bei der Lehrlingsausbildung einen Vorsprung von zehn bis 15 Jahren, der unbedingt gehalten werden müsse; auch die Berufserziehungswerke seien weltweit führend.116
Schon die Entwicklung bei der Nachwuchsschulung, für die das DINTA ab 1925 auf das Gelsenkirchener Konzept der Lehrwerkstätten gesetzt hatte, macht deutlich, wie stark das Amt und die vom Amt betreuten Einrichtungen in der NS-Zeit expandierten. Zugespitzt ließe sich sagen, dass das AfBuB unter dem Nationalsozialismus eine Bedeutung gewann, von der die Verantwortlichen des DINTA in den Weimarer Jahren nur hatten träumen können. Hatte es 1933 167 Lehrwerkstätten gegeben, in denen 16.222 Lehrlinge ausgebildet wurden,117 so stieg ihre Zahl bis 1940 auf 3.304 an; sie verzwanzigfachte sich also fast.118 Da dort gleichzeitig »nur« 244.250 Lehrlinge tätig waren,119 also deutlich weniger als das Zwanzigfache der Zahl von 1933, liegt der Rückschluss nahe, dass pro Lehrwerkstatt im Zeitverlauf weniger Lehrlinge aufgenommen wurden – offenbar gab es nicht nur eine quantitative Steigerung, sondern auch Anstrengungen, die Ausbildungsqualität durch die Verkleinerung der Lerngruppen zu verbessern. Ob sich diese Doppelstrategie im weiteren Kriegsverlauf – für 1944 wurde sogar die Zahl von rund 5.000 Werkstätten genannt – aufrechterhalten ließ, ist allerdings höchst fraglich.120 Zu den Lehrwerkstätten kamen noch, wie auch bereits in den Weimarer Jahren, »Anlernwerkstätten« und »Lehrecken« für Jugendliche, für die keine vollwertige Lehrstelle verfügbar war. Auch dort wurde, zumindest im Ansatz, nach den Prinzipien des AfBuB gearbeitet.121 Zu diesen Einrichtungen liegen keine genauen Zahlen vor, ebenso wenig wie zu den Werkschulen, bei denen es auch nicht unerhebliche Zuwächse gab.122
Um eine solche Fülle von Einrichtungen betreuen zu können, musste auch das AfBuB zügig wachsen. Dadurch, dass die Hauptverwaltung nach Berlin-Zehlendorf umzog, konnte im Düsseldorfer DINTA-Haus eine der vier ersten Landesschulen für Arbeitsführung untergebracht werden, die nun speziell für die Ausbildung der Ausbilder zuständig waren. Das Angebot richtete sich an Betriebsingenieure, die die Leitung von Lehrwerkstätten übernehmen sollten, aber auch an Lehrmeister und -gesellen.123 Die drei anderen Einrichtungen entstanden in Breslau, Stuttgart und Gelsenkirchen,124 wobei letztere als »Reichsschule für Ingenieure« firmierte125 – die Bezeichnungen waren uneinheitlich und änderten sich teilweise auch im Zeitverlauf. Nach dem »Anschluss« Österreichs 1938 kam eine weitere Schule in Wien hinzu.126
In diesen Reichs- und Landesschulen wurde im Prinzip ähnlich agiert, wie es in der Weimarer Republik üblich gewesen war. Die Menschen, die aus den Betrieben kamen, sollten weitergebildet werden, also Wissen aufnehmen, aber gleichzeitig auch Wissen abgeben – indem sie den Ausbildern aus ihrer betrieblichen Praxis berichteten. Das AfBuB saugte dieses Wissen auf, speicherte es und berücksichtigte es bei der Entwicklung der eigenen Konzepte, die insofern eine große Praxisnähe für sich in Anspruch nehmen konnten.
Eine Neuerung brachte das Jahr 1939, in dem das Volkswagen-Vorwerk in Braunschweig seine Tore öffnete. Dort wollte die DAF ihr Arbeitskonzept konsequent verwirklichen. Das Werk wurde mit den größten und modernsten Einrichtungen ausgestattet – und verkörperte im Verbund mit dem Hauptwerk in Wolfsburg fortan die NS-Arbeitskultur generell wie kein anderes Unternehmen in Deutschland.127 Dem Schalker Verein, der diese Leitbildfunktion ebenfalls beanspruchte, war damit ein starker Konkurrent erwachsen. Bezeichnend war, dass Braunschweig auch eine Reichsschule für Ausbildungsleiter erhielt – die bei Kriegsbeginn allerdings in das thüringische Bad Frankenhausen (im Südharz) verlegt wurde, wo sie im Dezember 1939 ihren Betrieb wieder aufnahm.128
Die drei zusätzlichen Schulen, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden, wurden allesamt nicht mehr in Groß-, sondern in landschaftlich reizvoll gelegenen Kleinstädten angesiedelt. Einerseits sollten die Schulen vor Bombenangriffen geschützt sein, andererseits ging es darum, den Teilnehmern ein erholsames Naturerlebnis zu verschaffen. So wählte die DAF für die siebte Schule das Städtchen Augustusburg im Erzgebirge;129 die achte Einrichtung wurde 1942 im lothringischen Diedenhofen (frz. Thionville) an der Mosel und die neunte 1943 in Bielatal in der sächsischen Schweiz eröffnet.130 Der Aufenthalt der Fortbilder an den Schulen, der inzwischen nur noch vier Wochen umfasste131 – für eine längere Ausbildung reichten die Ressourcen nicht mehr aus –, wurde in der üblichen Weise gestaltet: Ein morgendlicher Fahnenappell und Leibesübungen rahmten ein umfangreiches Vortragsprogramm; Mehrbettzimmer mit Etagenbetten sorgten für ein »Lagergefühl«, das die Gemeinschaft fördern sollte.132
Mit dem Ausbau des AfBuB ging zudem einher, dass innerhalb des Hauses neue Abteilungen und Institute geschaffen wurden, die dessen Projekte auf ein breiteres Fundament stellten. 1936 richtete das Amt eine eigene Dienststelle für Arbeitsphysiologie ein; dort wurde zwar nicht geforscht, aber der Anspruch erhoben, das arbeitsphysiologische Wissen zu erfassen und bei Bedarf an die Betriebe weiterzugeben.133 1940 gründete die DAF zudem das Institut für Arbeitspsychologie und Arbeitspädagogik unter Josef Mathieu, das ebenfalls dem AfBuB angeschlossen wurde.134 Damit hatten jene beiden Teildisziplinen der Arbeitswissenschaften, die für das AfBuB besondere Relevanz besaßen, also die Arbeitsphysiologie und die Arbeitspsychologie, im Amt ihre institutionelle Heimstatt gefunden.135 Eine Besonderheit des Instituts für Arbeitspsychologie und Arbeitspädagogik bestand im Übrigen darin, dass auch mehrere Frauen dort tätig waren. Unter ihnen ragte Martha Moers heraus, die zuvor Professorin für Psychologie an der Hochschule für Lehrerbildung in Beuthen gewesen war. Zu Moers’ akademischen Lehrern hatten bekannte Arbeitswissenschaftler wie Walther Moede und Walther Poppelreuter gehört. Während ihrer Tätigkeit am Institut trat sie in erster Linie mit Veröffentlichungen zum »weiblichen Arbeitscharakter« hervor. 1944 wechselte sie allerdings an das Institut für Klinische Psychologie der Universität Bonn, wo gegen Kriegsende vor allem hirnverletzte Soldaten behandelt wurden.
Die Ausweitung des Krieges durch den deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 hatte auch für das AfBuB Konsequenzen. Der enorme Personalbedarf der Streitkräfte schuf eine Lage, in der die eigenen Bestände permanent verteidigt werden mussten. Einerseits drohte die Gefahr, dass Mitarbeiter eingezogen wurden, was die dauerhafte Erfüllung bestimmter Aufgaben in Frage stellte;136 andererseits hing das Damoklesschwert einer politischen Entscheidung über dem Amt, die dessen Anstrengungen für nicht hinreichend kriegsrelevant erklärte und damit einen massiven Rückbau einleitete. Von Jahr zu Jahr mehrten sich die Stimmen, die der Meinung Ausdruck verliehen, in einem Kampf auf Biegen und Brechen könne sich Deutschland eine so aufwändige Berufsausbildung und Arbeitsgestaltung, wie sie das AfBuB propagiere und anleite, einfach nicht mehr leisten. Erinnert wurde an den Ersten Weltkrieg, in dem Lehrlinge vor allem Granaten drehten, weil jede Hand für die Unterstützung der Streitkräfte gebraucht wurde.
Doch genau hier hakten die Verantwortlichen des Amtes ein: Habe nicht die Erfahrung des Ersten Weltkrieges gezeigt, wie fatal die Folgen einer solchen Form des totalen Kriegseinsatzes waren? In der Nachkriegszeit fehlten der deutschen Industrie hinreichend qualifizierte Facharbeiter.137 Dieser Mangel sei bis in die Gegenwart hinein spürbar. Wenn man wieder so verfahre, könnte bei einer weiteren zeitlichen Ausdehnung des Krieges das Problem entstehen, auch für die Rüstung, für die Herstellung komplizierter Kriegstechnologie keine kompetenten Arbeitskräfte mehr zu haben. Gerade im Krieg seien hochwertige Produkte wichtig, die den Erzeugnissen des Feindes überlegen seien.138 Aber auch die Herausforderungen der Nachkriegszeit – offiziell musste von einem »Siegfrieden« ausgegangen werden, in dessen Folge Europa unter deutscher Führung wieder aufzubauen sein würde – seien nur mit einer bestens geschulten Arbeiterschaft zu meistern.139
Aber nicht nur in mittelfristiger, sondern auch in kurzfristiger Perspektive, so ein weiteres Argument, ziehe Deutschland Gewinn aus seinen tüchtigen Facharbeitern. Gerade weil viele junge Männer direkt nach der Lehre Soldaten würden, profitierte die Wehrmacht unmittelbar von ihren Fähigkeiten.140 Schließlich basiere die gegenwärtige Kriegführung in erster Linie auf der Nutzung technischen Geräts; nur wer mit Maschinen umzugehen gelernt habe, komme auch mit modernen Waffensystemen wie Flugzeugen, Panzern und U-Booten zurecht. Dabei gehe es nicht nur um die Bedienkompetenz, sondern auch um die Fähigkeit, im Notfall zu einer schnellen Reparatur imstande zu sein.141 Vieles spreche dafür, dass mittlerweile die Facharbeiter die besten Soldaten seien.142 Arnhold brachte die Siege in den »Blitzkriegen« der Jahre 1939 und 1940 direkt mit deren Kompetenzen in Verbindung:
»Ohne den jungen, technisch begabten und zu einem guten Teil auch technisch vorgebildeten deutschen Soldaten hätte die Stoßkraft unserer Wehrmacht niemals die Härte und Blitzartigkeit zu erreichen vermocht, die sie in dem augenblicklichen Kriege immer wieder beweist. Man muß dabei selbst einmal eine motorisierte Abteilung geführt haben, um den Wert eines gut ausgebildeten, verantwortungsbewußten Facharbeiters bzw. Handwerkers für die Schlagkraft der Truppe richtig einschätzen zu können.«143
Indem die Werktätigen die Uniform anzogen, wurden sie zu regelrechten »Kriegsarbeitern«, die das in den Betrieben Gelernte auf die Anforderungen im Feld übertrugen.144