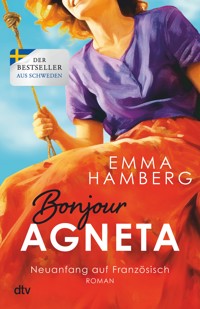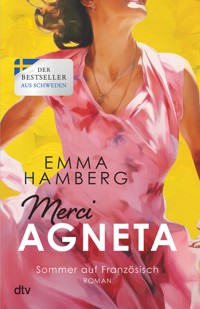
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Neuanfang auf Französisch
- Sprache: Deutsch
Dieser Sommer gehört Agneta! Agnetas wahres Leben hat endlich begonnen – ihr altes lässt sie erstmal zurück. Soll es doch sehen, wo es bleibt! Denn sie weiß genau, wo sie sein möchte: hier in Saint Carelle, mitten in der traumhaften Provence. Zusammen mit dem exzentrischen Einar, der lebensweisen Bonnibelle und ihrem Schwarm Fabien kann der Sommer genauso weitergehen. Doch die Ruhe trügt und Agneta muss kämpfen – für sich und für ihre Freunde. Aufgeben? Kommt gar nicht infrage. Agnetas großes Abenteuer geht weiter … Liebe und Baguette inbegriffen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Agnetas wahres Leben hat endlich begonnen – ihr altes, von nüchternem Pragmatismus geprägtes Dasein in Schweden lässt sie gerne zurück. Im sonnigen Saint Carelle erledigt sie ihre Einkäufe auf dem Markt, hält hier und da einen Plausch – soweit ihr rudimentäres Französisch dies zulässt –, schaut auf einen expresso in der Bar vorbei, wo sie von ihrem Schwarm herzlich begrüßt wird, und jeden Abend wäscht sie ihre Seidenunterwäsche von Hand. Kurzum: Sie ist auf dem besten Weg, zur waschechten Französin zu werden. Doch ungeahnte Stolperfallen tun sich auf, und die sind nicht nur kultureller Natur: Das alte Kloster, in dem Agneta ein neues Zuhause gefunden hat, ist plötzlich bedroht. Jetzt muss sie kämpfen … für das Leben und die Liebe!
Von Emma Hamberg ist bei dtv außerdem erschienen:
Bonjour Agneta
Emma Hamberg
Merci Agneta
Roman
Aus dem Schwedischen von Wibke Kuhn
1.
HUHU, wir wollten bloß mal anrufen und dir mitteilen, dass wir noch leben! Papa und ich sitzen gerade hier auf dem Balkon und genießen das Leben. Mit Sekt und … Kannst du mal ein Stück rutschen, sonst sieht Agneta mich doch gar nicht. Also, weißt du ….«
Der Mund meiner Mutter füllt jetzt den gesamten Bildschirm aus, während die Nasenflügel meines Vaters mehr oder weniger am rechten Rand vibrieren. Hoppla, jetzt schwenkt die Kamera plötzlich auf ein grünes Gebüsch neben dem benachbarten Reihenhaus. Meine Mutter kräht enthusiastisch, während sie eine Salzstange knabbert. Die Salzkörner bleiben an ihrem Lippenstift kleben, der sich dann wiederum auf ihren Zähnen verteilt.
»Ann-Sofie und Lennart haben ihre Hecke umgestaltet, die haben einen Mann aus … Woher kommt der noch mal? Aus Litauen? Nein, Estland war’s. Ein absolut WUNDERBARER junger Mann, spricht kein Wort Schwedisch, aber wie der diese Hecke geschnitten hat – er hat sie geradezu gestreichelt mit seiner Heckenschere.«
Das Handy bebt, das Grüne verschwindet und siehe da, jetzt bin ich wieder im weit geöffneten Salzstangenmund meiner Mutter. Ein Glas Sekt nähert sich, während die Nasenflügel meines Vaters schnauben, dass die Linse beschlägt.
»Und jetzt soll er uns bei unserer Hecke helfen. Wie hieß er noch gleich? Darmo …? Oder war es ein anderes Organ? Lungo? Lebri?«
»Tarmo, Schatz. Tarmo. Tarmo spricht überhaupt kein Schwedisch, aber er ist großartig. So was weiß man einfach, Agneta. So was spürt man.«
Meine Mutter senkt die Stimme, gleich wird sie mir etwas Vertrauliches erzählen.
»Tarmo bedeutet ›Energie‹ auf Estnisch, hat Ann-Sofie erzählt. Das trifft auf den kleinen Tarmo wahrlich zu. Du musst wissen, dass Tarmo dafür kämpft, seine ganzen Kinder zu ernähren. Wie viele hatte er noch schnell zu Hause in Estland?«
Irgendwo hier schalte ich ab, während meine Eltern lebhaft von Tarmos Privatleben erzählen und sogar etwas von einer Ladestation für Elektroautos, für die sich Lennart sehr eingesetzt hat. Sie wissen nichts von meinem Leben. Sie rufen mich nie an, um sich zu erkundigen, ob ich noch lebe. Aber wenn sie mich fragen würden, würde ich (nachdem ich mich von diesem Schock erholt hätte) ungefähr so antworten:
»Liebe Mama, lieber Papa, wie schön, dass ihr fragt! Ihr ahnt ja gar nicht, wie sehr ich lebe. Ich glaube, ich hab mein ganzes Leben lang noch nicht so sehr gelebt. Es kommt mir vor, als würde ich alles nachholen, was ich nicht gelebt habe. Wie bitte? Wie ich lebe? Ich habe einen besten Freund. Einar, ihr wisst schon. Dann hab ich noch andere Freunde. Ja, ihr habt richtig gehört – ich habe eine Clique! Wenn ich noch in Sollentuna leben würde, würde ich mit dieser Clique in die Berge fahren, wir würden zusammen Mittsommer feiern und nach Benidorm zum Golfspielen fahren. Diese Beispiele zähle ich nur auf, damit ihr versteht, wofür das Wort ›Clique‹ steht, ansonsten haben diese Menschen nämlich nichts mit Golf, Mittsommer oder Bergen am Hut. Bonnibelle, Henri, Colette, Paul und Fabien heißen sie. Meine Freunde. Meine Clique. Wenn man sich das mal überlegt – warum handelt eigentlich jedes Lied, jeder Film und jedes Gedicht von der romantischen Liebe? Warum gibt es kein einziges Musical über die Freundschaft? Musicalmenschen, die in der Schlussnummer hysterisch lächelnd über die Bühne tanzen, während Ballons und Schneeflocken vom Dach herunterschweben, weil sie endlich einen richtigen Freund gefunden haben! Ihr solltet mal sehen, was diese Freunde mit mir gemacht haben. Wie war das, Mama? Du willst mich sehen? Moment, ich dreh mal schnell die Kamera um … Hier bin ich! Das Kleid sieht doch super aus, oder? Das hab ich mir auf dem Markt in Arles gekauft. Ich weiß, es ist kurz, aber Einar findet, ich sollte alles zeigen, was ich habe. Zwei Beine sind offenbar eine super Sache. Nicht alle haben zwei Beine. Oder wenn sie zwei Beine haben, können sie sich nicht so bewegen, wie sie wollen. Aber ich kann mit meinen sogar tanzen! Ich tanze fast jeden Abend mit Einar. Hier zu Hause oder unten auf dem Marktplatz, jeden Freitagabend. Was? Nein, nein, ich wohne nicht in einem Schloss, was ihr da hinter mir seht, ist das Kloster. Ich habe einen eigenen Turm zum Schlafen, mit Ausblick in alle vier Himmelsrichtungen und mit einer schusseligen Kirchenglocke nebendran. Die schlägt und gibt Töne von sich, wie es ihr gerade in den Sinn kommt, was mir hervorragend passt. Und ihr solltet mal den Klostergarten sehen, jetzt, wo der Sommer kommt, er sieht aus, als wäre er gerade in die Pubertät gekommen. Möpse, Nasen und Beine wollen einfach nicht aufhören zu wachsen, überall Unmengen von Haaren, Hormone auf Speed und alles wächst auf einmal, ihr wisst schon: Peng – Aprikosen, peng – Feigen, peng – Kirschen, der ganze Rosengarten – pengbumm, voll aufgeblüht! Wir könnten hier auch einen Tarmo gebrauchen.«
»Agneta, bist du noch dran?!«
Meine Mutter klopft aufs Display, während sie gleichzeitig zu meinem Vater sagt:
»Hat sich das Bild jetzt aufgehängt oder wie man das nennt? Sie bewegt sich nicht. Du musst mal unsere Netzwerkverbindung prüfen.«
Die sonnenverbrannte Nase meiner Mutter nähert sich dem Display, ihre Nasenflügel flattern irritiert, und ich winke den beiden zu.
»Ich hab mich nicht aufgehängt, ich bin immer noch hier. Hallo!«
Die Miene meiner Mutter hellt sich auf.
»Also, ich hab gerade erzählt, dass … Aber hoppla, da ist er ja schon!«
Die Kamera wird erneut erschüttert, dreht sich ein paar Mal im Kreis und jetzt blicke ich direkt auf einen Männerschritt in Arbeitshose.
»TERE TARMO, TERE!«, deklamiert meine Mutter übertrieben laut und deutlich.
Mir flüstert sie vertraulich zu:
»Tere heißt Hallo auf Estnisch, Agneta.«
Jetzt hebt sie die Stimme wieder, es ist, als würde ein hysterisches Kind am Lautstärkeregler sitzen.
»This is Tarmo! He will talk garden with Papa now, so we say goodbye. Tarmo, you like the cava? It is bubbles in the wine, you see, and …«
Klick.
Dann sind sie weg – meine Mutter, mein Vater und Tarmo. Ich lege Einars Handy auf den gefleckten Marmortisch.
Das Handy hat Einar von Paul bekommen, damit sie miteinander facetimen können. Und das tun sie auch, obwohl es ein bisschen anstrengend für Einar ist, zu durchschauen, wie das alles zusammenhängt. Ist Paul hier oder dort oder einfach bloß in seiner Phantasie? Ist das meine Demenz oder ist das jetzt Facetime? Auch für einen geistig völlig gesunden Menschen ist das nicht so leicht zu verstehen. Aber meistens rufen mich meine Eltern auf diesem Telefon an, um mir von den neuen Ladestationen ihrer Nachbarn zu erzählen, davon, wie wahnsinnig spannend es neulich wieder beim Bridge war, oder um zu bestätigen, dass sie noch leben, und mir die heckenscherengestreichelten Hecken ihrer Nachbarn zu zeigen.
Wenn sie mich mal nach meinem Garten gefragt hätten, dann hätte ich ihnen gezeigt, was ich jetzt sehe. Die Sonne geht gerade unter. Es brennt geradezu zwischen den Obstbäumen hinten neben der Klostermauer. Der Himmel ist ganz rosa. Ich sitze auf einem der schiefen Caféstühle im Hinterhof und lasse meinen Blick über den Klostergarten streifen. Nein, ich bin kein Tarmo voller Energie, ich bin eine Agneta voller Liebe. Liebe mäht keinen Rasen. Liebe bewirkt, dass Rasen zu Wiese wird. Ich weiß ja nicht mal, wie die ganzen Blumen heißen, die hier gewachsen sind, aber es sind auf jeden Fall viele. Der Rosengarten ist so unbändig verwildert, dass er anfängt, über die Obstbäume zu wuchern und …
»BRÜÜÜÜLL!«
Aha, ist es mal wieder so weit. Dasselbe Lied jeden Abend in der Dämmerung.
»MuuuÄÄÄÄ!«
Ich greife nach dem Gartenschlauch, der aufgerollt an der Wand hängt, ziehe Meter um Meter heraus und drehe das Wasser auf. Jeden Morgen und jeden Abend. Obwohl es erst Juni ist, hat die Hitze schon losgelegt. Wenn ich ein paar Tage nicht gieße, fängt alles sofort an zu welken.
»BRÜÜÜÜLL!«
»Bist du das, Agneta?«
Einar macht die Fensterläden seines Schlafzimmers auf und schaut verschlafen heraus.
»Äääh, nein … Das sind die Kühe.«
»Kühe? Hier?«
»Nein, drüben bei den Dumonts.«
»Bei den Dumonts?«
»Die Familie mit den ganzen Kühen und Stieren, du weißt schon. Diese Kampfstiere, die du immer anfeuerst.«
Einar starrt mit nach innen gerichtetem Blick über den Klostergarten. Da dröhnt erneut das Muhen durch Saint Carelle.
»MUUUÖÖÖ!«
Da scheinen seine Sinne wieder zu funktionieren, und er muss lachen.
»Jetzt geht es ihr gut, das hört man. Ach, Kuh bei den Dumonts müsste man sein. Jede Nacht von einem dieser eleganten Stiere bestiegen werden, noch dazu im Freien. Nichts ist so wunderschön, wie von einem Stier unter freiem Himmel bestiegen zu werden. Hast du schon gefrühstückt?«
»Ja, vor zwölf Stunden. Aber wir essen bald zu Abend. Hast du Hunger?«
»Ja. Auf Stier.«
Einar seufzt sehnsuchtsvoll zu den Dumonts hinüber. Da klingelt das Handy wieder. Meine Mutter ist wieder auf Facetime. Ich gehe ran, und meine Mutter spricht im Flüsterton, während sie mit den leeren Weingläsern auf einem Tablett zum Haus zurückgeht. Das Handy liegt auch auf dem Tablett, ich sehe ihren schweren Busen unter dem türkisen Oberteil wogen.
»Agneta. Ich hab noch was vergessen.«
Jetzt kommt’s. Jetzt passiert’s! Jetzt fragt sie mich, wie es mir …
»Papa und ich haben uns unterhalten, wir finden, dass es langsam Zeit wird, dass du wieder nach Hause kommst. Jetzt hast du dich ein bisschen amüsiert und jetzt ist deine Vierzigjahrekrise auch durch und … ROLAND?! Du kannst doch diese Schalen nicht in die Spülmaschine stellen!«
»Mama, ich bin nicht vierzig. Ich bin fünfzig. Und ich habe keine Krise. Es geht mir besser denn je.«
»Ich könnte deinen Vater manchmal auf den Mond schießen! Wie oft hab ich ihm schon gesagt, dass die Goldkanten an diesen Schalen in der Geschirrspülmaschine abgehen? Man muss doch aufpassen auf die Goldkanten.«
»Alles um mich herum hat gerade Goldkanten. Und ich passe so gut auf diese Goldkanten auf, du wärst stolz auf mich. Hier wird nichts in der Spülmaschine abgewaschen.«
Jetzt hat meine Mutter das Handy auf die Arbeitsbank gelegt und ich schaue direkt an die Decke, während ich höre, wie sie die Schalen mit der Hand abwäscht und laut weiterredet.
»Wie auch immer, es gibt da so eine Redensart. Man sollte nicht mehr abbeißen, als man kauen kann.«
»Schlucken.«
»Du bist Schwedin, Agneta. Du bist keine Französin, auch wenn du es zu glauben scheinst. Das Ganze wird langsam albern. Vielleicht verpasst du das beste Stück, weil du es nicht kauen kannst. Magnus, das Haus, eure Kinder und deinen Job. Darauf musst du doch achtgeben. Ist das denn so schrecklich, was Papa und ich hier zu Hause haben? Wir sind glücklich damit, und das kannst du auch werden, wenn du nur … Roland! ROOOLAAA…«
Ich glaube, jetzt »hänge« ich mich grade auf. Danke, Mama, für diese perfekte Art, ohne ein Wort ein Facetime-Gespräch zu beenden. Ich sitze ganz still mit offenem Mund da. Meine Mutter starrt mich an und tippt mit den Fingern auf sämtliche Knöpfe, die sie finden kann.
»Mist, jetzt hat sie sich schon wieder aufgehängt.«
Klick.
Meine Mutter hat aufgelegt.
»BRÜÜÜÜLL!«
Und wieder wurde eine Dumont’sche Kuh bestiegen.
2.
Barry und Judy streichen mir um die Beine, miauen und jaulen fast vor Eifer, während ich in der engen, überhitzten Küche stehe und frische Fische unter Salzhaufen begrabe. Nein, das ist nicht gewöhnlich. Es ist auch nicht gewöhnlich, dass ein alter Liebhaber von Einar mit sechs Kilo Salz statt Blumen als Mitbringsel auftaucht. Salz, das er an einem Ort namens Äggmårt gestohlen hat, was überhaupt nicht gut klingt. Es klingt eher nach etwas, was mit Harry Potter zu tun hat, wie »Er-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf«. Voldemort, einfach gesagt. Bei Voldemort möchte man kein Salz holen. Aber anscheinend buchstabiert man Äggmårt so: »Aigues-Mortes« – und im Handumdrehen wird das Salz ganz wunderbar.
Was fängt man also mit sechs Kilo Salz an? Na ja, man backt Fisch darin. Füllt Forellen mit Kräutern (hör ich mich nicht an wie eine Frau von Welt?), legt sie auf ein Blech und backt sie in Salzhaufen, mit etwas geschlagenem Eiweiß und ein paar Spritzern Wasser aus der Blumenspritze dazu, und dann ab damit in den Ofen.
So. Jetzt haben sich die Katzen auch beruhigt. Ihre Zuneigung ist wirklich sehr unbeständig.
»Wisst ihr was, meine lieben kleinen Katzen? Mich täuscht ihr nicht. Ich hab irgendwo gelesen, dass ihr anfangt, an euren Herrchen und Frauchen zu knabbern, sobald sie nach ihrem Tod abgekühlt sind. Auch manche Hunde fressen ihre alten Besitzer, aber die warten länger als ihr. Ihr Katzen, ihr mampft einfach sofort los. Frauchen ist tot – sie kann uns nicht mehr streicheln oder füttern, sie ist völlig nutzlos! Komm, wir essen sie auf. Ihr seid süß, aber mich täuscht ihr nicht mit eurem Geschmeichel.«
Barry und Judy funkeln mich wütend an. Fast glaube ich, dass sie mich bei lebendigem Leibe auffressen wollen. Aber dann überlegen sie es sich doch anders, werfen ein paar Blicke zum Ofen, in dem der Fisch eingesperrt ist, und stolzieren davon. Ich nehme mein Weinglas, gehe aus der dampfigen Küche und setze mich an das Bronzetischchen im verrauchten Esszimmer. Wenn meine Mutter und mein Vater mich noch einmal anrufen und entsetzt ausrufen würden: »Aber geliebtes Kind, wir haben ja nur von uns selbst und Tarmo geschwafelt und dabei ganz vergessen, zu fragen, wie es dir geht. Wie geht es dir? Erzähl, wir wollen alles hören! Rutsch doch mal ein Stück, Roland, damit ich unsere Tochter sehen kann«, dann würde ich (nachdem ich mich vom ersten Schock erholt hätte) in etwa so antworten:
»Ich hab gerade mit den Katzen hier geredet. Apropos Tiere, ist doch komisch, dass man immer nur bei Tieren davon spricht, dass sie sich häuten oder ihr Gefieder wechseln. Erwachsene Schlangen zum Beispiel, die häuten sich zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben. Die alte Haut ist ihnen dann zu eng geworden, und genau so war es auch bei mir: Meine Haut war mir viel zu eng geworden. Oder Vögel, die sich mausern. Zerschlissene Federn, die nicht mehr funktionieren, werden abgeworfen und gegen ein anständiges Gefieder mit ordentlicher Funktion ausgetauscht. Meine betagten Flügel hatten ihre Funktion völlig eingestellt. Ja, ich bin ein Mensch, und ich habe mich sowohl gehäutet als auch gemausert. Und nicht nur Haut und Federn habe ich abgestreift, ich habe auch mein Zuhause gewechselt! Und jetzt sitze ich hier in meiner ganz neuen weichen Haut mit den frischen Federn in einer französischen Küche, in der ich mich zurechtfinde wie in meiner eigenen. Man könnte sagen, dass meine Kochkunst sich auch gemausert hat. Meine ganze Existenz hat sich quasi gehäutet.«
»Wer hat sich gehäutet?«
Einar betritt die Küche mit seinem zerknitterten Pyjama, Seidenschal und einer Zigarette. Nein, zwei Zigaretten. Eine schwelende in der Hand und eine unangesteckte zwischen den Lippen.
»Ich. Ich rede nur ein bisschen mit meinen Eltern.«
»Sind die hier oder dort?«
»Dort.«
»Schade. Es wäre lustig, sie kennenzulernen. Ist Paul schon da?«
»Paul ist in Täby.«
»In Täby?! Was will er dann in Schweden, noch dazu in einer Vorstadt von Stockholm?«
»Er wohnt da.«
»Aber warum denn, um Gottes willen?«
»Tja, da musst du Paul wohl selbst fragen.«
»Ein Kind kann doch nicht alleine wohnen! Nicht mal in Täby.«
»Er ist ungefähr sechzig Jahre alt.«
»Paul?«
Einar starrt mich an.
»Sicher?«
»Ja. Du bist über achtzig, und er ist sechzig.«
Einar nimmt einen Zug von der einen Zigarette, während er die andere im Aschenbecher auf dem Tisch ausdrückt.
»Dann kann er natürlich gerne in Täby wohnen.«
Der fast leere Salzeimer steht auf dem Tisch, und Einars Blick bleibt daran hängen.
»Was hast du mit dem Salz gemacht?«
Stolz zeige ich Richtung Küche und Ofen.
»Ich hab Fisch drin gebacken!«
»Du hast Fisch drin gebacken? In Salz aus Aigues-Mortes?«
»Du hast doch einen ganzen Eimer bekommen, ich dachte mir, dann müssen wir das wohl auch verbrauchen.«
»Weißt du, was so viel Salz wert ist?«
»Wie meinst du das – was es ›wert ist‹?«
»Salz aus Aigues-Mortes ist das aromatischste Salz der Welt. Ein paar Körnchen von diesem Salz erwecken dein Hähnchen zu neuem Leben. Oder verleihen deinem Salat ungeahnte Aromen. Oder deinem Kuchen genau die Salzigkeit, die er braucht. Das hier ist das Gold unter den Salzen. Nein, das ist der GOTT der Salze! So ein Eimer kostet wahrscheinlich sechstausend Kronen.«
»Sechstausend? Für Salz?«
»Das ist kein Salz, hab ich doch gerade gesagt, das ist der Gott der Salze. Wird wohl langsam Zeit, dass du dir die Ohren sauber machst, hm?«
Einar nimmt gereizt einen Lungenzug, während ich schlucke. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr wie eine Frau von Welt, ich fühle mich wie Miss Äggmårt. Einar zieht seine Schlafanzughose hoch, schaut mich mit neuen munteren Augen an und klatscht munter in die Hände.
»So! Was gibt es heute zum Abendessen?«
»Diesen eingebackenen Fisch …«
»Eingebacken? In was?«
»Im Sa … ich meine: in Kräutern.«
»In Kräutern? Wie schön. Dann geh ich jetzt noch mal kurz hoch ins Atelier. Ruf mich, wenn das Essen fertig ist.«
»Versprochen.«
Saved by Demenz.
KLOPF KLOPF KLOPF!
Es ist ungeheuerlich, wie fest dieses Salz sitzt. Mit dem Hammer schlage ich auf das steinharte Salz über dem Fisch, ich haue und dresche und verscheuche die neugierigen Katzen, und am Ende gibt der Gott der Salze nach. Im Kochbuch sah das so unglaublich leicht aus: einfach den Fisch in Salz legen, rein in den Ofen und dann vorsichtig die Salzkruste abheben. Abheben? Vorsichtig?! Wohl eher die Salzschicht grob mit dem Meißel behandeln und dann die Reste des Salzes wegreißen, die sich festgebissen haben. Aber dort, unter all dem Salz, ruhen zwei Fische mit Bäuchen voller Kräuter, und es duftet wirklich so gut, wie es das französische Kochbuch versprochen hat.
Eifrig springe ich runter in den Keller. Hier befinden sich in angenehmer Kühle nicht nur Einars und Armands Sammlung von leeren Champagnerflaschen, die Waschmaschine und alte Schaufensterpuppen, sondern auch fünf riesige Wäscheschränke. Jeder Schrank ist ein Abenteuer für sich. Gerade stehe ich vor dem nussbraunen mit den fleckigen Spiegeltüren.
»Aaaah, dieser Duft!«
Textilien, Holz und die Duftsäckchen, die Armand vor langer Zeit angefertigt hat. Seife aus Marseille, die er in Stücke geschnitten hat, in Stoffsäckchen gelegt, die er dann wiederum mit dünnen Stoffstreifen zugeschnürt und hier und da zwischen die Tischdecken geschoben hat. Und was für Tischdecken! Tischdecken von Reisen durch die ganze Welt, Tischdecken von Verwandten, Tischdecken aus der Hölle, Tischdecken mit Zitronen, nackten Männern, Vögeln, versaute Tischdecken und religiöse. Wenn man jemals eine Tischdecke suchen sollte – hier wird man fündig. Jetzt hätte ich gerne eine Tischdecke mit Fischen drauf. Ich blättere die Tischdecken durch wie Schallplatten in einer alten Plattenkiste. Und siehe da! Ich wusste es! Blockdruck, hysterische Farben, Fische, die durchs Wasser schießen wie hungrige Haie. Nicht schön, aber – Fische! Mit einem leichten Duft nach Savon de Marseille.
Einar ist gar nicht im Atelier. Auch nicht im Schlafzimmer, in der Bibliothek oder im Bad. Er ist wie die Katzen – überall und nirgends. Sein Hirn funktioniert genauso. Hier in der einen Sekunde und in der nächsten in einer völlig anderen Welt, einer völlig anderen Zeit. Meistens ist er bei Armand oder Paul. Auf die eine oder andere Art. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn auf einer Straße im Ort gefunden habe, auf dem Weg zu Paul. Oder er sitzt auf dem Beifahrersitz seines cremeweißen Opel und wartet darauf, dass Armand ihn zum Markt nach Arles chauffiert.
Aber oft ist Einar einfach nur verschwunden. Jedes Mal, wenn er verschwindet, wird mir ganz kalt, als wäre mit einem Schlag Winter in meinem Körper. Schneefall in meinen Venen, Minusgrade im Herzen, und ich bekomme einfach eine Heidenangst. Einar darf nicht verschwinden. Aber er tut es trotzdem. Sowohl sein Körper als auch sein Geist sind vollkommen unberechenbar.
Jetzt spüre ich, wie die Schneeflocken auf meine Haut fallen. Ich renne hinauf zu den Schlafzimmern im östlichen Teil des Klosters. Die Zimmer für die Gäste, Feste, Liebhaber und alle heiligen Momente. Das Leopardenzimmer? Leer. Der Sandsteinsaal? Leer. Das Ludwig-XIII-Zimmer? Ausgestopfte Tierköpfe mit schielenden Glasaugen, zwischen denen Spinnweben herabhängen. Und mitten im Zimmer das riesige Himmelbett mit den Jagdmotiven auf dem schweren Samtstoff. Aber keine Menschenseele weit und breit. Ich ziehe die Tür hinter mir zu.
Ein langes, hohes Bücherregal zieht sich im Flur am Zimmer von König Ludwig dem dreizehnten entlang, aber … Ich habe immer gedacht, dass sich dieses Regal bis ganz zur Hauswand erstreckt. Ich fahre mit der Hand über die Buchrücken, doch wo das Regal zu Ende ist – aus der Ferne unsichtbar hinter der Kante –, ist noch eine weitere Tür, schmaler und ziemlich unansehnlich. Ich greife nach der Klinke, aber die Tür scheint zu klemmen, als wäre sie verzogen. Ich stemme den Fuß gegen die Wand und ziehe noch einmal kräftig daran, sodass die Tür mit einem quietschenden Schrei nachgibt und aufgeht. Es kommt mir vor, als wäre nicht nur mir dieser Raum bis jetzt entgangen. Hier drinnen ist nichts von Einars und Armands Sorgfalt zu spüren. Dieses Zimmer gehört zu einer anderen Zeit.
In der Dunkelheit lassen sich drei schmale Eisenbettgestelle erahnen, und über jedem von ihnen hängt ein Kruzifix. Ein paar schlichte Stühle, ein Kleiderschrank und ein Nachttopf auf dem Boden. Die Betten sind säuberlich bezogen mit weißem Laken, flachen weißen Kissen und grauen Decken. Die Einfassungen der Kopfkissenbezüge sind gebügelt. Ich blicke auf den Wäscheschrank, in dem gebügelte Kleidungsstücke und zusammengefaltete Bettwäsche in ordentlichen Stapeln liegen. Haben die Nonnen hier geschlafen? In diesen kleinen Betten? Das Zimmer wurde auf jeden Fall seit ihrer Zeit nicht mehr geöffnet, denn es muss wirklich dringend gelüftet werden. Ich mache das Fenster auf, öffne die Fensterläden und lasse die Abendluft hereinziehen.
Die Sonne ist schon fast untergegangen, jetzt kommt das Licht nur noch von dem großen Kristalllüster, der an einem Ast unter dem höchsten Kastanienbaum hängt, und von den leuchtenden Laternen, die im Klostergarten verteilt sind. Es sind viele Laternen, in den Bäumen, um die Stämme herum, an den Hausecken, hinter den Büschen. Dramatische Schatten klettern über die Mauern.
Mein Blick bleibt am Küchenfenster hängen.
»Was zum …?! PFUI!«
Judy und Barry blicken nicht mal zu mir hoch, als ich ein paar Stockwerke schräg über ihnen mit den Armen wedle. Sie stehen einfach da, mitten auf dem Tisch, und vertilgen schmatzend den Äggmårt-Fisch. Ich rase aus dem Nonnenzimmer, die zahllosen schmalen Steinstufen hinunter, durch das rote Zimmer und zum Hinterausgang der verrauchten Bibliothek hinaus. Stolpere dabei über ein paar große Blumentöpfe, schaffe es gerade noch, dem Feigenbaum auszuweichen und …
Die Katzen sind weg. Stattdessen sitzt jetzt Einar am Tisch. Er hat immer noch seinen zerknitterten Schlafanzug an, gießt sich Wein ins Glas, als wäre nichts passiert und als würde er schon seit Stunden so dort sitzen, während die Katzen hinter ihm hervorlugen und versuchen, unschuldig auszusehen.
»Agneta, setz dich. Was für ein Abendessen, was für ein Abend!«
Einar! Er ist nicht weg, er ist hier! Die Schneeflocken schmelzen dahin. Aber dann sehe ich die Überreste vom Fischfest der Katzen.
»Aber das ganze Abendessen ist doch verdorben!«
»Verdorben? Wie kommst du denn darauf?«
Einar sieht aufrichtig ratlos aus, während ich mit den Armen auf das Bild der Zerstörung auf dem Tisch zeige.
»Die Katzen sind doch überall durchgetrampelt. Schau dir doch bloß das Tischtuch an! Voll mit Fisch und Salz, dabei wollte ich doch …«
Einar zieht den Stuhl neben sich heraus und klopft aufmunternd auf die Sitzfläche. Gehorsam setze ich mich neben ihn, während Einar den Fisch sauber macht, mir Stücke auf den Teller legt und mich auffordert, einen Schluck Wein zu trinken. Was ich auch tue. Einen großen Schluck.
Einar lächelt mich sanft an.
»Zwischen verbessern und verderben ist gar kein so großer Unterschied, wie du denkst. Verführen ist auch nicht so weit weg davon. Und verteilen gehört auch zur selben Wortfamilie, könnte man sagen. Du hast die Katzen verführt, sie haben das Abendessen verteilt, und was für ein Glück, dass sie nicht alles verdorben haben, sondern uns ein bisschen was übrig gelassen haben, womit wir uns versorgen können. Wie schön, dass es uns vergönnt ist, so rücksichtsvolle Katzen zu haben, oder? Noch etwas Brot, meine Gute?«
Einar reicht mir den Korb mit den Baguettescheiben. Ich schiebe die Gedanken an Toxoplasmose, Vogelgrippe, Katzenkratzkrankheit und alle anderen furchtbaren Katzenparasiten beiseite, während ich das Brot in die Flüssigkeit tunke, die der Fisch abgegeben hat. Einar schüttelt eine Leinenserviette aus, legt sie mir auf den Schoß, schüttelt eine weitere aus und legt sie sich selbst auf den Schoß. Dann prostet er mir zu.
»Weißt du, mein Liebling, diese Fische und dieses Salz kommen aus dem Meer.«
»Ja.«
»Das Leben, unser kleines Leben in unseren kleinen Körpern, ist wie ein riesiges Meer. Soviel wir auch segeln, die Winde zu bestimmen versuchen und uns Schwimmwesten anziehen – das Meer hat immer das letzte Wort. Wenn es Sturm gibt, gibt es Sturm. Wenn Unterströmungen kommen, dann kommen Unterströmungen. Aber das Meer will uns nicht nur Böses in Form von Stürmen und anderen Scheußlichkeiten. Es schenkt uns auch kurze, erfrischende Bäder, wenn wir uns auf dem Rücken mit dem Gesicht zur Sonne, auf ihm treiben lassen und auf dem Wasser schaukeln und schaukeln. Es schenkt uns Hummer, dicke Fische, Salz und Austern, in denen manchmal sogar Perlen sind. Man muss sich nur ins Meer werfen und auf das Beste hoffen.«
»Schön, aber … was willst du mir eigentlich sagen?«
»Dass du nicht weinen musst, wenn die Katzen ein bisschen am Fisch knabbern und das Tischtuch zerknittern. Und dass das Abendessen nicht so geworden ist, wie du wolltest. War es denn nicht schön, dieses Essen zuzubereiten?«
»Doch, absolut. Es war wirklich spannend mit diesem ganzen Salz … ich meine, mit diesen ganzen Kräutern, und zu versuchen, mir zusammenzureimen, was in dem französischen Kochbuch steht.«
»Du hattest also Spaß beim Kochen?«
»Ob ich Spaß hatte? Na ja, doch, wahrscheinlich schon ein bisschen.«
»Dann ist doch nichts verloren. Weißt du, was ein Dul-Tson-Kyil-Khor ist?«
»Ein Fisch?«
»Nein, das ist Tibetisch und bedeutet so was wie ›Sandbilder aus gefärbtem Pulver‹.«
Es ist schon erstaunlich mit Einars Demenz. Er kann seinen Gedankengang mitten im Satz ändern. Innerhalb von drei Sekunden von Fisch zu tibetischen Sandbildern.
»Weißt du, die tibetischen Mönche können wochenlang dasitzen und unglaubliche Kunstwerke schaffen. Und wenn sie dann fertig sind, heben sie den Blick, betrachten ihr Kunstwerk und dann fahren sie mit der Hand über den Sand. Zack, in wenigen Sekunden … ist alles weg.«
»Sie zerstören ihre eigenen Kunstwerke?«
»Nein, im Gegenteil. Das IST eben die Kunst. Die Kunst, zu verstehen, dass alles vergänglich ist. Und dass es dennoch jede Mühe wert ist. Weil es für einen Moment schön ist. Das Schöne bleibt, auch wenn es weg ist. Wie wenn man ein richtig gutes Abendessen gekocht hat, das im Nu aufgegessen wird. Oder wenn man eine Sandburg am Strand gebaut hat! Das dauert Stunden, man baut, man steckt gefundene Federn hinein, funktioniert Strandgut um zu einer Zugbrücke über Wallgräben, alles, während einem die Sonne warm auf den Rücken scheint. Dann kommt die Flut. Am nächsten Morgen ist die Burg verschwunden, mitsamt den Federn. Nichts ist mehr übrig. Aber es war ein schöner Tag und eine schöne Sandburg, und das Ganze bleibt in deinem Inneren erhalten.«
Okay, tut mir leid, da war jetzt doch nicht seine Demenz am Werk. Es lag an mir, dass ich nicht intelligent genug war, den Zusammenhang zu erkennen, bis Einar ihn mir im Prinzip auf die Nase gebunden hat.
»Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme.«
»Meinst du, dass sich die tibetischen Mönche irren?«
»Ich hasse es, dass alles zu Ende geht. Ich will keine Sandburgen bauen, wenn sie am nächsten Morgen wieder verschwunden sind.«
»Der Schmerz hat meistens ein Ende – findest du das nicht gut?«
»Doch, natürlich, aber alles Wunderschöne geht auch zu Ende. Ich bekomme zum Beispiel eine Todesangst, wenn du mal wieder verschwunden bist.«
»Aber ich verschwinde doch nicht, oder? Es muss nur gerecht sein, verstehst du, mon amour? Du kannst dir das Meer nicht vorenthalten, nur weil du Angst vor den Stürmen hast. Denk an all das, was du verpasst. Stell dir vor, wir hätten es zum Beispiel nicht gewagt, uns ins Meer zu werfen!«
»Du und ich?«
»Ja. Alles, was wir haben, haben wir der Tatsache zu verdanken, dass wir keine Angst vor den Stürmen hatten. Dass wir keine Angst hatten, zu ertrinken. Mon cher. Quelle baignade!«
Einar tupft sich den Mund mit seiner Serviette ab und zeigt mit einer schwungvollen Bewegung seiner Arme über sein eigenes Paradies. Doch dann bleibt sein Blick an dem offenen Fenster im Obergeschoss hängen.
»Mais mon cher Armand … Pourquoi la fenêtre est-elle ouverte? Dans la chambre des filles? Armand?«
»Ich bin Agneta. Ich verstehe kein Französisch.«
»Du verstehst kein Schwedisch, mein Lieber. Bist du jetzt völlig verrückt geworden?«
»Doch, allerdings verstehe ich Schwedisch. Aber du sprichst gerade Französisch.«
»Absurdité! Warum steht das Fenster des Mädchenzimmers offen?«
»Das Mädchenzimmer?«
Einar schaut mich an. Seine Augen, die gerade noch voller Eifer geleuchtet haben, als er vom Meer sprach, und dann noch mehr leuchteten, als er meinte, ich sei Armand … Jetzt hat er einen suchenden Blick. Ich weiß nicht, wo er gerade ist, was er sieht. Wer ich bin. Oder wer diese Mädchen waren. Und er weiß es auch nicht.
Einar legt mir die Hand aufs Bein, fragt probehalber, als wolle er sich vergewissern, dass er richtig liegt:
»Bist du in deinem Zimmer gewesen? Das ist schon so lange her.«
»In meinem Zimmer?«
»Ja, das Fenster steht doch offen. Schau!«
Einar zeigt zum zweiten Stock hoch, wo das Fenster der »Mädchen« offen steht.
»Ich hab dich gesucht und bin zufällig an diesem Zimmer vorbeigekommen, aber es war schrecklich stickig da drin, deswegen hab ich …«
»Bist du … jetzt Bonnibelle?«
»Nein, ich bin Agneta.«
»Agneta?«
»Ja. Moi Agneta, toi Einar. Wir essen gerade den Fisch, den ich in Salz gebacken habe und den die Katzen angeknabbert haben. Du hast vom Meer gesprochen und von den Sandbildern, die die Mönche wieder zerstören.«
»Nicht zerstören. Sie opfern sie, damit wir das Schöne der Vergänglichkeit erkennen können.«
Ich spüre, wie in meinem Inneren die Schneeflocken fallen.
3.
Bonjour, Madame de la Barre! Bonjour, Madame Cousin!«
Wenn ich über den Markt spaziere, begrüße ich wirklich absolut jeden, der mir über den Weg läuft. Dabei muss ich immer an diesen einen schwedischen Sänger denken und wie er sich zusammen mit dem Rest der schwedischen Bevölkerung in der Einsamkeit auf dem Land super wohl fühlt. Wo man seinen eigenen Schnaps brennen kann und in Ruhe Hering essen, wo der Zweifel schweigt und ein Ja »ja« heißt und ein Nein »nein«. Und wo es befreiend weit ist bis zum nächsten Haus.
Franzosen und Schweden sind sich unähnlich bis ins Letzte. Es gibt wahrscheinlich 127 französische Wörter, die auf irgendeine Art »Hallo« bedeuten, und diese 127 Wörter muss man die ganze Zeit benutzen (genauso wie wir Schweden mindestens 127 Arten kennen, uns vor oberflächlichen Bekannten zu verstecken, um lästigem Smalltalk zu entgehen. Wie gesagt, wir Schweden fühlen uns am wohlsten in der Einsamkeit auf dem Land, wo wir unseren Feind schon von Weitem erkennen können. Beziehungsweise unsere Bekannten). Wir Schweden sagen niemals unnötig Hallo.
Streift man indes durch die Gassen von Saint Carelle und sagt nicht Hallo, wenn man einem oberflächlichen Bekannten begegnet, ein Baguette kauft oder auf einen Hund trifft, stürzt die Stimmung jäh in den Keller. Und das dann auch noch auf Französisch, was womöglich schlimmer ist als jede andere schlechte Stimmung.
Wie auch immer, von diesen 127 französischen Wörtern für Hallo kenne ich genau drei: bonjour, bonsoir und coucou. Ich benutze sie ständig, weil ich eine Todesangst vor schlechter Stimmung auf Französisch habe. Wie jetzt, an diesem frühen Mittwochmorgen. In Saint Carelle ist Markttag. Mittwochs wird Käse verkauft, Wurst und Gemüse zum Einlagern. Es gibt ebenso viele ältere Damen wie Käse auf dem Marktplatz. Wohnen in diesem Dorf denn nur ältere Damen, könnte ich mich fragen. Ja, größtenteils schon, könnte ich antworten.
Saint Carelle ist nicht Saint Tropez. Hier gibt es keine schicken Nachtclubs, Casinos oder Strandpromenaden mit riesigen Yachten, die man bestaunen kann. Hier gibt es nur eine enge Bar mit Plastikmöbeln, zwei Bäckereien, von denen die eine grottenschlecht ist, sowie einen Friseur, der nur Frisuren für ältere Damen schneiden kann. Wegen seines Kundenkreises. Natürlich gibt es hier auch Herren, aber die drängen sich nicht zwischen den Ständen auf dem Marktplatz. Die sitzen vielmehr auf den Terrassenmöbeln aus Plastik, rauchen, plaudern und trinken kleine Tassen starken Kaffee. Der kleine Marktplatz ist also voll mit Damen, die auf dem Gemüse herumdrücken, auf Würste deuten, über Käse diskutieren und überlegen, ob sie am Nachmittag zusammen zur Course Camarguaise fahren sollen. Die Franzosen haben einfach ein geniales Talent, absolut grässliche Dinge total schön klingen zu lassen. Wie die Course Camarguaise, bei der Stiere in einem alten Amphitheater halbtot gestresst werden, während das Publikum dazu jubelt.
»Bonjour, Madame Dupin! Bonjour, Madame Deland! Bonjour, Madame … Madame Le… Le…«
Herrgott, die schlechte französische Stimmung zeichnet sich schon am Horizont ab.
»Madame … Madame Lenoir!«
Puh. Und alle antworten dasselbe:
»Bonjour, Madame Annjetá!«
Oui. Ich heiße mittlerweile Annjetá. Agneta wohnt immer noch in Sollentuna. Annjetá hingegen, die wohnt hier in Saint Carelle und kauft auf dem Markt Käse ein. Annjetá hat alle ihre alten Agneta-Kleidungsstücke weggeschmissen. Nicht eine einzige bequeme Jeans ist übrig geblieben. Kein Fleecepullover auf dieser Seite der Ostsee. Nicht eine einzige verwaschene Sloggi-Unterhose. Und meine praktischen BHs in Spülwassergrau haben Einar und ich zusammen mit dem Herbstlaub verbrannt. Annjetá besitzt jetzt vier Garnituren Unterwäsche von Bonnibelle. Ja, die muss sie jeden Abend von Hand auswaschen, mit einem speziellen Seidenwaschmittel. Aber wenn man in seinem Turmzimmer steht und schöne Unterwäsche mit Seidenwaschmittel bearbeitet, um sie dann auf der Leine über dem Waschbecken aufzuhängen (während gleichzeitig die Kühe in der Ferne auf der Weide muhen, wenn sie von ihren Stieren besprungen werden), ist das wie ein stilles Gebet der Dankbarkeit.
»Coucou, Annjetá, ma chérie!«
Bonnibelle ruft von Madame Martins Käsestand voller Ziegenkäse herüber. Lauter gleiche, runde Ziegenkäse in verschiedenen Reifestadien. Ein Ziegenkäse wird gelagert wie Menschen, könnte man sagen. Erst ist er weich, mild, weiß und völlig ungefährlich, um dann mit jedem Tag etwas aromatischer, voller und herausfordernder zu werden. Bevor der Käse komplett aufgibt, ist er knallgelb, hart wie Stein und hat ein so kräftiges Aroma, dass nur die Härtesten ihn essen können. Einar ist in dieser letzten Phase, sein Aroma ist so kräftig, dass es Berge versetzen kann. Bonnibelle ebenso. Ihre Aromen sind völlig unterschiedlich, aber sie sind intensiv und bitten niemanden um Verzeihung dafür. Bonnibelle steht dort mitten in ihrem Aroma und winkt mir zu, dass ich zu ihr rüberkommen soll.
Ich gehorche, wenn Bonnibelle winkt. Ich tue immer so, als würde ich alles verstehen, wenn sie mit mir spricht, was sie grundsätzlich auf Französisch tut. Auch heute hebt sie weder die Stimme, noch spricht sie pädagogisch langsam, nein, sie plappert einfach drauflos, wie der steinharte alte Käse, der sie ist. Wir geben uns Wangenküsschen. Ja! Ich bin so eine, die inzwischen Wangenküsschen gibt. Ich habe die Einsamkeit auf dem Lande hinter mir gelassen. Eine leichte Hand auf die Schulter des Gegenübers und drei Küsse in die Luft, genau neben die Wange, nie darauf.
Bonnibelle duftet wunderbar nach Lavendel, Talkumpuder und Föhnlotion. Sie zeigt mit ihren manikürten Fingern auf einen Käse nach dem anderen, wobei sie mit mir über irgendetwas redet, was wahrscheinlich mit Käse zu tun hat. Oder nein, vielleicht doch nicht. Sie sagt etwas von »petit enfant«, »fantastique« und »cette semaine«. Okay, ihre Enkelkinder kommen diese Woche zu Besuch. Drei kleine Pakete fallen mir in die Arme. Drei Pakete, von denen Bonnibelle zu meinen scheint, dass sie mich sehr glücklich machen werden, fast genauso glücklich, wie sie über ihre drei demnächst eintreffenden Enkelkinder ist.
Wir plaudern uns durch den Rest des Marktes. Weitere Pakete landen in meinem Arm, und ich sage bonjour, coucou, merci und versuche, nicht bonsoir zu sagen. Und ich bemühe mich, nicht zu auffällig auf die Dame hinter den Tomaten und den Zucchini zu starren. Dort steht die Frau von Jean. Sie ist ungefähr hundert Jahre alt. Ihr Mann Jean ist auch ungefähr hundert. Jetzt winkt sie uns zu. Wir gehen offenbar in ihre Richtung, denn Bonnibelle ist ein alter Ziegenkäse mit starkem Aroma, die sich vor nichts drückt. Sie kann mit der einen Hand einen erwartungsvollen Einar vor seinem Rendezvous mit Jean waschen, während sie mit der anderen Jeans Frau begrüßt. Oje, da wird vielleicht auf die Wangen geküsst und geplaudert, dann plaudern sie auch noch mit mir, es wird über Tomaten diskutiert, und vielleicht werden auch noch Feigen gekauft? Ich schaue die Frau an, die nicht nur »Jeans Frau« ist, sondern auch »die Frau von Einars Liebhaber«.
Der verheiratete Jean kommt jeden Donnerstag um zwölf Uhr zu Einar nach Hause, für eine Stunde Liebe machen. Das hält er jetzt schon seit vielen Jahren so. Sowohl Jean und Jeans Frau als auch Einar scheinen achselzuckend hinzunehmen, was an diesen Donnerstagen passiert. Ja, Einar war richtig gekränkt, als ich fragte, ob Jeans Frau von ihren erotischen Treffen wusste. »Herrgott noch mal, Agneta, jeder Mensch muss selbst die Verantwortung für seine Genussfreuden und seine Moral übernehmen!« Dann erklärte er mir und den Katzen lautstark, dass jeder »einen geheimen Garten haben sollte«. Die Katzen miauten zustimmend. Es sind sehr französische Katzen. Aber ich bin eine sehr schwedische Frau (obwohl ich aus der Einsamkeit auf dem Lande herausgerissen wurde), und ich musste mich zwangsweise mit diesem Heimlicher-Garten-Konzept auseinandersetzen. In gewisser Hinsicht verstehe ich es durchaus. Ein geistiger Garten, in dem man nach Lust und Laune anpflanzen, phantasieren und wild buddeln kann, ja, natürlich. Aber ein geheimer Garten, in dem man in echt anpflanzt, phantasiert und buddelt, mit echten Menschen und echten Gefühlen?
Während ich hier neben Jeans Frau stehe, bin ich mir nicht sicher, ob ich an dieses Konzept glauben soll. Aber was weiß ich? Jeden Donnerstag um zwölf geht auch sie irgendwohin. Keiner weiß, wohin. Vielleicht in ihren eigenen geheimen Garten.
»Annjetá?«
Bonnibelle stupst taktvoll meinen Arm an. Jeans Frau hat offenbar mehrfach »au revoir« gesagt, und adieu zu sagen, ist mindestens genauso wichtig, wie hallo zu sagen, und ich will keine schlechte Stimmung auf Französisch hervorrufen.
Bonnibelle winkt Jeans Frau zu.
»Au revoir, Thomasine!«
Thomasine heißt sie also. Sie hat einen eigenen Namen. Vielleicht auch einen eigenen geheimen Garten. Klingt irgendwie schon toll, so ein ganz eigener, geheimer Garten. Das Kloster und Einar sind mein geheimer Garten, auch wenn sie real sind. Sie sind wie eine unsichtbare Nabelschnur zu meiner seelischen Plazenta. Einar und das Kloster lassen Nährstoffe und Sauerstoff direkt in mich hineinströmen. Ohne sie würde ich wohl verschwinden wie eine Sandburg, wenn die Flut kommt. Auf einmal verschwunden. Ohne eine Spur zu hinterlassen. Zurück in die Unsichtbarkeit.
»Annjetá! Viens ici!«
Fabien steht rauchend vor seiner Bar, sein Hemd des Tages ist knallblau. Mit der einen Hand winkt er, während er mit der anderen einladend einen der orangen Stühle anhebt. Er will, dass ich rüberkomme. Denn hier in meinem geheimen Garten bin ich kein unsichtbares Unkraut, ich bin eine große, rote Rose.
4.
Wie sieht dein heimlicher Garten aus?
Ich schiebe mein Handy über den Tisch zu Fabien und hoffe, dass Google Translate die Übersetzung einigermaßen hinkriegt. Wir trinken beide einen Espresso in der Vormittagssonne. Der Markt auf dem Platz neben Fabiens Bar geht unbeeindruckt weiter, während sich die Sonne für den Tag auflädt. Man merkt jetzt schon, wie heiß es später werden wird. Aber noch ist es angenehm lau hier im Schatten. Im Schatten, geschützt vor der Sonne, meine ich. Und laue Luft, meine ich. Auf allen anderen Frequenzen ist es entweder heiß, lau oder kalt. Nie neutral. Fabien und ich hingegen trinken Kaffee, wir reden freundlich miteinander, wir helfen einander, wenn nötig, aber nie, wirklich niemals würden wir auch nur einen einzigen Schritt aus der Neutralität heraus tun. Als Schwedin habe ich eine Neigung zu lauer Neutralität, aber die Franzosen funktionieren nicht so. Fabien ist dennoch überraschend ehrgeizig bei der Bewahrung dieses neutralen Gefühls. Und dank Neutralitätspolitik und Bündnisfreiheit können wir einen Kaffee/Wein/Pastis trinken und uns per Google Translate unterhalten.
Fabien schüttet den letzten Kaffeerest in sich hinein und hackt mit gerunzelter Stirn eine Antwort mit seinen großen Fingern in sein Smartphone. Das Handy gleitet über den runden Tisch zurück.
Toter Garten. Du konntest sehen ihn. Von der Ruine!
Ich schaue vom Handy auf. Mit einem Grinsen zeigt Fabien auf die trockenen Platanen an der Hauswand. Er streckt sich nach hinten und drückt die Zigarette in einem der Blumentöpfe aus.
»Pauvre sans chance.«
Ich schüttle den Kopf.
»So hab ich das nicht gemeint. Warte! Attendre, wollte ich sagen.«
Mit einem freundlichen Lächeln korrigiert Fabien meine Aussprache.
»Attaandrö.«
Ich ahme ihn nach.
»Attaandrö.«
»Bien!«
Fabien applaudiert, während ich auf seinem Handy schreibe und es ihm dann vors Gesicht halte.
Nein, ich meine keinen gewöhnlichen Garten. Ich meine einen symbolischen. Einen Ort oder eine Person, bei der du du selbst sein kannst. Es kann auch ein imaginärer Ort sein! In dir drin!
Fabien liest. Schaut mich an. Liest erneut. Er schüttelt den Kopf, steht auf und bedient ein paar Herren, die nachgeschenkt bekommen wollen. Letzteres war vielleicht ein bisschen zu viel Herausforderung für Google Translate. Mit Google Translate muss man sprechen wie mit einem kleinen Kind. Deutlich und ohne kreative Ansprüche. Ich formuliere um.
Französisches Sprichwort:
»Einen geheimen Garten sollte jeder haben.«
Wo ist deiner?
Fabien gehört zu meinem geheimen Garten. Diese eine Nacht, die wir uns gegönnt haben, habe ich in meinem Garten vergraben. Und dort, in meinem geheimen Garten, kann unsere gemeinsame Nacht in Frieden ruhen. Keiner kann sie sehen, aber es kann sie mir auch keiner stehlen. Nicht mal Fabien und ich lugen dort hinein. Bei mir ist unsere Nacht in einem schönen, geheimen Garten vergraben, unter einem kristallklaren Sternenhimmel. Bei Fabien liegt sie vielleicht in diesem ausgetrockneten Blumentopf, in dem er gerade seine Zigarette ausgedrückt hat.
Ich war damals mit Magnus verheiratet und geriet in Panik. Ich geriet derart in Panik, dass ich an einem Abend ein ganzes Kloster mit Weihnachtsdeko versah. Ich geriet derart in Panik, dass ich Fabien nicht in die Augen schauen konnte. Ich konnte ihn überhaupt nicht sehen. Ich konnte ja nicht mal mich selbst sehen. Man könnte es so formulieren: Es wurde eine Beerdigung. Nieder mit dieser Nacht, ab unter die Erde, kein Grabstein, keine Totenklage – fertig. Jetzt bin ich geschieden, aber deswegen gräbt man ja keine Leichen wieder aus.
Moment mal – bin ich wirklich geschieden? Habe ich irgendwelche Papiere abgeschickt? Nein. Ich lebe einfach nur hier in meinem geheimen Garten und habe alles verdrängt, was Bürokratie betrifft, Scheidungspapiere, Kredite und … Oder doch, das mit dem Kredit weiß ich noch, weil Magnus mich irgendwann anrief und gereizt fragte, warum er die ganzen Kredite fürs Haus alleine zahlen soll. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass das nicht ganz gerecht ist. Aber noch mal ganz offen gesagt – ich habe einfach kein Geld. Nicht einen Pfennig. Ich arbeite für Käse und Logis. Das Kloster scheint nicht so viel zu kosten. Aber wir haben kein Geld übrig für irgendetwas anderes als Käse, Wein, ein bisschen Gemüse und Baguette. Bei Fabien ist alles kostenlos, Bonnibelle spendiert mir die Unterwäsche, und als Magnus anrief und mir die Ohren vollheulte wegen unserer Hauskredite, wegen der steigenden Zinsen und weil »es auch noch ein Morgen geben wird«, endete das Gespräch wie immer mit einer kleinen Belehrung darüber, dass ich endlich aufhören solle, mich wie ein Teenager zu benehmen. Aber ich lebe ja überhaupt nicht wie ein Teenager. Ich lebe wie ein schrecklich alter Mensch. Ich lebe wie Einar! Einar vergisst auch alles, was sich Baukredit und Scheidungspapiere nennt. Er erinnert sich nur ans Tanzen, ans Essen und an die Rendezvous mit seinen Liebhabern. Genauso wie ich. Außer dem Detail mit den Liebhabern.
»Bon!«
Fabien kommt wieder an meinen Tisch und greift sich sein Handy. Er liest im Stehen, was ich geschrieben habe. Fabien sind noch mehr Haare gewachsen, seit ich ihn zum ersten Mal sah. Das von grauen Fäden durchzogene, lockige Haar wuchert wild an den Seiten, ist auf seiner Stirn aber immer noch genauso dünn. Ganz zu schweigen von seiner Brustbehaarung, die aus dem aufgeknöpften Hemd quillt, das sich über seinem Bauch spannt. Fabien legt das Handy auf den Tisch und zwinkert einem neuen Gast beruhigend zu, der gerne bestellen will.
Meiner ist geheim. Sonst nicht geheim! Du zu schwedisch.
Ich lese und schaue ihn fragend an.
»Zu schwedisch? Comment?«
Fabien schreibt, ändert, schreibt erneut. Dann hält er mir das Handy hin.
Wir fragen hier nicht. Privat ist privat! Geheim ist geheim! Du ein Vogel mit den Fragen.
Ein Vogel mit den Fragen. Gott, wie ich diese Google-Translate-Poesie liebe! Was für ein Genie ist das bloß, das wie ein unsichtbarer Gott dasitzt und in alle Sprachen der Welt übersetzt? Wenn man in Google Translate blickt, starrt man ins Universum. So schön, so riesengroß, zu groß, um es verstehen zu können.
Der Korb ist inzwischen vollgepackt mit Käsepaketen, ein paar Tomaten, einigen fast rosa Zwiebeln und einem riesigen lilagrünen Salatkopf. Die Hitze macht jetzt wirklich ernst. Ich gehe auf der Schattenseite durch die Gassen, höre, wie es aus den Häusern heraus scheppert, wenn Menschen sich mit ihren vormittäglichen Tätigkeiten beschäftigen, während ich in die Rue Saint Denis einbiege. Schutz vor den starken Sonnenstrahlen bieten mir die Zweige der Bäume, die sich vom Klostergarten bis hinaus über die Straße erstrecken, um dann an der Hauswand gegenüber weiterzuklettern. Diesen kleinen Abschnitt der Gasse liebe ich. Eine geheime Lichtung im geheimen Garten. Die Klostermauer mit ihren abgenutzten Goldkreuzen und den steinernen Heiligenfiguren, die sich in dunklen Nischen auf der einen Seite verstecken, und die Häuser mit den von der Sonne gebleichten Fensterläden auf der anderen.
Vor dem Tor des Klosters gehen drei Männer auf und ab. Sie haben jeweils einen Aktenkoffer, einen Rollkoffer der robusteren Sorte und ordentlich zugeknöpfte Hemden. Einer von ihnen trägt sogar eine Krawatte, während der dritte, wie ich jetzt erst im Näherkommen sehe, einen Werkzeugkoffer in der Hand hat und eine Arbeitshose mit tausend Taschen trägt. Sie schauen sich um, spähen durch eine Lücke im Tor und klopfen an die separate Tür ein Stückchen weiter weg. Eindeutig zwei Bürohengste und ein Handwerker. Judy und Barry schleichen auf der Mauer auf und ab wie zwei misstrauische Wachlöwen. Ich bleibe vor den Herren stehen und ziehe den kleineren Schlüssel für die separate Tür aus der Tasche.
»Bonjour madame, voulez-vous …«
»Bonjour, and I’m sorry, I only speak English.«
Die Bürohengste tauschen einen Blick. Der mit der Krawatte räuspert sich.
»Bien, we today have un meeting réservé, it is for … for the …«
Der Mann mit der Krawatte sagt eine Menge Wörter, die ich nicht verstehe. Der Mann ohne Krawatte fällt ihm ins Wort.
»Et pour le …«
Jetzt sagt der Mann ohne Krawatte eine Menge anderer Wörter, die ich nicht verstehe. Dann übernimmt wieder die Krawatte.
»It is très important that we can …«
Sie holen verschiedene Kataloge hervor, Papiere, ein paar Bescheinigungen mit Stempeln, Ausweise, es wird auf verschiedene stornierte Daten seit 2018 gezeigt (fast schon geklopft). Zweifellos haben sie schon vorher versucht, mit ihren Rollkoffern hier reinzukommen. Okay, und jetzt fängt der Bürohengst ohne Krawatte auch noch an, die Kartons in seinem Rollkoffer aufzumachen. Der Handwerker lehnt ganz ruhig an der Mauer und schaut sich – seiner Meinung nach – lustige Youtube-Clips bei voll aufgedrehter Lautstärke an. Ich mustere die drei. Das sind keine Betrüger. Eindeutig kommen sie von irgendeinem Amt, irgendwas soll hier wohl ausgetauscht werden. Sie haben einen Termin ausgemacht, der Handwerker schaut sich zur Verzweiflung der beiden Bürohengste Youtube-Videos an, statt Sachen aufzubohren, und sie haben schon lange hier draußen gewartet. Immer wieder tippen sie auf ihre Uhren, und sogar ich spüre es, wenn die Geduld von Menschen zu Ende geht. Demnächst drehen sie durch.
Also schließe ich ihnen auf und bitte sie ins Haus. Ich habe noch nie drei große Männer so schnell durch eine so kleine Tür kommen sehen. Drei Sekunden später sind sie weg. Sie sind in die Katakomben des Klosters verschwunden. Ich gehe hinein, um ein spätes Frühstück für Einar zu machen, während die Katzen von der Mauer herunterfauchen.
5.
Im Schatten des riesigen Kastanienbaums decke ich den Tisch fürs Frühstück: Bonnibelles selbst gemachte Aprikosenmarmelade, die Butter unter der silbernen Glocke, den Kaffee in der silbernen Kanne, die aufgebackenen Baguettereste vom Vortag, einen Käse, der so kräftig ist, dass sich einem die Zehennägel kräuseln, und zwei dünne Porzellantassen mit Leopardenmuster auf ihren Untertassen. Dann gehe ich über die Wiese zum Feigenbaum und greife nach oben. Die gelben Feigen sind süßer als Zucker und haben innen eine ganz dunkle Purpurfarbe. Ich pflücke drei Früchte, schneide sie auf und lege sie neben den Käse. Einar sitzt in der Hocke neben der Hintertür, mit Sandalen, knallroter Seidenhose und nacktem Oberkörper. Er schmust mit den Katzen, die sich zu seinen Füßen räkeln, schnurren und wohlig strecken.
»Einar, Frühstück!«
Einar hält sich an einem der Marmortische fest und zieht sich hoch. Er reckt sich zur Sonne und lächelt breit. Heute ist ein guter Tag. Nicht alle Tage sind gut, aber jetzt gerade strahlt er. Langsam kommt Einar zum Frühstückstisch, zum Kastanienbaum und zu mir. Da tönt ein grelles Klingeln durch den ganzen Garten. Hektisch klopft Einar seinen ganzen Körper ab, um nachzufühlen, wo sein Handy steckt. Es klingelt erneut, und Einar sucht, bis er zum Schluss das Telefon unter dem Futter seiner Seidenhose findet. So steht er da, mit dem Telefon in der Hand, aber das laute Klingeln ist inzwischen verstummt.
»Das ist doch unmöglich. Erst muss man es finden und dann wissen, wo man draufdrücken muss. Warum kann man nicht einfach auf einem normalen Telefon anrufen? Da weiß man genau, wo man ist, und man muss nur einen Hörer abnehmen, um sprechen zu können.«
Einar reicht mir sein Handy. Ein verpasster Anruf von Paul. Ich rufe zurück und lehne das Handy ans Marmeladenglas. Paul erscheint auf dem Display. Er sitzt an seinem kahlen Schreibtisch in seinem ordentlichen Arbeitszimmer in seiner gut geputzten Drei-Zimmer-Wohnung in Täby. Er ist frisch rasiert und trägt perfekt gebügelte Sachen an diesem Hochsommertag.
Ich winke Einar heran.
»Komm! Hier ist Paul!«
»Hier wie in ›hier‹? Oder hier wie in ›da‹?«
»Hier wie in hier und da wie in Täby, aber hier auf dem Handy.«
Einar lässt sich auf seinen Stuhl fallen und nimmt das Handy in die Hand, gibt Pauls kleinem Gesicht auf dem Display einen Kuss und stellt ihn ganz verschmiert wieder ans Marmeladenglas.
»Mein Prinz! Mein wunderschöner Märchensohn! Bist du glücklich?«
Paul lächelt peinlich berührt.
»Glücklich ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen, aber es geht mir gut. Wenn du das gemeint hast.«
»Nein, nein, Paul, mein Prinz, ich rede nicht von gutgehen, ich rede von Glück! Bist du glücklich?«
Paul windet sich verlegen, und ich werde wieder daran erinnert, wie ähnlich sich die beiden sehen. Mit ihren schlaksig-langen Körpern, die auf natürliche Art muskulös sind. Keiner von den beiden macht jeden Morgen fünfzig Liegestütze, aber sie sehen so aus. Aber während Einar sich in Kaftane hüllt und mit funkelnden Augen auf das Handy blickt, sitzt der blasse Paul da eingeklemmt zwischen Ordnern in seinem gebügelten Hemd mit Pullover darüber und hat die Hände auf den Schreibtisch gelegt. Obwohl wir gerade Hochsommer haben.
»Ich weiß nicht so recht, wie ich auf diese Frage antworten soll.«
Einar zeigt auf die Reihen von Büromaterialien hinter Pauls Rücken.
»Sind diese ganzen Ordner da harmlos?«
Paul dreht sich um und schaut auf die nach Farben geordneten Ordner, die die ganze Wand bedecken.
»Ob die harmlos sind? Na ja, so könnte man es vielleicht formulieren.«
»Hab ich auch einen Ordner?«
»Selbstverständlich. Du hast sogar drei.«
»In welchen Farben?«
»Rot.«
»Die Farbe der Liebe. Du hast die Farbe der Liebe für deinen Vater ausgesucht. Hast du das gehört, Agneta?«
»Das war nicht wirklich der Grund. Ich habe nämlich blaue Ordner für meine Mandanten, grüne für …«
»Und rote für deinen Vater! Was machst du eigentlich mit diesen ganzen Ordnern? Gehören die alle dir?«
»Ich bin Wirtschaftsprüfer, wie du weißt. Und dazu braucht man Ordner.«
»Was steht in meinem Ordner?«
»Bonnibelle hat sich Sorgen um deine Finanzen gemacht und dachte, ich sollte sie mir mal anschauen. Dann sind da noch ein paar Kopien von Kaufverträgen, die Steuer …«
»Ich bin dir ja dankbar und so, aber weißt du, du musst dich nicht um mich kümmern. Ich bin so viele Jahre alleine zurechtgekommen, da komm ich jetzt auch noch zurecht, bis es Zeit ist, mich zu begraben. Wie ist das Wetter in Marseille?«
»Marseille? Ich bin hier in Täby. Und wir haben schönes Wetter.«
»Täby? Ach ja, stimmt. Paul ist in Täby, Armand in Marseille. Meine Liebsten sind überall, bloß nicht hier.«
»Ich habe bald Urlaub, und dann komme ich ein paar Wochen zu dir runter. Vielleicht brauchst du ja Hilfe bei irgendwas?«
»Hilfe? Nein, nein, ich brauch keine Hilfe. Was ich brauche, ist, dass du und ich zusammensitzen, gut essen, gut trinken und laut lachen. Das ist das Einzige, was ich brauche. Kommst du heute?«
»Nein, leider nicht.«
»Schade, heute ist so ein schöner Tag. Warte mal kurz … Jetzt ist das Fenster vom Mädchenzimmer wieder zu, stand das nicht neulich Abend offen?«
Einar zeigt auf die geschlossenen Fensterläden im zweiten Stock an der Klosterfassade.
Paul kommt bei diesen abrupten Themenwechseln nicht so richtig mit.
»Was für Mädchen?«
»Die Mädchen sind die Mädchen! Warum sind die Fenster da jetzt zu?«
Einar schaut mich streng an, und ich versuche, es ihm zu erklären.
»Ich hab die Läden zugemacht, weil ich dachte, dass sie nicht den ganzen Tag offen stehen sollten.«
Klopf, klopf, klopf!
Einar horcht auf.
»Was war das?«
Klopf, klopf, klopf!
»Da waren so ein paar Bürohengste, die irgendwas im Keller machen wollten. Sie haben offenbar schon vorher versucht, vorbeizukommen, aber aus irgendeinem Grund ist da wohl was schiefgelaufen. Aber jetzt reden wir weiter mit Paul, ja?«
»Bürohengste?«
»Ja, es schien, als ob sie irgendwas installieren wollten. Sie hatten Apparate dabei und einen Handwerker.«
BSSSS.
Jetzt hört man, wie gebohrt wird. Einar erstarrt und aus seinem Gesicht weicht jedes bisschen Farbe. Ich halte ihm eine Feige hin, aber er sieht es gar nicht. Paul versucht zu erfassen, was hier gerade vor sich geht, während Einar aufsteht und Miene macht, das Geräusch aufzuspüren.
»Haben die genauer gesagt, was sie da installieren wollen?«
»Das haben sie bestimmt. Sie haben nämlich furchtbar viel geredet, aber wie du weißt, versteh ich ja kein Französisch. Sie haben allerdings alle möglichen Papiere vorgezeigt, Diplome und Ausweise, also sind es keine Betrüger. Du kannst ganz beru…«
BSSSS.
Einar macht ein paar Schritte auf das ohrenbetäubende Bohrgeräusch zu.
»Sind sie im Keller?«
»Ich glaube, ja.«
»Wo ist mein Säbel?«
»Dein Säbel?! Was um Himmels willen willst du mit einem Säbel?«
Pauls Blick folgt uns besorgt, als Einar einen Stuhl umwirft und so schnell davonrennt, wie ein alter Mann eben rennen kann. Er dreht sich zu mir um und brüllt, dass der Speichel nur so spritzt:
»MEINEN SÄBEL! SOFORT!«
»Paul, wir hören uns später, ja?«
Ich schalte das Handy aus und renne Einar hinterher, überhole ihn, und dann stelle ich mich ihm mit hoch erhobenen Armen in den Weg.
»Einar. Ich weiß nicht, wo du gerade bist und was du mit einem Säbel willst, aber wir sind gerade im Garten zu Hause im Kloster, und alles ist in bester Ordnung.«
»Halt den Mund! Ich weiß sehr gut, wo ich bin. Und ich weiß genau, wer die da unten sind. Es ist vorbei, Agneta. Alles ist vorbei.«
Mein Gott, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Aber eines weiß ich ganz sicher, nämlich, dass es in den nächsten paar Minuten ausarten wird, egal, ob wir diesen Säbel finden oder nicht.
Einar stolpert zur Hintertür der Bibliothek, ich versuche, ihn gleichzeitig zu stützen und aufzuhalten. Als wir drinnen sind, verlieren wir beide das Gleichgewicht und reißen einen ganzen Stapel Bücher mit, die mit einem dumpfen, staubigen Laut zu Boden fallen. Wie damals, als die Kinder klein waren und vor dem Kühlregal im Supermarkt durchdrehten, zeige ich auf eines der Bücher, Bonjour tristesse, in der Hoffnung, ihn so von seinem Anfall ablenken zu können. Einar kann furchtbar gut schnelle Kehrtwendungen vollziehen.
»Schau, das alte Buch da – das ist ja schon ewig lange her. Wollen wir das nicht mal wieder lesen?«
Einar steht auf und schaut mich an. Oder nein, er schaut mich nicht an, er schaut direkt durch mich hindurch, schneidet mit seinem Blick quasi in mich hinein.
»Red nie wieder so mit mir. Nie wieder.«
Dann hebt er zitternd das Bein, als wolle er versuchen, die Kellertür einzutreten, aber das Bein will ihm nicht gehorchen. Mein Gehirn ist wie Einars Bein, es kommt nicht mehr hinterher. Haben wir nicht gerade noch unter dem Kastanienbaum gesessen und mit Paul geplaudert? Können wir nicht einfach damit weitermachen? Bevor der Kaffee kalt wird, Paul anfängt zu arbeiten, die Butter schmilzt und all die anderen kleinen Katastrophen eintreten, die sich …
Okay, jetzt reißt Einar die Kellertür mit beiden Händen auf und verschwindet mit erstaunlicher Geschwindigkeit über die enge Treppe nach unten. Ich ihm nach, mit Geheul. Ich erkenne meine eigene Stimme nicht wieder.
»Einar! EINAR! Warte, du kannst doch nicht einfach …«
»DOCH, DAS KANN ICH! Wir oder sie. WIR ODER SIE!«
Ich bin noch nie auf diesem Weg in den Keller gegangen. Es ist dunkel, doch Einar scheint kein Licht zu brauchen. Er weiß genau, wo er hinmuss. Besser gesagt, er schlägt alles beiseite, was ihm im Weg steht. Es ist eng, ich kann die Wände rechts und links fühlen, unsere Schritte sind gedämpft.
»Einar! Warte, ich seh nichts, ich kann nicht mehr atmen, es …«
Einar stößt eine weitere Tür auf. Hier ist es geräumiger, wir sind draußen in den Katakomben. Ich kann wieder atmen, aber ich sehe immer noch nichts. Das Hämmern klingt jetzt ganz nah, oder ist das nur mein Herzklopfen? Ich kann Einar nicht sehen, aber ich kann ihn hören. Er atmet laut, er keucht, und jetzt brüllt er auch noch. Du liebe Güte, das Ganze wird in einem völligen Desaster enden.
Man hört einen lauten Aufprall, Einar hat eine weitere Tür eingetreten, und jetzt dringt Licht herein. Ich blinzle. Und dann sehe ich in diesem Spalt zwei zu Tode verängstigte Büromenschen, einen Handwerker, der konzentriert auf Hochtouren bohrt, und Einar, der seine geballte Faust reckt.
6.
Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gerannt. Ich habe auch noch nie so laut geschrien. Ich bin auf die Rue Saint Denis hinausgerannt und habe mit der Faust gegen Bonnibelles Tür gehämmert. Habe ich die Tür eingeschlagen? Keine Ahnung. Meine Knöchel sind auf jeden Fall ganz rot. Ich bin weitergerannt zum Marktplatz, wie in so einem Alptraum, wenn man furchtbar schnell irgendwo hinwill, aber einfach nicht vom Fleck kommt. Wenn man seine Brille verliert und alles nur noch verschwommen sieht, wenn die Beine einem nicht mehr gehorchen, wenn einem die Stimme versagt, wenn die Ohren nichts mehr hören – in genau so einem Zustand rannte ich zur Bar.
Ich weiß kaum noch, wie das passiert ist, aber Fabien ist jetzt auf jeden Fall bei mir und Bonnibelle ebenfalls. Wir stehen vor dem alten Käsezimmer des Klosters, in dem die Nonnen damals Käse herstellten. Jetzt ist es nur noch ein Kellerraum mit langen Tischen, scheppernden Milchkannen, Käseformen aus Keramik, Schöpflöffeln für die Molke … und einem rasenden Einar.