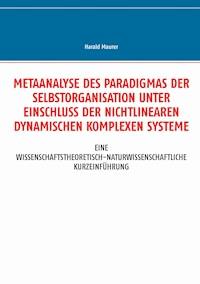
Metaanalyse des Paradigmas der Selbstorganisation unter Einschluss der nichtlinearen dynamischen komplexen Systeme E-Book
Harald Maurer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch bietet eine kurze Einführung in das Thema der Selbstorganisation aus einer naturwissenschaftlich-wissenschaftstheoretischen Perspektive. Das Buch richtet sich vor allem an Student(-inn-)en aus den Disziplinen der Kognitionswissenschaft, der komputationalen und kognitiven Neurowissenschaften, der Neuroinformatik, der Neurophilosophie, und der Neurolinguistik sowie an diejenigen, die sich für den Themenbereich der Künstlichen Intelligenz interessieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BoD-Wissenschaftsbuch
Autor:
Harald Maurer hat seinen Magisterabschluß an der Universität Tübingen im Jahr 2007 bei Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Walter Hoering gemacht. Sein Studium umfaßte die folgenden Fächer: das Hauptfach Philosophie, die Nebenfächer Informatik und Jura sowie die Beifächer Psychologie, Soziologie und vergleichende Religionswissenschaft mit Schwerpunkt Indologie. Daneben hat er auch Studien betrieben in Mathematik und den Naturwissenschaften, vor allem in Physik, Chemie, Biologie und Medizin.
Seit 2013 ist er Dozent gewesen im Fachbereich Philosophie an den Universitäten Tübingen, Heidelberg und Magdeburg. Zur Zeit schreibt er an seiner zweiten Promotionsarbeit als Dr. rer. nat. im Fachbereich Informatik und an einem Antrag für ein DfG-Forschungsprojekt im Fachbereich Theoretische Philosophie. Daneben übersetzt er für den U.S.-amerikanischen Verlag "CRC Press/The Science Publisher" sein Einführungsbuch über den Konnektionismus mit dem Titel: "Cognitive Science: Integrative Synchronization Mechanisms in Cognitive Neuroarchitectures of the Systemtheoretical Connectionism."
Harald Maurer
Eberhard Karls Universität Tübingen
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Wilhelm-Schickard Institut für Informatik
Theoretische Informatik: Logik und Sprachtheorie
Sand 13
72076 Tübingen
E-Mail: [email protected]
Vorwort
Das Buch bietet eine kurze Einführung in das Thema der Selbstorganisation aus einer naturwissenschaftlich-wissenschaftstheoretischen Perspektive. Es entstand im Rahmen der Vorbereitung für einen Antrag auf ein DfG-Forschungsprojekt über eben diese Thematik in den Jahren 2012-2017.
Das Buch richtet sich vor allem an Student(-inn-)en aus den Disziplinen der Kognitionswissenschaft, der komputationalen und kognitiven Neurowissenschaften, der Neuroinformatik, der Neurophilosophie, und der Neurolinguistik sowie an diejenigen, die sich für den Themenbereich der Künstlichen Intelligenz interessieren.
Ich möchte mich hiermit vor allem bei Prof. Dr. Holger Lyre (Theoretische Philosophie der Universität Magdeburg) bedanken, der mir in einer Vielzahl von Gesprächen wertvolle Anregungen für mein Verständnis des Themas gegeben hat, sodaß dieses Buch überhaupt entstehen konnte.
Abschließend möchte ich mich noch ganz herzlich bei meiner Frau Renate Maurer, Diplombetriebswirtin (BA) und Steuerberaterin, bedanken, die mit einem Höchstmaß an Unterstützung, Geduld und Nachsicht es erst ermöglicht hat, daß diese Arbeit entstehen konnte, und schließlich bei meiner Mutter für das Korrekturlesen des Manuskripts.
Tübingen, im Sommer 2017
Dr. phil. Harald Maurer M.A.
KAPITELVERZEICHNIS
Vorwort
Wissenschaftsgeschichte des Selbstorganisationsparadigmas
Terminologische Analyse des Selbstorganisationsparadigmas
Charakteristika von selbstorganisierten dynamischen Systemen
Fundamentalprinzipien des Selbstorganisationsparadigmas
4.1 Systememergenz bzw. spontane globale Systemorganisation
4.2 Zirkuläre kausale autokatalytische und crosskatalytische Systemdynamik
4.3 Fern-vom-Gleichgewichtsdynamik bzw. Fließgleichgewichtsdynamik
4.4 Relativ autonome und adaptive Systemregulation bzw. Systemkontrolle
4.5 Distribuierte Systemregulation und robuste, stabile Systemfunktionen
4.6 Nichtlineare Systemfunktionalität und probabilistische Systemprognose
4.7 Systemkonvergenz und interne stabile Systemelementkonfigurationen
4.8 Selbstorganisierte bzw. selbstgenerierte strukturelle Systemkomplexität
Exkurs: Selbstorganisation(-smechanismen) in der Neurokognition
Wissenschaftstheoretische Analyse der dynamischen fluiden Selbstorganisationsmechanismen
Selbstorganisation und „Einheitswissenschaft“
Literatur
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
a.A., A.A.
andere Ansicht, anderer Ansicht
Abb.
Abbildung
A.d.V.
Anmerkung des Verfassers
a.E.
am Ende
Bd.
Band
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
Chap.
Chapter
d.b.
das bedeutet
d.f.
daraus folgt
d.h.
das heißt
ders., Ders.
derselbe
dt.
deutsch
engl.
englisch
et. al.
et alii, et aliae, et alia (dt.: und andere)
etc.
et cetera bzw. ecetera (dt.: und andere)
Fn.
Fußnote
franz.
Französich
gem.
gemäß
Gl.
Gleichung
griech.
griechisch
Hf.
Heft
h.M.
herrschende Meinung
i.B.a.
in Bezug auf
i.d.R.
in der Regel
i.e.S.
im engeren Sinn
i.S.(v.)
im Sinne (von)
i.w.S.
im weiteren Sinn
Jhdt.
Jahrhundert
Kap.
Kapitel
lat.
lateinisch
m.E., M.E.
meines Erachtens
m.a.W.
mit anderen Worten
m.B.a.
mit Bezug auf
m.w.Lit.
mit weiterer Literatur
s., S.
siehe, Siehe
sog.
sogenannte, sogenannten, sogenannter
s.v.w.
so viel wie
übers.
übersetzt
U.z., u.z.
Und zwar, und zwar
v.a.
vor allem
Vgl.
Vergleiche
vs.
versus
z.B.
zum Beispiel
Zit.
Zitiert
1. WISSENSCHAFTSGESCHICHTE DES SELBSTORGANISATIONSPARADIGMAS
1.1 Seit den vierziger Jahren des 20. Jhdt.'s hat sich – mit dem Aufkommen der Kybernetik (WIENER (1948 (1961)), ASHBY (1947); System Dynamics: FORRESTER (1971)) – das allgemeine Prinzip der Selbstorganisation, einschließlich der Theorie der nichtlinearen dynamischen komplexen Systeme, in einer Vielzahl von Wissenschaftsdisziplinen zu dem vorherrschenden (Forschungs-)Paradigma bzw. zu dem vorherrschenden interdisziplinären Forschungsprogramm (weiter-)entwickelt (KROHN, KÜPPERS & PASLACK (1987), PASLACK (1991), KROHN & KÜPPERS (1990, 1992), MUSSMANN (1995), JAEGER (1996), MAINZER (1999), KANITSCHEIDER (1981, 2000, 2006), KÜPPERS (2008), BANZAF (2009)).
1.2 In der Philosophie und Wissenschaftstheorie hingegen ist diese neue Forschungsströmung bisher nur von ganz wenigen Autoren aufgegriffen worden (s. im einzelnen MAURER (2014a)):
1.21 Mit seinem “Dynamical Mechanistic Approach” in der Wissenschaftstheorie der Bio- und Neurowissenschaften beschäftigt sich in neuerer Zeit der U.S.-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker und Philosoph William BECHTEL mit der Analyse der komplexen, selbstorganisierten Dynamik von (neuro-)biologischen Mechanismen anhand einer dynamisch-mechanistischen Erklärung (engl. “dynamic mechanistic explanations”) (s. z.B. BECHTEL (2008); s. auch CRAVER (2007); einführend MAURER (2014a: Kap. 6.15.02.1)).
1.22 Ferner hat sich seit den neunziger Jahren des 20. Jhdt.'s der deutsche Wissenschaftstheoretiker und Philosoph Klaus MAINZER mit der Theorie der nichtlinearen komplexen Systeme auseinandergesetzt, auch in Verbindung mit Themen aus der Neuroinformatik und Neurophilosophie, der Robotik, der Künstlichen Intelligenz (KI) und des Konnektionismus (MAINZER 1994a, 1999, 2004a, b, 2008, 2010).
1.23 Desweiteren haben seit der Mitte der siebziger Jahre des 20. Jhdt.'s die deutschen Wissenschaftstheoretiker und Philosophen Hans LENK und Günter ROPOHL die Position vertreten, daß die (allgemeine) Systemtheorie mit ihrer Systemanalyse eine die philosophische Analyse überformende neue – oder erneuerte – „Synthetische Philosophie“ mit metatheoretischem Charakter begründet (LENK (1975, 1978, 2001), ROPOHL (1978, 1979, 2005, 2012) mit Hinweis auf den deutschen Wissenschaftstheoretiker und Philosophen Bernulf KANITSCHEIDER (1985/1986 a,b)).
1.24 Mit seiner schon in den zwanziger Jahren des 20. Jhdt.'s begonnenen „Allgemeinen Systemlehre“ hat weiterhin der österreichische theoretische Biologe Ludwig von BERTALANFFY (1949 (1972), 1950a,b, 1953, 1968, 1975) den Versuch unternommen, diese zu einem interdisziplinären Forschungsprogramm weiterzuentwickeln in Gestalt einer „Allgemeinen Systemtheorie“ (“General Systems Theory (GST)”), die allgemeine Gesetzmäßigkeiten, z.B. in Form von (logischen) Homologien und allgemeinen Systemprinzipien, zur Beschreibung von formal gleichartigen Erscheinungen in den verschiedenen Wissenschaftsbereichen bereitzustellen in der Lage ist. Dieses organismische Systemdenken zeichnet sich nun vor allem dadurch aus, daß im Rahmen der Analyse eines Organismus als eines lebenden Systems der Prozeß der materiell-energetischen Systemdynamik in Rückkopplungsschleifen (engl. “feedback”) im Fokus steht, wodurch er als ein offenes System, das sich mit seiner Umwelt im „Fließgleichgewicht“ (engl. “steady state”, “flux equilibrium”) befindet, zu betrachten ist.
Als einen Vorläufer dieses allgemeinen Systemansatzes kann auch der russische Mediziner und Philosoph Alexander BOGDANOV (1922 (1980)) betrachtet werden, der zu Beginn des 20. Jhdt.'s sein Programm einer allgemeinen Organisationslehre, der “Tektology”, entworfen hat.
1.3 Schließlich sind ansonsten bisweilen lediglich einzelne Aspekte einer (allgemeinen) System- und Selbstorganisationstheorie in der Philosophie angegangen worden (s. die Sammelbände: KRATKY & WALLNER (Hrsg.) (1990), NIEGEL & MOLZBERGER (Hrsg.) (1992), PORT & VAN GELDER (Eds.) (1995), KRAPP & WAGENBAUR (Hrsg.) (1997), GLOY, NEUSER & REISINGER (Hrsg.) (1998), EDLINGER, FEIGL & FLECK (Hrsg.) (2000), FELTZ, CROMMELINCK & GOUJON (Eds.) (2006), VEC, HÜTT & FREUND (Hrsg.) (2006), BREUNINGER (Hrsg.) (2008)) (s. z.B. die Einzelabhandlungen in der Philosophie: FISCHER (1990), BACHMANN (1998), HEIDELBERGER (1990), HEUSER (1986, 1989, 1990), ZIEMKE (1992), HOFER (1996)), und in der Wissenschaftstheorie: LENK (1978), ROPOHL (1979), KRATKY (1990), KNOBLOCH (1992), MÜNDEMANN (1992), SCHLOSSER (1993), SCHWEITZER (1997), GLOY (1998a,b), HOFKIRCHNER (1998), OESER (1998), NEUSER (1998), WUKETITS (2000), BUNGE (2000), LORENZEN (2000), ROCKWELL (2005), KRALEMANN (2006), BREIDBACH (2007), FREUND, HÜTT & VEC (2004, 2006), HÜTT (2006), HÜTT & MARR (2006), LIVET (2006), MAURER (2006 (2009), 2014a)).
2. TERMINOLOGISCHE ANALYSE DES SELBSTORGANISATIONSPARADIGMAS
2.1 Im Gegensatz hierzu wird eine Neufassung der philosophischen Begriffsanalyse des (allgemeinen) Selbstorganisationsprinzips vorgenommen (s. z.B. einführend HEYLIGHEN (2001, 1995), HEYLIGHEN & JOSLYN (2001), DI MARZO SERUGENDO et al. (2004), DI MARZO SERUGENDO et al. (2006), HOOKER (2011); s. auch JANTSCH (1980)), orientiert an der theoretischen Terminologie, wie sie in der Mathematik, z.B. in der (allgemeinen) nichtlinearen Dynamischen Systemtheorie (engl. “Dynamic Systems Theory (DST)”), verwendet wird (s. Kap. 1.1, MAURER (2014a): Kap. 1.21, 1.22), und an den neuesten (system-)theoretischen Konzepten aus den Natur- und Humanwissenschaften (MAURER (2014a): Kap. 1.25). Dabei wird eine fluide Konzeption von Selbstorganisationsmechanismen in das Zentrum der Betrachtung gerückt, die in neuester Zeit vor allem in der Neuroinformatik und der komputationalen Neurowissenschaft (MAASS & NATSCHLÄGER & MARKRAM (2002), MAASS (2007), JAEGER ((2002) 2008), WERNING (2001, 2005a, 2005b, 2012), PIPA (2010)), in der kognitiven Neurowissenschaft (PASEMANN (1995, 1996), REMPIS et al. (2013)), SINGER (2013)), in der Kognitionswissenschaft (STROHNER (1995), KURTHEN (1996)) sowie in der theoretischen (Neuro-)Philosophie und Wissenschaftstheorie (BECHTEL (2008), CRAVER (2007), MAINZER (1994a, 2006)), z.B. vor allem im Rahmen eines fluiden Modells der (Neuro-)Kognition (MAURER (2004 (2009), 2006 (2009), 2009, 2014a, 2014b, 2016a,b), zunehmend als entscheidend betrachtet wird.
2.2 Dabei wird im allgemeinen (ASHBY (1962, 2004); GLANSDORFF & PRIGOGINE (1971), NICOLIS & PRIGOGINE (1977): “order through fluctuations”; VON FOERSTER (1960), VON FOERSTER & ZOPF (Eds.) (1962): “order from noise”; KAUFFMAN (1993)) als zentral für das Prinzip der Selbstorganisation der zu beobachtende Sachverhalt angesehen, daß, entgegen dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, relativ (system-)autonom, spontan qualitativ neue, „emergente“ (STEPHAN (1999, 2006), HOYNINGENHUENE (2007), KORNWACHS (2008)) und relativ stabile Strukturen und Prozesse, oder allgemein: (Ordnungs-)Muster bzw. Eigenschaften eines Systems als Ganzem auftreten und aufrechterhalten werden, die – mit Bezug auf die Analyseebene der Systemkomponenten – grundsätzlich nicht ableitbar oder vorhersehbar sind (HEYLIGHEN (2001), EBELING et al. (1998), SCHMIDT (2008)). Diese spontanen Strukturbildungsprozesse entstehen dadurch, daß ein dynamisches System einen Systemzustand höherer Ordnung einnimmt, indem ein „Export von Entropie“ stattfindet, sodaß „die Entropieproduktion auf ein Minimum beschränkt wird” (EBELING (1976, 1982, 1989), EBELING et al. (1990, 1998), SCHRÖDINGER (1944)). Ferner hat man dabei die „konservative Selbstorganisation“ im thermischen Gleichgewicht von der „dissipativen Selbstorganisation“ (PRIGOGINE (1980), NICOLIS & PRIGOGINE (1977)); s. auch von BERTALANFFY (1950b), HAKEN ((1982) 1990) abzugrenzen (JANTSCH (1981), MAINZER (1994a, 1997)). Ein offenes Nichtgleichgewichtssystem, d.h. ein System fern des thermischen Gleichgewichts, zeichnet sich dadurch aus, daß seine Phasenübergänge und die Stabilität seiner (Ordnungs-)Strukturen durch eine kritische Balance aus nichtlinearen und dissipativen Mechanismen bestimmt werden, d.h. sich neue, emergente (makroskopische) (Ordnungs-)Strukturen ausbilden durch eine Vielzahl von komplexen nichtlinearen Wechselwirkungen von (mikroskopischen) Systemelementen, wenn der Austausch von Materie, Energie und Information des offenen dynamischen (dissipativen) Systems mit seiner Umgebung einen kritischen Wert erreicht (MAURER (2014a): Kap. 1.23).
3. CHARAKTERISTIKA VON SELBSTORGANISIERTEN DYNAMISCHEN SYSTEMEN
Ausgehend davon kann man nun eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende (Mindest-)Anzahl von (Haupt-)Merkmalen bzw. (Haupt-)Eigenschaften von selbstorganisierten (dynamischen) Systemen aufzählen, die dadurch als ein Ausgangspunkt einer weitergehenden Analyse der (allgemeinen) Prinzipien der Selbstorganisation dienen kann, wobei manche dieser Eigenschaften bei allen physikalischen, physikalisch-chemischen, biochemischen bis hin zu den komplexeren (neuro-)biologischen und (neuro-)kognitiven Systemen anzutreffen sein werden (Kap. 4.1, 4.7, 4.9), während andere vor allem bei letzteren auftreten (Kap. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8).





























