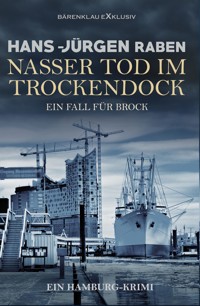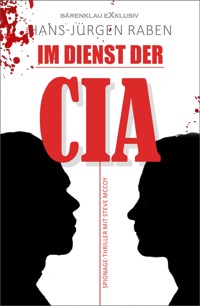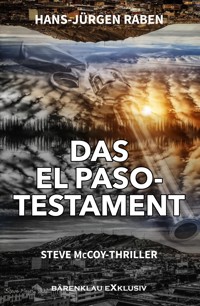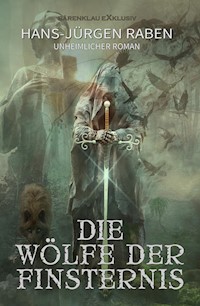3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach seiner Entlassung aus der Armee erklärt Martin Bennett den Vereinigten Staaten seinen persönlichen Krieg. Ein Gouverneur und ein Senator sind die ersten Opfer missglückter Entführungen. Dann wird ein amerikanischer Diplomat in Mexiko mit zahlreichen anderen Geiseln verschleppt – unter ihnen der Geheimagent Steve McCoy, der eigentlich nur einen Urlaub in Mexiko machen wollte. Die Situation spitzt sich immer dramatischer zu, und die Geiselnahme droht in einem Massaker zu enden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hans-Jürgen Raben
Mexiko sehen und sterben
Ein Polit-Thriller mit Steve McCoy
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kathrin Peschel, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Der Autor Hans-Jürgen Raben
Weitere Werke des Autors
Das Buch
Nach seiner Entlassung aus der Armee erklärt Martin Bennett den Vereinigten Staaten seinen persönlichen Krieg. Ein Gouverneur und ein Senator sind die ersten Opfer missglückter Entführungen. Dann wird ein amerikanischer Diplomat in Mexiko mit zahlreichen anderen Geiseln verschleppt – und unter ihnen der Geheimagent Steve McCoy, der eigentlich nur einen Urlaub in Mexiko machen wollte. Die Situation spitzt sich immer dramatischer zu, und die Geiselnahme droht in einem Massaker zu enden …
***
1. Kapitel
Sacramento, Kalifornien, Juni 1987
»Es ist so weit!«
Eddie Floyd spuckte seinen Kaugummi aus dem heruntergedrehten Seitenfenster und stieß seinen Nachbarn in die Rippen. Der kleine dunkelhäutige Kubaner warf ihm einen mürrischen Blick zu, nickte langsam und ließ den Motor des weißen Pontiacs an. Sie rollten gemächlich durch das ruhige Villenviertel, das sich den ganzen Hang emporzog. Von den meisten Häusern hatte man einen herrlichen Blick in die Landschaft, gerade jetzt, als die Sonne ihre letzten Strahlen über Kalifornien schickte.
Doch die beiden Männer in dem Auto hatten keinen Sinn für das farbige Schauspiel der untergehenden Sonne. Gonzales, der Kubaner, kannte den Weg genau. Schließlich hatten sie das Unternehmen oft genug geprobt.
Floyd griff unter seinen Sitz und zog eine Uzi-Maschinenpistole heraus. Die Schulterstütze war nach vorn geklappt, sodass die Waffe nicht viel länger aussah als eine langläufige Pistole. Er überprüfte die Mechanik und lud durch. Anschließend schob er die Waffe unter seine Jacke.
Ein Pfeifton weckte ihre Aufmerksamkeit. Sie griffen beide gleichzeitig zu dem Sprechfunkgerät, das zwischen ihnen auf der Sitzbank lag.
»Langsam, langsam«, knurrte Eddie, »nur nicht nervös werden.«
Er hob das Gerät vor die Lippen. »Hier Frisco eins, bitte kommen!«
»Hier Zentrale. Ist bei euch alles in Ordnung?« Die Stimme klang heiser und schnarrend.
Eddie nickte, obwohl ihn sein Gesprächspartner nicht sehen konnte. »Klar! Wir sind gleich da. Es sind noch etwa zweihundert Yards bis zu dem Haus.«
»Dann fahre jetzt schneller. Er ist auf die Terrasse gegangen. Der Posten sitzt wie immer auf einem Gartenstuhl am Eingang. Wir starten jetzt.«
»Verstanden«, erwiderte Eddie leise.
»Also dann los!« Er nickte Gonzales aufmunternd zu, und der schwere Wagen schoss mit einem Ruck vorwärts.
Weiter oben an der Hangstraße löste sich gleichzeitig ein Lieferwagen aus einer Parklücke und rollte die schmale, gewundene Straße hinunter. Die beiden Fahrzeuge würden sich bei gleichbleibender Geschwindigkeit vor einer breiten Toreinfahrt treffen, die mit einem verzierten schmiedeeisernen Tor verschlossen war. Unmittelbar dahinter lag ein kleines Häuschen versteckt hinter einer Hecke.
Ein kiesbestreuter Weg führte zu einem weiten Vorplatz, hinter dem ein weißes Haus im Südstaatenstil stand. Die Säulen der Terrasse glühten dunkelrot unter den letzten Sonnenstrahlen.
Das war der private Wohnsitz des Gouverneurs von Kalifornien.
Inzwischen hatten die beiden Fahrzeuge das Tor erreicht. Sie bremsten ab, und der Posten blickte gelangweilt zu ihnen hinüber. Er sah einen PKW mit zwei Männern, die ihn überhaupt nicht beachteten, und einen Lieferwagen mit der Aufschrift einer Wäscherei. Hinter dem Steuer saß nur ein einzelner Mann. Der Posten vertiefte sich wieder in sein Comicheft und lehnte sich in seinem Gartenstuhl zurück.
Dann ging alles sehr schnell. Der Motor des Lieferwagens heulte auf, der Wagen bog in die Einfahrt und prallte gegen das Tor. Der schmale Riegel brach sofort, und die Torflügel schlugen knallend zur Seite. Ehe der Posten überhaupt begriff, was geschah, war der Lieferwagen schon durch und raste auf das Haus zu.
Der Posten zerrte an seinem Holster, um die Pistole herauszubekommen, aber da hielt der Pontiac schon neben ihm. Ein Mann sprang heraus und hielt ihm eine Maschinenpistole unter die Nase. Der Posten hob hilf los die Arme.
Eddie Floyd zog ihm die Pistole aus dem Holster und trieb ihn zu dem kleinen Häuschen hinüber. Mit Handschellen fesselte er ihn an eine Heizung. Der Überfall hatte bis jetzt nur Sekunden gedauert, niemand hatte ein Wort gesagt.
»Damit kommt ihr nicht durch!«, rief der Posten hinter Eddie her.
Eddie drehte sich schweigend um und hieb dem Mann die Maschinenpistole ins Genick. Stöhnend brach er in die Knie.
Eddie schwang sich bereits wieder in den Wagen, und Gonzales folgte dem Lieferwagen.
Der Mann, der zwischen den Säulen seines Hauses auf der breiten Treppe stand, hatte das Geschehen bisher fassungslos verfolgt. Erst als der Lieferwagen schleudernd vor dem Haus bremste und dabei eine Ladung Kies in die Luft schleuderte, löste er sich aus seiner Erstarrung. Er rannte ins Haus zurück und sah, wie aus der hinteren Tür mehrere Männer sprangen.
»Los! Zwei Mann nach hinten!«, schrie eine Stimme. Sie gehörte einem massigen Mann mit einem Kinnbart, der mit einem schweren Revolver herumfuchtelte.
Er sah sich um. »Eddie, zu mir! Wir müssen ihn herausholen!«
Obwohl die Männer scheinbar wild durcheinanderrannten, lief das Geschehen mit militärischer Präzision ab. Zwei Mann sicherten die Rückfront des Hauses, Gonzales deckte den Rückweg und behielt die Toreinfahrt im Auge. Die Fahrzeuge standen mit laufendem Motor in Richtung Ausfahrt und waren fluchtbereit. Eddie folgte dem Anführer die Treppe hinauf.
Und in diesem Augenblick erschien der Gouverneur wieder auf dem Schauplatz. Aber er tat etwas, was sie als Einziges bei ihrer Planung nicht berücksichtigt hatten: Er wehrte sich!
Er stand ruhig und breitbeinig in der Eingangstür, deren gläserne Flügel blitzten. In seiner rechten Armbeuge lag ein doppelläufiges Jagdgewehr und dann krachte auch schon der erste Schuss.
Die Schrotladung ging zum größten Teil an den beiden Angreifern vorbei und schlug in den Kies des Vorplatzes. Trotzdem wurde der massige Mann an der Hand getroffen. Er brüllte auf und ließ den Revolver los, der scheppernd die Stufen hinunterrutschte.
Das Jagdgewehr schwenkte ein Stück herum, und Eddie Floyd sah aus wenigen Yards Entfernung in die beiden dunklen Mündungen, die ihm vorkamen wie Kanonenrohre. Einen Herzschlag lang trennte ihn nur ein winziger Fingerdruck vom Tod.
Eddie Floyd reagierte instinktiv. Sein Finger fand den Abzug, und die Uzi spuckte ihre tödliche Ladung aus.
Der Gouverneur wurde nach hinten gerissen, und die zweite Schrotladung ging in die Luft. Er fiel in die Glastür, und klirrend zersprang eine Scheibe. Dann war alles ruhig.
Der massige Mann mit dem Bart hielt sich seine zerschossene Hand und näherte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht dem Toten. »Verdammt, da ist nichts mehr zu machen«, murmelte er.
Er drehte sich zu Eddie um, der immer noch in der gleichen Haltung dastand, die Maschinenpistole im Anschlag. Sein Gesicht war schweißüberströmt, und seine Augen flackerten leicht. Schließlich löste er den Finger vom Abzug. »Ich musste es tun, sonst hätte er mich erschossen.«
»Schon gut«, sagte der andere und winkte ab. »Es ist eben schiefgegangen. Da lässt sich nichts mehr ändern. Wir müssen hier weg, es wird gleich ungemütlich werden.«
Die Männer bestiegen die beiden Fahrzeuge und rasten zum Tor hinaus. Sekunden später lag wieder die gewohnte Ruhe über der Gegend, aber nicht sehr lange, dann wurde sie erneut gestört: durch den Lärm von Polizeisirenen, die sich von allen Seiten näherten.
2. Kapitel
»Was halten Sie davon?« District Attorney Jackson sah den Police-Captain mit zusammengezogenen Augenbrauen an.
»Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen«, erwiderte der Captain. »Ich möchte mit meinen Schlussfolgerungen noch vorsichtig sein. Aber ein paar Dinge gibt es, die sonnenklar sind.«
»Und die wären?« Der Staatsanwalt bohrte mit seiner Schuhspitze im Kies herum. Er hatte seine Hände auf dem Rücken verschränkt und musterte die große weiße Villa. Die Leiche des Gouverneurs hatte man schon weggebracht, aber die blutbespritzte Glastür war selbst aus einigen Yards Entfernung deutlich zu erkennen.
»Es waren zwei Autos mit mindestens vier Männern, wahrscheinlich mehr«, erläuterte der Captain.
»Der Posten kann sich zwar nur undeutlich erinnern, bestätigt es aber. Wir wissen, dass es sich bei den Wagen um einen weißen PKW sowie einen Lieferwagen handeln soll, der die Aufschrift einer Wäscherei trug.«
»Und wie ging der Überfall Ihrer Meinung nach vor sich?«, erkundigte sich Jackson. »Sie werden doch schon eine Theorie haben?«
»Ja.« Der Captain nickte. »Obwohl die Aussagen der Zeugen, die die Schüsse gehört haben, widersprüchlich sind, scheint doch festzustehen, dass die Gangster nicht als Erste geschossen haben. Der erste Schuss kam aus der Schrotflinte.«
Jackson sah den Polizeioffizier scharf an. »Wollen Sie es dem Gouverneur übelnehmen, wenn er sich gegen einen Überfall zur Wehr setzt?«
»Keineswegs. Aber diese Tatsache ist sehr wichtig. Sie beweist, dass es sich bei diesem Überfall nicht um einen Mordanschlag handelte.«
»Sondern? Der Gouverneur ist immerhin tot!«
Der Captain ließ sich nicht irritieren. »Ich glaube, dass man versucht hat, den Gouverneur zu entführen. Offenbar klappte aber nicht alles so, wie die Täter sich das vorgestellt hatten. Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem der Gouverneur getötet wurde.«
Jackson schwieg einen Moment. »Es klingt einleuchtend, aber was für ein Motiv könnte dahinterstecken?«
Der Captain zuckte mit den Schultern. »Es ist noch zu früh, darüber Theorien aufzustellen. Es waren in jedem Falle Professionelle, die dafür verantwortlich sind. Heute war der einzige Tag seit Wochen, an dem der Gouverneur allein zu Hause war. Die Täter waren über die Wache informiert und über die Stärke des Torriegels. Sie hatten sich gründlich vorbereitet. Und sicher hätten sie ihr Ziel auch erreicht, wenn der Gouverneur nicht zu seinem Gewehr gegriffen hätte.«
»Ich glaube, Sie haben recht.« Jackson nickte. »Bei einem Mordanschlag wäre man anders vorgegangen. Das heißt, wir müssen auch hier auf die neuen Spielarten des Terrorismus gefasst sein.«
Sie blickten beide schweigend auf die Untersuchungsbeamten, die in einem für den unbefangenen Betrachter unverständlichen Chaos durcheinanderliefen und Spuren sicherten.
»Gibt es schon irgendwelche Hinweise?«, fragte der Staatsanwalt. »Ich möchte, dass alles darangesetzt wird, dass man diese Burschen schnappt. Denn ich habe den Verdacht, dass sie es noch einmal versuchen. Diese Gangster lassen sich von einem Misserfolg so schnell nicht abschrecken.«
Der Captain winkte einen seiner Beamten heran. »Wie sieht’s aus?«
»Wir haben keine wesentlichen Erkenntnisse, die über die ersten Ermittlungen hinausgehen«, sagte der Mann. »Wir wissen aber immerhin mit einiger Sicherheit, dass es mindestens sechs Leute waren. Das spricht für eine gewisse Organisation.«
»Das ist alles?«, erkundigte sich der Captain.
»Nein. Wenn Sie bitte mitkommen wollen. Wir haben noch etwas Interessantes gefunden.«
Sie folgten dem Mann über den Vorplatz, und der Kies knirschte unter ihren Schritten. Neben der Treppe war ein Fotograf damit beschäftigt, einen Gegenstand, der seitlich neben der Treppe zwischen den Blumen lag, vor die Linse zu bekommen. Er hob die Hand. »Okay, erledigt. Ihr könnt ihn jetzt herausholen.«
Einer der Beamten bückte sich und hob mithilfe eines Tuches vorsichtig einen Gegenstand hoch. Der Captain sog scharf die Luft ein, als er erkannte, worum es sich handelte.
Es war ein schwerer Revolver. Der Captain streckte die Hand aus, und der Mann reichte ihm die Waffe auf dem weißen Tuch.
»Ein Colt .44 Magnum«, sagte der Captain. »Ziemlich großes Kaliber.«
Er schnupperte an der Mündung und prüfte die Trommel. »Aus dieser Waffe ist kein Schuss abgefeuert worden«, meinte er schließlich.
Er gab den Revolver zurück. »Ins Labor damit. Und die Kollegen sollen sich mit der Untersuchung beeilen. Vielleicht haben wir ja mal Glück, und es sind Fingerabdrücke drauf.«
»Sieht so aus, als gehörte die Waffe einem der Gangster«, meinte der Staatsanwalt. »Aber wieso hat er sie weggeworfen?«
Der Captain zog seine Stirn in Falten und sah äußerst nachdenklich aus. »Er hat sie nicht weggeworfen. Wir haben auf der Treppe ein paar Blutspritzer gefunden, die offensichtlich nicht vom Gouverneur stammen. Es kann sein, dass einer der Gangster angeschossen wurde und seine Waffe fallen ließ. Offensichtlich fand er sie in der Eile nicht gleich wieder, da sie zwischen die Pflanzen gerutscht war.«
»Also haben wir einige Spuren.«
Staatsanwalt Jackson sah befriedigt aus. Er schüttelte dem Captain die Hand. »Ich muss jetzt gehen. Sie halten mich auf dem Laufenden!«
»Selbstverständlich. Sobald wir die Ergebnisse der Laboruntersuchungen haben, erhalten Sie den ersten Bericht.«
3. Kapitel
»Woran hat es gelegen?« Der Mann, der diese Frage stellte, saß lässig und entspannt in einem weichen Clubsessel vor einem flackernden Kaminfeuer. In der rechten Hand hielt er ein Glas mit einer goldgelben Flüssigkeit, aus dem er hin und wieder einen kleinen Schluck nahm. Der Mann war mittelgroß und sehr schlank. Sein Alter war schwer zu bestimmen, aber die vierzig hatte er sicher schon deutlich überschritten.
Die tiefen Furchen in seinem Gesicht gaben seiner Haut ein ledernes Aussehen. Der Blick der hellblauen Augen verriet Intelligenz und ein wenig Grausamkeit.
Der Mann hieß Martin Bennett. Er blickte in die Runde und wiederholte seine Frage, diesmal eine Spur schärfer.
Eddie Floyd rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. »Wir konnten nicht ahnen, dass der Gouverneur gleich schießen würde. Davon stand nichts im Plan.«
Bennett lächelte, aber es sah nicht sehr freundlich aus. »Es gibt keinen Plan, der hundertprozentig funktioniert. Aber ich muss von meinen Leuten erwarten, dass sie sich auf neue Situationen einstellen können.«
Bennett wusste, wovon er sprach. Er war lange Zeit Offizier in der Armee der Vereinigten Staaten gewesen. In Vietnam hatte man ihm Gelegenheit gegeben, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Das hatte er getan, und es hatte ihm Spaß gemacht. Vor allem, weil er Dinge tun durfte, für die man ihn im Frieden lebenslang hinter Gitter gebracht hätte. Und er tat auch ein paar Dinge, die selbst im Krieg nicht erlaubt waren. Deshalb hatte man ihn auch sang und klanglos entlassen, als der Vietnamkrieg zu Ende gegangen war.
Bennett brauchte ein paar Monate, bis er den Schock überwunden hatte. Er war der Meinung, dass der einzige Job, für den er taugte, das Krieg führen war. Vielleicht hatte er sogar recht damit. Jedenfalls hatte er beschlossen, die Beleidigung, die man ihm mit der Entlassung angetan hatte, zu rächen.
Und so erklärte er den Vereinigten Staaten seinen ganz persönlichen Krieg.
Seine Armee rekrutierte er aus einigen Berufsgangstern, aus entlassenen Soldaten, die keinen Job fanden, und aus einigen politischen Wirrköpfen, die glaubten, das ihrer Meinung nach brüchige politische System der USA mit einigen entschlossenen Schlägen stürzen zu können.