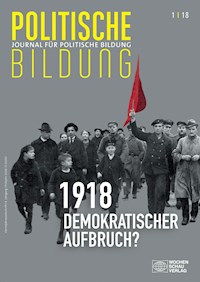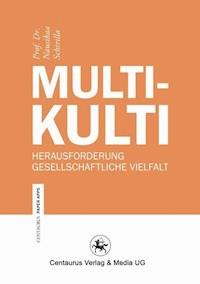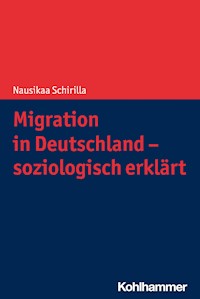
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Dieses Lehrbuch bereitet grundlegende Themen zur Migration in Deutschland soziologisch auf und liefert so das Wissen, das Studierende aller sozialwissenschaftlicher Fächer für die Seminar- und Prüfungsvorbereitung benötigen. Es bietet zudem eine Orientierung für alle, die in pädagogischen und sozialen Berufen mit Migration zu tun haben. Zunächst werden klassische Theorien der Migrationssoziologie erklärt und ausgewählte soziostrukturelle Daten eingeordnet. Anschließend werden Migrationstheorien und der Begriff der Transnationalität erörtert. Weitere Kapitel behandeln mit Migration verbundene Themen wie soziale Ungleichheit, Diskriminierung, Rassismus, Familie und Gender. Abschließend wird der aktuelle fachliche Diskurs über postmigrantische und postkoloniale Perspektiven vorgestellt. Jedes Kapitel schließt mit Fallbeispielen, Hinweisen zur weiteren Recherche und ausgewählten Literaturtipps sowie relevanten Prüfungsfragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einleitung
1 Migrationssoziologie, Migrationsforschung und Migration
Soziologische Zugänge
Migration
Migrationssoziologie
Kurzzusammenfassung
2 Kultur, Diversität, Intersektionalität
Kultur und gesellschaftliche Machtverhältnisse
Methodologischer Nationalismus
Diversität
Intersektionalität
Reflexive Migrationsforschung
Kurzzusammenfassung
3 Soziale Ungleichheit, Bildung und ethnische und soziale Segregation
Migrationshintergrund und soziale Benachteiligung
Soziale Ungleichheit
Bildungsungleichheit
Soziale Passungen
Ethnische und soziale Segregation
Ungleichheitsdiskurse
Kurzzusammenfassung
4 Minderheiten, Mehrheiten und Integration
Etablierte und Außenseiter
Integration
Desintegration
Kurzzusammenfassung
5 Gender, Geschlechterverhältnisse und Migration
Geschlechterverhältnisse
Geschlechterrollen
Ungleichheit unter Frauen
Kurzzusammenfassung
6 Lebenswelten von Migrant*innen
Vielfältige Identitäten
Macht der Konstruktionen
Sinus-Ansatz
Netzwerke
Kurzzusammenfassung
7 Rassismus und Diskriminierung
Diskriminierung
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Rassismus
Kurzzusammenfassung
8 Transnationalität und internationale Theorien
Transnationalität
Soziologie globaler Ungleichheiten
Kurzzusammenfassung
9 Postmigrantische Perspektiven
Der postmigrantische Ansatz nach Foroutan
Der postmigrantische Ansatz nach Yildiz
Kurzzusammenfassung
10 Postkoloniale Aspekte
Provincializing Europe
Was folgt daraus?
Kurzzusammenfassung
Abkürzungsverzeichnis
Literatur
Die Autorin
Prof. Dr. Nausikaa Schirilla studierte Philosophie, Soziologie und Pädagogik an den Universitäten Köln, Leeds/England und Frankfurt am Main. Sie promovierte und habilitierte in Erziehungswissenschaften an der Universität Frankfurt am Main. Seit 2005 ist sie Professorin für Soziale Arbeit, Migration und Interkulturelle Kompetenz an der Katholischen Hochschule Freiburg mit den Schwerpunkten Migrationsforschung, Migration und Soziale Arbeit, Care und Migration, postkoloniale Perspektiven und Interkulturelles Philosophieren. Aktuell forscht sie im Projekt »Inklusives Digitales Erinnnerungsarchiv – Migrantinnengeschichte als Teilhabe (IDEA)«, www.heridea.de.
Nausikaa Schirilla
Migration in Deutschland – soziologisch erklärt
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-040476-2
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-040477-9epub: ISBN 978-3-17-040478-6
Einleitung
In den ersten Wochen an ihrer Grundschule und neuen Kita in Frankfurt a. M., wo ca. 80 bis 90 % der Kinder einen Migrationshintergrund hatten, kam meine Tochter einmal empört nach Hause und sagte: »Mama, jedes Kind spricht hier noch eine Sprache, nur ich nicht, wieso hast Du mir nicht richtig Ungarisch beigebracht?«
Letzteres hatte ich als schlechte Patriotin in der Tat nicht gemacht, aber was hier interessant ist, ist der Perspektivwechsel, der in der Aussage eines 6-jährigen Kindes aus Frankfurt am Main zum Ausdruck kommt. Was sonst als Problem und als defizitär beschrieben wird – eine Schule oder eine Kindertagesstätte mit Kindern aus 20 Nationen, mit Kindern, die zu Hause eine andere Sprache als deutsch sprechen, mit Eltern, die Deutsch erlernen – all dies erschien dem Kind bewundernswert, interessant, als Stärke, und sie persönlich betrachtete sich selbst als defizitär. So kann Migration aus unterschiedlichen Perspektiven völlig unterschiedlich wahrgenommen und auch dargestellt werden.
Ebenso verhält es sich mit einer wissenschaftlichen Perspektive: Was für die einen ein Ghetto oder eine Parallelgesellschaft darstellt und damit als Bedrohung markiert wird, stellt für andere als ethnische Segregation ein Forschungsinteresse dar, wieder andere fragen, wieso die Tatsache, dass Menschen bestimmter Gruppen in einem Viertel wohnen, überhaupt zum Problem gemacht wird. Was einige als Leitkultur bezeichnen, nennen andere Dominanzkultur und wo viele unüberbrückbare kulturelle Wertekonflikte erblicken, sehen andere Konstruktionen von Einen und Anderen und damit Othering-Prozesse.
Eine wissenschaftliche Perspektive stellt immer eine Differenzierung dar und diese kann dazu beitragen, so manche Verwirrung aufzuklären und Kontroversen zu ordnen. So ist auch dieses Lehrbuch zu verstehen. Es greift grundlegende Themen zur Migration im gesellschaftlichen Kontext in Deutschland auf, die für eine pädagogische Arbeit relevant sind, und versucht diese im Rekurs auf soziologische oder auch allgemein sozialwissenschaftliche Zugänge zu beleuchten, zu erklären und damit greifbar zu machen. Dabei geht es nie nur um eingewanderte Gruppen, sondern immer auch um die Gesamtgesellschaft.
Daher werden in diesem Band nach der Klärung grundlegender Begrifflichkeiten zunächst ausgewählte soziostrukturelle Daten zur Migration nach Deutschland dargestellt und Herausforderungen definiert. Im Folgenden wird versucht, die allgemeine Migrationsforschung und soziologische Zugänge als spezifische Disziplinen zu verorten und einige klassische Themen der Migrationssoziologie aufzugreifen (▶ Kap. 1).
Weitere Kapitel behandeln mit Migration verbundene Themen wie Kultur und Diversität (▶ Kap. 2), soziale Ungleichheit (▶ Kap. 3), Diskriminierung, Rassismus (▶ Kap. 7), Familie und Gender (▶ Kap. 5). Anschließend werden Migrationstheorien erörtert und der Begriff der Transnationalität eingeführt (▶ Kap. 8). Abschließend wird der spezifische aktuelle fachliche Diskurs über postmigrantische (▶ Kap. 9) und postkoloniale Perspektiven (▶ Kap. 10) vorgestellt. Die Thematik der letzten Kapitel bringt kritische Fragen zu den Ausführungen in den davor liegenden Kapiteln. Von daher kann das Buch auch von hinten gelesen werden.
Jedes Kapitel schließt ab mit einer Kurzzusammenfassung, einem Beispiel zur Veranschaulichung, relevanten Prüfungsfragen, ausgewählten Literaturtipps und Hinweisen zur weiteren Recherche.
1 Migrationssoziologie, Migrationsforschung und Migration
Soziologische Zugänge
Mit soziologischen Erklärungsansätzen sind in diesem Band wissenschaftliche Zugänge gemeint, die soziales Handeln thematisieren, also das Handeln von Individuen in der Gesellschaft bzw. Handeln von Individuen insofern diese Teile einer Gesellschaft sind. Hier wird sowohl das Individuelle als gesellschaftlich konstituiert als auch das Gesellschaftliche als individuell gestaltet gedacht (Benhabib 1995). Wie sich dieses Wechselverhältnis genau ausgestaltet, welche Seite stärker fokussiert wird, unter welchen Bedingungen sich beide Ebenen konstituieren, welche Faktoren dieses Verhältnis beeinflussen – all dies sind Fragen, die von unterschiedlichen theoretischen Positionen abhängen und beeinflusst sind. Mit Gesellschaft sind hier im weitesten Sinne Aspekte gemeint, die Mechanismen oder Ordnungen betreffen, die das Zusammenleben beeinflussen, gestalten oder bestimmen. Wie diese genau verstanden werden, hängt von der jeweiligen theoretischen Ausrichtung ab, aber dass eine allgemeine, überindividuelle Ebene mehr ist als die Summe ihrer Teile, ist Konsens soziologischer Ansätze.
Im Kontext von Migration ist der so beschriebene soziologische Blick insofern bedeutsam, als Phänomene und Problemkonstellationen nicht in der Zielgruppe der Zugewanderten selbst begründet werden, wie beispielsweise in möglichen Defiziten, sondern in der Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Mechanismen. Es wird hier nicht um soziologische Aspekte der Frage gehen, wieso Menschen migrieren, sondern welche sozialen Dynamiken Migration entfaltet.
Soziologie ist im Sinne einer Definition von Max Weber die Wissenschaft des sozialen Handelns unter besonderer Berücksichtigung seiner institutionellen Bedingtheiten wie auch seiner institutionellen Wirkungen. Max Weber schrieb 1920 in seinem Werk »Wirtschaft und Gesellschaft«, Soziologie sei eine Wissenschaft, die soziales Handeln deutend verstehen wolle und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären wolle (Schneider 2008: 20). Die Soziologie ist sowohl eine theoriegeleitete wie auch eine empirisch forschende Disziplin. Dabei ist hervorzuheben, dass eine soziologische Perspektive nicht eine einheitliche Theorie beinhaltet, sondern als Betrachtungsweise und Strukturierung einer Fragestellung oder eines Themenfeldes zu verstehen ist. In diese Betrachtungsweise gehen indirekt auch theoretische Annahmen ein, die hier aber nicht eigens begründet werden können, sondern immer wieder mitbedacht werden müssen.
Ein weiterer Vorteil einer soziologischen Perspektive besteht im Rekurs auf die Empirie, also auf Daten, die das Verständnis bestimmter Phänomene erleichtern und bestimmen. Dabei stellt sich wiederum die Frage, wie sich dieser Empirie genähert wird, mit welchen Methoden sie erhoben, analysiert und dargestellt wird – auch hier bestehen in der Soziologie und in den Sozialwissenschaften generell grundlegende methodische, wissenschaftstheoretische und erkenntnistheoretische Kontroversen (vgl. beispielsweise Helfferich 2011, Mayntz 1969). Als spezifisch soziologisch darf in diesem Kontext wiederum nicht die Bevorzugung eines besonderen Zugangs gelten, sondern der Bezug auf eine Empirie prinzipiell und die Frage nach der Reflexion, Diskussion und Auszeichnung der Methoden und ihnen zugrundeliegende erkenntnistheoretische Setzungen in der empirischen Sozialforschung. Auch hier ist es das ›Wie‹, das den soziologischen Zugang ausmacht, also die Arten und Weisen zu fragen und die Forschung zu strukturieren und weniger die spezifischen Inhalte.
Seit den Anfängen der Soziologie – für viele in der Mitte des 19. Jahrhunderts, für andere schon einige Jahrhunderte früher – hat sie sich zu einem hoch differenzierten Wissensgebiet entwickelt, das durch konkurrierende theoretische und methodische Ansätze gekennzeichnet ist. Aktuell lässt sich eine zunehmende Spezialisierung theoretischer Paradigmen, vielfältiger Anwendungsbereiche, mannigfaltiger Methoden und unterschiedlicher Priorisierungen der Problemstellungen ausmachen. Als Beispiel seien folgende Gebiete aufgeführt, die auch auf der Webseite des Heidelberger Max Weber Instituts für Soziologie zu finden sind: Sozialstrukturanalyse, vergleichende Makrosoziologie, Organisationssoziologie, politische Soziologie, Drittsektorforschung, Kriminalsoziologie, Kultursoziologie (vgl. https://www.soz.uni-heidelberg.de/ueber-das-mwi/, Zugriff 21. 01. 2022).
Die zentrale Klammer der Disziplin bilden soziologische Theorien, Forschungsmethoden und verschiedene Felder der empirischen Sozialforschung und diese werden auch in diesem Band immer wieder aufgegriffen.
Es ist kein Zufall, dass in obiger Aufzählung des Max Weber Instituts die Migrationsforschung nicht auftaucht. Migration selbst geriet nur partikular oder relativ spät in den Fokus soziologischer Betrachtungsweisen, obwohl berühmte ›Gründungsväter‹ der Soziologie wie beispielsweise Georg Simmel schon früh migrationsgezogene Fragen thematisierten (Simmel 1908). Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich bezüglich einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise von Migration, die ja auch ein soziales Handeln im oben beschrieben Sinne darstellt, eine fächerübergreifende Migrationsforschung herausgebildet, die sich durch den Fokus auf das Phänomen der Migration auszeichnet. Was darunter zu verstehen ist, geht aus dem Selbstverständnis eines der ältesten Migrationsforschungsinstitute, dem IMIS der Universität Osnabrück, hervor:
»Migration bildet seit jeher ein zentrales Element gesellschaftlichen Wandels. Räumliche Bewegungen von Menschen veränderten in den vergangenen Jahrhunderten die Welt: Unzählige Beispiele belegen das Ausmaß, mit dem Arbeits- und Siedlungswanderungen, Nomadismus, Bildungs- und Ausbildungswanderungen, Menschenhandel, Flucht, Vertreibung oder Deportation die Bevölkerungszusammensetzung sowie die Entwicklung von Arbeitsmärkten, politischen Systemen, kulturellen Identitäten oder religiösen Orientierungen beeinflussten. Auch in Zukunft wird Migration ein zentrales gesellschaftliches Thema mit hohem politischen Gewicht bleiben« (https://www.imis.uni-osnabrueck.de/imis/ziele.html, Zugriff 31. 10. 2021).
Das IMIS beschreibt seine Aufgabe so:
»Seit Anfang der 1990er Jahre gilt das wissenschaftliche Interesse des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück den vielfältigen Aspekten räumlicher Mobilität und ihren Folgen in Geschichte und Gegenwart. [...] Dem Institut gehören Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fächer und Forschungsgebiete an: Erziehungswissenschaft, Ethnologie, Geographie, Geschichtswissenschaften, Geschlechterforschung, Kunstgeschichte, Ökonomie, Politikwissenschaften, Psychologie, Rechtswissenschaften, Religionswissenschaften, Soziologie, Sprachwissenschaften« (ebenda).
Während sich Migrationsforschung durch den Fokus auf ein bestimmtes soziales Handeln auszeichnet, nämlich räumliche Mobilität, und inter-, trans- oder multidisziplinär angegangen werden kann, soll in dem vorliegenden Band der Fokus auf sozialwissenschaftliche Aspekte der Folgen von Migration für die migrierten Subjekte und für die Gesamtgesellschaft gelegt werden. Migrationssoziologie ist eine durch den Gegenstand gekennzeichnete Unterabteilung der Soziologie und durch die Disziplin geprägte Unterabteilung der Migrationsforschung. Allerdings sind die Grenzen der hier rezipierten Theorien und Forschungsansätze fließend, da auch sozialwissenschaftliche Studien, vor allen aus den Erziehungswissenschaften, sich diesen Fragen widmen und für die Erklärung der gesellschaftlichen Aspekte von Migration fruchtbar sind.
Dabei wird immer wieder die Frage gestellt, dass Migration als ein spezifischer Fokus und eine eigene Forschungsrichtung schon selbst umstritten ist, da, wenn sie die in sich so heterogenen zugewanderten Gruppen isoliert betrachtet, sie diese zu einer einheitlichen Gruppe und damit zu Anderen macht (Othering). Diese Frage wird den gesamten Band selbstreflexiv begleiten und darauf wird in dem Kapitel zu postmigrantischen Ansätzen besonders eingegangen.
Migration
Eingangs ist es hilfreich, einen Blick auf Daten über Migration nach Deutschland zu werfen. Mit Migration wird die dauerhafte Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Individuen, Familien oder Gruppen an einen anderen Ort bezeichnet, in der Regel in einem anderen Land (IOM 2020: 8). Weltweit waren 2019 ca. 272 Millionen Menschen, also 3,5 % der Weltbevölkerung, migriert (ebenda: 7). Dies gilt zumindest für legale, reguläre Migration, und diese Zahlen sind um eine unbekannte Dunkelziffer irregulärer Migration zu ergänzen. Dabei gibt es Länder, wie beispielsweise die Vereinigen Arabischen Emirate, die sehr hohe Migrationszahlen – bis zu 80 % – aufweisen. Pandemiebedingt ist die Migration in vielen Staaten aber zurückgegangen, was sich allmählich wieder ändert (Samaddar 2020).
Im Gegensatz zur allgemeinen Migration wird Fluchtmigration – oder Forced Migration – nicht als Wechsel in ein anderes Land, sondern durch seinen Zwangscharakter definiert (https://www.unhcr.org/). Für 2020 wurde auf der Webseite des Hohen Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen die Zahl der Flüchtlinge mit 82,4 Millionen angeben, aus dieser Gruppe fliehen aber 85 % der Menschen in benachbarte Regionen innerhalb oder außerhalb des eigenen Landes (https://www.unhcr.org/dach/de/services/statistiken, Zugriff 13. 09. 2021). Bezüglich der erzwungenen Migration werden daher Binnenvertriebene, die in sichere Regionen des eigenen Landes migrieren, und Flüchtlinge, die ins Ausland fliehen, unterschieden. Zu beachten ist hier auch, dass der größte Teil dieser Menschen zunächst in Nachbarstaaten flüchten und nur ein kleiner Prozentsatz in einen anderen Kontinent weiterzieht (ebenda).
Eine übergreifende Definition von Migration besteht daher darin, Migration ganz allgemein als ein zentrales Element der Anpassung der Menschen an Umweltbedingungen und an soziale, wirtschaftliche und politische Herausforderungen zu verstehen (Oltmer 2010). In diesem Sinne ist Migration ein »Normalfall« (Bade 2004). Fast alle Länder auf der Welt waren bereits Zielland oder Entsendeland für Migration. So war Deutschland jahrhundertelang ein Auswanderungsland. Aus sozialen und auch anderen Gründen wanderten beispielsweise bereits im 14. Jahrhundert viele Menschen aus den deutschsprachigen Gebieten ins damalige Ungarn bzw. nach Siebenbürgen aus, nach Russland im 18. Jahrhundert und in die USA im 19. Jahrhundert. Historisch sind neben dem dauerhaften Ortswechsel aber auch grenzüberschreitende Pendelmigration wie beispielswiese die sogenannten »Hollandgänger« zu nennen, also Personen aus benachbarten Regionen, die in den Niederlanden arbeiteten, aber ihre Familie und ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland behielten (Bade 2004).
Was Einwanderung betrifft, so sind für Deutschland beispielsweise die sogenannten »Ruhrpolen« zu erwähnen, die zu Arbeitszwecken im 18. Jahrhundert in das aufstrebende Ruhrgebiet kamen und sich dort dauerhaft niederließen (Bade 2004). Nicht zu unterschätzen ist auch die Aufnahme von ca. zwölf Millionen deutscher Flüchtlinge nach 1945 in die neue Bundesrepublik – diese Gruppe umfasste Vertriebene aus den Ländern des östlichen Europas und Flüchtlinge aus den damaligen sowjetisch besetzten Zonen sowie aus der DDR (vgl. Beer 1994).
In den meisten wissenschaftlichen Publikationen in Deutschland wird die Migrationsdefinition des statistischen Bundesamts verwendet. Mit Migrant*innen sind Personen mit Migrationshintergrund gemeint, also Menschen, die entweder selbst aus dem Ausland zugewandert oder von denen ein Elternteil aus dem Ausland in die Bundesrepublik zugewandert ist. Diese Definition muss aber als vorübergehender Arbeitsbegriff verstanden werden, denn der Fokus auf den Migrationshintergrund grenzt Menschen aus, macht Personen zu anderen, die sich – insbesondere in der zweiten oder dritten Generation – als Teil der bundesrepublikanischen Gesellschaft begreifen. Zur Kritik an der Kategorie Migrationshintergrund und zu Alternativen dazu hat beispielsweise Ann-Kathrin Will in einer Debatte des Rats für Migration, einem Zusammenschluss vieler Migrationsforscher*innen, Stellung bezogen (https://rat-fuer-migration.de/2022/06/07/rfm-debatte-2022/).
Ann-Kathrin Will argumentiert hier, dass die Kategorisierung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund einerseits Differenzen symbolisch verfestigt und andererseits empirisch lückenhaft sei (ebenda). So fehlt Will zufolge beispielsweise die Kategorie »Deutsche mit Migrationshintergrund« in vielen Statistiken. Die Kategorie »Deutsche ohne Migrationshintergrund«, zu der im Kontext zugewanderter Familien Angehörige gehören, die bereits seit mindestens zwei Generationen die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt besitzen, ignoriere deren mögliche Migrationserfahrungen, wenn sie als Deutsche zugewandert sind. Hingegen können Enkel von Zugewanderten als »Personen mit Migrationshintergrund« gelten, selbst wenn nur ein Großelternteil zugewandert ist und die anderen Großelternteile »Deutsche ohne Migrationshintergrund« sind.
Zur Migration nach Deutschland können folgende Zahlen – Stand 2019 – genannt werden (Die Beauftragte 2020: 18 ff). Die Daten sind dem 12. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, entnommen. Dieser Bericht wird zweijährlich erstellt und stellt eine wichtige Datenquelle zu Migration in Deutschland dar. 20,8 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund im oben beschriebenen Sinne, das sind 25,5 % der Bevölkerung, also mehr als ein Viertel. 52 % davon haben die deutsche Staatsangehörigkeit und 48 % sind Ausländer*innen. Das Geschlechterverhältnis umfasste 2019 10,7 Millionen Männer und 10,1 Millionen Frauen. Unter sozialen und politischen Aspekten ist es wichtig zu betonen, dass die Verteilung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sehr ungleich ist. Während in den westlichen Bundesländern der Migrationsanteil 30 bis 35 % beträgt, sind es in den östlichen Bundesländern maximal 7 % pro Bundesland. Migration ist konzentriert in Ballungsräumen und Großstädten, so haben Städte wie Stuttgart oder Frankfurt am Main eine Bewohnerschaft, die zu 40 % und mehr einen Migrationshintergrund aufweist. Was die Herkunft betrifft, ist zu betonen, dass 53 % der Eingewanderten 2018 aus einem EU-Mitgliedsstaat kamen. Generell sind die wichtigsten Herkunftsländer an erster Stelle die Türkei, dann Rumänien, Polen und Bulgarien sowie Griechenland, Spanien, Italien und die Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Interessant ist ferner, dass die Menschen mit »Migrationshintergrund« deutlich jünger sind: Im Schnitt waren sie 2019 35,5 Jahre alt, bei Menschen ohne Migrationshintergrund betrug das Durchschnittsalter 47,4 Jahre. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Migrierten beträgt 21 Jahre, die meisten Migrant*innen leben also schon viele Jahre in Deutschland und betrachten sich als Teil dieser Gesellschaft. Ein Blick in das Aufenthaltsgesetz zeigt, dass es sehr vielfältige Gründe geben kann, um in Deutschland zu bleiben: Arbeit, Familie, Studium, medizinische Behandlung, humanitäre Gründe sowie der Schutz vor Verfolgung.
Ein Blick auf die Geschichte der Migration in die Bundesrepublik lässt weitere Unterschiedlichkeiten in der Einwanderung deutlich werden. So lassen sich folgende Phasen der Migration nach Deutschland unterscheiden: Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs blieben einige »Displaced Persons« – vor allem Verschleppte in den ehemaligen Konzentrationslagern und Zwangsarbeiter*innen – in Deutschland und damals schon wanderten auch Flüchtlinge aus dem Ausland ein, die 1951 den Rechtsstatus »Heimatlose Ausländer« erhielten. Neben den mehreren Millionen deutscher Flüchtlinge, die nach 1945 aufgenommen und integriert worden sind, kamen seit den in den 1950er Jahren auch Flüchtlinge aus dem mittleren und östlichen Europa nach Deutschland, so beispielsweise viele Ungar*innen nach dem Aufstand 1956 in Ungarn.
Eine Phase der Einwanderung mit weitreichenden Folgen stellte die Arbeitsmigration der sogenannten ›Gastarbeiter‹ dar. Das war eine Phase der Anwerbung von Arbeitskräften in den 1950er und 1960er Jahren, die durch das Arbeitsministerium bzw. entsprechende Agenturen direkt im Ausland erfolgte und in Abkommen geregelt war. So wurde 1955 ein Anwerbeabkommen mit Italien abgeschlossen, 1961 mit der Türkei und vielen anderen süd- und südosteuropäischen Staaten sowie nordafrikanischen Staaten. Ab 1973 wurde ein Anwerbestopp durchgesetzt, aber die Familienzusammenführung wurde den in Deutschland Arbeitenden zunächst erlaubt. So kamen von den 1950 bis in die 1970er Jahre ca. 9.5 Millionen Menschen nach Deutschland und ca. vier Millionen sind geblieben. Diese Phase der Arbeitsmigration ist dadurch gekennzeichnet, dass von der deutschen Seite aus keine Integrationsmaßnahmen vorgesehen waren, keine Vorbereitung oder Begleitung. Oft erfolgte die Arbeitsaufnahme direkt nach Ankunft und es gab keinen systematischen Deutscherwerb. Viele gingen von einem kurzfristigen Aufenthalts aus – sowohl der deutsche Staat als auch die Migrant*innen selbst rechneten stark mit einer Rückkehroption, die sich dann aber für viele nicht realisierte.
Eine weitere wichtige Phase der Einwanderung stellte die Migration der (Spät-)Aussiedler*innen dar. Seit den 1970/80er Jahren wurde die Einwanderung von Aussiedler*innen, d. h. von deutschstämmigen Menschen aus Ländern des östlichen Europas ermöglicht und ab den 1990er Jahren die Einwanderung von Spätaussiedler*innen. Es handelt sich hier im deutschstämmige Mittel-/Osteuropäer*innen, also ehemalige deutsche Auswanderer*innen, die sich in Rumänien, Ungarn, Russland etc. niedergelassen, die die deutsche Zugehörigkeit erhalten hatten und dies auch belegen konnten. Die Auswanderung nach Deutschland war ab 1989 wesentlich leichter, von 1989 bis in die 1990er Jahre sind ca. vier Millionen Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen eingewandert.
Eine Besonderheit charakterisierte die Einwanderung dieser Gruppe. Die Geschichte der ca. vier Millionen Spätaussiedler aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion geht auf die deutsche Migration nach Russland ab dem 18. Jahrhundert zurück. Die zugewanderten Deutschen hatten dort damals viele Sonderrechte, z. B. deutschsprachige Schulen, Land, Verwaltungshoheiten; sie haben die deutsche Sprache gepflegt und eine deutsche Zugehörigkeit erhalten. Aber im zweiten Weltkrieg wurden die meisten Deutschstämmigen in der Sowjetunion Opfer von Deportationen nach Sibirien, Kasachstan, Kirgisien u. a. Sie galten als Verbündete des Nazideutschlands, das die Sowjetunion angegriffen hatte, und waren auch Opfer der damals vollzogenen Zwangskollektivierung in der Sowjetunion. In ihren neuen Wohngebieten fern der alten russischen Heimat war die deutsche Zugehörigkeit erschwert. Wenn sie nach Deutschland kamen, waren sie rechtlich Deutsche, hatten also die deutsche Staatsangehörigkeit, waren aber von einer Sozialisation in der russischen Sprache, Kultur und Gesellschaft geprägt. Sie wurden in ihrer neuen Heimat sozial nicht als Deutsche anerkannt und hatten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen (vgl. Strobl 2000).
Aber auch Flucht und Asyl stellten und stellen einen wichtigen Einwanderungsgrund nach Deutschland dar. Ab den 1970er Jahren stieg die Einwanderung von Asylsuchenden, nach der Änderung des Asylgesetzes 1993 gingen die Zahlen rapide zurück, seit 2013 war aber ein neuer Anstieg der Flüchtlingszahlen zu beobachten. So wurden 2013 ca. 109.000 neue Asylanträge gezählt (https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/asylzahlen-node.html), 2014 wurden ca. 200.000 Asylanträge gestellt und 2015 ca. 890 Asylanträge. Seit 2017 sind die Asylerstanträge rückläufig. Die Herkunftsländer der Flüchtlinge sind vor allem Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und Eritrea. Der Rückgang wurde durch die Corona-Pandemie noch verstärkt, erst Im Jahr 2022 sind die Zahlen von Schutzsuchenden wieder gestiegen, vor allem durch den Angriffskrieg auf die Ukraine.
Aktuell spielt Migration aus EU-Ländern eine wichtige Rolle. In den letzten Jahren war die Einwanderung aus EU-Staaten wie Rumänien oder Bulgarien auf hohem Niveau konstant, phasenweise auch aus Griechenland, Spanien und Italien. Bei der EU-Einwanderung handelt es sich um eine Migration jüngerer, qualifizierter Fachkräfte (https://mediendienst-integration.de/migration/wer-kommt-wer-geht.html). Aktuell ist eine gezielte Rekrutierung von Arbeitskräften insbesondere für Pflege und Handwerk zu beobachten. EU-Bürger*innen sind rechtlich in vielem Bundesbürger*innen gleichgestellt; innerhalb der EU gilt das Recht der Freizügigkeit, d. h., Angehörige der EU-Staaten können nach Deutschland kommen und hier Arbeit suchen, und es gibt keinerlei rechtliche Einschränkungen und es bedarf auch keines Aufenthaltstitels. Angehörige von Staaten außerhalb der EU – also Drittstaatler*innen – brauchen in der Regel bei der Einreise ein Visum, aber spätestens nach drei Monaten einen Grund, um in Deutschland zu bleiben, d. h. einen Aufenthaltstitel, und sie müssen viele Voraussetzungen erfüllen, um eine Verlängerung eines befristeten Aufenthaltstitels – der Aufenthaltserlaubnis – oder den Erwerb eines unbefristeten Aufenthaltstitels – der Niederlassungserlaubnis – zu erreichen. Anspruch auf Familienzusammenführung und sozialrechtliche Ansprüche hängen vom Aufenthaltstitel ab. Asylsuchende wiederum erhalten während ihres Verfahrens keinen Aufenthaltstitel, diesen erhalten sie erst mit der Flüchtlingsanerkennung, und wenn diese nicht erfolgen kann, entfällt auch der Anspruch, in Deutschland bleiben zu können.
Aus dieser Aufstellung wird deutlich, wie unterschiedlich Migrationsgründe, Migrationsmotive, der rechtliche Status, Migrationsgeschichten und Selbstverständnis sein können. Das Aufenthaltsgesetz nennt verschiedene Gründe, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland bleiben zu können: Die wichtigsten sind Arbeit oder Arbeitsuche, humanitäre Gründe und Schutzsuche vor Verfolgung und Bedrohung, Ausbildung oder Studium, medizinische Behandlung oder Familienzusammenführung. Obwohl sie grundsätzlich jünger ist, ist die Migrationsbevölkerung auch hinsichtlich Alter, Geschlecht, Bildung, rechtlichem Status, Religion, Kultur und migrationsspezifischer Aspekte sehr gemischt. Sie hat grundsätzlich zur ohnehin wachsenden Vielfalt in Deutschland beigetragen, beispielsweise zur religiösen Vielfalt in Deutschland – so wurde in der jüngsten Studie zum muslimischen Leben in Deutschland, die von der Deutschen Islamkonferenz (DIK) herausgegeben wurde, die Anzahl der Muslime mit ca. fünf Millionen angegeben (https://www.deutsche-islam-konferenz.de/).
Auf der rechtlichen Ebene sind zu erwähnen:
·
das Zuwanderungsgesetz von 2005,
·
die verschiedenen asyl- und ausländerrechtlichen Restriktionen, die 2016 bis 2019 umgesetzt wurden, und
·
das Fachkräfteeinwanderungssetz von 2021.
Seit dem Zuwanderungsgesetz von 2005 sind Integrationsmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben – dies gilt vor allem für einen Deutschkurs und einen Orientierungskurs, die als Integrationskurse subventioniert und leicht zugänglich sind. Es gibt zudem eine Verpflichtung zu Integrationskursen für Drittstaatsangehörige und ein bundesweites Integrationsprogramm – d. h. ein öffentlich finanziertes System zur Beratung und Begleitung von neu zugewanderten Erwachsenen und Jugendlichen. Mit diesen neuen Möglichkeiten der öffentlichen Förderung hat Deutschland anerkannt, dass es ein Einwanderungsland ist.
Soziologisch interessant sind soziokulturelle Aspekte, soziale Status und soziale Ungleichheit, Fragen der Verortung und der Zugehörigkeit der Zugewanderten sowie die der Mehrheitsgesellschaft und entsprechende Wechselwirkungen. Es sei aber vorausgeschickt, dass soziologisch betrachtet Migrationshintergrund zunächst keine relevante analytische Kategorie darstellt. Am besten wird dies deutlich in den Migrantenmilieu-Studie des Sinus-Instituts (https://www.sinus-institut.de/media-center/news/sinus-migrantenmilieus-2018). Seit 2008 wird durch das Sinus-Institut analog zu den sozialen Milieustudien in Deutschland versucht, auch Gruppen von Migrant*innen mit dem Milieuansatz zu beschreiben. Der Milieuansatz umfasst Lebensstile und Lebensweisen, Konsumgewohnheiten, Werte sowie Einstellungen und politische Haltungen. Das Sinus-Institut unterscheidet acht Milieus in der Migrationsbevölkerung, vom religiös verwurzelten Milieu bis hin zu einem Performer-Milieu. Das interessante Ergebnis der 2008 und 2018 durchgeführten Studien besteht in dem Nachweis, dass die ethnische Herkunft nicht relevant für die sozialen Milieus ist. Das bedeutet, dass Menschen aus einem Herkunftsland in der Regel in allen Milieus zu finden sind. Auch sind alle Milieus, Schichten, Bildungsniveaus und Lebensweisen bei Personen aus verschiedenen Herkunftsländern und Ethnien anzutreffen. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Milieu und ethnischer Herkunft (▶ Kap. 6). Auch wenn im Folgenden der Fokus auf migrationsbedingte Fragen gelegt wird, so muss betont werden, dass es DEN MIGRANTEN oder DIE MIGRANTIN nicht gibt und Die Migrationsbevölkerung in sich ist sehr vielfältig hinsichtlich Lebensstilen, Einstellungen, Bildung, Herkunft, Migrationsdauer, Migrationsmotiven und Migrationswegen usw.
Dennoch gibt es empirische Erkenntnisse, die verallgemeinerbar sind, auch wenn sie nicht für alle zutreffen. Es ist soziologisch relevant, dass Migrationshintergrund einhergeht mit einem signifikant höherem Armutsrisiko (vgl. Die Beauftragte 2020: 23), mit einem signifikant höherem Prozentsatz an Arbeitslosigkeit und höherer Betroffenheit von Altersarmut. Aus den Berichten der Beauftragten für Migration und Flucht und anderen Studien geht hervor, dass seit Jahrzehnten Indikatoren wie Armutsrisiko, Arbeitslosigkeit, Altersarmut und Benachteiligung beim Übergang von der Schule in den Beruf auf deutliche Disparitäten zwischen Menschen mit und ohne Migrationsgrund hinweisen. Soziale Benachteiligung und Migration überschneiden sich oft – die Zusammenhänge von Migration und sozialer Ungleichheit werden in einem eigenen Kapitel behandelt (▶ Kap. 3). Sie stehen auch im Zusammenhang zu einer statistisch sichtbaren Bildungsbenachteiligung.
Weitere soziologisch relevante Grunddaten zu Migration hängen mit Erfahrungen von Rassismus und Diskriminierung (▶ Kap. 7) zusammen. Diese verweisen auf Ungleichheiten und Machtverhältnisse, zeigen aber auch die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Gerechtigkeitskonzepte, neuer Identitäten in der Migrationsgesellschaft und neuer Narrative, d. h. neuer Bilder der Gesellschaft von sich selbst, die Migration als selbstverständlichen Teil der Gesellschaft begreifen. Auf der Website der »Neue Deutsche Organisationen« – einer Plattform von migrantischen Selbstorganisationen war lange zu lesen:
»Wir sind ›von hier‹. Hört auf zu fragen! Seit Jahrhunderten wandern Menschen ein und aus und prägen das Land. Deutschland hat sich stets verändert. Und wir gestalten diesen Wandel mit: [...] Wir wollen kein Praktikum, wir wollen die Chefetage!« (https://neuedeutsche.org/de/, Zugriff 01. 07. 2019).
Migrationssoziologie
Seit mehr als zwei Jahrzehnten erschienenen im deutschen Sprachraum migrationssoziologische Überblickswerke. Diese behandelten einerseits soziologische Zugänge zu Gründen und Erklärungsansätze von Migration aus der Geschichte der Soziologie und historische Konzeptualisierungen der Interaktionen von Zugewanderten und Einheimischen oder der Mehrheitsgesellschaften (vgl. Aigner 2017, Faist 2020, Han 2000, Oswald 2007, Treibel 2013, Zwengel 2018). Für die historischen soziologischen Erklärungsansätze zu Migration sind insbesondere zu nennen
·
Georg Simmel mit seinem Exkurs über den Fremden (Simmel 1908),
·
Robert Parks Studien zu Migrant*innencommunities in den USA, Chicago und die sogenannte Chicago School (Aigner 2017),
·
Phasen der Migration nach Shmuel Eisenstadt (2000) und
·
die Studien zu Minderheiten und Mehrheitsgruppen von Norbert Elias (Preuß 2020).
Ein besonderer Fokus lag daher also oft auf der angelsächsischen Migrationssoziologie. Dadurch wurde das assimilatorische Integrationsmodell der Chicago School der Soziologie aus den 1930er Jahren übernommen und als Folie oder Norm für Prozesse in den Nachkriegsgesellschaften genutzt. So waren auch in der deutschen Soziologie lineare Stufenmodelle der Beziehungen zwischen Eingewanderten und Mehrheitsgesellschaft beliebt (wie beispielsweise im Integrationskonzept von Hartmut Esser 2001).
Auf der anderen Seite thematisierten migrationssoziologische Werke die Zahlen zu Migrationsbewegungen sowie soziale Hintergründe von Wanderungsbewegungen weltweit und nach Deutschland, also die sozialen Motive und Beweggründe für Migration, sozioökonomische Hintergründe, soziale Identitäten und Verhaltensweisen der neuzugewanderten Bevölkerung sowie die Wechselbeziehungen zwischen neu Eingewanderten und Mehrheitsbevölkerung. Neuere migrationssoziologische Publikationen behandeln ein viel breiteres und ausdifferenzierteres thematisches Spektrum. So werden in dem 2020 erschienen Werk »Soziologie der Migration« beispielsweise folgende Themen behandelt: Arbeitsmarkt und Integration, Fremdheit, Identität und Hybridität, Intergruppenbeziehungen und Interaktionen in urbanen Räumen, migrationspolitische Kontroversen, Migration und Medien, Bildung, Familie, Gender, Religion und Sport sowie Migration und soziale Ungleichheit; aber auch Fragen zu Ethnizität, Diskriminierung und Rassismus (Faist 2020). Andere behandeln in neuen migrationssoziologischen Einführungswerken allgemeine Fragen der Migrationsforschung wie z. B. die verschiedenen Gruppen der Migrant*innen in Deutschland, Heterogenität und Benachteiligung, Partizipation und Vielfalt, Lebensbereiche wie Wohnen und Bildung sowie Kommunikation und Deutscherwerb und Spezifika der jüngere Fluchtmigration (vgl. Zwengel 2018). Auch die erwähnte jüngere Publikation – der von Thomas Faist herausgegebene Band zur Einführung in die »Soziologie der Migration« – präsentiert internationale Migrationsbewegungen, Hintergründe, Formen und Charakteristika sowie Versuche ihrer Theoretisierung. In diesem Band sind Aspekte von transnationalen Migrationsformen sehr stark beleuchtet und theoretisch reflektiert (Faist 2020).
Es wird deutlich, dass sich in der Migrationssoziologie die thematischen Bezüge und paradigmatischen Rahmungen in den letzten Jahren stark verändert haben. Dies kann im Kontext einer Anpassung der Wissenschaft an gesellschaftliche Veränderungen als Normalität gesehen werden, in dem Sinne, dass Migration zum ›Normalfall‹ geworden ist. Damit geraten eher soziale Zugehörigkeiten und soziale Teilhabe sowie Narrative von Eingewanderten und Mehrheitsbevölkerung in den Fokus soziologischer Betrachtungen.
Ludger Pries skizziert in einem Überblicksartikel die Entwicklung der soziologischen Migrationsforschung in Deutschland wie folgt (Pries 2021): Er hebt zunächst hervor, dass das Thema Migration im 20. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum in Bezug auf die Soziologe lange randständig war, »theoretisch und empirisch unterentwickelt und nationalistisch eingehegt« (Pries 2021: 151). Dies hatte mit der nicht vorhandenen Wahrnehmung oder Leugnung von Deutschland als Einwanderungsland zu tun, so wurden weder die bereits erwähnten vielfachen älteren und jüngeren Ein‐ und Auswanderungsbewegungen oder beispielsweise Zwangsarbeit im Nationalsozialismus soziologisch diskutiert. Dies ist wiederum Pries zufolge der lange vorherrschenden eher statischen Vorstellung einer nationalstaatlich verfassten Gesellschaft zuzuschreiben (ebenda).
Diese an Homogenität und einen unkritischen Kulturbegriff orientierten Konzepte von Gesellschaft wurden zunehmend in Frage gestellt. Politisch spielte hierbei das bereits erwähnte Zuwanderungsgesetz von 2005 eine zentrale Rolle, das die Integrations- und Migrationspolitik weitgehend neugestaltet und Deutschland als Einwanderungsland anerkennt. Pries hebt hervor, dass sich auch in der Forschung viel verändert hat. Es erschienen Studien mit dem Anspruch einer bilanzierenden Gesamtsicht auf Migration und Integration, zu subjektiven Aspekten von Migrationserfahrung und es entwickelte sich mit dem wissenschaftlichen Monitoring von Integrationsprozessen und Versuchen wissenschaftlich fundierter Policy-Beratung eine nicht unerhebliche Begleitforschung zu verschiedenen Aspekten der Einwanderung und ihren sozialen Folgen. Damit sei, so Pries (ebenda: 165) die Migration in der Soziologie angekommen und Migrationssoziologie habe sich zu einem bedeutsamen Zweig innerhalb der deutschsprachigen Soziologie entwickelt.