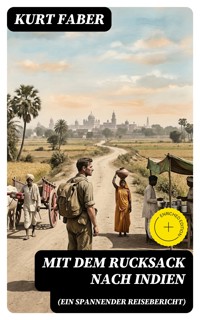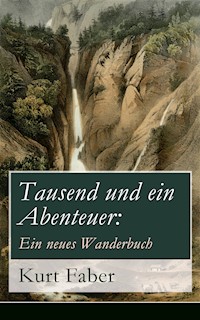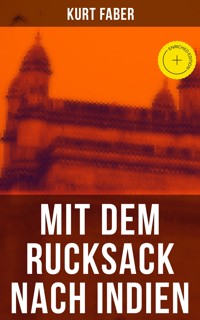
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In 'Mit dem Rucksack nach Indien' entführt uns Kurt Faber auf eine fesselnde Reise durch das exotische Land, indem er seine Abenteuer auf humorvolle und mitreißende Weise beschreibt. Der Leser wird in einen literarischen Kontext eingeführt, der von Reiseberichten geprägt ist, aber Faber hebt sich durch seine einzigartige Erzählstimme hervor. Mit lebendigen Beschreibungen der Landschaft, der Menschen und der Kultur bietet das Buch einen tieferen Einblick in Indien. Fabers Stil ist gleichzeitig unterhaltsam und informativ, was das Buch zu einem unvergesslichen Leseerlebnis macht. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mit dem Rucksack nach Indien
Books
Inhaltsverzeichnis
Mit dem Rucksack nach Indien
Die Straße der Abgebauten
Inhaltsverzeichnis
Anfang in Wien – Die nicht vorhandenen Backhahnderln[1] – Endlich unterwegs – Heimat in der Fremde – Politik im Eisenbahnwagen – Ankunft in Belgrad – Nix Daitsch – Serbische Bummelzüge – Der allzugewissenhafte Schaffner – Nisch – Kalif Storch am Bosporus-Stambul.
Das war am 21. März des Jahres 1926. Es liegt also noch nicht allzuweit zurück in der Weltgeschichte, und ich sehe das alles heute noch vor mir, als ob es gestern gewesen wäre, denn es war ein wichtiger Tag in meinem wechselvollen Leben. Nur der Zufall hatte mich in eines jener guten alten Wirtshäuser geführt, die sich da zwischen steilen, wunderlichen Giebeln in dem engen Gewirbel von Gassen und Gäßchen verstecken als pathetische Überbleibsel aus der guten alten Zeit, wo es noch »nur a Kaiserstadt, nur a Wian« gegeben hat. So eine von den Wirtschaften, wo es noch Backhahnderln – richtige Backhahnderln gibt und a Möhlspeis – richtige Möhlspeis und nicht so ein verzuckertes Zeug, wie sie es heute den Zugereisten aus dem Osten vorsetzen. An dem runden Tisch saßen behäbige Bürgersleute in verschossenen Anzügen, die einmal bessere Zeiten gesehen. Gewiß hatte es ihnen heute, wie schon so oft, nicht zum Backhähnderl gelangt. Aber den »Heurigen[2]« konnte man sich noch leisten, wenn er fünfzig Heller kostete, und dabei ließ sich gut reden und orakeln von der Aufwertung, die nicht kommen wollte, von den Häusern, die man einstmals besessen, von den Straßen der alten Stadt, die man umtaufte und immer wieder umtaufte, bis sich kein Mensch mehr auskenne, und vom Kaiser, der einmal wiederkommen müsse, wenn alle Stricke reißen.
Und derweilen brummte das Feuer in dem großen Kachelofen und der verspätete Winter wirbelte den Schnee vor dem Fenster, als ob er nachholen wollte, was er versäumt hatte in den letzten Monaten. Und die Katze schnurrte neben dem Ofen und der Dackel des Herrn früheren Hausbesitzers Schapferl streckte alle Viere von sich aus purer Behaglichkeit und kurzum: es war ein Idyll trotz alledem.
O letzter Abend auf deutschem Boden! Ich möchte die Stunden festhalten, damit sie nicht zu schnell vergehen. Aber ehe ich mich’s versah, war das Lokal schon leer. Der Wirt stellte die Stühle auf den Tisch und kam auf mich zu, während er die Hände an der Schürze abputzte; »Feierabend, Herr Nachbar. – Drei Schilling. Hobdiähre.«
Da zahlte ich den Obulus, nickte noch einmal zum Abschied dem Kaiser Franzel zu, der von der Wand herunterschaute und ging hinaus auf den Platz, wo eben die zitternden Schläge der Turmuhr am Stefansdom die Mitternachtsstunde verkündeten. Dicht unter dem Dom hielt eine Droschke mit einem verfrorenen Pferd und einem frosterstarrten Kutscher mitten im Schneegestöber. Und ich sagte mir: den mußt du patronisieren. Wer weiß, ob es noch Pferde geben wird, wenn du wieder zurückkommst in dieses benzinschnaubende Deutschland von heute.
Wir fuhren über die Ringstraße, wo die Lichter der Autos rot leuchteten durch die Nacht und durch den Schnee. Wir kamen durch die umgetaufte Jaurèsgasse – gesprochen wie geschrieben – und landeten schließlich am Bahnhof. Es war ein etwas überstürzter Abschied. Ich hatte gerade noch Zeit, meinen Rucksack aus der Gepäckaufgabe zu holen. Er war noch schwer von allerlei unnötigen Dingen. Aber bis Konstantinopel – so dachte ich mir – würde er noch aushalten und dann würde man wohl weiter sehen. Wenig sah ich voraus, daß er in Bälde auf persischen Karawanenwegen wandern, daß er den Himalaya besteigen und unter dem Schatten ceylonesischer Kokospalmen noch immer mein Begleiter sein würde. Aber so geht es zuweilen auf dieser Erde. Indes rumpelte der Zug immer weiter auf der großen Straße, die nach dem Morgenlande führt[1q]. –
Einmal – im Glück und im Sommer des Reiches – da war es, als ob sich auf modernen Stahlrossen der Ritt nach dem Ostland noch einmal wiederhole. Das war die Zeit, da die Salonwagen des schnellen Balkanzuges alle besetzt waren mit Ingenieuren, Offizieren, Kaufleuten, Bankdirektoren mit Bündeln von Aktien und Kisten voll Gold, das sich umsetzte in Bergwerke und Eisenbahnen, das sprudelnde Brunnen und üppige Baumwollplantagen hervorzauberte in der dürftigsten Wüste. Das war die Zeit, in der gelehrte Leute die dicksten Bücher schrieben über diesen Weg. Berlin-Bagdad. Der Weg zur Sonne; die neue Heerstraße der Abenteurer. –
Ach, sie ist inzwischen zu einer Straße der Abgebauten geworden. Denn die Zeiten sind schlecht. Manch einer in Deutschland träumt von großen Reisen nach Nord-oder Südamerika, vorausgesetzt, daß er die dazu nötigen 500–600 Mark aufbringen kann. Und wer dazu nicht in der Lage ist – nun ja, es ist nicht jedermanns Sache, mit 10 oder 15 Mark Arbeitslosenunterstützung seinen Angehörigen auf dem Pelze zu sitzen, und also schnürt man sein Bündel und wandert gen Osten, wo man mit guten Beinen zur Not auch ohne Fahrkarte nach fremden Ländern kommt, falls nicht der an den Grenzen lauernde St. Bürokratius einen vorzeitigen Strich durch diese Rechnung macht und den abenteuernden Jüngling per Schub wieder nach der Heimat befördert. Der ganze Osten ist heute übersät mit deutschen Männern und deutschen Rucksäcken. Scharenweise tauchen sie auf in Athen und Konstantinopel, arbeitsuchend tippeln sie einzeln und in Gruppen auf der staubigen Straße, die nach Angora führt, sie tragen ihre Unruhe in die syrische Wüste und in den armenischen Kaukasus, abenteuernd ziehen sie als moderne Marco Polos noch weiter hinein in den bunten Orient und sind der Schrecken aller Konsulate von Teheran bis Kalkutta. Was Wunder, wenn nach allen diesen Glücksrittern auch einmal einen Landsknecht der Feder die Lust nach dem Orient anwandelt und er mit dem Rucksack nach Osten zieht?
Öde und eintönig war die Reise durch die graue Pußta, über der der Wind mit den Wolken um die Wette lief. Düstere Männer mit großen Pelzmützen saßen stumm und breit auf den Bänken, während Marktfrauen in bunten Trachten wie knallrote Klatschrosen zwischen ihren Körben erblühten. Man war eben schon hinterwärts von Temesvar, und da konnte man nichts anderes erwarten. Aber wie man eben dachte, daß es noch immer exotischer werden würde, da füllte sich der Wagen mit Männern ohne Pelzmützen und Bauersfrauen in bunten Kopftüchern, die so schön heimatlich pfälzisch sprachen, daß ich nicht umhin konnte, mich an der Unterhaltung zu beteiligen. – Ja, sie kamen von Werbas. Und ich sei wohl auch aus der Gegend, das höre man schon an der Sprache. – Nein? Aus Deutschland? Das könne doch gar nicht sein. Im Kriege seien viele Deutschländer in der Gegend gewesen und die hätten ganz anders geschwätzt, überhaupt kenne sich da schon kein Mensch mehr aus. Erst hätte man hier sollen magyarisch reden, dann serbisch und alleweil soll es eine Sünde sein, wenn man Deutsch spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Heute dürfe man das nur noch mit dem lieben Vieh tun, wenn man nicht riskieren will, daß einem der Wojwode auf den Pelz rückt. Nun mischte sich ein starker Mann mit großen Fäusten, Kanonenstiefeln und einer Stimme wie ein Erdbeben ins Gespräch.
»Ruh’, ihr Weibsleut’«
Augenblicklich herrschte Ruhe und der Mann mit den Stiefeln nahm mich alsbald ins Gebet.
Von Deutschland komme ich? Geradewegs? – Ja, und ob man dort auch etwas wisse von dem, was mit unsereinem hier unten passiert? Zum Beispiel gerade hier in der Batschka?
Er schaute zum Fenster hinaus in das graue Land, über dem das erste Grün wie eine Ahnung des Frühlings lag. Dicht an der Bahnlinie bauten Leute an einem Hause. »Das sind die ›Freiwilligen‹«, erklärte der Landsmann. »Freiwillig waren sie im serbischen Heer, oder gaben sich wenigstens nachträglich dafür aus. Freiwillig sind sie zu uns gekommen wie eine Herde von Heuschrecken. Niemand hat sie gerufen, am wenigsten wir in der Batschka. Jeder nahm einem Bauern ein Stück Land, als ob das so sein müßte, und der Minister kam selbst von Belgrad, um zu sehen, daß sie es auch behielten. Dem Deutschen nimmt man’s und die anderen setzen sich darauf. So etwas nennt man Agrarreform. Keiner von den Burschen versteht das Geringste von der Landwirtschaft, und zudem sind die Stellen kaum groß genug, um einen vom Verhungern zu retten, selbst wenn er was davon verstünde. Die meisten wären froh, wenn sie den armseligen Kram um ein Butterbrot wieder an den deutschen Vorbesitzer verkaufen könnten. Aber das erlaubt nun wieder nicht der Wojwode und legt der Gemeinde Steuern auf, damit sie die Herrschaften durch den Winter füttern.«
Aber das sei alles nur Politik und nütze ihnen ebensowenig wie sie den Magyaren genützt habe. Die Schwaben seien nun einmal da und würden immer da sein und er halte es mit den Worten des guten alten Banater Dichters:
»Denn wo des Schwaben Pflug das Land durchzogen, Bleibt deutsch die Erde, und er weicht nicht mehr!«
Während er so sprach, nickten die »Weibsleut« und murmelten beifällig. Nur eine stramme, rotbackige Frau an seiner Seite ließ ihre Augen mißtrauisch durch den ganzen Wagen gehen und stieß ihn mehrmals warnend in die Seite, worauf er grimmig zu Boden starrte. – Überdem tauchte der hohe Kirchturm von Neusatz auf. Der Zug hielt an einem schönen, ländlichen Bahnhof, wo alle ausstiegen und eine neue Ladung Schwaben von draußen hereinkam. Weiter ging die Reise über die Donau zur trutzigen Feste Peterwardein, zu deren Füßen noch immer schöne Schwabenhäuser hinter blühenden Kirschbäumen standen.
Nur wenige Stunden Eisenbahnreise von Neusatz liegt die Stadt Belgrad. Je nun, eine Großstadt im modernen Sinne ist sie nicht. Aber wenn man über Nacht zur Hauptstadt eines Zwölfmillionenstaates geworden ist, so bringt das Verpflichtungen mit sich. Zu einem Verkehrsturm hat man es freilich noch nicht gebracht. Dafür aber steht bis in die entferntesten Vororte zwischen baufälligen Hütten an jeder Straßenecke ein Schutzmann, der für die Regulierung des Straßenverkehrs zu sorgen hat. Kommt nun von ungefähr wirklich einmal ein Mistwagen angefahren, so erhebt er majestätisch seinen Gummiknüppel und gibt die Straße frei für Ochsen, Büffel, oder was sonst als Zugtier dienen mag. Im Innern der Stadt aber ist in den letzten Jahren viel gebaut worden und wirklich so etwas wie großstädtische Eleganz aufgekommen. Das Muster dazu haben sie sich von ihren neuen, in der Kultur weiter vorangeschrittenen Brüdern aus Agram geholt. Was aber ist Agram? Ein kleines Wien. Und also – mögen sie es nun wahr haben wollen oder nicht – also ist Belgrad gleich Wien. Dieselben Menschen, dieselben Bauten – ja, und dieselben stolzen Wiener Kaffeehäuser mit denselben Typen, die ewig Domino spielen, mit den Möhlspeisen, die man zum Nachtisch bekommt, und den Kellnern, die es so unnachahmlich schön zu sagen wissen: »Hobdiähre!«
Deutsch hörte man überall sprechen. Jeder Kellner kann es, wenn er es auch manchmal erst in Erwartung eines Trinkgeldes wahrhaben will. Auch deutsche Namen fehlen nicht über den Ladenschildern, die man freilich erst mühsam entziffern muß aus der seltsamen kyrillischen Inschrift. »Haisepic Kpayc«, das heißt z.B. »Heinrich Krause«. Par ordre du moufti heißt es so, denn »nix daitsch« ist die Parole im neuen Staate S.H.S. Auch sonst hält man hier etwas aufs Herkommen. Es ist ja eine alte, jedem Wandersmann zur Genüge bekannte Regel: »Je kleiner der Staat, je größer der Bürokratismus.« So werden z. B. die Reisenden des Orientzuges auf der ganzen Strecke von Paris bis Konstantinopel nicht nennenswert belästigt, abgesehen von den Kontrollen an den unzähligen Grenzen. Ganz anders aber bei uns: Sehr höfliche Beamte machen die Runde durch den Zug und nehmen in sehr zuvorkommender Weise alle Pässe in Empfang, die dann nach der Ankunft zwecks Abstempelung in ein anderes Stadtviertel getragen und dort persönlich abgeholt werden müssen. Natürlich ist bei der Rückkehr der Zug schon über alle Berge und alsdann hat der glückliche Reisende noch die Ehre, dem aufblühenden Staate S.H.S. eine Wohnsteuer von fünfzig Dinar pro Nacht zu bezahlen für ein Zimmer, das bloß deren dreißig kostet. – Aber warum sollen es die Durchreisenden besser haben als die eigenen Staatsbürger?
Mitten in der Nacht fuhr ich mit dem Bummelzug weiter. Denn erstens ist das billig und zweitens und überhaupt – aber ich werde es nie wieder tun! Das Fahrgeld gibt hier noch weniger als anderswo Anspruch auf einen Sitzplatz. Wer Wert auf einen solchen legt, der muß ihn sich erkämpfen im Wettlauf mit einer schreienden Menge opangobeschuhter Bauern. Aus dem Kampfe war ich nicht als zweiter Sieger hervorgegangen. Ein Glücksfall ließ mich einen guten Platz erwischen, aber schon nahmen zwei Frauen mit drei schreienden Säuglingen mir gegenüber Platz. Ein zwei Zentner schwerer Mann setzte sich auf meinen Schoß und ein anderer stellte einen Korb voll Eier auf meinen Kopf. Da räumte ich das Feld. Und immer kamen noch mehr Menschen mit Körben und Säcken, mit kleinen Kindern und sonstigen Landesprodukten. Es sah aus wie in einem deutschen Wagen vierter Klasse in der seligen Hamsterzeit. Dazu kam die allen primitiven Menschen eigene Angst vor der frischen Luft. Ein scharfer Gestank – zehnmal schlimmer als im Zwischendeck eines großen Ozeandampfers – lag über allem. Aber ängstlich wachten sie darüber, daß keine Spalte eines Fensters aufgemacht wurde. Auf serbischen Eisenbahnen darf man alles machen. Du darfst rauchen, spucken, schreien, du darfst deine Nase an deines Nächsten Rockärmel putzen. Erlaubt ist, was gefällt auf serbischen Eisenbahnen. Aber sage niemand, daß das Auge des Gesetzes nicht dennoch wacht. Ich wenigstens sollte es herausfinden, noch ehe die Nacht viel älter war. Im Stehen war ich ein wenig eingenickt und stemmte den Fuß gegen eine der Bänke. Schon erschien das finstere Gesicht des Zugführers.
»Fünfzig Dinar!«
»Wie?« sagte ich schlaftrunken.
»Fünfzig Dinar Strafe.«
Fünfzig Dinar? Das war ein Dollar.
Ich sagte nichts und er auch nicht. An der nächsten Station kam er wieder mit einem Polizeibeamten.
»Fünfzig Dinar!« sagte der streng.
Fast hätte er mich eingeschüchtert, wenn mir nicht rechtzeitig ein hinter mir stehender Österreicher, der sich auskannte, noch etwas zugeflüstert hätte.
»Zahlen’s nix!«
Das erklärte ich denn auch rund heraus, worauf die beiden sich aufs Handeln verlegten.
Ob ich nicht wenigstens dreißig Dinar bezahlen wollte?
Nein.
Dann zwanzig.
Nein.
Schließlich einigten wir uns auf zehn, als der Zug eben in Nisch einlief.
Illusion der Städte, die auf den Landkarten stehen! Was gibt es hier anderes als Schlamm und Schweine und verfallene Häuser? Die Stadt – oder wie man das Gebilde nennen mag – liegt etwas abseits von der Bahn, und da es gerade ein Regentag war, mußte jeder, den es nach einem Besuch gelüstete, vorerst sich einem Schlammbad unterziehen. Es kam nur darauf an, ob er ein Fußbad oder eine Dusche vorzog. Die letztere wurde denen zuteil, die in den kleinen Panjekutschen fuhren. Aber es war wirklich nicht der Mühe wert. Bemerkenswert war nur die kleine Moschee und das Minarett, die die Nähe des Orients verkündeten.
Und weil ich gerade von Minaretten erzähle, kann ich nicht umhin, die folgende Geschichte zu berichten:
War einst in Konstantinopel ein deutscher Gesandter aus dem Schwabenlande, der sich nie so recht abfinden mochte mit Hammelbraten und solchen Dingen, die sie hier zu Lande essen. Also verschrieb er sich eine Köchin aus Böblingen. Die kochte fortan redlich die Spätzle, und Sonntags machte sie Mauldäschle, zur vollen Zufriedenheit ihres Herrn; aber über Moscheen, Muezzins, Minarette und alle die anderen Erscheinungen der fremden Umwelt machte sie sich so ihre eigenen Gedanken. Eines Tages nun wollte der Gesandte von ihr wissen, wieviel Uhr es wohl wäre.
»‘s ischt sechs«, sagte die Küchenfee, »der Herr Pfarrer hat’s schon ausg’rufe.«
Von Nisch geht es südwärts in dem gleichen unmöglichen wandelnden Möbelwagen, der sich balkanischer Bummelzug nennt, und ehe man sichs versieht, steht man schon wieder an einer Grenze. Denn in diesen östlichen Ländern ist der Grund uneben von lauter Grenzen, und selbst der harmloseste Wanderer kommt nicht zur Ruhe vor den Schikanen, die sich immer wieder in neuer Auflage wiederholen.
Schon immer war es so gewesen, aber heute trifft das mehr zu als je in dieser gehetzten, friedlosen Welt: hat man irgendwo ein Zusammentreffen mit den Organen der Staatsautorität, so ist es, als ob man den Saum des Teufelsmantels berühre. Wer heute nach Ostland reist, der weiß ein Lied davon zu singen. Sechs Länder, zwölf Grenzen, an denen sie sich liebevoll deiner annehmen und sich eingehend erkundigen nach deiner Gesundheit, deinem Vorleben, deinem Impf-und Taufschein und danach, ob du etwas zu verzollen habest, an denen sie dich sorgsam registrieren, notieren und visitieren, indem sie immer noch einmal in deinem vieldurchwühlten Rucksack wühlen und sich gewissenhaft erkundigen, ob du auch keine Goldstücke ein-und ausführest. Sechs neue Länder, sechs neue Valuten, von denen an jeder ein Stückchen kleben bleibt an den schmierigen Händen geschäftstüchtiger Levantiner, die ihre Buden an den Grenzen wie Mausefallen aufgestellt haben. Sind’s Schillinge, sind’s Kronen, sind’s Dinar, Dollar, Levas? Sie summen dir im Kopf, sie tanzen nachts vor den Augen, und nichts ist bei ihnen gewiß, als der immer neue Verlust bei jedem neuen Handel.
Aber das ist doch alles nur der Vorhof zur Hölle, die einen bei der Ankunft am Goldenen Horn erwartet, und dieses war nun nicht mehr weit. Schwerfällig keuchte der Zug über den schneebedeckten Schipkapaß und rumpelte auf der anderen Seite wieder hinunter in ein Land, dessen Hügelhänge weiß waren von Blüten, wie vorher vom Schnee der Berge. Hier war endlich der Frühling, ja beinahe schon der Sommer. Der Sonnenschein lag hell auf den weißen Straßen und an den Bachrändern klapperten die Störche. Auf den Bahnsteigen wimmelte es von roten Fezen und von buntgestickten Kopftüchern. In der Ferne ragten die Minarette der stolzen Moschee von Adrianopel in den dunkelblauen Himmel – ja, und da stand eine Gesellschaft von Griechen in den seltsamen Ballettröckchen, und nebendran ein schwarzbärtiger Hodscha mit weißem Turban und schwarzäugige Türkenjungen mit rotem Fez und blauen Pluderhosen, die bakschischheischend die Hände hoben. Hier endlich war Sommer und Sonne, und aus der Ferne begann es schon heraufzusteigen wie eine Ahnung des Ostens, des ewig unergründlichen Orients mit all seinen Wundern und Wunderlichkeiten.
Eine Weile noch schaute ich hinaus in das weite Land, auf das sich schon die Nachtschatten zu senken begannen, und träumte von diesen Dingen mit offenen und dann mit geschlossenen Augen, bis mich auf einmal harte Hände schüttelten und eine rauhe Stimme mir in den Ohren gellte:
»Stambul!«
Ein Lehrling im Morgenland
Inhaltsverzeichnis
Modernes Morgenland – Hoffnungslose Sprachstudien – Der freundliche Koch – Und noch ein Freund – Ich mache die Bekanntschaft eines Zigeunerfürsten – Allerlei Nachtquartiere, Kämpfe mit St. Bürokratius – Ein neues Wort: lnschallah! Besuch im Palast der Prinzessin – Die Badewanne als Schweinetrog – Praktische Sozialisierung – Ein Kapitel über das Reisen – Allerlei Bekanntschaften – Hugo, der Wandervogel, zeigt mir die Stadt – Phantasien auf der Galatabrücke.
Ach, die Zeiten vergehen, aber sie gleichen sich nicht! Alles ist auf den Kopf gestellt, alles hat sich geändert auf dieser Erde. Oder wie kommt es sonst, daß gerade die Länder, die wir einstmals gekannt und geliebt haben, wegen ihres Geschreis und ihrer Zügellosigkeit, wegen ihrer Lumpen und Laster, weil ihnen das alles so schön zu Gesicht gestanden hat in Sommer und Sonne – daß nun ausgerechnet gerade die in preußischer Strammheit machen müssen?
Wer hat, der einmal in Kairo, in Port Said, in Damaskus gewesen, sich nicht mit Händen und Füßen verteidigen müssen gegen das Gewimmel, das da, mehr malerisch als vertrauenerweckend, einen Sturmangriff auf seine Koffer machte, das ihm Briefmarken und Münzen und alte Götter und persische Teppiche – made in Germany – verkaufen wollte? Wo alles ringsum ein Aufruhr war von roten Fezen und schwarzen Rollhaaren, bis dann endlich der o so sanfte, hilfsbereite, fürstlich großartige Dragoman[3] mit dem gelben Gesicht und den wundervoll schwarzen, mandelförmigen Augen sich seiner annahm in seiner Not, nicht immer zu seinem Vorteil. O Sonne, o Farben des Orients[3q]! O katzbalgendes Durcheinander der Levante, das wir so oft verfluchten und das man doch nicht missen wollte, weil es ein Teil dieses Landes und ein Abglanz dieser Sonne ist. Weil es festzustehen schien für alle Zeiten wie ein Gebot des Koran.
Und war dies in Konstantinopel nicht auch einmal so gewesen? So wenigstens las man es in den Berichten der Reisenden, und außerdem konnte man sich das gar nicht anders vorstellen unter diesem blauen orientalischen Himmel.
Ja, und nun stand ich allein mit meinem Rucksack in der weiten Bahnhofshalle, wo noch immer die Lichter brannten im fahlen Morgenlicht, das grau durch die Fenster fiel. Mich fröstelte auf diesem ersten Stückchen morgenländischen Boden, das ich mir so ganz anders vorgestellt hatte. So bodenlos allein und verlassen kam ich mir vor in dem fremden Lande. Nur um überhaupt eine Ansprache zu haben, wandte ich mich um irgendeine Auskunft an einen vorübergehenden Bahnbeamten, der gar nicht so aussah wie eine Figur aus Tausendundeiner Nacht, sondern ganz nüchtern uniformiert in einer neutralen Uniform, die man ebensogut in Paris wie in London oder sonstwo sehen konnte. Er verstand nur Türkisch und ging achselzuckend weiter, ohne mich nur eines Blickes zu würdigen. Und so taten es alle anderen. Ein rucksackbewehrter Franke – das war schon längst nichts Neues mehr und an so etwas ließ sich nichts verdienen. Das wußte man aus Erfahrung. Ich kam auf den engen Bahnhofsplatz, wo die Kutscher auf den Böcken schliefen und schließlich in eine nichts weniger als großstädtisch ausschauende Straße, wo Schuhputzjungen sich die Kehle heiser schrien und Scharen von Arbeitern mit ihren Suppeneimern hinunter zum Hafen gingen. Das alles hatte man anderswo auch schon gesehen. Nur die Inschriften auf den Ladenschildern schauten reichlich exotisch in einem sinnverwirrenden Durcheinander arabischer Schriftzeichen von den Hauswänden. Das brachte mich einigermaßen außer Fassung. Ich setzte mich auf die Treppe eines Brunnens – später erfuhr ich, daß es ein berühmter, beinahe ein heiliger Brunnen war – und schaute verstört in das Getriebe der engen und übelriechenden Gassen.
Wohin in dieser fremden Welt[2q]?
Es war ja wahrlich nicht meine erste Reise in die Fremde. Aber zum erstenmal in meinem Leben befand ich mich in einem Lande, von dessen Sprache ich kein Wort verstand. Wie Sphinxen starrten mich alle Inschriften an. Hier konnte man kein Hotel von einer Barbierstube unterscheiden. An der gegenüberliegenden Seite der Straße stand so etwas, das man mit einigen Konzessionen vielleicht als Gastwirtschaft bezeichnen konnte. Ich ging darauf zu, und schon stand in der Tür ein weißgekleideter Koch, der sich vor mir so tief verneigte, als ob ich der Sultan selber wäre. Es war ein blitzsauberes Lokal mit weißgedeckten Tischen und einem Büfett, auf dem in großen Kupferkesseln die wunderlichsten Speisen standen. Joghurt und Pilau und solche orientalischen Küchengeheimnisse, von denen ich noch nichts wußte. Unaufgefordert brachte mir der Wirt ein gebratenes Huhn, einen Hammelbraten und noch verschiedene andere Dinge, für die meine Wissenschaft nicht ausreichte, und wurde indes nicht müde, sich nach dem Woher und Wohin des Efendi zu erkundigen. Da er nur Türkisch und Griechisch sprach und ich von dem allem nicht ein Wort verstand, war es eine sehr einseitige Unterhaltung, bis sich ein eben hereinkommender Gast hineinmischte.
»Servus, Landsmann!« riet er begeistert. »Ja, das hab’ ich gewußt. Hab’ ich gestern gesagt dem Efendi, daß wird kommen deutscher Mann mit Rucksack.«
»So –?«
»Ja, was glauben’s«, fuhr er fort, indem er mit den langen weißen Fingern durch den schwarzen Haarschopf fuhr, der ihm fast bis zur Schulter herunterhing. »Bin ich hier schon sechs Jahre in Stambul, und alle Tage seh’ ich andere, die mit Rucksack kommen. Manchmal zwei, manchmal sechs oder sieben. Manchmal Deitsche, manchmal Esterreicher, manchmal Ungarn oder Tscheech, und keiner ka Geld net.«
Wieder fegte er die schwarzen Haare zurück, die ihm düster über das bleiche Gesicht herunterhingen. – Ja, er sei auch nicht der erste beste Hergelaufene. Er habe den Krieg beim soundsovielten böhmischen Reserveregiment mitgemacht und sein Bruder sei bei der Kapelle der Hoch-und Deutschmeister gewesen. Sein Vater käme aus Oberösterreich, die Mutter sei eine waschechte Tschechin, und er sei in Ungarn aufgewachsen. Aber wie der Krieg dann so ein böses Ende genommen habe – ja, was willst mache? – da sei er eben für die Gelegenheit ein Jugoslave geworden und mit dem Paß nach Konstantinopel gereist, wo damals die Alliierten waren und das Geld auf der Straße lag.
Und was er denn da getrieben hätte? fragte ich schüchtern.
»Natürlich Kafföhhaus! Mit am Musikkasten kommst überall durch. Dreimal in der Nacht die Marseillaise, sechsmal rule Britannia un a blau-weiß-rots Banderl und dazwischen die neuesten Schlager. Schenne Stadt, Konstantinopel – ja, was glaubst, i bin nämlich zur Zeit a Zigeuner!«
Mit einem Griff in die Brusttasche zog er einen Pack von Ansichtskarten hervor, auf denen unser Freund mit Geige und Schmachtlocken als Zigeunerfürst abgebildet war; allabendlich auftretende große Attraktion im Café in Pera.
»Da schaust!« meinte stolz der Zigeunerbaron.
Ich schaute allerdings. Dieser kosmopolitische Herr war offenbar der geborene Levantiner, wenn auch seine Wiege ganz wo anders gestanden hatte. Ich fragte ihn nach der Adresse eines billigen und empfehlenswerten Hotels.
»Ja na«, sagte er mit einem Seitenblick auf meinen Rucksack, »Sechskreuzerhotels gibt’s nur draußen in Piri Pascha. In Skutari könnens für fünf Piaster übernachten, aber da gibts viel Beischläfer mit sechs Beinen. Da zahlt sich’s besser aus, wenn man auf der Treppen zu der Taximkaserne kampiert.«
Sonst aber, meinte er, sei gleich nebenan das Hotel Mossul, wo man ein türkisches Pfund (etwa 2.- RM.) für ein Zimmer bezahle.
Und also entschied ich mich für das Hotel Mossul. – Je nun, es war nicht eben das erste Hotel am Platze, und der Efendi im Büro, der ein leidliches Französisch sprach, war auch nicht der liebenswürdigste aller Hoteliers. Ob ich mich schon bei der Polizei angemeldet hätte? fragte er mit saurer Miene.
»Nein«, antwortete ich.
»Dann müssen Sie das unbedingt sofort tun, Efendi.«
Mit einem weiteren Seufzer überreichte er mir einen mächtigen vorgedruckten Bogen, aus dessen Umfang allein man schon die alte Wahrheit noch einmal bestätigt fand: »Ein Narr fragt viel, worauf sieben Weise nicht antworten können.« Da zudem die Fragen in arabischen Buchstaben türkisch gedruckt waren, hatten wir gleich eine einstündige Konferenz bis zur Festlegung des Wichtigsten.
»Und vergessen Sie nicht, sich auch gleich abzumelden!« rief mir der Efendi nach, als ich mich endlich auf den Weg machte.
»Abmelden?«
»Natürlich«, seufzte der Efendi, »wollen Sie denn immer in Konstantinopel bleiben? Drei bis vier Tage brauchen Sie zur Anmeldung, und wenn Sie nur acht Tage in Konstantinopel bleiben wollen –«
So machte ich mich denn mit einer Seele voll böser Ahnungen auf den Weg zu der Stätte, die dem zugereisten Franken den ersten Begriff gibt von dem, was orientalischer Kismet ist.
Aber nein, ich will das nicht im einzelnen erzählen. Die Feder sträubt sich, wie es in den Romanen heißt. Selbst auf dem Papier möchte ich es nicht noch einmal erleben.
Du hast deine Bogen nach bestem Können ausgefüllt, und gehst mit einer Seele voll Sicherheit zum Efendi auf der Polizeistation. Der runzelt die Stirn und sagt dir in schlechtem Französisch, daß das nicht die richtige Adresse sei. Wieder wanderst du durch die buckligen Straßen von Stambul nach einer anderen Station, zu einem anderen Efendi, der alsbald Allah zum Zeugen anruft, daß auch er nicht die zuständige Stelle sei. Im Zimmer Nummer so und soviel hast du endlich den richtigen Mann gefunden, der deine Personalien fein säuberlich in ein dickes Buch einträgt, in zierlichen arabischen Buchstaben, die dünn wie Spinngewebe sind, und der dich dann zum nächsten Efendi schickt, und so gelangst du über noch einige andere Zwischenstationen zum Bei und endlich zum Pascha, der seufzend seine Unterschrift darunter setzt, worauf du dann die ganze lange Reihe der Efendis, Beis und Paschas noch einmal durchlaufen mußt.
Ja, nun weiß ich, was eine Paschawirtschaft ist! Zu allerletzt kam ich auf meinen Wanderungen in ein wirklich feudal aufgemachtes Büro, wo ein Herr, der offenbar etwas zu sagen hatte, einen recht umfangreichen Stempel auf meine – wie heißt man den Wisch? – auf meine »Wessika[5]« drückte und ich glaubte, daß nunmehr die Sache erledigt wäre.
»Inschallah[4]!« meinte er auf meine diesbezügliche Frage.
Ich war eben noch ein Lehrling im Morgenlande. Inzwischen habe ich es noch oft gehört auf türkischen Märkten, persischen Bazaren, in arabischen Kaffeehäusern.
Inschallah! – So Gott will.
Das ist das Zauberwort, um das sich hier alles dreht. Es ist der Schlüssel zum Verständnis des Orients.
Inschallah sagt dir der Schneider, dem du den Auftrag auf einen Anzug erteilt hast, Inschallah wird er sagen, wenn du nach acht Tagen kommst, um ihn abzuholen. Morgen, Inschallah, tröstet dich der Führer in der Karawanserei, wenn du dich nach dem Abreisetermin der Karawane erkundigst. Inschallah, sagt achselzuckend der Kaufmann, dem du einen verfallenen Wechsel präsentierst und geht zu seinem eigenen Schuldner, der seinerseits mit dem gleichen Worte aufwartet. Alle sagen sie es, vom Schah auf dem Pfauenthrone bis herunter zum ärmsten Bettler. Alle machen das Wort zum Angelpunkt ihres Lebens.
Inschallah – wenn Allah es will! Ach, es ist das Schicksal dieses Landes, daß Allah zumeist sehr lange braucht, um sich zu besinnen!
Wie dem auch sei: es war Allahs Wille, daß ich noch einen zweiten Tag in drangvoll fürchterlicher Enge auf dem Polizeipräsidium zu Stambul verlor, ehe die Angelegenheit erledigt war, aber fortan machte ich stets einen großen Umweg um das graue Gebäude. Immerhin war das alles keine verlorene Zeit. Denn wer orientalische Völkerstudien betreiben will, der findet hierfür kein geeigneteres Objekt, als das an-und abmeldende Gewimmel auf der Polizeidirektion in Stambul.
Was je unter östlicher Sonne umhergelaufen ist, vom pelzmützigen Perser bis zum arbeitsuchenden Hamburger Zimmermann unter dem Schatten seines breiten Hutes, ist hier alles vertreten. Gleich am Anfang machte ich die Bekanntschaft von zwei ehemaligen Offizieren von der Sorte, wie man sie heute überall auf der Erde antreffen kann.
Kriegsleutnants, Freikorpssoldaten, die der Höllenspuk dieser tollen Zeit aus der Bahn geworfen hat, in der sie unter normalen Umständen heute vielleicht schon solide, sorgende Familienväter geworden wären, anstatt mit vierzig Jahren hier auf der Jagd nach dem Glück am Rande des Orients umherzuirren. Diese waren aus München und beide ein wandelndes Stück Weltgeschichte der letzten Jahre. Sie waren beim Freikorps im Baltenland und in Oberschlesien gewesen. Sie hatten den Kapp-Putsch mitgemacht und in der Pfalz gegen die Separatisten gekämpft. Und ja – dann war es auf einmal vorbei mit Krieg und Kriegsgeschrei. Der Friede war ausgebrochen, der ach so laue und langweilige Friede, der den Philistern den Tisch deckte und den Kämpfern den Stuhl vor die Türe setzte. Und so kam man nach Konstantinopel. –