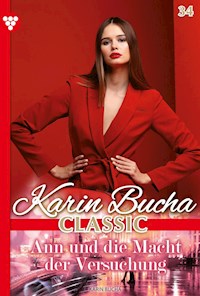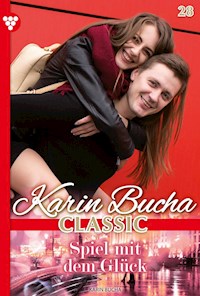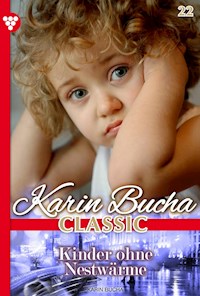Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Karin Bucha Classic
- Sprache: Deutsch
Karin Bucha ist eine der erfolgreichsten Volksschriftstellerinnen und hat sich mit ihren ergreifenden Schicksalsromanen in die Herzen von Millionen LeserInnen geschrieben. Dabei stand für diese großartige Schriftstellerin die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Fürsorge, Kinderglück und Mutterliebe stets im Mittelpunkt. Karin Bucha Classic ist eine spannende, einfühlsame geschilderte Liebesromanserie, die in dieser Art ihresgleichen sucht. Gert Wendhoff packt seinen kleinen Handkoffer fester und passiert die Sperre des Hamburger Hauptbahnhofs. Es ist früher Morgen. Die lange Fahrt von Süddeutschland nach dem Norden und die schlaflose Nacht liegen ihm wie Blei in den Gliedern. Langsam, wie ein Mensch, der viel Zeit hat, zuviel Zeit, geht er durch die Halle. Er sieht an den einzelnen Ständen, wie geputzt und aufgeräumt wird. Ein Mann sucht Papier zusammen und läßt es in einem Sack verschwinden. Wendhoff bleibt sekundenlang vor dem Zeitungskiosk stehen, an dem schon reger Betrieb herrscht. Man müßte sich eine Tageszeitung kaufen – überlegt er – vielleicht steht eine ausgeschriebene Stelle für mich drin. Ohne den Gedanken zu verwirklichen, setzt er seinen Weg fort. Aus den Wartesälen dringt der Geruch frischen Kaffees in seine Nase. Er kämpft mit sich. Darf er sich ein warmes Getränk leisten? Seine Barschaft ist knapp, aber das Verlangen, etwas Warmes zu sich zu nehmen, ist riesengroß. Er sucht den Wartesaal Erster Klasse auf. Ein bitteres Lächeln zieht seine Mundwinkel herab. Eigentlich gehört er nicht hierher. Er gehört zu den Erfolglosen, zu denjenigen, die der Krieg entwurzelt hat. Alle Erwartungen, alle Hoffnungen haben der Krieg und die lange Gefangenschaft zerschlagen, und nur sein armseliges Leben, das er kaum fristen kann, hat er ihm gelassen. Wendhoff hat den Gang im Wartesaal durchquert. Angenehme Wärme umgibt ihn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Bucha Classic – 3 –Mit den Augen der Liebe
Karin Bucha
Gert Wendhoff packt seinen kleinen Handkoffer fester und passiert die Sperre des Hamburger Hauptbahnhofs. Es ist früher Morgen. Die lange Fahrt von Süddeutschland nach dem Norden und die schlaflose Nacht liegen ihm wie Blei in den Gliedern.
Langsam, wie ein Mensch, der viel Zeit hat, zuviel Zeit, geht er durch die Halle. Er sieht an den einzelnen Ständen, wie geputzt und aufgeräumt wird. Ein Mann sucht Papier zusammen und läßt es in einem Sack verschwinden.
Wendhoff bleibt sekundenlang vor dem Zeitungskiosk stehen, an dem schon reger Betrieb herrscht.
Man müßte sich eine Tageszeitung kaufen – überlegt er – vielleicht steht eine ausgeschriebene Stelle für mich drin. Ohne den Gedanken zu verwirklichen, setzt er seinen Weg fort.
Aus den Wartesälen dringt der Geruch frischen Kaffees in seine Nase. Er kämpft mit sich. Darf er sich ein warmes Getränk leisten? Seine Barschaft ist knapp, aber das Verlangen, etwas Warmes zu sich zu nehmen, ist riesengroß.
Er sucht den Wartesaal Erster Klasse auf. Ein bitteres Lächeln zieht seine Mundwinkel herab. Eigentlich gehört er nicht hierher. Er gehört zu den Erfolglosen, zu denjenigen, die der Krieg entwurzelt hat. Alle Erwartungen, alle Hoffnungen haben der Krieg und die lange Gefangenschaft zerschlagen, und nur sein armseliges Leben, das er kaum fristen kann, hat er ihm gelassen.
Wendhoff hat den Gang im Wartesaal durchquert. Angenehme Wärme umgibt ihn. Gedämpftes Licht strahlt auf weißgedeckte Tische. Er sucht sich einen Ecktisch aus und bestellt sich ein Kännchen Kaffee. Hinterher bereut er es. Eine Tasse hätte auch genügt.
Er schließt die Augen, bevor er sich aus der silbernen Kanne den Kaffee in die Tasse gießt. Er glaubt, jetzt schon die belebende Wirkung zu spüren.
Und dann trinkt er, Schluck um Schluck. Wie ein Ritus ist es. Wärme durchströmt seinen Körper und weckt seine Lebensgeister. Er kauft sich sogar eine Zeitung vom vorbeigehenden Händler und vertieft sich darin.
Er überfliegt die Anzeigen der Vergnügungsstätten. Es berührt ihn kaum.
Wendhoff schlägt die Seite um. Was kümmern ihn diese Anzeigen? Er sucht Arbeit, Arbeit, die ihn ausfüllt, die ihn vorwärtsdrängt und zum Erfolg führt. Arbeit, die ihn ernährt.
Er hätte sich lieber an einem der Stände Brötchen kaufen sollen, anstatt hier den Kaffee zu trinken. Aber er wird das Gefühl des Hungers überwinden, wie er es in letzter Zeit häufig hat überwinden müssen.
Er hockt hinter seiner Zeitung und hat für nichts anderes Interesse. Er ist dreißig Jahre alt, gut gewachsen, mit einem schmalen, jetzt etwas zu schmalen Gesicht mit angenehmen Zügen, klaren Grauaugen, die mißtrauisch und prüfend dreinblicken.
Sein Anzug ist sauber, wenn auch abgetragen. Sein Oberhemd verknüllt durch die Bahnfahrt. Aber seine Krawatte sitzt tadellos, wie bei einem Mann, der auf sein Äußeres hält.
Er kommt sich dennoch unsauber vor. Er möchte ein Bad nehmen, sich rasieren und in das letzte frische Oberhemd steigen.
Ach, er möchte so vieles und kann doch gar nichts tun. Er hat keine Freunde mehr und keine Verwandten. Er hat kein Heim mehr. Er ist ein Mensch geworden, der das Vertrauen zu sich selbst verloren hat.
Die Zeitung hat er längst sinken lassen, und der Kaffee erkaltet. Er stiert vor sich hin, und die ganze trostlose Lage, in der er sich befindet, packt ihn, daß er aufheulen könnte wie ein Kind, das sich verlaufen hat und nicht heimfinden kann.
*
Leonore Breitenstein hat ihren Mercedes bestiegen und ist allein durch die Straßen, die langsam zum täglichen Leben erwachen, gefahren. Sie hat es plötzlich nicht mehr auf Tinas Party ausgehalten.
Sie sieht die Freunde und Bekannten vor sich, die sich bei Ludwig Crämer zusammengefunden hatten. Schon um Mitternacht hatte sie die kleine Gesellschaft verlassen wollen, doch man ließ sie nicht weg. Reinhold Schnitzler, dem sie nun doch entschlüpft ist, hat sie mit ganzer Überredungskunst festgehalten. Die Stimmung wurde immer gehobener. Es wurde viel getrunken und sinnloses Zeug geredet, weil die Zunge versagte und die Sinne vom Alkohol umnebelt waren. Sie hatten getanzt, und selbst der Mokka hatte sie nicht ganz nüchtern gemacht.
Plötzliche Unlust hatte Leonore überfallen, und so war sie einfach verschwunden, da keiner Anstalten traf, das gastliche Haus Crämers zu verlassen.
Als sie dicht vor dem Bahnhof war, folgte sie einer Eingebung und parkte.
Sie wollte etwas trinken und suchte den Wartesaal auf. Sie wollte allein sein und strebte auf den freien Ecktisch zu. Als sie Platz genommen hatte, sah sie auf dem Tisch eine Zeitung und benutztes Geschirr. Sie raffte ihre Handtasche und Handschu-
he auf, um den Platz zu wechseln, als
eine sonore Stimme an ihr Ohr schlug.
»Behalten Sie bitte Platz, ich gehe gleich.«
»Danke!« sagte sie und ließ sich wieder nieder.
Wendhoff hatte sich zwei Brötchen vom Verkaufskiosk in der Halle geholt, die er nun trocken zum Rest des Kaffees aß. Dazu las er die Stellenangebote in der Zeitung.
Leonore bestellte ihre Brause und blickte um sich. Auf der Zeitung dicht vor ihr blieb ihr Blick haften. Im gleichen Moment legte der Mann sie aus der Hand. Leonore sah zur Seite.
Wie angezogen wandte sie aber gleich darauf den Blick ihrem Gegenüber wieder zu. Seine Grauaugen musterten sie ungeniert, und sie fühlte sich abermals unsicher.
Sie ahnte nicht, daß sie für Wendhoff eine Augenweide war mit ihrem gepflegten Äußeren, ihrer Schönheit. Auf ihren schmalen Händen, die einen kostbaren Stein trugen, blieb sein Auge haften.
Alles an ihr atmete Wohlhabenheit. Wendhoff kam das Ungewöhnliche seines Benehmens zum Bewußtsein. Man starrte eine Dame nicht so auffällig an.
»Verzeihung«, murmelt er, und Leonore lächelt leicht. Er sieht wie ein Junge aus, der bei einer Dummheit ertappt ist.
»Ich habe nichts zu verzeihen«, sagt sie, und sie beginnt, den Mann aufmerksamer zu betrachten. Seine Stimme hat es ihr angetan.
»Doch. Es war unhöflich von mir, Sie so anzustarren, aber…« Er bricht ab und merkt, wie es ihm heiß in die Stirn schießt.
»Aber…?« lockte sie.
»Sie sind sehr schön«, gesteht er ehrlich. »Ich habe lange keine so schöne Frau gesehen.«
Er sagt das mit ungewöhnlichem Ernst, beinahe widerwillig. Sie mustert ihn weiter. Dann sagt sie aus ihrem Sinnen heraus:
»Spätheimkehrer?«
»Ja.«
Das klingt unfreundlich, und es hat den Anschein, als wollte er mit diesem einzigen Wort eine Mauer zwischen sich und ihr aufrichten.
»Jetzt muß ich mich entschuldigen. Ich war taktlos«, sagt sie.
»Sieht man es mir so deutlich an?«
Ihre unwahrscheinlich blauen Augen unter der klugen Stirn sehen ihn ohne Spott an. Ihr weicher Mund lächelt leicht.
»Nicht so sehr«, erwidert sie nach einer Pause. »Ihre Scheu hat mich auf den Gedanken gebracht. Sind Sie in Hamburg zu Hause?«
»Ich habe kein Zuhause mehr«, stößt er abermals unwillig hervor. »Das Beste wäre, man machte einfach Schluß. Blödsinn, in diese Stadt zu kommen, als ob man ausgerechnet auf mich gewartet hätte.« Er sagt das voll Bitterkeit und wie zu sich selbst. Sie wird hellhörig. Da ist ein Mensch, der verzweifelt ist und Hilfe nötig hat. Sie versinkt in Nachdenken. War sie nicht auch einmal in einer solchen Verfassung? Und war es nicht auch ein Fremder, der ihr damals geholfen hat und sie später heiratete? Hat Ernst Breitenstein ihr nicht liebreich die Hand gegeben und sie in geordnete Verhältnisse, in Wärme und Geborgenheit geführt?
Sie hebt den Blick und sieht mitten hinein in die hellen Augen, auf deren Grund Verzweiflung steht.
»Ich kenne diesen Zustand…«
Er macht eine kleine Verbeugung. »Gert Wendhoff.«
»Ich bin Leonore Breitenstein.« Wieder lächelt sie, und sie zieht ihn damit ungemein an. »Ja, auch ich war einmal verzweifelt und wollte Schluß machen.«
Sie blickt vor sich hin und spielt mit dem Löffel. Er muß immerzu auf die schöngeformte Hand mit dem kostbaren Stein blicken.
Plötzlich hat er nicht mehr das bedrückende Gefühl der Einsamkeit. Ein Mensch sitzt ihm gegenüber, der zu ihm spricht, der ihn trösten will, der Anteil an seinem Schicksal nimmt. Eigentlich ist das wie ein Wunder. Inmitten einer Millionenstadt gibt es einen Menschen, der ausgerechnet ihm sein Herz ausschüttet. Denn daß die Frau, die er vor kurzem noch nicht gekannt, das Bedürfnis hat, über sich und ihre Erlebnisse zu sprechen, das spürt er genau. Er trinkt ihre weiteren Worte fast in sich hinein. Schon dieser warmen, wohltuenden Stimme zu lauschen, bringt die vielen verwirrenden Gedanken in ihm zur Ruhe.
»Mein verstorbener Mann hat mich buchstäblich von der Straße aufgelesen. Ohne zu fragen, wer ich bin und woher ich kam, nahm er mich mit sich. Ich hatte plötzlich ein Dach über dem Kopf. Ich bekam ein langentbehrtes gutes Essen, und ich wurde nicht ausgefragt. Alles war für Ernst Breitenstein selbstverständlich. Er war ein guter Menschenkenner. Er war auch voller Geduld. Er wartete, bis ich von mir aus zu sprechen begann, und dann griff er helfend ein.
In seinem Juweliergeschäft, das angesehen und gut eingeführt war – es befand sich bereits seit drei Generationen in den Händen einer Familie – gab er mir einen Arbeitsplatz. Langsam, ganz langsam, nahm ich Fühlung mit meiner Umwelt, die mir äußerst gleichgültig war. Viel konnte ich ihm zunächst nicht helfen. Aber was ich tat, tat ich mit dem Einsatz meiner ganzen Persönlichkeit. Ich kämpfte mit allen Mitteln um diesen Arbeitsplatz. Ja – und dann wurde ich seine Frau. Ganz langsam wurde aus der Achtung Zuneigung…«
Sie verstummt, und er stört sie nicht. Zuneigung hat sie gesagt – nicht Liebe. Ja, aus Dankbarkeit kann auch eine Art von Liebe entstehen.
»Warum erzählen Sie mir das alles, mir, einem Fremden?«
Das klingt unhöflich, beinahe grob.
Sie verliert ihre Ruhe nicht. Sie lächelt nur und sieht von ihren Händen auf in seine kühlen Grauaugen. »Warum? Ich glaube, ich erklärte es Ihnen schon. Sie hat das Schicksal gestoßen – mich auch…«
»Aber Sie scheinen jetzt in sehr guten Verhältnissen zu leben.«
Seine Stimme hat einen hochmütigen Klang. Leonore kennt auch diese Reaktion. Vor Jahren hätte sie nicht anders gesprochen.
»Glauben Sie mir, obwohl ich jetzt in guten Verhältnissen lebe, nie habe ich vergessen, daß ich einmal bittere Not kennengelernt habe. Heute, inmitten der ausgelassenen Gesellschaft, überkam mich plötzlich die Unlust. Auf einmal begann ich meine Umgebung, an die ich mich längst gewöhnt glaubte, mit anderen Augen zu betrachten. Ich fand alles um mich herum sinnlos und töricht. Meine Freunde, soweit man überhaupt von solchen sprechen kann, benahmen sich unter dem Einfluß des Alkohols albern. Ich lief davon. Allein sein wollte ich. So kam ich hierher und traf in dieser Stimmung auf Sie. Sie wirkten auf mich wie – wie mein Gewissen.«
Um sie herum setzt das tägliche Leben ein. Aus dem Lautsprecher werden ankommende und abfahrende Züge angesagt. Reisende kommen und gehen. Die Tische werden besetzt. Kellner laufen geschäftig hin und her.
Irgendwo plärrt ein Kind.
Langsam versinkt das Bild vor Leonores Augen, und ein anderes entsteht vor ihr. Auch ein Wartesaal. Nur ein kleiner, verwahrlost, der Fußboden schmutzig, ein uralter Kellner im abgewetzten Anzug und überall Menschen, Menschen, auf Stühlen, Bänken und Koffern. Jeder kleinste Platz ist belegt. Und sie scheu in einer Ecke auf einer Holzkiste, die ihre Habseligkeiten birgt. Eine abgenutzte Tasche hält sie fest an sich gepreßt. Sie enthält ihren kostbarsten Schatz: Inkas Bild. Das Bild eines süßen kleinen Mädchens, mit dunklen Haaren und großen samtdunklen Augen.
Ein Bild ist alles, was von ihrem Kind übrig geblieben ist auf der Flucht, als die Bomben fielen. Wie eine Wahnsinnige hat sie, nachdem alles vorüber war, nach Inka gesucht. Von einem zum anderen ist sie gelaufen, Verzweiflung im Herzen, und nur von dem einen Wunsch getrieben: Ich muß Inka wiederfinden. – Aber man hat sie nicht gefunden.
Teilnahmslos, wie ausgebrannt, wurde sie mit den anderen fortgetrieben. Das Leben hörte nicht auf, es ging weiter, auch ohne Inka, so sehr ihr Herz auch nach dem Kinde schrie. Inka war tot. Daran war nicht mehr zu zweifeln. Alles, was sie später auf die Beine gestellt hatte, verlief im Sand. Von Inka fand sich keine Spur mehr.
Die Erinnerung hat sie überwältigt. Langsam rinnt eine Träne über ihre Wange. Wendhoff bemerkt dieses lautlose Weinen, und er spürt, daß sein Herz noch nicht ganz verhärtet gegen das Schicksal anderer ist.
»Sie scheinen Hilfe nötiger zu haben als ich«, sagt er teilnehmend.
»Verzeihen Sie, ich benehme mich kindisch.« Sie strafft sich und zieht ihren eleganten Mantel fröstelnd über der Brust zusammen. Er hat längst das kostbare Abendkleid mit dem tiefen Ausschnitt bemerkt, das zarte weiße Haut und einen schönen Brustansatz freigibt. Er ist irritiert. Wie lange ist es her, daß er einer schönen Frau gegenübersaß und sie ihn wie ihresgleichen behandelte, ihn – den arbeitslosen Mann ohne Zukunft.
Wie lange ist es her, daß er eine Frau im Arme hielt und weiche Hände sein Gesicht streichelten und weiße Arme sich um seinen Hals schlangen?
Eine Ewigkeit – und er selbst kommt sich uralt vor.
»Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen?«
Langsam dreht er ihr den Kopf zu. »Bitte!«
»Kommen Sie mit zu mir. Eine Tasse Mokka wird uns beiden guttun, und Ruhe. Hier sind zuviel Menschen.«
Unschlüssig blickt er sie an. Er spürt, das ist kein verlockendes Angebot, das ihm eine gelangweilte Frau macht. Ihre Bitte kommt aus einem verstehenden, mütterlichen Herzen.
»Gern«, sagt er einfach.
*
Gert Wendhoff hat sich bequem in das rote Polster des schweren Wagens gelegt. Er wagt keinen Seitenblick auf die Frau hinter dem Lenkrad. Er sieht nur die schmale Hand, jetzt von feinstem Leder umspannt, wie sie ruhig und sicher den Wagen durch den rege gewordenen Verkehr lenkt.
Merkwürdig! sinnt er, wieviel Spanne ist vergangen, seitdem er in trostloser Stimmung aus dem Zug stieg? Jetzt sitzt er neben einer schönen Frau und fährt mit ihr in ein fremdes Haus.
Leonore Breitenstein! Schöner Name! Leonore!
Er paßt zu der Trägerin genau wie das dezente Parfüm, das aus ihrer Kleidung strömt und ihn umschwebt.
Sie haben die Innenstadt verlassen und passieren eine breite, baumumstandenen Straße, fahren vorbei an blühenden, gepflegten Gärten. Manchmal huscht eine helle Fassade eines der schönen neuen Häuser vorbei. Und dann sieht er, als er den Blick nach links wendet, die Elbe.
In Blankenese ändert sie die Fahrtrichtung. Das Blinklicht am Wagen flammt auf. Als der Gegenverkehr eine Minute stockt, steuert sie in ein geöffnetes Tor. Langsam rollt der Wagen an der Seite eines der Häuser vorbei, das in seiner modernen Bauart sein berufliches Interesse erweckt.
»Da wären wir«, sagt Leonore Breitenstein, und ehe er noch helfend beispringen kann, hat sie sich schon aus dem Wagen geschwungen und geht auf den Eingang zu. Eine geräumige Halle mit sehr viel Blumen und einem eingebauten Kamin tut sich vor ihm auf. Sein schönheitsdurstiges Auge nimmt jede Einzelheit wahr.
Sie beobachtet ihn stumm. Sein Gesichtsausdruck sagt ihr mehr als alle Worte.
Als im Hintergrund eine ältliche Frau in weißer Schürze auftaucht, nimmt sie ihm den Koffer aus der Hand. »Hier, Doris, bringen Sie den Koffer in das Gästezimmer mit dem Blick auf die Elbe.«
»Jawohl, gnädige Frau!«
Nach einem kurzen, abtastenden Blick auf den abwartend dastehenden Gert Wendhoff geht sie über die gewundene Treppe in das Obergeschoß.
»Meine Haushälterin«, stellt Leonore die auf der Galerie verschwundene Frau vor. »Sie ist ein treuer, zuverlässiger Mensch und wird auch Sie gern bemuttern.«
Verständnislos blickt er sie an. »Wollen Sie damit sagen, daß ich hierbleiben soll?«
»Natürlich!« Sie lacht leise auf. Es ist ein warmes, einnehmendes Lachen. »Glauben Sie, ich würde Sie wieder davonlaufen lassen? Kommen Sie, Herr Wendhoff, nicht wahr, so war doch Ihr Name?«
»Gewiß«, beeilt er sich, ihr zu versichern. »Wollen Sie meine Papiere sehen?«
Röte schlägt ihr bis unter das
dunkle Haar. »Später mal. Ich glaube auch so an Sie.«
Sie geht in die Garderobe, und er folgt ihr, hilft ihr aus dem Mantel und hängt seinen Trenchcoat daneben.
»Jetzt lassen wir uns einen Mokka kochen«, wendet sie sich freundlich an ihn, bemerkt seinen bewundernden Blick, der ihrer schlanken Gestalt im eleganten Abendkleid gilt. »Entschuldigen Sie, ich ziehe mich rasch um. Wenn Sie sich etwas frisch machen wollen?«
»Sehr gern, wenn es möglich wäre?«
»Kommen Sie, bitte.«
Neben ihr steigt er die teppichbelegte Treppe empor. Auf dem Gang zur Linken öffnet sie eine Tür. »Hier ist das Badezimmer. Sie finden alles, was Sie im Augenblick brauchen.« Ein Lächeln geht über ihr schönes, schmales Gesicht. »Allerdings, einen Rasierapparat finden Sie nicht. Ich bin auf Herrenbesuche nicht eingerichtet.«
Also gibt es keinen Mann in ihrem Leben. Er empfindet bei dem Gedanken Freude.
Nach zehn Minuten steht er wieder in der Halle.
Aus einem der Sessel erhebt sich Leonore und geht ihm lächelnd entgegen. Sie hat sich blitzschnell umgezogen und nur ihr Gesicht zurechtgemacht.
Sie trägt einen weitschwingenden Rock und einen hellen Pullover. Sie sieht jung und erfrischt aus, und ihr Lächeln erwärmt ihn noch mehr für sie.
»Den Kaffee trinken wir im Wintergarten. Kommen Sie«, fordert die ihn auf, und sie empfindet es angenehm, daß er ihr an dem wie hergezauberten Frühstückstisch den Sessel zurechtrückt und ihr ein Kissen hinter den Rücken schiebt. »Danke schön.«
Wie ein altes Ehepaar – denkt sie, und die Situation beginnt ihr Freude zu machen, als sie sich gegenübersitzen. Mit aller Aufmerksamkeit bedient sie ihn, daß es ihm zunächst zumute ist, als sei ihm der Hals wie zugeschnürt. Auf ihre Aufmunterung hin greift er zu dem knusprigen Brötchen. Er ißt langsam und bedächtig, als wolle er diese frühe Morgenstunde von Herzen genießen.
»Darf man wissen, welche Pläne Sie für die Zukunft haben«, erkundigt sie sich behutsam, als ihre Zigaretten brennen.
»Zukunft?« Er dehnt das Wort in seinem Munde. »Gibt es für mich eine Zukunft?«
»Natürlich! Warum so bitter? Sie sind jung, gesund…«
»… und habe mein Studium nicht zu Ende bringen können. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich könnte höchstens auf dem Bau als Maurer arbeiten.«
»Also haben Sie mit dem Baugewerbe etwas zu tun?« forscht sie weiter. Sie versteht, warum er sich jedes Wort abkaufen läßt. Es ist die Scham. Dafür hat sie Verständnis.
»Einmal wollte ich Architekt werden.« Das klingt bitter und hoffnungslos.
»Und warum sollten Sie es nicht werden?«
Er lacht rauh auf. »Weil mir ganz einfach das Geld dazu fehlt.«
»Geld?« Sie macht eine wegwerfende Handbewegung. »Was Sie zunächst nötig haben, ist Verständnis und ein gemütliches Zuhause. Geld für Ihr Weiterstudium ist aufzutreiben.«
»Wollen Sie damit sagen, daß Sie mir das Geld beschaffen wollen?« fragt er überrascht.
»Warum nicht?« Sie sieht ihn ernsthaft an, und wie sie es sagt, hört es sich an, als sei es das Selbstverständlichste von der Welt.
Wendhoff kann nicht mehr stillsitzen. Er tritt an das tiefe Fenster heran. Vor ihm senkt sich ein terrassenförmig angelegter Garten bis hinab zum Strom. Breite Stufen führen zu einem schmalen Streifen Strand. Er sieht einen Steg und ein Segelboot. Über dem Wasser der Elbe liegt die Morgensonne. Weithin geht sein Blick.
»Schön wohnen Sie, wunderschön«, sagt er und reißt sich ungern von dem zauberhaften Bild los.
»Wollten wir nicht von Ihnen sprechen?« lenkt sie wieder auf das Thema zurück, das ihn unsicher, ja scheu macht. Oder ist es die Wucht der Erkenntnis: Es gibt noch Menschen, die Anteil an fremdem Leid, an fremden Nöten und Schicksalen nehmen?
»Lassen Sie mir Zeit, Frau Breitenstein. Wenn Sie es gern sehen, will ich gern einige Tage Ihr Gast sein. Weiteres wird sich finden.«
Ihre Augen lassen sein schmales Gesicht nicht los. Langsam sagt sie: »Einverstanden!«
*
Gert Wendhoff weiß jetzt alles von Leonore Breitenstein. Sie selbst hat es ihm erzählt. Aber ist es auch alles? Gibt es nicht tief im Herzenswinkel etwas, was sie vor aller Welt verschließt?
Sie ist nach dem Tode ihres Gatten Breitenstein die Erbin eines alteingesessenen, gutgehenden Juweliergeschäftes geworden. Bei ihm selbst hat sie alles gelernt. Sie kennt alle kostbaren Steine und die dazugehörigen Fassungen. Sie hat sich selbst in Entwürfen versucht, und sie haben Anklang gefunden.
Sie hat auch gutgeschultes Personal. Personal, auf das sie sich in jeder Beziehung verlassen kann. Auch einen Geschäftsführer, einen vornehmen alten Herrn, der wie ein pensionierter Oberst aussieht – oder wie ein Staatsanwalt, mit seinen hellen, durchdringenden Augen.
Er versieht seinen Dienst mit großer Geschicklichkeit und wahrer Hingabe. Manchmal erweckt er mit seinem Arbeitseifer den Anschein, als hätte er dem toten Breitenstein in die Hand versprochen, ein wachsames Auge auf das Geschäft zu halten.
Mit Leonore, der Chefin, verstand er sich ausgezeichnet. Er bewunderte ihren feinentwickelten Geschmack, ihre charmante Art, mit der Kundschaft umzugehen, die nicht immer einfach zu behandeln war, überhaupt ihr großes Interesse, das sie für das Geschäft zeigte und dem sie ihre meiste Zeit opferte.
In letzter Zeit war das etwas anders geworden. Bockwoldt war ein scharfer Beobachter. Er fand sie nervös, manchmal zerstreut, oft tief in Gedanken versunken, und sie benötigte plötzlich mehr Freizeit für sich, ohne sich darüber zu äußern. Während er sonst über alles unterrichtet wurde. Er schätzte ihre Offenheit, mit der sie ihm stets entgegengekommen war.
Und nun war sie plötzlich verschlossen, und er wußte nichts mehr über ihr Privatleben. Mitunter hatte sie ihn auch sonntags zum Essen oder wochentags zum Tee in ihr Haus gebeten. Auch das war ausgeblieben.
Bockwold machte sich schon seine Gedanken. Ob sie verliebt war? Möglich konnte es sein! Sie war eine
auffallend schöne Frau, und keiner sah ihr an, wie alt sie war. Sie gehörte zu dem Typ Frauen, die schwer altern.
Des Rätsels Lösung war sehr einfach. Leonore verbrachte jede freie Minute in Gert Wendhoffs Gesellschaft, der sich gut in ihrem Hause eingelebt hatte. Die Sonne hatte seine Haut gebräunt. Die Augen blitzten jungenhaft und übermütig darin. Er hielt viel auf sein Äußeres. Nichts erinnerte mehr an den vom Schicksal getretenen Mann. Sein Gang war beschwingt. Die gute Kost bekam ihm vorzüglich. Er wurde breiter in den Schultern, und seine Haltung hatte an Selbstbewußtsein gewonnen.
Er war von tiefer Dankbarkeit gegen Leonore erfüllt. Er hätte seine Hände unter ihre Füße breiten mögen. Alles, was er war, verdankte er ihrer Güte.
Stundenlang saß er unter schützendem Sonnenschirm auf der Terrasse des Hauses und arbeitete. Er hatte sein Studium wieder aufgenommen und stürzte sich mit allem Willen in die Arbeit.
Er wollte etwas erreichen. Er wollte der Frau beweisen, daß sie keinem Unwürdigen die Hand gereicht hatte.
Manchmal, wenn er zur kurzen Pause den Kopf hob und den vorbeifahrenden Schiffen nachschaute, kam ihm alles wie ein wunderschöner Traum vor. Das Haus, die Umgebung, die Frau, und nun noch seine Arbeit. Sie hatte bereits Verbindungen aufgenommen.
Ein Klubhaus sollte völlig neu gestaltet werden, und für die Innenarchitektur war ein Preisausschreiben erlassen.
Daran arbeitete er mit Hingabe und Eifer, und Leonore störte ihn dabei nicht. Er würde alles bei seiner Arbeit vergessen, sogar Sommer, Sonne und Freizeit, wenn Leonore ihn nicht mit sanfter Hand lenken würde.
So gelingt es ihr, ihn zu Segelfahrten auf der Elbe zu überreden.