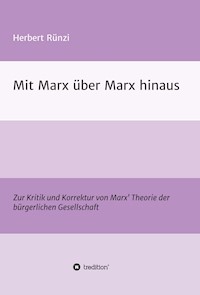
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Arbeit enthält eine betont wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Marx' Theorie der bürgerlichen Gesellschaft bzw. ihrer kapitalistischen Produktionsweise, so wie diese vor allem in den drei Bänden von 'Das Kapital' ausgeführt worden ist. Diese Auseinandersetzung führt einerseits zu dem Ergebnis, dass die meisten Schritte der Marxschen Darstellung sowohl in logischer als auch empirischer Hinsicht als unzulänglich zu kritisieren sind. Das wird in umfassender und detaillierter Weise belegt, was den Hauptteil der vorliegenden Arbeit ausmacht. Andererseits zeigt die Auseinandersetzung, dass sich hinter den expliziten Ausführungen von Marx der Aufbau einer anderen Theorie verbirgt. Diese alternative Theorie, die nicht mehr der Kritik anheim fällt, wird in ihren Grundlinien offengelegt. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie mit dem Wesen beginnt, in dem es um den "Heißhunger nach Mehrarbeit" geht. Dann kommt der Schein, der vom sich selbst verwertenden Kapital beherrscht wird. Danach folgen die Erscheinungen, die vom Streben nach Wohl angetrieben werden. Während sich die Prinzipien des Wesens und des Scheins verwirklichen können, kommt es beim Wohl zu einem Scheitern in dem Sinne, dass die schrankenlose Kapitalakkumulation und damit der Heißhunger nach Mehrarbeit in Gang gesetzt wird. Die alternative Theorie schließt sich damit zu einem großen Kreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1312
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Herbert Rünzi
Mit Marx über Marx hinaus
Zur Kritik und Korrektur von Marx‘ Theorie der bürgerlichen Gesellschaft
© 2019 Herbert Rünzi
1. Auflage 2019
Autor: Herbert Rünzi
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN 978-3-7482-9370-5 (Paperback)
ISBN 978-3-7482-9371-2 (Hardcover)
ISBN 978-3-7482-9372-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort:
I. Zur Ableitung des Werts bei Marx
1. Die sich austauschenden Waren
2. Vom Tauschwert zum gemeinsamen Gehalt
3. Vom gemeinsamen Gehalt zur vergegenständlichten Arbeit
4. Die abstrakt menschliche Arbeit
4.1. Von der Arbeitsprodukteigenschaft zur abstrakt menschlichen Arbeit
4.2. Die drei grundsätzlichen Varianten der abstrakt menschlichen Arbeit
4.3. Das bei Marx überwiegende Verständnis von wertbildender Arbeit
4.4. Zusammenfassende und weiterführende Bemerkungen
5. Die gesellschaftlich notwendige Arbeit
6. Die physiologische Arbeit
7. Das Problem der komplizierten Arbeit
8. Die gesamtgesellschaftliche Dimension gesellschaftlich notwendiger Arbeit
9. Der gesellschaftsspezifische Charakter der wertbildenden Arbeit
10. Bewertung der Marxschen Darstellung
II. Zur Ableitung der Wertform und des Geldes bei Marx
1. Die einfache Wertform
2. Der Tauschwert
3. Der Übergang zur Geldform
4. Die Schwierigkeiten des Austauschprozesses
5. Der in der Ware enthaltene Widerspruch
6. Der falsche Schein der Wertform
7. Marx’ Rede von der Wertgegenständlichkeit
8. Der Wechsel zur Argumentation mit unkoordinierten Marktverhältnissen
9. Zur Ableitung der Wertform in den 'Grundrissen'
10. Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis
11. Zusammenfassende Bemerkungen
III. Der Marxsche Geldbegriff
1. Maß der Werte
2. Zirkulationsmittel
3. Geld
3.1. Schatzbildung
3.2. Zahlungsmittel
3.3. Weltgeld
4. Zusammenfassung
IV. Zur Ableitung der allgemeinen Formel des Kapitals
1. Die Verwandlung von Geld in Kapital
1.1. Das Aufgreifen von G - W - G
1.2. Von G - W - G zu G - W - G’
1.3. Von G - W - G’ zur Bewegung G - W - G’ - W’ - G” - W” - G’”
1.4. Zusammenfassende Bemerkungen
2. Die Ableitung des Kapitals über die Schatzbildung
3. Zur Ableitung des Kapitals in den 'Grundrissen'
4. Die Allgemeinheit der allgemeinen Formel des Kapitals
5. Die verschiedenen Möglichkeiten des Kapitalverständnisses
5.1. Der Übergang zu den die Kapitalbewegungen ausführenden Menschen
5.2. Die mit den vier Übergangsweisen verbundenen vier Theorievarianten
5.3. Kapital auf den Ebenen Wesen, Schein, Erscheinungen und Sein
5.4. Begriffliches Kapital und zweckhaftes Kapital
6. Zusammenfassende Bemerkungen
V. Das Kapital als sich selbst verwertender Wert
VI. Von der allgemeinen Formel des Kapitals zum industriellen Kapital
1. Der Übergang zur Produktion
2. Das industrielle Kapital als Grundform des Kapitals
3. Zusammenfassende Bemerkungen
VII. Der Kauf von Arbeitskraft und Produktionsmitteln
1. Der Kauf der Ware Arbeitskraft
2. Der Kauf von Produktionsmitteln
3. Zusammenfassende Bemerkungen
VIII. Der Wert der Ware Arbeitskraft
1. Die Bestimmung des Werts der Ware Arbeitskraft
2. Die Notwendigkeit des Werts der Ware Arbeitskraft
3. Die Variationen im Wert der Ware Arbeitskraft
4. Die erweiterte Reproduktion der Arbeitskraft
5. Zusammenfassende Bemerkungen
IX. Der sich mit der Warenform der Arbeitskraft verbindende Schein
1. Die Widersprüchlichkeit der Grundform des Kapitals
2. Der Arbeitslohn
3. Zusammenfassung
X. Die Produktion von Mehrwert
1. Der Produktionsprozess
2. Die produktive Arbeit
3. Die Dienste
4. Marx' Auseinandersetzung mit A. Smith
5. Zusammenfassende Bemerkungen
XI. Die Produktion von mehr Mehrwert
1. Der Normalarbeitstag
2. Die Produktion des absoluten Mehrwerts
3. Die Produktion des relativen Mehrwerts
4. Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation
5. Zusammenfassende Bemerkungen
XII. Die Zirkulation des Kapitals
1. Die Zirkulationskosten
2. Der Umschlag des Kapitals
3. Die Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals
4. Zusammenfassende Bemerkungen
XIII. Die Verwandlung des Mehrwerts in Profit
1. Vom Mehrwert zum Profit
2. Die hinter der Verwandlung von Mehrwert in Profit stehende Logik
3. Zusammenfassende Bemerkungen
XIV. Die Verwandlung des Profits in Durchschnittsprofit
1. Die unterschiedlichen Profitraten
2. Vom Profit zum Durchschnittsprofit
3. Das Transformationsproblem
4. Zusammenfassende Bemerkungen
XV. Das kaufmännische Kapital
1. Darstellung der Marxschen Argumentation
2. Zur Logik des Handelskapitals
3. Zusammenfassende Bemerkungen
XVI. Die Verwandlung des Surplusprofits in Grundrente
1. Die Differentialrente I
2. Die Differentialrente II, die absolute Rente und der Bodenpreis
3. Zusammenfassende Bemerkungen
XVII. Das zinstragende Kapital
1. Die Ableitung des zinstragenden Kapitals
2. Zins und Unternehmergewinn
3. Die sonstigen Inhalte des V. Abschnitts
4. Zusammenfassende Bemerkungen
XVIII. Die Revenuen und ihre Quellen
1. Die trinitarische Formel
2. Die Konkurrenz der Subjekte
3. Zusammenfassende Bemerkungen
XIX. Fazit
Endnoten
Literaturverzeichnis
Vorwort:
In der vorliegenden Arbeit geht es um Marx‘ Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Genauer gesprochen ist seine Theorie der kapitalistischen Produktionsweise Thema, die diese Gesellschaft im Kern kennzeichnet. Dabei geht es um Überlegungen, die von Marx insbesondere in den drei Bänden seines Hauptwerks ‚Das Kapital‘ ausgeführt werden, aber auch in anderen Schriften von ihm Vorkommen.
Über 200 Jahre nach der Geburt von Karl Marx und mehr als 150 Jahre nach der Erstveröffentlichung des I. Bandes seines Hauptwerks könnte man meinen, dass in dieser Sache sowohl in affirmativer als auch in kritischer Hinsicht schon längst alles Wesentliche gesagt worden ist. Diese Position, derzufolge nur noch Wiederholungen zu erwarten sind, mag angesichts der verstrichenen Zeit und der Vielzahl der Marx gewidmeten Interpretationen zwar sehr nahe liegen. Nichtsdestoweniger möchte ich mit dem vorliegenden Text beweisen, dass sie trügt. Mit ihm ist nämlich der Anspruch verbunden, Marx‘ theoretische Ausführungen in einer Weise zu behandeln, die nicht nur neu ist, sondern ihnen auch endlich gerecht wird. Das gilt sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht. Denn der folgende Text ist auf der einen Seite dadurch charakterisiert, dass die einzelnen Schritte der Marxschen Darstellung so eingehend kritisiert werden, wie das bislang nicht der Fall war. Auf der anderen Seite wird aus der Marxschen Darstellung all das herausgeholt, was in ihr an richtigen und wichtigen Inhalten enthalten oder auch nur angedeutet ist.
Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine Auseinandersetzung mit Marx‘ Überlegungen zur bürgerlichen Gesellschaft und ihrer kapitalistischen Produktionsweise, die sich auf alle ihre bedeutsamen Teile und damit auf sie als Ganzes bezieht. Von den mir bekannten anderen Rezeptionen des Marxschen Werks unterscheiden sich meine Bemühungen aber nicht nur durch den Umfang der besprochenen Punkte, sondern auch dadurch, dass die einzelnen Argumentationsschritte von Marx viel präziser untersucht werden, als das gemeinhin der Fall ist. Obwohl es gerade dazu eine riesige Literatur gibt, trifft die über das bislang übliche Maß hinausgehende Genauigkeit meiner Auseinandersetzung mit Marx auch auf den Anfang der Marxschen Theorie und damit die Themen Tauschwert, Wert, Wertform und Geld zu.
Bei meiner Besprechung der Marxschen Theorie folge ich grundsätzlich dem Argumentationsgang, der in den drei Bänden von ‚Das Kapital‘ zum Ausdruck kommt. Dort, wo dies bei der Besprechung des I. Bandes geboten ist, werden aber auch Stellen zu Rate gezogen, die in Marx‘ Darstellung später kommen. Bei der Behandlung des III. Bandes kommt es in meinen Ausführungen dagegen zu einer beträchtlichen Umstellung. Denn das zinstragende Kapital, das bei Marx vor der Verwandlung des Surplusprofits in Grundrente kommt, wird von mir deswegen erst danach behandelt, weil die beiden Theorieteile so besser zusammen passen.
Ergebnis meiner Ausführungen ist auf der einen Seite, dass die in den drei Bänden von ‚Das Kapital‘ vorliegende Theorie in vielfältiger Weise unzulänglich und fehlerhaft ist. Das beginnt schon ganz am Anfang mit der Ware, die als Ausgangspunkt für einen direkten Schluss auf den Wert dient. Dieser Schluss ist nämlich nicht nur logisch in dem Sinne mangelhaft, dass es ihm an Notwendigkeit gebricht. Da der Wert nicht das ist, was die Austauschverhältnisse entweder als abstrakte Identität oder in der Form der Negation der Negation direkt begründet, ist er in diesem Zusammenhang auch empirisch falsch. Das bedeutetjedoch nicht, dass der Wert vollkommen unbrauchbar ist. Es kann sich bei ihm vielmehr immer noch um eine Größe handeln, die als indirekter Grund der Preisverhältnisse fungiert und genau deshalb eine Wesenskategorie darstellt. Voraussetzung dabei ist jedoch, dass er als solcher bestimmt und empirisch gegeben ist. Denn ein Grund, der unbestimmt und/oder inexistent ist, ist auch als Wesensgrund für eine überzeugende Begründung von vornherein vollkommen untauglich.
Auf der anderen Seite läuft das genannte Ergebnis aber nicht darauf hinaus, dass die Marxsche Theorie der kapitalistischen Produktionsweise getrost auf den Müllhaufen der Wissenschaftsgeschichte geworfen werden kann. Denn in seiner aktuellen Darstellung verborgen findet sich zumindest ansatzweise eine andere Theorie, die insofern tragfähiger ist, als auf sie die Kritikpunkte nicht mehr anwendbar sind, die gegen erstere vorgebracht werden können. Diese alternative Darstellung zerfällt in die Bereiche Wesen, Schein und Erscheinungen und hat ein Bewusstsein dafür, dass in diesen drei Bereichen aufje unterschiedliche Art und Weise zu argumentieren ist.
Auf der Ebene des Wesens, das aus dem Heißhunger nach Mehrarbeit zu entwickeln ist, geht es deswegen um eine Argumentation per logischer Geltung, weil es sich bei diesem Heißhunger nicht um einen Zweck handelt, der von Menschen bewusst ausgeführt wird, sondern um einen Begriff, der von ihnen nur bewusstlos verwirklicht wird. Im Rahmen dieser Argumentation wird per Wenn-Dann-Folgerungen auf das geschlossen, was es geben muss, wenn es den Heißhunger nach Mehrarbeit gibt. Sofern in dieser Weise auf Menschen geschlossen wird, die bestimmte Aktivitäten vollziehen, werden diese als Charaktermasken angesprochen. Auf dieser Grundlage ist klar, dass damit nur gezeigt wird, dass es diese Aktivitäten geben muss. Dagegen ist noch nicht geklärt, wie die Menschen als freie Subjekte dazu kommen, diese Aktivitäten im Rahmen ihrer bewussten Handlungen mitzuvollziehen. Das ist vielmehr eine Aufgabe, die auf der Ebene des Wesens offen bleiben muss, weil sie erst auf der Ebene der Erscheinungen ausgeführt werden kann. Hier ist es also um den Unterschied zwischen logischer Geltung oder Existenz und teleologischer Genesis oder Entstehung zu tun. Während die erstere zum Bereich des Wesens gehört, fällt die letztere in die Erscheinungen.
Auf der Ebene des Scheins, der sich aus dem Kapital bzw. aus dem in ihm enthaltenen Anspruch ergibt, sich mit möglichst großer Rate als Wert selbst zu verwerten, ist ebenfalls per logischer Geltung zu argumentieren. Denn bei diesem Anspruch, den es zunächst auf der Ebene des Kapitals im Allgemeinen oder des Gesamtkapitals, dann des Kapitals im Besonderen oder des Branchenkapitals und schließlich des Kapitals im Einzelnen oder des Einzelkapitals gibt, handelt es sich ebenfalls um keinen Zweck, sondern um einen Begriff. Der Unterschied zum Wesen besteht auf dieser Grundlage nur darin, dass nicht auf bestimmte menschliche Aktivitäten geschlossen wird, die von Charaktermasken bewusstlos ausgeführt werden, sondern nur auf bestimmte Bedingungen, in denen die Menschen handeln. Das hat zur Folge, dass die logische Geltung oder Existenz insofern auch schon die empirische Existenz beinhaltet, als nicht erst noch zu erklären ist, wie diese Bedingungen in den Handlungen entstehen, die Menschen als freie Subjekte vollziehen.
Auf der Ebene der Erscheinungen, die vom menschlichen Streben nach Wohl aus zu entwickeln sind, ist dagegen nicht per logischer Geltung zu argumentieren. Stattdessen geht es auf ihrer Grundlage deswegen um die Argumentation per teleologischer Genesis, weil es sich bei diesem Streben um einen Zweck handelt, der bewusst ausgeführt wird. Im Rahmen dieser Argumentation wird nicht nur gezeigt, dass es bestimmte menschliche Handlungen geben muss. Vielmehr wird auch dargelegt, wie es zu diesen Handlungen kommt. Es wird also nicht nur auf ihre Existenz geschlossen. Thema ist vielmehr auch schon ihre Entstehung.
Diese Argumentation per teleologischer Genesis unterscheidet sich vom Heißhunger nach Mehrarbeit und vom Anspruch auf Selbstverwertung des Werts zum einen dadurch, dass sich das ihr zugrunde liegende Wohl nicht positiv durchsetzt, sondern aufgrund der Unsicherheit der Marktverhältnisse in dem Sinne scheitert, dass es zur maßlosen Akkumulation von Kapital kommt. Zum anderen füllt sie gerade in dieser Form die Lücke, die wir auf der Ebene des Wesens konstatiert haben. Denn hinter dieser Akkumulation, die ungeachtet dessen bewusst verfolgt wird, dass sie kein ursprünglicher Zweck darstellt, sondern nur ein Zweck, der als Folge der in Erfahrung gebrachten unsicheren Marktverhältnisse im Nachhinein übernommen wird, steht als unbewusster Inhalt das Streben nach immer mehr Mehrarbeit.
Die skizzierte Theorie wird in der vorliegenden Arbeit deswegen nicht in der Form einer in sich notwendigen Ableitung von Grund aus dargestellt, weil es in dieser Arbeit lediglich um die Kritik an der aktuellen Darstellung von Marx geht, in der die alternative Darstellung eben nur angelegt ist. Trotzdem wird sie hier schon erwähnt, weil auf ihrem Hintergrund deutlich wird, dass die meisten Fehler, die in Marx‘ aktueller Darstellung enthalten sind, damit zu tun haben, dass Marx die drei theoretischen Ebenen und die ihnen jeweils angemessenen Argumentationsweisen nicht klar genug auseinander halten kann, sondern mehr oder weniger wild durcheinander wirft. Obwohl es misslich ist, im Vorwort Ergebnisse vorwegzunehmen, die erst im Haupttext zustande kommen, soll das an zwei Beispielen verdeutlicht werden:
Das eine bezieht sich auf den Anfang von Marx‘ Darstellung, in der er ausgehend von den Waren und ihrem Austausch auf den Wert schließt. Bei diesem Vorgehen vermengt er nämlich deswegen Wesen und Erscheinungen, weil der Wert eine Kategorie darstellt, die zum Wesen gehört, und der Warentausch zusammen mit dem Tauschwert ein Phänomen ist, das den Erscheinungen zuzurechnen ist. Ganz abgesehen davon, dass der Schluss von den Waren auf den Wert weder logisch zwingend noch sein Ergebnis empirisch richtig ist, wird der Wert, der als Wesenskategorie kein bewusstes Phänomen darstellt, damit zu einer Größe, die den ihre Waren austauschenden Menschen bekannt sein müsste. Denn nur auf dieser Grundlage wäre verständlich, dass die Menschen die Waren zumindest im Durchschnitt in einem Verhältnis tauschen, das den Werten dieser Waren entspricht.
Das andere Beispiel für die Vermischung zwischen den theoretischen Ebenen ist das Kapital. Bei ihm wird das Wesenjedoch nicht mit den Erscheinungen, sondern eher mit dem Schein vermengt. Das zeigt sich daran, dass es bei Marx zwei Kapitalbegriffe gibt. Der erste stellt einen Wert dar, an den das Streben nach maßlos viel Mehrwert gekoppelt ist. Beim zweiten handelt es sich dagegen um einen Wert, der sich selbst verwerten will. Korrekt ist nur der zweite Begriff, der zum Schein gehört. Verkehrt ist dagegen der erste Begriff, der dem Wesen zuzurechnen ist. Denn das Streben nach maßlos viel Mehrwert, das die Fassung darstellt, in der Marx den Heißhunger nach Mehrarbeit zum Thema macht, darf nicht dem Wert beigelegt werden. Es stellt vielmehr ein Prinzip dar, von dem aus direkt auf die Menschen geschlossen wird, die es verwirklichen. Auf diese Weise kommt man aber zum Wesen der bürgerlichen Gesellschaft und nicht zu ihrem Schein.
Während ich für meine Auseinandersetzung mit Marx beanspruche, alle theoretisch wichtigen Argumentationsschritte zu behandeln, ist bezogen auf die Sekundärliteratur zum einen darauf hinzuweisen, dass ich mich im Wesentlichen auf einige wichtige Vertreter der Autoren beschränke, die sich konkret auf die Marxschen Argumentationen beziehen und nicht nur über sie hinwegreden. Das sind auf der Marx eher affirmativ gegenüberstehenden Seite vor allem Michael Heinrich und Wolfgang Fritz Haug und auf der eher kritischen Seite in der Hauptsache Eugen von Böhm-Bawerk und Joachim Nanninga. Zum anderen besitzt diese Auseinandersetzung einen überwiegend negativen Charakter. Der Grund dafür besteht darin, dass man bei der Kritik, die an den einzelnen Argumentationsschritten von
Marx mit Recht zu üben ist, nur in Ausnahmefällen auf die Sekundärliteratur positiv rekurrieren kann. Denn die allgemeine Regel ist, dass von ihr die einzelnen Schritte von Marx entweder gutgeheißen oder nur auf unzulängliche Weise kritisiert werden. Das ist auch der Grund dafür, dass die Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur vollständig in die Endnoten verbannt wird. Diejenigen, die nur daran interessiert sind, wie Marx zu verstehen ist, können sich ihre Lektüre sparen. Denn die Endnoten tragen nichts zum Verständnis der sich direkt auf Marx beziehenden Überlegungen bei.
Obwohl das, was in der vorliegenden Arbeit ausgeführt wird, natürlich den Anspruch erhebt, aus sich heraus vollkommen einsichtig zu sein, könnte es aufgrund dessen zu Verständnisschwierigkeiten kommen, dass ihre Inhalte in vielfältiger Hinsicht neu und unbekannt sein dürften. Von den Leserinnen und Lesern wird daher verlangt, sich auf Gedanken einzulassen, die ihnen noch nicht vertraut sind. Das gilt gerade auch für diejenigen, die sich schon mit Marx beschäftigt haben. Denn das Aneignen neuer Überlegungen ist bekanntlich noch mühsamer, wenn es mit dem Aufgeben alter Überzeugungen verbunden ist. Es ist daher zu hoffen, dass auch dieses Publikum die erforderliche Bereitschaft mitbringt. Ferner ist darauf zu bauen, dass die Offenheit für Neues ungeachtet dessen aufgebracht wird, dass ich mit dieser Arbeit den Anspruch verbinde, etwas zu sagen zu haben, was wirklich weiterführend und damit auch geeignet ist, die Debatte um Marx auf eine ganz neue Ebene zu heben. Dem einen oder der anderen mag dieser Anspruch zwar vollkommen überzogen Vorkommen. Das allein besagt jedoch noch gar nichts. Dass er unhaltbar ist, kann vielmehr nur dadurch gezeigt werden, dass man sich inhaltlich auf meine Argumentationen einlässt und auf dieser Basis in der Lage ist darzulegen, dass sie Ausführungen enthalten, die unzulänglich sind. Eine solche innerliche Kritik wäre mir sehr willkommen.
Das ist nicht zuletzt deswegen der Fall, weil ich bezogen auf die unterschiedlichen Varianten der Interpretation von Marx‘ Theorie, die es nun einmal gibt, auch dem Eindruck entgegentreten will, dass auch dann keine von ihnen in der Lage wäre, die andere zu überzeugen, wenn die Debatten zwischen ihnen entgegen dem gegenwärtigen Anschein nicht mehr und mehr aufgegeben, sondern bis in alle Ewigkeit fortgeführt würden. Dieser Eindruck mag zwar bezogen auf die bisherigen Interpretationsvarianten richtig sein, von denen keine in der Lage ist, die anderen eines Besseren zu belehren. Das gilt aber nicht für die vorliegende Arbeit. Denn in ihr werden Argumente vorgebracht, die nach meiner festen Überzeugung das Potential haben, viele der bislang ergebnislos geführten Debatten einer Lösung zuzuführen.
I. Zur Ableitung des Werts bei Marx
„Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine „ungeheure Warensammlung“, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware.“ (I, 49)1
Wie diese Aussage zeigt, mit der der I. Band von ‚Das Kapital' beginnt, fängt Marx bei seiner theoretischen Erklärung der „Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht“, mit der „Analyse der Ware“ an. Er begründet das mit dem Hinweis, dass diese Gesellschaften durch eine „ungeheure Warensammlung“ gekennzeichnet sind und die „einzelne Ware“ deren „Elementarform“ darstellt. Obwohl nicht nur dem zugestimmt werden muss, dass es sich bei der „ungeheuren Warensammlung“ um eine empirische Tatsache oder einen Bestandteil unserer Erfahrungen handelt, sondern auch davon ausgegangen werden kann, dass wir es bei unseren gegenwärtigen Gesellschaften immer noch mit Gesellschaften zu tun haben, die durch die „kapitalistische Produktionsweise“ gekennzeichnet sind, kann Marx’ Hinweis auf die gegebene Warenfülle natürlich nicht als notwendige Begründung für seinen Ausgangspunkt verstanden werden. Denn es ist nicht einzusehen, warum mit dem begonnen werden muss, was massenweise vorkommt.i Da es die genannte Tatsache gibt, soll dieser Ausgangspunkt im Folgenden trotzdem akzeptiert werden. Dazu müssen wir schon deshalb bereit sein, weiljeder Anfang nur im Nachhinein dadurch zu begründen ist, dass aus ihm eine überzeugende Theorie entwickelt werden kann. Es wäre daher falsch, wenn man eine vorgängige Begründung verlangen würde.ii
1. Die sich austauschenden Waren
Die einzelne Ware bestimmt Marx zunächst als "Gebrauchswert oder Gut". (I, 50) Sie ist damit "ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt". (I, 49)
Wenn wir uns zunächst dem zuwenden, dass Marx die einzelne Ware als „ein äußerer Gegenstand, ein Ding“ bestimmt, ist angesichts dessen, dass wir aus unseren Erfahrungen auch ungegenständliche Waren in der Form der Dienstleistungen kennen, zu bemerken, dass er nicht mit der Ware als solcher, sondern genauer nur mit der gegenständlichen Ware beginnt.iii Dieser Umstand, der auch dadurch belegt wird, dass von den „Warenkörpern“ (u. a. S. I, 52, 59 und 62) gesprochen wird, hat zwar zur Folge, dass wir keine unmittelbare Aufklärung über die ungegenständlichen Waren erwarten dürfen. Aber auch dieser Umstand berechtigt noch nicht zu einer Kritik des Marxschen Ausgangspunktes. Denn die Tatsache, dass Marx die ungegenständlichen Waren nicht von Beginn an in seine Überlegungen einbezieht, schließt zum einen nicht aus, dass das richtig ist, was er über die gegenständlichen Waren zu sagen hat. Zum anderen kann es durchaus sein, dass die ungegenständlichen Waren später auf Basis der Verhältnisse eingeholt werden können, die sich aus den gegenständlichen Waren ergeben. Das würde zeigen, dass zu Beginn nur die gegenständlichen Waren zum Thema zu machen sind, weil diese zu den grundlegenden Verhältnissen gehören, aus denen die ungegenständlichen Waren erklärt werden können.2
Wenn wir nun dazu übergehen, dass Marx den „äußeren Gegenstand“ oder das „Ding“ deswegen als „Gebrauchswert“ bestimmt, weil es „durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt", dann kann dem ohne Zweifel zugestimmt werden. Denn der Gebrauchswert stellt mit Sicherheit eine Eigenschaft der gegenständlichen Waren dar, die wir aufgrund unserer Erfahrungen kennen. Gleichfalls kann befürwortet werden, dass Marx die Feststellung trifft:
„Der Gebrauchswert verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Konsumtion.“ (I, 50)
Denn der Gebrauchswert stellt als bloße Brauchbarkeit anfangs in der Tat nur eine Anlage oder Möglichkeit dar. Oder er ist zunächst nur eine Bestimmung, die sich erst noch verwirklichen muss.
Wenn Marx vom „Gebrauch oder der Konsumtion“ spricht, könnte man zum anderen meinen, dass er nur die gegenständlichen Waren zum Thema macht, die Konsumtionsmittel darstellen, und die ebenfalls vorkommenden Produktions- und Zirkulationsmittel daher nicht in seine Betrachtung einbezieht. Deshalb sei darauf hingewiesen, dass das für die Produktionsmittel nicht zutrifft. Denn bezogen auf den Gebrauchswert schreibt Marx:
„Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfnis befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d. h. Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.“ (I, 49)
Mit den gegenständlichen Gebrauchsmitteln bezieht sich Marx daher neben den Konsumtionsmitteln auch auf die Produktionsmittel. Folge davon ist, dass unter dem „Gebrauch“ oder der „Konsumtion“ ein Vorgang zu verstehen ist, in dem nicht nur die Konsumtionsmittel, sondern auch die der Produktionsmittel ihrer Verwendung zugeführt werden. Der Unterschied besteht nur darin, dass wir es bei den Produktionsmitteln mit produktiver Konsumtion zu tun bekommen. Demgegenüber stellt sich die Konsumtion der Konsumtionsmittel als konsumtive Konsumtion dar.
Daran, dass Marx in die Gebrauchswerte neben den Konsumtionsmitteln auch die Produktionsmittel einbezieht, ändert im Übrigen auch der Umstand nichts, das erstere im Vordergrund stehen. Das zeigt zumindest seine Rede von der „einfachen Warenzirkulation“ (I, 162), als die wir die Bewegung W - G - W kennen lernen werden. Denn es gibt gewisse Hinweise darauf, dass es Marx in ihrem Rahmen vor allem um die Beschaffung von Konsumtionsmitteln geht. (vgl. S. 227)
Man könnte der Auffassung sein, dass das, was für die Produktionsmittel gilt, auch auf die Zirkulationsmittel mit dem Unterschied zutrifft, dass diese im Rahmen der zirkulativen Konsumtion verbraucht werden. Deswegen sei darauf hingewiesen, dass dieser Eindruck trügt. Obwohl Marx in diesem Zusammenhang (vgl. S. 438) nicht vollkommen klar ist, kann nämlich davon ausgegangen werden, dass er die gegenständlichen Zirkulationsmittel deshalb außenvor lässt, weil diese gesamtgesellschaftlich gesehen faux frais darstellen. (vgl. S. 436) Als solche haben sie nämlich eine theoretisch nachgeordnete Bedeutung und gehören damit gerade nicht zum Umkreis der wesentlichen oder grundlegenden Verhältnisse, auf die es Marx offensichtlich abgesehen hat.iv
Auf das in der gerade präzisierten Art zu verstehende Moment des Gebrauchswerts geht Marx wohl deshalb nicht weiter ein, weil es seiner Ansicht nach allen Gesellschaftsformen zukommt (vgl. I, 50); er aber nur die Gesellschaften behandeln will, "in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht." Gerade weil der Gebrauchswert auch in den von Marx betrachteten „bürgerlichen Verhältnissen“ (19, 360) oder in den Verhältnissen der "bürgerlichen Ökonomie" (ZK, 7) eine Rolle spielt, ist dies allein zwar noch kein Grund, ihn nicht genauer zu untersuchen. Hier soll dieser Punkt jedoch hingenommen werden, weil es durchaus sein kann, dass der Gebrauchswert keiner eingehenderen Betrachtung bedarf.3
Wichtiger als die erste Eigenschaft ist bei Marx das zweite Bestimmungsmoment der gegenständlichen Ware, auf das er mit der folgenden auf die Gebrauchswerte bezogenen Feststellung zu sprechen kommt:
„In der von uns betrachteten Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des-Tauschwerts." (I, 50)
Es umfasst den „Tauschwert“ und ist somit die Eigenschaft, die den Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand überhaupt erst zur Ware macht. Denn der Terminus „Tauschwert“ kann genauso als Tauschgegenstand oder Tauschmittel übersetzt werden wie die Bezeichnung Gebrauchswert als Gebrauchsgegenstand oder Gebrauchsmittel.v
Wie das angeführte Zitat zeigt, führt Marx die Bestimmung des Tauschwerts auf etwas eigenartige Weise ein, wenn er davon redet, dass die Gebrauchswerte der Waren seine „stofflichen Träger“ sind. Weil das Getragenwerden auf etwas zu verweisen scheint, was seinem Träger nicht selbst oder nicht innerlich zukommt, sondern ihm eher äußerlich verliehen wird, könnte man den Eindruck bekommen, dass der Tauschwert dem als Ware auftretendem Ding weniger oder anders zukommt als der Gebrauchswert. Genauer gesprochen könnte man meinen, dass der Gebrauchswert zwar eine gegenständliche Eigenschaft dieses Dings darstellt, es sich beim Tauschwert aber nur um eine ungegenständliche Eigenschaft handelt, die nur das Bezogensein der einzelnen Dings auf etwas Anderes zum Inhalt hat.vi Es sei deshalb geprüft, was davon zu halten ist.
In diesem Zusammenhang ist zunächst auf Folgendes zu verweisen: Zum einen kann festgehalten werden, dass der Tauschwert mit dem Gebrauchswert das Merkmal teilt, dass er zunächst ebenfalls nur eine Anlage, Möglichkeit oder Bestimmung darstellt. Wie der Gebrauchswert ist er daher etwas, was sich erst noch verwirklichen muss. Während der Gebrauchswert sich im Gebrauch verwirklicht, realisiert sich der Tauschwert im Tausch, der wie der Gebrauch erst noch zu erfolgen hat. Zum anderen stellt nicht nur der Tauschwert eine Bestimmung dar, die nicht den Dingen als solchen zukommt, sondern den Menschen zu verdanken ist. Dieses Merkmal kommt vielmehr auch dem Gebrauchswert zu. Denn dieser ist den Dingen, die als Waren auftreten, gleichfalls nicht von Natur aus eigen, sondern nur deshalb, weil die Menschen ihnen diese Bedeutung zuschreiben. Das zeigt sich z. B. daran, dass die stoffliche Eigenschaft der Härte als solche einen Diamanten noch nicht zu einem Gebrauchswert macht, sondern erst der Umstand, dass diese Härte für die Menschen nützlich ist.vii
Auf diesem Hintergrund könnte das stoffliche Ding, das als Ware auftritt, genauso als Träger des Gebrauchswerts bezeichnet werden, wie Marx bezogen auf den Gebrauchswert vom Träger des Tauschwerts spricht. Daher besteht der Unterschied nur darin, dass der Gebrauchswert in einer direkten Beziehung zu den für ihn maßgeblichen stofflichen Eigenschaften des jeweiligen Dings steht und der Tauschwert nicht. Folge davon ist, dass zwar der Gebrauchswert etwas ist, was dem Ding angesehen werden kann. Der Tauschwert stellt dagegen etwas dar, was ihm oder seinen stofflichen Eigenschaften gerade nicht entnommen werden kann. Angesichts dieses Unterschieds zwischen dem Gebrauchswertsein und dem Tauschwertsein desjeweiligen als Ware auftretenden Dings, kann nun auf der einen Seite festgestellt werden, dass er belegt, dass zwar der Gebrauchswert eine gegenständliche Eigenschaft der einzelnen Ware darstellt, aber der Tauschwert nur als eine ungegenständliche Eigenschaft charakterisiert werden kann. Auf der anderen Seite ist darauf hinzuweisen, dass das nicht ausschließt, dass der Tauschwert doch etwas darstellt, was in der Stofflichkeit des Dings so direkt verankert ist, wie das beim Gebrauchswert der Fall ist. Und daran ändert der Umstand nichts, dass man der als Anker dienenden gegenständlichen Eigenschaft als solcher nicht ansehen kann, dass sie als Grund des Tauschwerts fungiert. Darauf ist hier hinzuweisen, weil sich zeigen wird, dass Marx genau auf eine solche Verankerung des Tauschwerts aus ist.viii
Der Gebrauchswert ist eine menschliche Bestimmung, die den dafür geeigneten Dingen in allen gesellschaftlichen Verhältnissen zugeordnet wird. Der Tauschwert ist demgegenüber eine zusätzliche menschliche Bestimmung, die dem Gebrauchswert nur in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen beigelegt wird. Aus diesem Umstand kann aber gleichfalls nicht geschlossen werden, dass innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft der Tauschwert den Waren in dem Sinne nur als eine ungegenständliche Eigenschaft der einzelnen Ware zukommt, dass auch nicht von einer Verankerung gesprochen werden kann. Es kann vielmehr bei der Marxschen Position bleiben, dass der Tauschwert innerhalb dieser Gesellschaft zwar nur eine ungegenständliche Eigenschaft darstellt, diese aber eine direkte Beziehung zur Stofflichkeit der einzelnen Ware aufweist. Und daran ändert der Umstand nichts, dass diese Verankerung eines Nachweises bedarf, der erst noch zu erbringen ist.
Daran, dass Marx in Bezug auf den Tauschwert auf eine ungegenständliche Eigenschaft aus ist, die aber in einer gegenständlichen Eigenschaft des Warendings verankert ist, ändert im Übrigen auch die folgende Stelle nichts, auf die wir auf der Seite 125 noch genauer eingehen werden:
"Wenn es im Eingang dieses Kapitels in der gang und gäben Manier hieß: Die Ware ist Gebrauchswert und Tauschwert, so war dies, genau gesprochen, falsch. Die Ware ist Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand und „Wert“." (I, 75)
Zu ihr ist zunächst zu sagen, dass sie zurückzuweisen wäre, wenn mit ihr behauptet werden sollte, dass die Bezeichnung Tauschwert auf die einzelne Ware insgesamt nicht angewendet werden kann. Trotz des Umstandes, dass das eine Bestimmung darstellt, die dem Gebrauchsgegenstand äußerlich ist, kann die einzelne Ware nämlich ganz selbstverständlich als Tauschwert charakterisiert werden. Ausgeschlossen ist in diesem Zusammenhang nur, dass von einer gegenständlichen Eigenschaft gesprochen wird, die dem einzelnen Warending als solchem entnommen werden kann. Denn beim Tauschwert handelt es sich um eine ungegenständliche Eigenschaft, die ihrem Träger nicht angesehen werden kann. Wenn die obige Stelle in dieser Weise zu verstehen ist, widerspricht sie den obigen Ausführungen nicht. Im Gegenteil bestätigt sie, dass der Tauschwert zwar eine ungegenständliche Eigenschaft darstellt, die aber auf der gegenständlichen Eigenschaft beruht, die Marx hier mit der Bezeichnung „Wert“ anspricht.ix
Die Eigenschaften, die am einzelnen Ding ohne Verweis auf Anderes zum Ausdruck kommen, kann man als innere oder auch als absolute Eigenschaften bezeichnen. Dagegen können die Eigenschaften, die am einzelnen Ding als solchem nicht zum Ausdruck kommen, äußere oder relative Eigenschaften genannt werden. Gegen diese Wortwahl ist so lange nichts einzuwenden, so lange klar bleibt, dass auch die äußeren oder relativen Eigenschaften in gegenständlichen Eigenschaften des einzelnen Dings verankert sein können. Widerspruch wärejedoch zu erheben, wenn man die äußeren oder relativen Eigenschaften als ungegenständliche Eigenschaften verstehen würde, die überhaupt keinen Bezug zur Stofflichkeit der jeweiligen Sache ausweisen, sondern sich nur dem äußeren Verhältnis verdanken, in dem sich diese Sache befindet.x
Wenn man die eingangs zitierte Stelle liest, entsteht der Eindruck, dass Marx die von ihm zum Thema gemachte Ware in der Form anspricht, in der wir sie als Bewohner der bürgerlichen Gesellschaft unmittelbar oder von uns aus wahrnehmen. Mit anderen Worten scheint er sie als Erfahrungstatbestand aus dem unmittelbaren Sein aufzugreifen. Auf dieser Grundlage kann zwar dem ersten Bestimmungsmoment der Ware voll und ganz zugestimmt werden. Dem zweiten Bestimmungsmoment ist jedoch zu widersprechen. Während der Gebrauchswert der Waren etwas ist, was in empirischer Hinsicht eindeutig bestätigt wird, ist das beim Tauschwert anders. Denn den direkten und damit auch wechselseitigen Tausch zwischen Ware und Ware, auf den sich Marx mit seiner Rede vom Tauschwert augenscheinlich bezieht, gibt es nicht. Die einzelnen Exemplare der empirischen Waren werden nämlich nicht gegen fremde Ware getauscht, sondern für fremdes Geld verkauft. Daher läge es näher, nicht vom Tauschwert, sondern vom Verkaufswert zu reden.xi
Angesichts dieser Situation gibt es drei Möglichkeiten: Zum einen kann man am empirischen Ausgangspunkt festhalten und versuchen, die Marxschen Ausführungen auf dieser Grundlage zu verstehen. Zum anderen kann man bezogen auf den Warentausch entweder zu dem Schluss kommen, dass Marx mit etwas beginnt, was es zwar in der Gegenwart nicht mehr gibt, aber in der Vergangenheit gegeben hat. Oder man zieht zum dritten die Konsequenz, dass Marx einen Ausgangspunkt wählt, der nicht nur nicht in der Gegenwart vorkommt, sondern den es auch der Vergangenheit nicht gegeben hat und der deshalb etwas Nicht-Empirisches und damit so etwas wie ein Modell darstellt, das es nur in der Theorie oder nur in unseren Gedanken oder Vorstellungen gibt.
Aufgrund dieser drei Varianten stellt sich die Frage, welcher Weg zu gehen ist. Bei ihrer Beantwortung kann darauf hingewiesen werden, dass die dritte Möglichkeit aufjeden Fall zu verwerfen ist. Der Grund dafür besteht darin, dass ein nichtempirischer Ausgangspunkt nichts zur Erklärung der gegebenen Wirklichkeit beitragen kann. Dass das in empirisch beschreibender Hinsicht so ist, dürfte unmittelbar einleuchten. Denn ich gebe das, was ist oder existiert, nicht wieder, wenn ich mit etwas beginne, was nicht existiert. Anders sieht es in theoretisch begründender Hinsicht aus. Denn man kann sich nicht nur vorstellen, dass man ausgehend von einem nicht-empirischen Ausgangspunkt per logischer Argumentation zwingende Schlüsse auf eine Gegebenheit ziehen kann, die es empirisch gibt, sondern darüber hinaus auch der Meinung sein, dass man auf diese Weise nachweisen kann, dass ersterer Grund und letztere Folge ist. Daher sei darauf hingewiesen, dass dieser Eindruck verkehrt ist. Ausgehend von einem nicht-empirischen Ausgangspunkt A kann man mittels einer rein logischen Wenn-Dann-Folgerung eine empirische Gegebenheit B nämlich auch dann nicht begründen, wenn die kausale Logik selbst absolut überzeugend sein sollte. Auch die zwingendste Logik ist nämlich nicht in der Lage, den Übergang vom Nicht-Sein zum Sein auf überzeugende Weise zu bewerkstelligen. Da die Logik von einem göttlichen Schöpfungsakt zu unterscheiden ist, kann mit ihrer Hilfe die Gegebenheit B nämlich nur dann aus dem Ausgangspunkt A abgeleitet werden, wenn nicht nur sie, sondern auch dieser Ausgangspunkt empirisch existiert.xii
Auszuscheiden ist aber auch die zweite Möglichkeit. In empirisch beschreibender Hinsicht dürfte das ganz klar sein. Denn, wenn ich eine Feststellung über das treffe, was nicht mehr ist, mache ich keine Aussage über das, was ist. Dafür spricht aber auch die begründende Seite. Das ist nicht nur der Fall, weil die historische Erklärung, um die es hier geht, im Unterschied zur logischen Begründung keine Notwendigkeit im eigentlichen Sinne kennt. Das ist vor allem so, weil mit einer historischen Argumentation dann, wenn sie empirisch richtig ist, zwar erklärt werden kann, wie etwas entstanden ist. Es kann aber nicht erklärt werden, warum es dieses Entstandene trotz des Umstandes immer noch gibt, dass sein historischer Grund längst vergangen ist. Die gegenwärtige Existenz kann folglich nicht mit einem vergangenen Grund begründet werden. Dazu ist gerade dann, wenn alles ständig in Bewegung ist, nur ein gegenwärtiger Grund in der Lage.xiii Wir finden daher bestätigt, dass auch die zweite Variante ausgeschieden werden kann und deshalb nur noch der erste Weg in Frage kommt.xiv
Allerdings scheint auch er nicht aussichtsreich zu sein. Denn aus ihm scheint sich nur ergeben zu können, dass der Marxsche Tauschwert als empirisch inexistent zurückzuweisen ist. Schaut man genauer hin, zeigt sich jedoch, dass dieser Eindruck trügt. Zwar ist richtig, dass der Marxsche Ausgangspunkt nicht dem unmittelbaren Sein bzw. dem Sein in der Form entspricht, in der wir es als in der bürgerlichen Gesellschaft lebende Subjekte unmittelbar oder von uns aus wahrnehmen. Denn wir haben es nicht mit dem Tausch, sondern nur mit dem Verkauf und Kauf zu tun. Da Verkauf und Kauf auf den Tausch einer Ware mit anderer Ware hinauslaufen, befindet sich der Marxsche Ausgangspunkt aber in Übereinstimmung mit dem, was man deswegen als mittelbares Sein bezeichnen kann, weil die bürgerlichen Subjekte es nicht von sich aus oder unmittelbar in Erfahrung bringen, sondern es auf der Basis dessen, dass man sie darauf aufmerksam machen muss, nur mittelbar wahrnehmen. Dieses mittelbare oder zu vermittelnde Sein genügt aber, um den Marxschen Anfang mit dem Tauschwert empirisch zu belegen.xv
Dieser sich eigentlich indirekt vollziehende Warentausch ist aber nicht wechselseitig, sondern nur einseitig. Daher ist Marx’ Beginn in empirischer Hinsicht nur akzeptabel, wenn er lediglich vom einseitigen Tausch spricht. Beim ersten Lesen der Marxschen Ausführungen könnte man der Meinung sein, dass das gerade nicht der Fall ist und er den wechselseitigen Tausch mit der Folge behandelt, dass die empirische Kritik doch noch greift. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass in den uns hier interessierenden Seiten vom wechselseitigen Tausch nur an einer Stelle klar gesprochen wird, in der davon die Rede ist, dass die Waren „gegeneinander ausgetauscht werden“. (I, 54) Zumal es sich dabei um die Aussage eines unbekannten Autors handelt, die von Marx nur in der Anmerkung 9 zitiert wird, ist es durchaus möglich, ihn so zu verstehen, dass es ihm nur um den einseitigen Warentausch geht.4 Und das ist in empirischer Hinsicht nicht zu beanstanden.xvi
Aus den obigen Überlegungen ergibt sich, dass nur der zuletzt behandelte erste Weg von wissenschaftlicher Bedeutung ist, der mit einer logischen Art und Weise der Begründung einhergeht. Da diese Überlegungen unsere Überlegungen sind und unklar ist, in welchem Ausmaß sie von Marx geteilt werden, können wir uns im Folgenden trotzdem nicht auf den diesen Weg beschränken, sondern müssen auch die anderen Argumentationsmöglichkeiten im Blick behalten. Das gilt zum einen für die zuerst behandelte dritte Möglichkeit, die mit der ersten die logische Art und Weise der Argumentation teilt und insofern sowieso vorkommt. Das gilt zum anderen für die an zweiter Stelle behandelte zweite Variante, die vom vergangenen wechselseitigen Tausch ausgeht und deswegen mit einer historischen Argumentation verbunden ist.
"Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen, ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwert scheint daher etwas Zufälliges und rein Relatives, ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto. Betrachten wir die Sache näher." (I, 50/51)
Wenn man diese Stelle liest, findet man einesteils bestätigt, dass Marx’ Rede vom Tauschwert tatsächlich im Zusammenhang mit der Rede vom Tausch zwischen Waren steht. Andernteils ist darauf aufmerksam zu machen, dass Marx im obigen Zitat nicht nur vom Tausch zwischen Ware und Ware spricht, sondern zudem zum Ausdruck bringt, dass die Waren "sich austauschen". Zu diesem eher formalen reflexiven Aspekt, der aus den Waren „Subjekte“ (vgl. 19, 358) macht, ist zu sagen, dass er im empirischen Sinne dann eindeutig zurückgewiesen werden müsste, wenn er als Aussage über das uns vorliegende Sein wörtlich gemeint sein sollte. Denn im Rahmen der in diesem Sein vorhandenen Gegebenheiten sind die Waren keine Dinge, die sich selbst bewegen können, sondern lediglich Sachen, die von Menschen in Bewegung gesetzt werden. Und das gilt nicht nur im Hinblick auf das unmittelbare Sein, in dem es eine Umsetzung von Ware in Geld und von Geld in Ware gibt, sondern auch bezogen auf das mittelbare Sein, bei dem es um die direkte Umsetzung von einer Ware in andere Ware zu tun ist.5
Weil das negative empirische Urteil über die subjekthaften Waren so eindeutig ist und es Marx schlechterdings nicht unbekannt geblieben sein kann, dass die Waren sich nicht selbst bewegen, sondern nur von Menschen auf den Markt geworfen werden können, stellt sich die Frage, ob seine Rede von den sich tauschenden Waren wirklich wörtlich verstanden werden muss. Um sie zu beantworten, sei auf die folgende Stelle vorgegriffen:
"Die Waren können nicht selbst zu Markte gehn und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehn, den Warenbesitzern. Die Waren sind Dinge und daher widerstandslos gegen den Menschen. Wenn sie nicht willig, kann er Gewalt brauchen, in andren Worten, sie nehmen. Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehn, müssen die Warenbesitzer sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, so daß der eine nur mit dem Willen des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensaktes sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigne veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- und Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, daß die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten." (I, 99/100)
Dieses Zitat, dessen juristische Aspekte hier nicht interessieren, bestätigt einesteils, dass Marx natürlich weiß, dass der Austauschprozess nicht von den Waren selbst, sondern nur von Menschen vollzogen werden kann. Andernteils fasst er diese Menschen in einer eigentümlichen Form. Er beschreibt sie nämlich als bloße "Repräsentanten von Ware" oder allgemeiner gesprochen als "Charaktermasken", deren Kennzeichen darin besteht, dass ihre Subjektivität auf die Ausführung eines vorgegebenen Zwecks und ihre Persönlichkeit auf "die Personifikation der ökonomischen Verhältnisse" beschränkt ist. Weil ihre Aktivitäten lediglich die Verwirklichung vorausgesetzter Inhalte umfassen, sind die Menschen nur als Funktionsträger und Ausführungsorgane gefasst. Als solche handeln sie deswegen bewusstlos, weil einem Inhalte, die man ausführt, ohne sie sich selbst zum Zweck gesetzt zu haben, eben unbewusst sind. Marx geht also nur so weit, die Versubjektivierung der Ware durch die Verwarelichung des Subjekts oder allgemeiner und vielleicht verständlicher ausgedrückt die "Personifikation der Sache" durch die "Versachlichung der Personen" (I, 128) zu ersetzen.
Auf dieser Grundlage kann die Rede von den sich tauschenden Waren als Abkürzung für die Rede von den Waren verstanden werden, die von Menschen ausgetauscht werden, die dabei als Charaktermasken auftreten. Damit erübrigt sich auf der einen Seite die empirische Kritik, die an den sich selbst tauschenden Waren ansetzt. Auf der anderen Seite könnte man aber der Meinung sein, dass die Rede von den verwarelichten Subjekten oder Charaktermasken zum Anlass für eine neuerliche empirische Kritik genommen werden muss. Dabei könnte man sich zum einen darauf beziehen, dass die Menschen Subjekte sind, die sich die Inhalte, die sie ausführen, mit der Folge als subjektive Zwecke selbst geben, dass sie sie bewusst ausführen. Zum anderen könnte man daraus schlussfolgern, dass es falsch ist, die Menschen als Charaktermasken darzustellen, die auf die Ausführung von Inhalten beschränkt sind, die ihnen einesteils vorgegeben sind und deswegen nicht als subjektive Zwecke, sondern nur als objektive Zwecke bezeichnet werden können, und die sie andernteils nicht bewusst, sondern als objektive Zwecke nur unbewusst ausführen.
Zu dieser empirischen Kritik ist einerseits zu sagen, dass ihr voll und ganz Recht zu geben wäre, wenn vom unmittelbaren Sein gesprochen würde. Die Transaktionen des Verkaufs und Kaufs der Waren, die es auf seiner Grundlage gibt, stellen nämlich tatsächlich subjektive Zwecke dar, die die menschlichen Subjekte sich selbst gegeben haben und die sie daher auch mit Bewusstsein ausführen. Daher wäre es falsch, in diesem Zusammenhang von Charaktermasken und damit objektiven Zwecken zu reden und auf diese Weise zu suggerieren, die Menschen würden sie nur unbewusst realisieren. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass hier von Verkauf und Kauf und damit vom unmittelbaren Sein gar nicht die Rede ist, sondern eben nur vom einseitigen Warentausch und damit vom mittelbaren Sein. Weil der Tausch dem mittelbaren Sein angehört, ist er kein subjektiver und bewusst ausgeführter Zweck. Er wird vielmehr von den Menschen im Rahmen des Verkaufs und Kaufs von Waren eher unbewusst mitvollzogen.6 Daher ist es nicht falsch, sondern im Gegenteil gerade empirisch angemessen, in diesem Zusammenhang nicht von Subjekten, sondern von der Versachlichung der Personen oder von Charaktermasken zu sprechen.xvii
Zum einen könnten die obigen Ausführungen gerade deswegen als läppisch oder als bloße Spitzfindigkeiten ohne praktische Relevanz abgetan werden, weil die Differenz zwischen dem unmittelbaren und dem mittelbaren Sein und damit zwischen der Ebene der subjektiven Zwecke, Subjekte und bewussten Handlungen und der der objektiven Zwecke, Charaktermasken und unbewussten Vollzüge im vorliegenden Zusammenhang nicht sehr groß ist. Der Unterschied liegt nämlich lediglich darin, dass ein Inhalt, der auf der Ebene der Subjekte nur mittelbar verfolgt wird, auf der Ebene der Charaktermasken als unmittelbares Ziel fungiert. Wir haben es daher nur mit einem formalen Unterschied zu tun, der auf der Basis dessen, dass es auf beiden Ebenen um den gleichen Endzweck geht, zu keinerlei inhaltlichen Konsequenzen führt.
Daher sei darauf hingewiesen, dass die aufeinander folgenden Verkaufs- und Kaufzwecke zwar leicht in das Ziel des einseitigen Warentauschs mit der Folge übersetzt werden können, dass auch das letztere mit Bewusstsein vollzogen werden und deshalb gleichfalls eine Art subjektiver Zweck darstellen kann. Trotzdem bleibt es bei der grundsätzlichen Differenz zwischen den beiden Ebenen. Im Übrigen sei schon an dieser Stelle angemerkt, dass wir im Folgenden Verhältnisse kennen lernen werden, bei denen die Rede von Charaktermasken nicht mehr so folgenlos bleibt, sondern mit einer Relativierung der Menschen als Subjekte einhergeht. Während bezogen auf den Fall des Warentauschs aufgrund des rein formellen Unterschieds zwischen einem mittelbar und unmittelbar verfolgten Inhalt nicht gesagt werden kann, dass das Charaktermaskesein das Subjektsein einschränkt, kann im Hinblick auf diese Verhältnisse festgestellt werden, dass es genau zu einer solchen Einschränkung kommt. (vgl. S. 257 und 343)
Zum anderen könnte darauf aufmerksam gemacht werden, dass zur obigen Interpretation dessen, was unter Charaktermaske zu verstehen ist, die Rede von "Willensverhältnissen" nicht passt, die im obigen Zitat ebenfalls enthalten ist. Diesem Einwand, der darauf beruht, dass man nur dort vom Willen reden sollte, wo subjektive Zwecke vorliegen und damit Inhalte gegeben sind, die mit Bewusstsein ausgeführt werden, ist vollkommen Recht zu geben. Gerade weil er nicht von den Verhältnissen sprechen will, mit denen die Menschen als Subjekte konfrontiert sind, sondern nur von denen, die sie lediglich als Charaktermasken betreffen, hätte Marx besser daran getan, den Hinweis auf die „Willensverhältnisse“ zu unterlassen. Denn der Wille kommt genauso nur den Subjekten zu wie das Bewusstsein. Dieser Punkt ist m. E.jedoch weit davon entfernt, zu belegen, dass Marx anders von Charaktermasken spricht, als oben erläutert. Die Rede von den „Willensverhältnissen“ dürfte sich nämlich vor allem den hier noch nicht interessierendenjuristischen Aspekten verdanken, die ohne Willen nicht denkbar sind und deswegen erst auf einer Ebene behandelt werden können, auf der die Menschen nicht mehr als Charaktermasken, sondern nur noch als Subjekte agieren.xviii
Wenn wir nun zu dem Fazit kommen, das aus den obigen Ausführungen zu ziehen ist, können wir festhalten, dass Marx die Ware und ihren Umschlag dann, wenn er vom Warentausch redet und damit vom Geld absieht, zwar nicht in der Form aufgreift, in der wir ihn als Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft unmittelbar wahrnehmen. Der Umstand, dass Marx nicht vom unmittelbaren Sein, sondern nur vom mittelbaren oder zu vermittelnden Sein redet, ändert aber nichts daran, dass sein Anfang empirisch weder in eher inhaltlicher noch in eher formaler Hinsicht zu beanstanden ist. Gerade weil er den Warentausch nicht in der unmittelbar erfahrenen geldvermittelten Form zum Thema macht, sondern das Geld aus seiner Betrachtung ausschließt, kann er nicht von Subjekten, sondern muss er von bloßen Charaktermasken reden. Aus diesem Grund ist klar, dass wir uns im Folgenden, auf die Marxsche Ebene nicht nur deswegen einzulassen haben, weil wir seiner weiteren Argumentation nur unter dieser Bedingung innerlich werden können. Diesen Schritt müssen wir auch deshalb vollziehen, weil wir keinen empirischen Grund haben, uns der Ebene zu verweigern, auf der Marx argumentiert.xix
Weil das im Folgenden wichtig werden wird, sei hier zum einen noch darauf hingewiesen, dass sich mit dem Unterschied zwischen den Subjekten und den Charaktermasken zwei unterschiedliche Argumentationstypen verbinden. Während mit den Subjekten, die subjektive Zwecke bewusst ausführen, die Argumentation per teleologischer Genesis liiert ist, bekommen wir es bei den Charaktermasken, die objektive Zwecke bewusstlos verwirklichen, mit der Argumentation per logischer Geltung zu tun. Während man im Rahmen der teleologischen Genesis ausgehend vom subjektiven Zweck und damit auf subjektivistische Art nicht nur auf die Existenz der ihn ausführenden Aktion schließen kann, sondern auch auf ihre Entstehung, haben wir es im Rahmen der logischen Geltung nur mit ihrer Existenz zu tun. Auf der Basis dieser Argumentation kann man ausgehend vom objektiven Zweck per Wenn-Dann-Folgerungen auf objektivistische Weise nämlich nur darauf schließen, dass es die ihn ausführende Handlung im Rahmen des mittelbaren Seins geben muss. Damit ist aber noch nicht gesagt, wie diese Aktion im Rahmen des unmittelbaren Seins zustande kommt, in dem die Menschen nicht als Charaktermasken, sondern als Subjekte auftreten, die bewusst handeln. Diese Erklärung, die die Vermittlung des mittelbaren Seins mit dem unmittelbaren Sein zum Inhalt hat, stellt vielmehr eine zusätzliche Aufgabe dar, die neben der logischen Geltung zu lösen ist.xx
Im nächsten Kapitel (vgl. S. 129ff. und S. 150ff.) wird sich zeigen, dass Marx deswegen so ungewöhnlich begonnen und das Geld ausgeblendet hat, weil er dieses Geld ableiten will.xxi Im Hinblick darauf sei zum zweiten noch bemerkt, dass der genannte Unterschied zwischen der teleologischen Genesis und der logischen Geltung sich nicht nur auf die den subjektiven oder objektiven Zweck ausführende Handlung bezieht, sondern auch auf die Dinge, die in ihrem Rahmen erforderlich sind. Auf dieser Grundlage macht es einen Unterschied, ob das Geld im Rahmen einer Argumentation per logischer Geltung oder per teleologischer Genesis als erforderlich aufgezeigt und in diesem Sinne abgeleitet wird. Während wir im letzten Fall gesagt bekommen, wie es im Rahmen von bewussten menschlichen Handlungen entsteht, bleibt der Entstehungsprozess im ersten Fall nämlich außenvor.
Zum dritten sei gerade auf Basis der auf der Seite 18 erwähnten zweiten Verständnismöglichkeit darauf hingewiesen, dass die teleologische Genesis nicht mit der historischen Erklärung verwechselt werden darf. Während diese die historische Entwicklung hin zu einem bestimmten Zustand nachzeichnet und es damit mit der äußeren Geschichte zu schaffen hat, hat es jene mit dem zu tun, was man innere Geschichte nennen kann. In ihr geht es auch bezogen auf die Entstehung des Geldes nicht um vergangene, sondern nur um gegenwärtige Gründe.
2. Vom Tauschwert zum gemeinsamen Gehalt
Auf das oben auf der Seite 20 angeführte Zitat sind wir bislang nur insofern eingegangen, als Marx in ihm von „sich“ austauschenden Waren spricht. Bislang unbeachtet blieb dagegen, dass er auch zum Ausdruck bringt, dass der Tauschwert zunächst als das „quantitative Verhältnis“ oder die „Proportion“ erscheint, „worin sich Gebrauchswerte einer Art mit Gebrauchswerten anderer Art tauschen“. Auf diese Feststellung ist einzugehen, weil sie nicht nur ausschließt, dass es sich beim Tauschwert um eine gegenständliche Ware handelt. Unabhängig davon, ob diese auf einer gegenständlichen Eigenschaft beruht oder nicht, scheint sie nämlich auch nicht zu einer ungegenständlichen Eigenschaft zu passen. Denn es macht keinen Sinn, ein Verhältnis, von dem die einzelne Ware nur Teil ist, dieser Ware als Eigenschaft zuzuordnen.xxii Das wäre nämlich genauso falsch, wie wenn man das aus Mann und Frau bestehende Verhältnis der Ehe z. B. dem Mann zuordnen und sagen würde, der Mann hat die Eigenschaft der Ehe.
Aus diesem Grund kann man hier den Eindruck bekommen, dass das oben befürwortete Verständnis des Tauschwerts, das ihn zu einer ungegenständlichen Eigenschaft macht, die auf stofflichen Verankerungen beruht, an der Sache vorbei geht. Denn bei Marx scheint der Tauschwert weder eine gegenständliche noch eine ungegenständliche Eigenschaft zu sein. Stattdessen scheint er hier in einer dritten Bedeutung von ihm zu reden, die darauf hinausläuft, dass es sich bei ihm um nichts Anderes, als das quantitative Verhältnis zwischen den Waren geht, die sich einseitig austauschen. Wenn wir uns diesem Eindruck zuwenden, kann zwar zugestanden werden, dass Marx im obigen Zitat tatsächlich von einem Tauschwert spricht, der als Verhältnis gerade nicht als Tauschwert einer Ware angesprochen und in diesem Sinne den einzelnen Waren als gegenständliche oder ungegenständliche Eigenschaft zugeordnet werden kann. Dieser Redeweise bedient sich Marx aber nur an dieser Stelle. Sie stellt daher eine Ausnahme dar, was sich daran zeigt, dass Marx gleich wieder zur Rede vom Tauschwert der einzelnen Ware übergeht, die als solche nicht das Tauschwertverhältnis, sondern nur eine Tauschwerteigenschaft meinen kann.xxiii
Auf dieser Grundlage können wir es nicht nur bei unserem obigen Verständnis des Tauschwerts als ungegenständliche Eigenschaft der einzelnen Waren belassen. Vielmehr können wir weiterhin davon ausgehen, dass es bei Marx um eine ungegenständliche Eigenschaft zu tun ist, die trotz ihrer Ungegenständlichkeit in der Stofflichkeit der Waren verankert ist. Dass wir damit richtig liegen, zeigt sich schon daran, dass Marx den Eindruck, beim Tauschwert handele es sich um etwas „rein Relatives“, das als solches jede stoffliche Verankerung ausschließt, als Schein bezeichnet. Ferner wird das daran deutlich, dass Marx sich im Zuge seiner Rede vom „innerlichen, immanenten Tauschwert“ daran macht, den bislang noch offenen Bezug zur Stofflichkeit nachzuweisen und damit zu belegen, dass wir es beim Tauschwert ungeachtet dessen mit einer zwar ungegenständlichen, aber in der Gegenständlichkeit verankerten Eigenschaft zu tun haben, dass er sich erst noch verwirklichen muss und darüber hinaus eine relative Eigenschaft darstellt, die als solche dem einzelnen Gegenstand nicht angesehen werden kann.xxiv
Im Übrigen sei auf Folgendes hingewiesen: Wenn der Tauschwert eine Relation darstellen und unter dieser Relation der noch nicht verwirklichte Tauschwertausdruck verstanden würde, dann gäbe es ihn nur während der kürzeren oder längeren Zeit, in der sich der Tauschwert der einen Ware lediglich ausdrückt, ohne sich als solcher schon zu verwirklichen. Sobald die Verwirklichung dieses Ausdrucks erfolgt wäre, würde der Tauschwert verschwinden. Denn die Relation, mit der er sich deckt, gäbe es nicht mehr. Wenn der Tauschwert dagegen die Relation darstellen würde, die mit dem Vollzug des Tausches zusammenfällt, dann wäre er eine verschwindende Existenz, die es nur einen logischen Augenblick lang und damit gar nicht wirklich geben würde. Denn vor dem Tausch wäre er noch nicht und nach dem Tausch nicht mehr vorhanden. Wenn der Tauschwert demgegenüber eine gegenständliche oder ungegenständliche Eigenschaft der einen Ware darstellt, die in Gestalt der anderen Ware zum Ausdruck kommt, dann ist das anders. Dann ist der Vollzug des Tausches nicht das Verschwinden, sondern das Verwirklichen des Tauschwerts, was im Fall der gegenständlichen Eigenschaft mit der Realisierung der schon vorhandenen Möglichkeit oder Anlage und im Falle der ungegenständlichen Eigenschaft mit dem Entstehen von etwas vollkommen Neuem einhergeht. Beides macht auch dann einen Unterschied, wenn die andere eingetauschte Ware nur noch als Gebrauchswert von Interesse sein sollte. Es gibt hier also eine Differenz zwischen einem bloßen Verschwinden und einem Verwirklichen. Wenn der Tauschwert eine Relation darstellt, dann verschwindet er auf die eine oder andere Art mit dem Tausch. Wenn er eine Eigenschaft der einzelnen Ware darstellt, dann wird er im Tausch auf die eine oder andere Weise verwirklicht.xxv
Marx redet in dem hier thematisierten Zitat aber nicht nur in Bezug auf die Wahrnehmung vom Schein, der Tauschwert sei etwas „rein Relatives“. Auf der Basis dessen, dass das Austauschverhältnis zwischen den Waren „beständig mit Zeit und Ort wechselt“, bezeichnet er vielmehr auch den Eindruck als Schein, der Tauschwert sei etwas „Zufälliges“, das als solches nicht erklärt werden kann. Damit gibt er schon zu erkennen, dass er sich mit der mit der Zufälligkeit einhergehenden Unerklärbarkeit der Tauschverhältnisse nicht zufrieden geben, sondern auf etwas hinaus will, was er zunächst als "innerlicher, immanenter Tauschwert" bezeichnet. Da dieser Tauschwert nicht nur nicht rein relativ, sondern auch nicht zufällig sein soll, zielt er damit nämlich auf etwas ab, was in der Lage ist, das Tauschverhältnis zu begründen.xxvi Betrachten deshalb auch wir die Sache näher:
"Eine gewisse Ware, ein Quarter Weizen z. B., tauscht sich mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold usw., kurz mit anderen Waren in den verschiedensten Proportionen. Mannigfache Tauschwerte also hat der Weizen statt eines einzigen. Aber da x Stiefelwichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold usw. der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seide, z Gold usw. durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte sein." (I, 51)
Hier wird es interessant, beginnt Marx doch mit seinen Folgerungen. Prüfen wir deshalb seine Argumentation mit einiger Ausführlichkeit. Weil sich ein Quarter Weizen „mit x Stiefelwichse oder mit y Seide oder mit z Gold“ austauscht, wird im ersten Satz „kurz“ gesagt, er tausche sich "mit andern Waren in den verschiedensten Proportionen", und im zweiten Satz daraus gefolgert, er habe nicht nur einen, sondern "mannigfache Tauschwerte". Dazu ist zunächst zu sagen, dass dem unter der Bedingung, dass vom verwirklichten Tauschwert gesprochen wird, nur zugestimmt werden kann, wenn es um mehrere Quarter Weizen geht. Wenn dagegen nur von einem Quarter Weizen gesprochen wird, kann es die Mannigfaltigkeit nur auf der Ebene der bloßen Austauschbarkeit geben. Denn einundderselbe Quarter Weizen kann sich immer nur mit einer anderen Ware tatsächlich austauschen.
Unabhängig von diesen beiden Möglichkeiten ist desweiteren darauf hinzuweisen, dass der Rede von den „mannigfachen Tauschwerten“ nur unter der Voraussetzung beigepflichtet werden kann, dass damit eine Aussage über die Ware Weizen gemacht wird. Viele verschiedene Tauschwerte zu haben, ist tatsächlich eine ihrer Eigenschaften. Sie kommt der Ware Weizen zu, sofern sie sich wirklich mit vielen verschiedenen anderen Waren austauscht bzw. als austauschbar erklärt.
Auf dieser Grundlage fällt auf, dass Marx im obigen Zitat von der Stiefelwichse, der Seide und dem Gold als Tauschwerten des Weizens nur redet, um fortfahrend zu erklären, sie seien deswegen „durch einander ersetzbare oder einander gleich große Tauschwerte", weil sie alle „Tauschwert von einem Quarter Weizen“ sind. Wenn wir uns zunächst der inhaltlichen Aussage zuwenden, die in dieser Folgerung enthalten ist, kann zum einen festgehalten werden, dass die größenmäßige Gleichheit offensichtlich als genauere Bestimmung der Ersetzbarkeit zu verstehen ist und nicht als Alternative zu ihr. Zum anderen bleibt vollkommen unklar, worin diese Gleichheit und Ersetzbarkeit besteht. In welchem Sinne ist x Stiefelwichse als Tauschwert des Quarter Weizens durch y Seide oder z Gold "ersetzbar", wo sich die Stiefelwichse von der Seide mindestens so sehr unterscheidet wie die Seide vom Gold? In welchem Sinne kann von den Tauschwerten des Weizens gesagt werden, sie seien "einander gleich groß", wo doch die quantitative Bestimmtheit der Stiefelwichse "x", der Seide "y" und des Goldes "z" ist und diese Größen sich zudem auf unterschiedliche Maßeinheiten beziehen? Da nicht abzusehen ist, inwiefern die unterschiedlichen Tauschwerte miteinander verglichen werden können, kann auf diese Frage keine bestimmte Antwort gegeben werden. Daher können wir festhalten, dass die in Rede stehende Gleichheit hier noch vollkommen unbestimmt und leer ist.
Dem könnte entgegengehalten werden, dass man zwar zu keinem bestimmten Inhalt der Gleichheit kommt, wenn man die Gebrauchswerte der dem Weizen gegenüber stehenden Waren als solche betrachtet, es aber anders aussieht, wenn man den Nutzen ins Auge fasst, den diese unterschiedlichen Gebrauchswerte dem Weizenbesitzer liefern. Man könnte nämlich der Auffassung sein, dass der Weizenbesitzer seinen Weizen mit den anderen Waren deshalb in denjeweiligen Proportionen als austauschbar erklärt, weil die jeweils eingetauschten Warenmengen ihm den gleichen Nutzen bringen. Wenn wir uns deshalb dieser Verständnisvariante zuwenden, die die gesuchte Gleichheit in der Menge des subjektiven Nutzens findet, kann zunächst darauf hingewiesen werden, dass sie als Interpretation schon deshalb fehlgeht, weil Marx nicht auf eine solche rein subjektive Gleichheit abzielt, sondern es – wie wir noch in diesem Abschnitt genauer sehen werden – auf eine Gleichheit objektiverer Art abgesehen hat, die nichts mit dem Gebrauchswert und dem Nutzen zu tun hat.
Wenn wir in Form einer Zwischenbemerkung die genannte These trotzdem als solche betrachten, ist entgegen dem ersten Eindruck zwar zuzugestehen, dass sie insofern die an eine Erklärung gebundenen Bedingungen erfüllt, als der genannte Grund unabhängig von seiner angeblichen Folge bestimmbar ist. Das ist nämlich trotz des Umstandes der Fall, dass der Grund nur im rein subjektiven Empfinden des einzelnen Subjekts liegt, das es so nur im Hier und Jetzt gibt und das als solches nicht von anderen Subjekten festgestellt werden kann. Mit diesem Empfinden kann aber nur der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Tauschverhältnissen erklärt werden. Es kann genauer gesagt nur gezeigt werden, dass der Quarter Weizen dann, wenn er gerade mit x Stiefelwichse austauschbar ist, auch mit y Seide und z Gold ausgetauscht werden kann. Es kann aber nicht erklärt werden, warum er gerade mit x Stiefelwichse austauschbar ist. Denn zu diesem Zweck müsste der Nutzen des Quarters Weizen mit dem von x Stiefelwichse verglichen werden, was aber deshalb nicht möglich ist, weil der Weizen für den Weizenbesitzer gar keinen Gebrauchswert hat.
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die genannte Erklärung logisch gesehen zwar grundsätzlich möglich, aber empirisch unzutreffend ist. Das hat zwei Seiten: Zum einen ist das der Fall, weil es hier ja nicht nur um Tauschverhältnisse geht, die lediglich für das einzelne Subjekt gelten, sondern um Tauschverhältnisse von allgemeinerer Bedeutung. Und von diesen Tauschverhältnissen ist von vornherein klar, dass sie nicht dadurch erklärbar sind, dass sie dem einzelnen Warenbesitzer denselben Nutzen bringen. Dafür können vielmehr nur Gründe verantwortlich sein, die über die Vorlieben des einzelnen Subjekts hinausgehen. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, dass der Nutzen, den ein bestimmter Gebrauchswert dem einzelnen Subjekt bietet, außerordentlich volatil ist und sich sozusagen von Augenblick zu Augenblick verändert. Wenn die relativen Tauschverhältnisse sich aus diesem Nutzen erklären würden, müssten sie genauso volatil sein. Obwohl die empirischen Tauschverhältnisse durchaus veränderlich sind, sind sie aber eindeutig nicht so veränderlich, wie sie sein müssten, wenn sie durch den einzelnen Nutzen erklärbar wären. Aus diesen Gründen kann mit dem subjektiven Nutzen für das einzelne Subjekt nicht der Zusammenhang zwischen den einzelnen Tauschrelationen erklärt werden, sondern allenfalls der Umstand, dass man bei gegebenen Tauschrelationen den einen Tausch dem anderen zu einem bestimmten Zeitpunkt deswegen vorzieht, weil er einem mehr Nutzen bringt.7





























