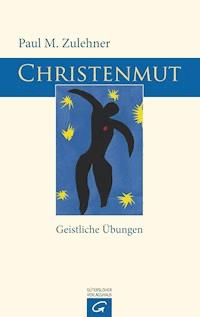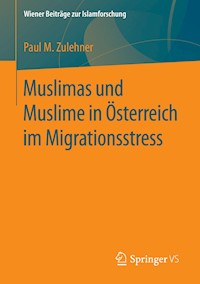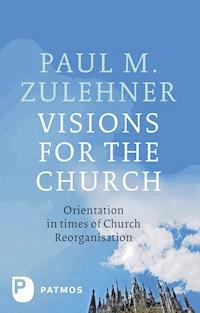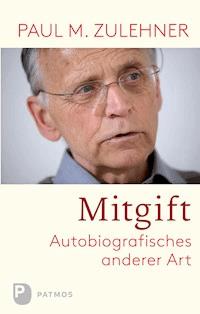
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Paul M. Zulehner bedenkt in seiner Autobiografie der etwas anderen Art spirituell und theologisch das, was er freudig erlebt und dunkel erlitten hat. Seine Lebensgeschichte erscheint als roter Faden, an dem sich bedeutende gesellschaftliche wie kirchliche Themen der letzten Jahrzehnte entlangreihen. So wird seine Biografie zu einem Spiegel, in dem sich kirchlich und theologisch Engagierte wiederfinden und die jüngere Kirchengeschichte in einem manchmal überraschenden Licht betrachten können. Paul M. Zulehner gehört zu den bekanntesten Theologen Europas, der keine Angst vor der Wahrheit hat, wenn es um die Situation und Zukunft der Kirche geht. Doch ist seine Kritik immer konstruktiv und geprägt von einer großen Loyalität. Das macht ihn zu einem inspirierenden Vordenker und geschätzten Gesprächspartner.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über den Autor
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Paul M. Zulehner
Mitgift
Autobiografisches anderer Art
Patmos Verlag
Inhalt
Ouvertüre
Mitgift
Mit Gift
Eine Autobiografie anderer Art
Arbeiten und Lieben
1. Satz: Presto Arbeiten
»Er führte mich hinaus ins Weite« (Psalm 18,20)
Weltbürger
Beijing
Die Lektion chinesischer Studierender
Katholisch: nicht konfessionell, sondern universell
Licht und Salz
Praxis-Erweiterung
Orpheus und Eurydike
Wurzeln
Fromme liebevolle Eltern
Kohlstatt
Familiärer Solidaritätstrainer
Anregende Vielfalt
Musikalische Ader
Singen und Denken
Gymnasialzeit
Lehrmeister
Innsbruck
CCEE
Carlo M. Martini, Basil Hume, Miloslav Vlk
Franz Kamphaus
Pastorale Lehrjahre
Altmannsdorf
Neuausrichtung
Das Passauer Pastoralbiotop
Beirat der deutschsprachigen PastoraltheologInnen
Zurück nach Wien
Diözesansynode Rottenburg-Stuttgart
An der Universität Wien
Anfrage Roms zur Frauenordination
Frauen in die Bildungskongregation
Antrittsbesuch bei Kardinal König
Pastorales Forum
Universitätsreformen
Biblische Bilder als Inspiration meiner Pastoraltheologie
Lebe!
Erbarmen
Leibhaftig glauben
Medienarbeit
Brigitte Schwaiger
2. Satz: Menuett Lieben
Gott lieben – meine spirituelle Lebensreise
Benedikt und Ignatius
Bin ich nicht Volk?
Spirituell in den Tag
Mein Lieblingspsalm
Menschen lieben
Priester werden
Unbeschwerte Kindheit
Männerfreundschaften
Frauenfreundschaften
Aufarbeitung
Wandlungen der Priesterliebe
Kinder
3. Satz: Lento Wofür ich stehe und einstehe
Orientierungen für den Kirchenumbau
1. Verbuntung
2. Umbau der Kirchengestalt
3. Belonging before believing
4. Vision der Jesusbewegung
5. Wie Jesu Vision in einer Kultur wächst
6. Visionsarme Strukturen sichern nicht die Zukunft
7. Jede und jeder trägt eine Vision in sich
8. Die Last des Amtes in den Kirchen: Spurtreue sichern
9. Neuer Wein, nicht nur neue Schläuche
10. Abmilderung von ererbten Irritationen
11. Auf die Gratifikationen kommt es an
12. Von der Moral zur Mystik
13. Je mystischer desto politischer. Und umgekehrt.
14. Abendmahl und Fusswaschung
15. Das eucharistische Herz der Kirchen
16. Nicht Dienstleistungsbetrieb, sondern eine Gemeinschaft, die Dienste leistet
17. Eine arme Kirche für die Armen
18. The Great Chain of Being
19. Universell, nicht konfessionell: also wirklich katholisch
20. Erbarmen als gemeinsamer Nenner
21. The Mission of the Christian Churches
Respekt vor dem Reichtum an Lebensformen
Institution – Person
Pluralisierung
Coda: Die Unvollendete
Fragment
Reinkarnation oder Fegfeuer
Lebenslauf
Anmerkungen
Du siehst, ich will viel. Vielleicht will ich Alles: das Dunkel jedes unendlichen Falles und jedes Steigens lichtzitterndes Spiel.
Es leben so viele und wollen nichts, und sind durch ihres leichten Gerichts glatte Gefühle gefürstet.
Aber du freust dich jedes Gesichts, das dient und dürstet.
Du freust dich Aller, die dich gebrauchen wie ein Gerät.
Noch bist du nicht kalt, und es ist nicht zu spät, in deine werdenden Tiefen zu tauchen, wo sich das Leben ruhig verrät.
Rainer Maria Rilke
Ouvertüre
Mitgift
Mitgift – ich kann dieses Wort drehen, wie ich will: Es bleibt schillernd. Als Brautgabe besitzt es Wohlklang. Es lässt an Hochzeiten des Lebens denken. Oder an das von Jesus offerierte himmlische Hochzeitsmahl. Es weckt Gefühle von überraschendem und unverdientem Beschenktsein. Als würde unerwartet ein Mensch ins Leben treten, den man als immer schon vertraut erkennt. Dieses Gefühl hat für mich eine warme Farbe und einen sanften Ton. Rainer Maria Rilke muss es gekannt haben. Wie hätte er sonst gedichtet:
Du kommst und gehst. Die Türen fallen viel sanfter zu, fast ohne Wehn. Du bist der Leiseste von Allen, die durch die leisen Häuser gehn.
Man kann sich so an dich gewöhnen, dass man nicht aus dem Buche schaut, wenn seine Bilder sich verschönen, von deinem Schatten überblaut; weil dich die Dinge immer tönen, nur einmal leis und einmal laut.
Oft wenn ich dich in Sinnen sehe, verteilt sich deine Allgestalt: du gehst wie lauter lichte Rehe und ich bin dunkel und bin Wald.
Du bist ein Rad, an dem ich stehe: von deinen vielen dunklen Achsen wird immer wieder eine schwer und dreht sich näher zu mir her,
und meine willigen Werke wachsen von Wiederkehr zu Wiederkehr.Rainer Maria Rilke
Mit Gift
Andererseits: Kaum zerlege ich das Wort in zwei Teile, verändern sich Ton und Farbe von Grund auf. »Mit Gift« signalisiert mir dann ganz anderes. Tiere wie Schlangen oder Spinnen kommen mir in den Sinn. Die Atmosphäre kann vergiftet sein, ökologisch wie zwischenmenschlich – etwa nach einer Trennung oder Scheidung. Giftige Vorgänge beschädigen auch in Organisationen, politischen Parteien, Unternehmen, Fakultäten, aber auch christlichen Kirchen das Klima. Wer wie ich jahrzehntelang in einer Kirche gedient hat, kennt solches Kirchen-Gift besser als viele, welche bisweilen die Kirche ätzend von außen kritisieren und dabei gar nicht bemerken, wie sehr sie eigene seelische Nöte der Kirche aufladen.
Ich werde mich freilich hüten, in meinen Erzählungen selbst giftig zu sein und zu vergiften. Obwohl die letzten Jahrzehnte mir wiederholt Anlass gegeben haben, mich über Ereignisse zu »giften«. In der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils erlebte ich einen unglaublichen Aufbruch. Und litt danach unter dessen schleichendem Abbruch. In diesen dunklen Zeiten tröstete mich ein Spruch von Karl Valentin. Mitten in den grausamen Jahren des Nationalsozialismus rief er den Leuten von der Bühne herab zu: »Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist.«
Dieses doch ziemlich ohnmächtige Kirchen-Gefühl hat mich in den letzten Monaten gänzlich verlassen. Der Grund hat einen Namen und ein lateinamerikanisches Gesicht: Franziskus, Bischof von Rom. Ich hätte mir nicht träumen lassen, eine solche Zeit der Kirche in meinem fortgeschrittenen Alter noch einmal zu erleben. Es fühlt sich an, als ob man sich nach Jahren eingewohnter Einsamkeit »unsterblich« in einen Menschen verliebt, der den Lebensweg unvorhergesehen kreuzt.
Eine Autobiografie anderer Art
Ob es Sinn macht, aus meinem Leben zu erzählen und die Geschichte(n) auch noch zu drucken? Dienen Memoiren nicht lediglich der Befriedung eines ungepflegten Narzissmus? Andererseits will ich nicht einfach eine Pflichtautobiografie abliefern, sondern riskiere eine »Autobiografie anderer Art«. In ihr wird mein Leben wie ein Faden sein, der größere gesellschaftliche wie kirchliche Themen zusammenhält. Viele dieser Ereignisse haben mich geprägt, andere wiederum konnte ich selbst in bescheidenen Grenzen mitgestalten. Vieles habe ich freudig erlebt, anderes dunkel durchlitten. Zwischen diesen Polen verlief der ganz normale Wahnsinn des Alltäglichen. Und all das schicke ich mich an zu erzählen und spirituell und theologisch zu bedenken. Ich stehe mit meinen Erfahrungen nicht allein da. Das ist mir in vielen Vorträgen – einmal kam ich in einem Jahr auf fast 160 – , auf zahlreichen Kursen, in langen nikodemischen Nachtgesprächen klar geworden. Es mag also durchaus sein, dass manche im Spiegel meiner spirituell wie theologisch ausgeleuchteten Geschichte sich selbst ein wenig besser verstehen. Schön wäre es für mich, wenn sie dank meiner Erzählungen mit dem, was sie zumal in der Kirche erfreut und was sie erlitten haben, gelassener zurechtkommen.
Ich werde mein Leben vom »Ende« her aufrollen. Ich erzähle zunächst, was mich jetzt bewegt und erst danach, was ich die Jahre hindurch geworden bin. Von dem, was ich heute bin, schaue ich an die Anfänge meines Lebens zurück. Ich versuche zu verstehen, was mir widerfahren ist und was ich damit zu machen trachtete. Ich habe Günter Anders im Ohr, der mahnte zu bedenken: »Ja, was tue ich denn da eigentlich? Ja, was tut man mir denn da eigentlich?«1
Ich will Sie gewinnen, mir nicht nur beim Erzählen wohlwollend zuzuhören, sondern zumal bei den Deutungen skeptisch zu begleiten. Vieles, was mir nahegegangen ist, haben andere anders erlebt. Ich kann nur von meiner Warte aus den langen verschlungenen Weg überblicken. Manches kann ich erklären, vieles wird als unerklärlich stehen bleiben. Während des autobiografischen Erzählens werde ich da und dort innehalten. Dann werde ich mich über das Erlebte »zurück-beugen«, also das Erlebte »re-flektieren«. Das kann ich als Praktischer Theologe einfach nicht lassen. Denn die erlebte Praxis ist eine der besten Erkenntnisquellen.
Wenn ich mein Smartphone einschalte, begrüßt mich der Anfang des von Johann Sebastian Bach so grandios vertonten Chorals »Wer nur den lieben Gott lässt walten«. Dieser spirituelle Text hat mich über viele Jahre begleitet. Seit Jahren habe ich mir angewöhnt, jeden Morgen um sechs Uhr zu meditieren. Jeden Montagmorgen singe ich den Choral als Lied, hoffend dass auch jemand anderer mitsingt, um die anhebende Woche unter sein Motto zu stellen. Dieser Liedtext ist mir behilflich, das viele Unerklärliche, das Helle und Dunkle, in meinem Leben auch dann anzunehmen, wenn ich es nicht begreife. Erst wenn ich auf der anderen Seite des Todesufers angekommen bin, werde ich mein Leben in Gottes Armen und mit seinem Erbarmen erklärt bekommen.
Arbeiten und Lieben
Mir ist es immer dann gut gegangen, wenn meine beiden Lebensbeine gesund waren. Diese sind »Arbeiten und Lieben«2. Beim Lieben berührt mich das Zweckfreie: die Anbetung, die Gottesliebe, die Beziehungen zu anderen Menschen, zur Mitwelt. Beim Arbeiten beschäftigt mich Zweckvolles: Da will ich schöpferisch sein, ein Werk hervorbringen, meine eigene Geschichte schreiben und mich selbst ein Leben lang »erschaffen«. Diese »Selbstverwirklichung« erlebe ich als Gottes große Zumutung. Sie weist mich als Ebenbild des schöpferischen Gottes aus. Wenn sich Lieben und Arbeiten in meinem Leben ergänzen und tragen, dann »geht« es mir buchstäblich gut.
Was aber ist, wenn eines der beiden Lebensbeine lahmt? Wie ginge es mir, wenn ich nicht mehr arbeiten könnte? Was macht es mit mir, wenn eine liebevolle Beziehung zerbricht? Immer wenn solches geschah, ging es mir nicht gut. Es macht mir bis heute zu schaffen, wenn eines der beiden Lebensbeine beeinträchtigt ist. Ich spüre, wie dann das andere überlastet ist und in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ich beginne mein autobiografisches Erzählen mit dem »Arbeiten«. Es bildet nach dieser Ouvertüre den ersten Satz meiner autobiografischen Lebenssinfonie. Dafür entscheide ich mich schon allein deshalb, weil es mir leichter fällt, davon zu berichten. Die Arbeit war und ist zudem mein Lebensschwerpunkt. Manche sagen mir seit meiner Emeritierung: »Jetzt bist du in Pension und hast viel Zeit.« Ich erwidere: »Ich bin nicht in Pension. Ich bekomme eine.« Mich hat meine Arbeit immer fasziniert und gepackt. Ich habe gern gearbeitet und mache das noch immer. Die Emeritierung hat daran nichts geändert. Würde ich sonst dieses Buch schreiben?
Spät oder zu spät habe ich entdeckt, dass ich lange Zeiten meines Lebens hindurch in die Arbeit geflohen war. War für mich Arbeit manchmal Zuflucht, ja Flucht? Gar vor dem Lieben? War ich ein »Liebesflüchter«, ein »Beziehungsmuffel«? Darüber mehr im zweiten Satz der Sinfonie, in dem ich von meinem Lieben erzählen will.
Arbeiten und Lieben im Gleichgewicht zu halten, betrachte ich als eine der hohen Lebenskünste. Mir ist das lange nicht gelungen. Der Weg zur Balance verlief über aufkeimendes Leiden und wachsende Unruhe. Spät in der Nacht, nach einer Heimkehr aus Brixen nach Passau 1980, habe ich ein Gedicht verfasst. Ich fühlte mich damals wie ein Workaholic, der von einer Vortragsreise müde in seiner leeren Wohnung ankam.
die hände ausgestreckt
müde gerädert
dem nachtzug entstiegen
leer die wohnung
niemand der wartet
der körper ermattet
doch das herz auf reisen
es flieht aus der leere
und sucht deine nähe
vergeblich das läuten
keine verbindung
du bist selbst auf reisen
von arbeit gebunden
leer bleibt die wohnung
erschöpft auch der körper
spiegel der seele
herr, sag, wo bist du?
Allerdings verblieb ich nicht beim Klagen. Ich spürte, wie das Erlittene sich zunehmend in Widerstand wandelte. Ich wollte nicht mehr nur »Arbeitssklave« sein. Ich ahnte, dass mein Leben dabei war, in ein »Gelebtwerden« zu kippen. So machte ich mich auf die Suche nach einer besseren Balance zwischen Arbeiten und Lieben.
aufruhr
ich komme heim
auf dem tisch liegt post
ich mache sie auf
und lese bedrängt
bildungswerk bonn
einen vortrag zur buße
fortbildungskurs
jahrgang 50
in münster
eine akademie
plant zwei tage
zur scheidung
dazwischen verlangt
ein beirat die zeit
sie packen zu
besetzen mein leben
sie nehmen die zeit
als wär es die ihre
sie zwängen mein leben
hinein in termine
die wenn sie kommen
mein leben verbrauchen
mir geht blitzartig auf
ich werde gelebt
ist es wirklich mein leben?
ich plane den aufruhr
so geht es nicht weiter
ich selber will leben
mein eigenes leben
ich!
ganz unten im berg
von amtlicher post
liegt ein brief
ich öffne ihn zaghaft
in warmer erwartung
erahne befreiung
im lesen der zeilen
durchschreit’ ich ein tor
in der mauer
zur freiheit
zum leben
zu dir
aufruhr im gang
ich beginne zu leben
An diese beiden Sätze, das Presto des Arbeitens und das Menuett des Liebens, schließe ich einen beschaulichen dritten Satz an. In diesem Lento fasse ich zusammen, wofür ich heute stehe.
Viele Sinfonien enden schließlich mit einer Coda. Auch diese meine autobiografische Sinfonie. Sie bleibt als Ganzes gesehen eine Skizze, eine Unvollendete. Zu Ende komponieren werde ich Sie erst, wenn ich sterbend in die Liebe des eigentlichen Komponisten meines Lebens hineinfalle.
1. Satz: Presto Arbeiten
»Er führte mich hinaus ins Weite« (Psalm 18,20)
Weltbürger
Meinen Umfragen zufolge haben die Wiener einen enormen Hang zum Provinziellen. Zwar hatte die Stadt zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen offenen Geist, der noch die Weite der K.-u.-k.-Monarchie atmete, aber dieser scheint inzwischen verflogen zu sein. Der Wiener zählt sich zu allererst auch nicht einmal zu Wien, sondern zu seinem Grätzel3. Sie oder er sind Ottakringer oder Favoritener, Meidlinger oder Sieveringer. Selbst Wien ist vielen schon zu weit. Geschweige denn Österreich oder gar Europa, von der weiten Welt ganz zu abgesehen.
Dass ich als geborener Wiener nicht diese Provinzialität geerbt habe, hat einen biografischen Grund. Ich hatte das Glück, dass schon meine Familie wiederholt den Lebensort gewechselt hatte. Das sind die vielen Stationen: Wien – Niederbayern – oberes Mühlviertel – Ottensheim – Wien. Auch innerhalb Wiens haben wir mehrmals den Wohnort gewechselt. Von Wien zog die Familie später nach St. Thomas bei Waizenkirchen weiter.
Nach der Matura 1958 im Wiener Wasagymnasium lebte ich ein Vierteljahrhundert hindurch nie mehr als acht Jahre an einem Ort: Innsbruck – Wien – Bamberg – Passau waren meine befristeten Lebensorte. Erst als ich 1984 an die Universität Wien heimberufen wurde, kam die längste sesshafte Zeit meines Lebens. Ich habe ein kleines gemütliches Haus gebaut und wurde leidenschaftlicher Hobbygärtner.
Wichtige Studienreisen haben meine fachliche Entwicklung gefördert. 1968 ging es mit dem Institut für Sozialethik nach Prag und Russland, um vor Ort die Lage der Religion im kommunistischen Sowjetsystem und im Prager Frühling zu studieren. 1983 besuchte ich die Philippinen. Mit der Prälatur Infanta auf der Hauptinsel Quezon und ihrem Bischof Julio Labayen bestand eine Partnerschaft mit dem Vikariat Wien-Süd. Ich stützte mich bei meiner Antrittsvorlesung in Wien auf diese »Begegnung mit Infanta«. Erzbischof Franz Jachym hatte damals den Kopf geschüttelt und gemeint: »Ihr macht eben in eurer Generation Pastoraltheologie anders.« Der Kontakt mit den Philippinen wurde von Veronika und Gunter Prüller-Jagenteufel noch länger am Leben erhalten. Die Studienreisen mit ihnen haben eine ganze Studentengeneration bereichert.
Im Rahmen meines ersten Besuchs auf den Philippinen hat uns eine Schwester namens Teresia Estallila zu den Dumagats mitgenommen. Dieser bedrohte Stamm pflegt bis heute seine Steinzeitkultur. Unsere Reisegruppe schlief wegen der Kälte »in Bündeln«, um einander zu wärmen. Wir erfuhren von fremden Sitten und Gebräuchen, von der Feldarbeit der Frauen und der Arbeit der Männer mit den Kindern. Sehr beeindruckt hat mich das Eheschließungsritual. Der Vater der Braut und jener des Bräutigams setzen sich an einem Tisch, vor sich haben sie ein Holzbrett. Sie stoßen zwei Dolche in das weiche Holz. Die Botschaft ist klar: Wer untreu wird, muss mit dem Tod rechnen. Denn Untreue bedroht das Überleben des Stammes.
Nach den Philippinen ging die Reise weiter nach Taiwan. Ich begleitete Missionarinnen und Missionare bei ihrer jährlichen Fortbildungswoche. Sie waren nach dem Sieg von Mao Zedong vom chinesischen Festland auf die Insel geflohen. Dort wurden viele chinesische Festlandsflüchtlinge, aber auch malaysische Ureinwohner getauft. Die einen wegen des Reises, die anderen, weil sich die Missionarinnen und Missionare nachhaltig um den Erhalt ihrer Kultur gekümmert haben. Ihnen ist der Erhalt der einheimischen Sprachen zu verdanken, die sie auch in der Liturgie verwendeten. Ich habe in Abständen insgesamt sieben Mal mit dieser Gruppe von Missionarinnen und Missionaren gearbeitet und dabei Freundinnen und Freunde gewonnen. Ich bewundere, dass sie ihr ganzes Leben auf die Karte der Mission gesetzt haben. Ob ich das könnte, so radikal alles zu verlassen? Aber zugleich habe ich erlebt, was diese Mutigen gewinnen. Luis Gutheinz zum Beispiel, ein Tiroler Jesuit, ist in die taiwanesische Kultur so sehr eingetaucht, dass er inzwischen mehr Chinese als Europäer ist. Er hat eine beeindruckende Chinesische Theologie verfasst, und das mehrere Jahrhunderte nach dem gescheiterten Versuch seines jesuitischen Mitbruders Matteo Ricci, der das Christentum mit dem Konfuzianismus versöhnen wollte. Dessen Grab in Beijing ist heute wieder zugänglich, obgleich es auf dem Gelände der Kommunistischen Parteiakademie liegt.
Zur Reisegruppe gehörten neben mir Sr. Lea Ackermann, Fritz Köster SAC sowie Eduard Puffer – ein Arzt aus Bad Schallerbach in Oberösterreich. Drei Jahre später reisten wir zusammen nach Mombasa in Kenia. Dort studierten wir die Lage von Kinder-Prostituierten. Sr. Lea hat mit Solwodi eine Organisation gegen Frauenhandel und Kinderprostitution gegründet und ist dafür mehrmals geehrt worden. Ihr verdanke ich eine köstliche »feministische« Erzählung: Als sie Theologie studierte, fragte sie ein Mitbruder aus dem männlichen Zweig der Weißen Väter, ob sie nicht mit ihm in die Mission gehen möchte, um dort den Haushalt zu machen. Sie darauf: »Magst nicht du mit mir in die Mission gehen und den Hausmeister machen?« Sr. Lea lebte viele Jahre mit dem kürzlich verstorbenen Pater Fritz im Pfarrhaus Andernach am Rhein. Sie machte nicht die Hausfrau und er nicht den Hausmeister.
Meine Pastoraltheologie wurde zudem geprägt durch eine Bildungsreise nach Peru und Bolivien mit Fachleuten von Misereor im Jahr 1983. Den Verantwortlichen lag auch an fundierter Bildungsarbeit für die Menschen im Geberland Deutschland. Zur Vorbereitung jeder zweijährigen Bildungsoffensive fuhr eine Gruppe in das jeweilige Schwerpunktgebiet. Ich wurde als Pastoraltheologe mitgenommen. Wir besuchten das umstrittene Megastaudammprojekt in Cajamarca in Nordperu. Unter Beteiligung deutscher Firmen und mit Geldern der Bundesregierung wurden dort weite Gebiete überflutet. Viele Menschen verloren dadurch ihre Lebensgrundlage. Ein Treffen mit Gustavo Gutierrez in Lima hat mich sehr beeindruckt. Als bedrückend erlebte ich den Besuch in einer Silbermine in Potosi (Bolivien), wo die Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter gefährlich und ausbeuterisch waren. In einem Dorf hoch in den Bergen begegnete ich einem spanischen Jesuiten. Ich erlebte eine einheimische Hochzeit mit. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich vom spanischen Missionar, dass in diesem christlichen Dorf die Zeit vor der Trauung keinesfalls kirchennormkonform verlief: Um zu beweisen, dass das Paar Kinder zeugen konnte, musste(!) es vor der Eheschließung zusammenleben. Als der Missionar bei seinem Beichtbefähigungsexamen in Spanien von diesem Brauch erzählte, fiel er durch.
Bei der Trauung spielte sich eine berührende Zeremonie ab. Die Frau hielt einen leeren Hut, der Mann schob seine beiden Hände darüber. Der Priester legte in die Hände des Mannes mehrere Goldstücke, die der Mann durch seine Hände hindurch in den Hut fallen ließ. So wurde rituell beschworen, dass das Paar und seine Familie immer ausreichend viel Geld fürs Leben haben möge.
So bin ich, in überschaubaren Verhältnissen aufgewachsen, durch viele Wohnortswechsel und Bildungsreisen mit der Zeit doch ein Weltbürger geworden. Einzig in Australien war ich (bisher) nicht. Und nicht in Israel (leider!). Die weltweiten Reisen haben mein Denken katholisch im Sinn von allumfassend gemacht.
Beijing
Ich kann von Glück sagen, dass ich in den Jahren 2008, 2010 und 2011 zu Vorlesungen ins Priesterseminar in Beijing eingeladen worden war. Diese Reisen waren theologisch besonders prägend. Peter Neuner, Dogmatiker und Ökumeniker aus München, mit dem ich seit Passauer Zeiten befreundet bin, war schon vor mir dort tätig. Er hatte den damaligen Studienleiter Johannes Chen-Binshan in München promoviert. Jetzt brauchte dieser im Rahmen des Umbaus des Priesterseminars in eine theologische Fakultät mit Diplomabschlüssen jemanden für Pastoraltheologie. Ich habe mit freudiger Neugierde zugesagt, in diesem mir fremden Land Pastoraltheologie zu unterrichten.
Die drei Aufenthalte in China blieben nicht ohne Auswirkungen auf meine Pastoraltheologie. Auf dem Nabel der Welt im Park des Tempels des Himmlischen Friedens zu stehen ist für uns Europäer, die sich weltkirchlich für das Zentrum der Welt halten, bewegend und ernüchternd zugleich. Das chinesische Imperium verstand sich als »Reich der Mitte« mit einer jahrtausendalten Kultur. Viele Kulturschätze Chinas wurden zwar durch die Kulturrevolution unter Mao Zedong (1966–1976) zerstört, doch heute werden sie in bewundernswerten Genauigkeit wiederhergestellt. Davon konnten wir, Peter Neuner und ich, uns in dem von China einverleibten Tibet überzeugen. Nach dem bislang letzten Kurs in Beijing im Jahre 2011 haben wir Tibet eine Woche lang bereist und bestaunten die mit hohem Aufwand wiedererrichteten Tempel und Kulturdenkmäler.
Die Lektion chinesischer Studierender
Eine der ersten Fragen, die mir die Studierenden in Beijing stellten, war: Wie steht es um das Heil der Buddhisten, Maoisten, Kommunisten, Daoisten – also der Mehrheit der Menschen in China? Zwar wächst die Zahl der Christen in China relativ rasch, weil das Christentum in Verbindung mit der bewunderten westlichen Technologie für viele Intellektuelle die dazugehörige »Erfolgsreligion« darstellt. Aber die in eine der christlichen Kirchen Hineingetauften bilden im chinesischen Milliardenvolk nach wie vor eine marginale Größe. Mich verwundert, dass die mächtige Kommunistische Partei Chinas in der katholischen Kleinstkirche eine derart große Gefahr sieht und sie verfolgt, einen beträchtlichen Teil in den Untergrund treibt und den anderen Teil in josephinischer Manier über die »Patriotische Vereinigung« von innen her rigoros kontrolliert.
Ich bin in einem katholischen Land groß geworden und auch meine ersten Jahre an der Universität verbrachte ich in den katholischen Gegenden Bambergs und Passaus. Bei den Franken war zudem der Anteil der evangelischen Christen groß. Durch die Ausbildung von Priestern und Pastoralreferentinnen und -referenten sowie das Training von Pfarrgemeinderäten und engagierten Mitgliedern in Gemeinden und Verbänden fokussierte ich meine fachliche Arbeit auf die katholische Kirche. »Katholisch« klang für mich von Kindesbeinen an konfessionell. Das war eine Nachwirkung der Reformation. Denn als sich in der einen »weströmischen« Kirche im Zuge der Abspaltung der Protestanten in Augsburg um 1530 eine neue Konfession bildete, mutierte auch die katholische Kirche spätestens auf dem Konzil von Trient zu einer solchen. »Katholisch« meinte dann nachreformatorisch im Vergleich zu den anderen christlichen Kirchen jene »wahre Kirche«, außerhalb derer es kein oder nur in seltenen Ausnahmen Heil gab. Als Bürger eines katholischen Landes beunruhigte mich das nicht ernsthaft. Ich konnte hoffen, dass Gott alle rettet, die mir lieb und teuer sind. Und die wenigen Nichtkatholiken im Land? Diese zu retten überließ ich der weisen Kluglist Gottes.
Ich merkte rasch, dass die chinesischen Studierenden das ganz anders wahrnahmen. Wenn die Katholiken auch in China ein Heilsmonopol haben, wenn also nur getaufte Mitglieder der katholischen Kirche gerettet werden: Kann es dann wirklich Gottes Plan sein, dass nur eine Minderheit des chinesischen Riesenvolks zum Heil kommt? Und die vielen anderen? Sie rührten mit ihren Fragen an ein auch in meiner Biografie sehr wirkmächtiges Thema. Das Heilsmonopol der christlichen Konfessionen wurde mit einer fatalen theologischen Ansicht des Kirchenlehrers Augustinus erklärt: Aus der großen Zahl der Menschheit werde Gott nur eine kleine Schar retten. Augustinus meinte zu wissen, dass es so viele sein werden, als Engel gefallen waren. Die Übrigen würden am Ende eine unübersehbare »massa damnata« bilden, die große Zahl der Verdammten. In der westkirchlichen Tradition des Christentums wurde diese Ansicht des Augustinus über Jahrhunderte offiziell gelehrt, in Katechismen gedruckt und Kindern beigebracht. Auch ich habe es Kindern in der Volksschule gelehrt. Um es auch den Getauften nicht zu leicht zu machen, wurde das »Durchkommen« an viele moralische Details gebunden. Schwere Sünden brachten einen rasch ins Heils-Out, das Beichten hingegen führte auf die Heilsspur zurück. Weil das Sündigen angesichts des reichhaltigen Sündenkatalogs nicht selten war, wurde die häufige Beichte eingemahnt – am besten vor jedem Kommunionempfang, mindestens also einmal im Jahr zur österlichen Zeit. Wer angesichts der ungewissen, weil an moralische Integrität gebundene Heilsaussicht ganz sicher gehen wollte, feierte die Herz-Jesu-Freitage, was ich auch machte. Oder ich betete inständig den Rosenkranz. Von Seherkindern aus Fatima belehrt, fügten wir hinzu: »Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen.« Zu diesen Heilsbedürftigen zählte man in erster Linie sich selbst. Das alles habe ich getreu mitgemacht. Richard Rohr, franziskanischer Mystiker aus New Mexico in Kalifornien karikiert solche heilsängstliche Spiritualität als »worthiness-contest«.
Diese Pastoral zeitigte freilich bei mir wie bei vielen Katholiken beträchtliche Kollateralschäden. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit eine lähmende Höllenangst entwickelt zu haben. Einmal träumte ich – und dieses Traumbild sehe ich bis heute plastisch vor mir – in einem Fass eingeschlossen zu sein, als es darum ging, in den Himmel einzuziehen. Ich hatte riesige Angst, dass ich nicht rechtzeitig aus dem Fass herauskäme. Diese kindliche Höllenangst sehe ich heute für gar nicht jesuanisch an. Angst ist Enge, wie ich aus ihrer bedrängenden Erfahrung weiß. Ich hatte in meinem Glauben nicht befreiende Weite, sondern beängstigende Enge gelernt. Was ich in Predigten gehört, im Religionsunterricht gelernt und später in den moraltheologischen Vorlesungen des Kasuistikers Josef Miller SJ4 in Innsbruck studiert habe, waren die bedrohlichen Reden Jesu vom engen Nadelöhr, vom Gericht, von der fürchterlichen ewigen Hölle, vom Heulen und Zähneknirschen. Die Heilslage selbst jener Getauften, die mit ihrem Mund bekennen: »Jesus ist der Herr« und in ihren Herzen glauben »Gott hat ihn von den Toten auferweckt« und die laut Paulus auf diese Weise »gerettet werden« (Röm 10,9), wurde mit Blick auf moralisches Versagen dennoch als prekär angesehen. Die vielen kontrastierenden Texte der Hoffnung gar für alle Menschen wurden den Gläubigen – auch mir – wohlweislich vorenthalten.
Wenn es in meinem gläubigen Leben und theologischen Denken eine bedeutende Entwicklung gegeben hat, dann war es »Weitung«. Ich kann heute den Psalm 18,20 sehr gut nachvollziehen, in dem es heißt: »Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen.« Solche Weitung widerfuhr mir an den Wurzeln meines Glaubens und damit an den Quellen meines Lebens. Die Studierenden aus dem Priesterseminar in Beijing haben mir dazu den letzten längst fälligen Anstoß gegeben.
Natürlich war mir der Beitrag von Karl Rahner, »Der Christ und seine ungläubigen Verwandten«5, bekannt. Aber ich hatte seine existenzielle Tragweite in meiner Studienzeit in Innsbruck noch nicht verstanden. Dass zur bleibenden Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils die von der kirchlichen Autorität nicht verworfene Frage gehöre, ob wir hoffen dürfen, dass Gott am Ende alle rettet, war in meinem Kopf zwar angekommen, aber hatte noch nicht mein Herz und damit auch nicht meine Pastoraltheologie revolutioniert. Dazu brauchte es fragende chinesische Studierende, die in ihrer Verwandtschaft, unter den Familienmitgliedern und den Angeheirateten fast nur »ungläubige Verwandte« hatten. »Ungläubige« im Sinn des Evangeliums, versteht sich, aber nicht »Ungläubige« im Sinn ihrer religiösen Traditionen. Wer als Gläubiger Nichtgläubige wirklich liebt, kann wohl gar nicht anders, als nach deren Heil zu fragen und für sie fest auf dieses zu hoffen.
Katholisch: nicht konfessionell, sondern universell
Die Studierenden im Priesterseminar Beijing haben mir geholfen, das altehrwürdige Wort »katholisch« in seiner ursprünglichen Weise zu verstehen. Es hörte auf, konfessionell eng zu sein. Jetzt las ich es wieder universell. Das Thema war nicht mehr Gott und die Rettung der von ihm auserwählten Katholiken. Mein Denken wurde katholischer, denn es drehte sich nunmehr um Gott und die eine Menschheit.
Zu Hilfe kam mir, dass ich mich just in dieser Zeit in die europäische Mystik vertieft hatte. Das verdankte ich nicht dem, was mir in meiner Kindheit oder Jugendzeit in meiner eigenen Kirche erschlossen worden war. Ich bekam einen Anstoß von außerhalb der Theologie. Der Zukunftsforscher Matthias Horx entdeckte einen Trend, den er »Respiritualisierung« genannt hatte. Für ihn war dies ein Megatrend der späten Neunzigerjahre.6 Günther Nenning, selbst ein weltanschaulicher Vagabund, hatte über diese Zeit vermerkt: »Die Sehnsucht boomt, aber die Kirchen schrumpfen.«7 Der spirituelle Markt sei also offen. Die Kirchen, und Günther Nenning meinte als gelernter Österreicher primär die katholische Kirche im Land, fänden jedoch zu diesem Markt keinen Zugang.
Ich widmete mich seit der Mitte der Neunzigerjahre der Erforschung dieser »Respiritualisierung«, wobei mich das »Re-« störte, weil ich überzeugt war, dass jeder Mensch spirituell sei und diese Begabung kulturell lediglich verschüttet, aber nicht zerstört werden könne. Aber Spiritualität sei in unserer Kultur wie Glut unter der Asche – und nunmehr werde sie wieder angefacht. Unterstützung fand ich bei diesem Forschen durch die Mainzer Kulturanthropologin Ariane Martin. Sie schrieb beim früh verstorbenen Kollegen Manfred Kremser eine Studie über die »Dimensionen zeitgenössischer Spiritualität« (in Deutschland). Den Titel ihrer wichtigen Arbeit lehnte sie an ein Gedicht von Nelly Sachs an: »Sehnsucht ist der Anfang von allem«. 8 Ich war bei diesem Dissertationsprojekt an der Universität Wien Zweitgutachter und befand mit dem Erstgutachter die Arbeit als sehr gut. Aus der Forschungsarbeit von Ariane Martin habe ich für mein pastoraltheologisches Nachdenken großen Gewinn gezogen.9
Ich erforschte aber die spirituelle Dimension moderner Kulturen nicht nur theoretisch, sondern suchte praktischen Zugang zur aufkeimenden Spiritualität in säkularen Szenen. In einer deutschen Großstadt kam ich in Kontakt mit einer spirituellen Einrichtung außerhalb meiner Kirche. Die Erfahrungen, die ich dort sammelte, machten mich pastoraltheologisch nachdenklich. Teresa von Àvila, Meister Eckhart wie auch Johannes Tauler standen dort hoch im Kurs. Ich fragte mich, warum diese mystischen Texte außerhalb der katholischen Kirche derart geschätzt wurden, nicht aber in meiner eigenen Kirche? So begann ich, mich in Teresa von Àvilas »Innere Burg«10 meditativ ebenso zu vertiefen wie in die Predigten von Meister Eckhart und Johannes Tauler. Später wandte ich mich der tiefen Mystik des Johannes vom Kreuz zu.11
Mystikerinnen und Mystiker faszinieren mich. Sie sind keine Konfessionalisten, sondern geborene Universalisten. Jeder Mensch hat, so ihre Überzeugung, die Möglichkeit zur Gotteinung. Jede und jeder ist berufen, auf diesem Weg »gänzlich Liebe zu werden«. Für die Mystikerinnen und Mystiker liegt die Gotteinung all unserem Tun gnadenhaft längst voraus, wie Karl Rahner es in seiner mystischen Seelsorgstheologie einprägsam formulierte.12 Rahner war der Überzeugung, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker sein werde, also einer der etwas erfahren hat, oder er werde nicht Christ sein können.
Es geht also in jedem einmaligen Leben darum, so lernte ich von Meister Eckhart, »zu werden, was wir ewiglich in ihm gewesen sind«. Mich hat sehr berührt, wie Eckhart das in seiner poetischen Sprache erläutert. Er erzählt vom inneren Leben in Gott, vom trinitarischen »Tanz der Liebe« (Richard Rohr) und wie dieser uns Menschen unaufhaltsam erfasst. Über das innergöttliche Lieben und wie dieses die gesamte Schöpfung durchwaltet und gestaltet, schreibt er:
… nicht aber so der Heilige Geist: der ist vielmehr nur ein Ausblühen aus dem Vater und aus dem Sohn und hat doch eine Natur mit ihnen beiden.
Darum sollen wir niemals ruhen, bis wir das werden, was wir ewiglich in ihm gewesen sind …
Darum sage ich, dass es des Vaters Wesen ist, den Sohn zu gebären,
und des Sohnes Wesen, dass ich in ihm und nach ihm geboren werde;
des Heiligen Geistes Wesen ist es, dass ich in ihm verbrannt und in ihm völlig eingeschmolzen und gänzlich Liebe werde.
Ähnlich sieht das die heilige Hildegard von Bingen, die 2012 von Benedikt XVI. zur Kirchenlehrerin der katholischen Kirche gekürt wurde. In einer grandiosen Vision schaut sie, wie sich die ganze Schöpfung im »Weltleib« Gottes entfaltet und vollendet: »In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir« (Apg 28,18). Gott ist für sie ständig weltgebärend. Sie schaut, worauf diese Geburtsgeschichte der Schöpfung hinausläuft. Vollendet ist sie, wenn der Menschensohn als Ziel der Schöpfung zu seiner Vollgestalt erblüht ist. »Menschensohn« ist jener Name, den Jesus selbst für sich verwendete. Damit deutet er an, was in ihm steckt und Gott mit ihm vorhat. In seiner Auferstehung, die Jesus von Raum und Zeit frei machte, ist er »zum Christus eingesetzt« worden (Apg 2,36). Seit der Erhöhung über die Erde am Kreuz »zieht er alles an sich« (Joh 12,32). Der ganze Kosmos wird zum vollendeten Christus. Zum »kosmischen Christus« eben. Christus wird zum Namen der vollendeten Schöpfung. Wenn dieser Vorgang der Umwandlung der ganzen Schöpfung mit dem Ende der Zeiten vollendet sein wird, wird »Gott alles in allem« sein (1 Kor 15,28).
Bei meinen Vorbereitungen darauf, was ich den chinesischen Studierenden vermitteln sollte, stieß ich auf den Christushymnus im Kolosserbrief. Dieser hatte in meiner gesamten theologischen Ausbildung in Innsbruck13 keinerlei Rolle gespielt. Mit der Vision Hildegards klingt dieser in hohem Maße zusammen:
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes,
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles erschaffen
im Himmel und auf Erden,
das Sichtbare und das Unsichtbare,
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten;
alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung,
in ihm hat alles Bestand.
Er ist das Haupt des Leibes,
der Leib aber ist die Kirche.
Er ist der Ursprung,
der Erstgeborene der Toten;
so hat er in allem den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen,
um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen,
der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. (Kol 1,15–20)
Es ist kein Geringerer als Hans Urs von Balthasar, durch den ich verstehen gelernt habe, wie dieser Prozess der Vollendung aller verlaufen könnte. Wie bei Meister Eckhart ereignet sich nach seiner gut begründeten Überzeugung der Weg ins Heil, indem wir Liebende werden. Wer wahrhaft liebt, ist faktisch im Heil. Liebe ist, so riskiert Karl Rahner zu formulieren, »Heil im atheistischen Modus«. Er hat dabei die Gerichtsrede bei Matthäus auf seiner Seite (Mt 25,31–46). Gerettet werden die Liebenden. Wahrhafte Liebe ist, so der große, durchaus nicht »liberale« Theologe aus Luzern, gleichsam »verhülltes« Heil.14 Wer immer liebt, ist auf dem Weg in seine Vollendung. Diese erreicht, wer völlig in den Heiligen Geist eingeschmolzen »gänzlich Liebe wird« (Meister Eckhart).
Die einzige Frage an das Leben eines jeden Menschen ist: Gibt es wenigstens kleine Spuren der Liebe? Findet Gott solche »bei Stalin, Hitler und mir«, wie ich in Vorträgen provozierend formuliere? Wird Gott etwas von dem antreffen, was er in jedem seiner geliebten Geschöpfe bewirken möchte und was er trotz unserer Ängste und der daraus erwachsenden Bosheiten vollenden wird? Dazu wird er von jedem »Memoiren anderer Art« lesen und all das auffinden, was unserem menschlichen »Richten« verborgen bleibt. In dem als Beleg für das Fegfeuer katholischerseits gern zitierten Schrifttext heißt es – meine zuversichtliche Hoffnung stützend:
… das Werk eines jeden wird offenbar werden; jener Tag wird es sichtbar machen, weil es im Feuer offenbart wird. Das Feuer wird prüfen, was das Werk eines jeden taugt. Hält das stand, was er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. (1 Kor 3,13f.)
Ich verstehe von da aus besser, warum Jesus mahnte: »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet« (Mt 7,1). Paulus hatte das präzise verstanden: »Richtet also nicht vor der Zeit; wartet, bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird. Dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten« (1 Kor 4,5). Wenn Gott jeden lobt, dann wird er auch bei jeder und jedem fündig werden. Wie könnte er sonst loben?
Meine Theologie wird an dieser Stelle nicht naiv und blauäugig. Sie kennt die dämonischen Mächte, die das Reifen der Liebe verhindern. Dem »Erbheil« (Hermann Stenger) steht »Erbunheil« entgegen. Unsere Glaubenstradition hat dieses mit dem unglücklichen Wort »Erbschuld« mehr missverständlich denn einsichtig gemacht. Das Erbunheil trägt seit allem Anfang Züge von Gewalt, Gier und Lüge15, die allesamt der Angst entspringen. Niemand entrinnt diesen Dämonen. Keiner ist in dieser Hinsicht ohne Sünde. Es gibt eine »sinnlose, von den Vätern (und Müttern) ererbte Lebensweise« (1 Petr 1,18). Jede ist so verwundet, dass sie des heilenden Erbarmens Gottes bedarf. Auch das gilt für jeden. Auch für mich.
Gott wirkt also im Inneren in der gesamten Evolutionsgeschichte. Er wurde in der Auferstehung zum Herzen jener Welt, in deren Innersten bislang »Tod und Vergeblichkeit saßen«. So haben es die Kirchenväter gesehen. Karl Rahner hielt darüber eine berührende Osterpredigt.16
Die Mitte meiner eigenen Gläubigkeit in diese Richtung zu öffnen und meine Pastoraltheologie von da aus zu fundieren: Das verdanke ich den chinesischen Studierenden. Ich traue es Gott vorbehaltlos zu, dass er am Ende aller »Äonen« (Ewigkeiten) alle rettet – und wiederhole formelhaft die Trias »Stalin, Hitler und mich«. Andere würden Polpott aus Kambodscha, skrupellose Diktatoren, aber auch gierige Finanzspekulanten hinzufügen. Gott wird bei diesen im Tod viel Reinigungsarbeit leisten müssen, um das Gold seiner Schöpfung zu reinigen. Solche Reinigung setzt mit dem Tod ein und kann sich dann eine »höllische Ewigkeit« lang hinziehen. Aber schließlich wird es nichts mehr geben, was nicht vollendet ist. Gottes Macht, so der griechische Kirchenlehrer Gregor von Nyssa, wäre nicht vollkommen, gäbe es noch irgendeine widergöttliche Macht. Dass am Ende »Gott alles in allem ist«, verträgt sich nicht mit der Existenz von Sünde, Tod und Teufel.
Ich habe nach Beijing angefangen, östliche Kirchenväter zu lesen. Heute weiß ich, dass ich damit nachgeholt habe, was die großen Gewährsleute des Zweiten Vatikanischen Konzils wie Joseph Ratzinger, Henri de Lubac, Ives Congar, Hans Urs von Balthasar und nicht zuletzt auch Karl Rahner getan hatten. Aus dem westlichen Heilspessimismus augustinischer Prägung haben sie sich herausgehofft und dabei durch Autoren der Mystik und des östlichen Heilsoptimismus Unterstützung erfahren.17 Ich verstehe jetzt, warum Karl Rahner meinte, die Frage des Konzils nach dem universellen Heilsoptimismus habe eine bleibende Bedeutung.
Mich interessiert seitdem mehr als zuvor, auf welchen Wegen Gott mit Anhängern der großen Religionen der Welt, aber auch mit der wachsenden Zahl von Skeptikern, Zweiflern und Atheisierenden zurechtkommt. »Gott ist auch ein Gott der Atheisten«, so betitelte ich einen Vortrag, den ich erstmals in der deutschen Gemeinde in Brüssel gehalten und dann mehrere Male wiederholt habe. Ich erinnere mich auch, dass ich in Prag im Rahmen einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in der von Tomaš Halìk gegründeten Christlichen Akademie mit dem »Edelatheisten« Alfred Grosser diskutiert habe. Die Frage war, ob Atheismus und Gottesglaube zwei gleich gültige Weltanschauungen seien: Gleich gültig ist sprachlich und sachlich an gleichgültig dran. Alfred Grosser hat große Sympathie für das Christentum. Er arbeitet als Journalist bei der französischen katholischen Wochenzeitschrift »La Croix«. Wie in seinem lesenswerten Buch »Die Früchte ihres Baumes« 18 argumentierte er auch bei unserer Diskussion voller Sympathie für die engagierten Christen. Er lobt die vielen Früchte, die am Baum der Kirchen reifen, aber refrainartig fügt er am Ende der Kapitel hinzu: Das alles können wir Atheisten auch.
Ich habe ihm damals – es war schon nach meiner Erfahrung in China – zu sagen versucht, dass ich mir das als gläubiger Christ geradezu erwarte. Denn Gottes Geist, der Liebe ist und zur Liebe drängt, wirke unaufhörlich und erfolgreich in allen. Auch in den Atheisten. Gott sei für mich eben auch ein Gott der Atheisten. War das eine Vereinnahmung, die Hans Urs von Balthasar Karl Rahner wegen dessen Begriff von den »anonymen Christen« vorwarf?19 Nein, meine ich heute: Es geschieht nicht eine Vereinnahmung der Menschen durch die Kirche, sondern eine radikale Verausgabung Gottes für alle. Schon Teresa von Àvila zeigte sich davon überzeugt, dass Gott dem Innersten der Seelenburg eines jeden Menschen einwohnt. Bei ausnahmslos allen.
Licht und Salz
Seitdem ich meinen Glauben fest auf diesem heilsoptimistischen Fundament gegründet erlebe, muss ich meine Pastoraltheologie umbauen. Wandert der Akzent vom befürchteten Heilspessimismus zum erhofften Heilsoptimismus, wandelt sich der Grundauftrag der Kirche. Ihre Mission muss neu definiert werden.
Den heilspessimistischen Kontext habe ich exklusiv erlebt. Die Kirche erschien mir als Nadelöhr der Rettung. Sie war wie ein schmales Tor zur bleibenden Stadt des himmlischen Reichs, durch das ein Kamel nur durch Gottes Zutun durchkommt. Heute werde ich den Verdacht nicht los, dass sich die heilspessimistische Theologie so lange gehalten hat, weil sie der Kirche und ihrem Klerus eine unermessliche Macht über die Herzen der Menschen gab. Heilspessimistische Konzepte sind höchst klerikalismusanfällig.
Mir war diese heilspessimistische Sicht geläufig. Als Kaplan habe ich in der Volksschule in Wiens 12. Arbeiterbezirk gleich nach dem Konzil (1965–67) den Kindern der zweiten Klasse vor der Erstkommunion die Sakramente der Kirche erklärt. Dazu verwendete ich eine Vorlage des Regensburger Katechetikers Josef Goldbrunner.20
Biografische Randnotiz: Dessen Lehrstuhl hätte ich im Jahr 1977 von Passau aus nach dem Willen der Fakultät in Regensburg übernehmen sollen. Bischof Rudolf Graber aber verweigerte mir das Placet, weil ich mich in einem Interview für die Weihe von verheirateten Männern eingesetzt hatte. Das erschien mir unangemessen, weil er selbst großzügig konvertierte evangelische Pastoren ordinierte.
Josef Goldbrunner, Die großen Gnadenzeichen
Das Schaubild von Josef Goldbrunner, das ich im Religionsunterricht eingesetzt hatte, trägt den Titel »Die großen Gnadenzeichen«. Unter der Überschrift zeigt es das Kreuz, von dem aus Gnadenströme fließen. Aus der Seitenwunde Jesu gelangt die Gnade in ein großes Becken – die Kirche. An dem Becken sind sieben Rohre angebracht. Es sind die sieben Sakramente. Durch diese sollte die rettende Gnade zu den Menschen gelangen. Der Clou: Am Rand des Bildes ist ein Wasserhahn gezeichnet, aus dem Wasser fließt. Die Anleitung zum Bild: Das Wasser fließt nur, wenn ein Priester den Wasserhahn bei der »Spendung der Sakramente« aufdreht. Er könnte den Hahn auch zulassen, wenn jemand die Bedingungen nicht erfüllt. Bei solchem Verweigern haben wir gern mit Jesus argumentiert: »Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert« (Joh 20,23).
Was aber, wenn Gott die Rettung der unzählig vielen, für die Christus Mensch geworden ist und sein Blut am Kreuz vergossen hat, auch ohne in der Taufe sichtbar gemachte Beziehung zur Kirche oder gar ohne ausdrückliches Bekenntnis zu Jesus dem Herrn vollbringen kann und, wie ich mit vielen hoffe, auch vollbringen wird? Wozu dann die Kirche – und damit meine Existenz in der Kirche, in deren Dienst ich mein ganzes Leben, und davon 50 Jahre im priesterlichen Dienst, gestellt habe? Verliert die Kirche im Rahmen des Heilsoptimismus nicht ihren Sinn?
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben es viele genau so verstanden: Es genüge für die rettende Vollendung, wenn der Buddhist als ein guter Buddhist, ein Atheist als ein guter Atheist lebe. Niemand müsse mehr zum Evangelium bekehrt und Christ werden. In der Vollendung würden dann alle vereint sein. Es genüge, wenn sie dann erkennen, dass sie ein seliges Moment in jenem vollendeten »Weltleib« sein werden, deren »Haupt« der auferstandene Christus ist. Neuere Religionstheologien in Asien schlagen solche Erlösungskonzepte vor.
Nicht zufällig ist mir deshalb die Dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche wichtig. Sie zählt neben der Pastoralkonstitution »Die Kirche in der Welt von heute« und den Dekreten über die Offenbarung und die Religionsfreiheit zu den Hauptdokumenten der Kirchenversammlung. Die Mission der Kirche musste in einer vertieften Weise neu bestimmt werden. Dabei schließt sich der Bogen vom Konzil zur Belehrung der Jünger durch Jesus. In seiner programmatischer Rede auf dem Berg der Seligpreisungen erklärte er ihnen: »Ihr seid das Licht der Welt!« – »Ihr seid das Salz der Erde« (Mt 5,13f). In sakramentaltheologischer Sprödheit formulierte das Konzil: »Die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit« (Lumen genium Nr. 1).
Zeichen verbinde ich mit »Licht«. Oder mit dem Bild von Hans Urs von Balthasar: Die Kirche enthüllt das Verhüllte; also das, was Gottes Geist in allen seinen »Ebenbildern« bewirkt. Enthüllen meint, das Tuch, das verhüllt, wegzuziehen. Offenbar machen. Kirche ist Veröffentlichung dessen, was Gott mit allen vorhat und mit seiner Gnade vollbringt. Das »Zeichen« ist vor aller Welt aufgerichtet. Das macht für mich die Kirche zur Licht-Stadt auf dem Berg der ganzen Menschheit.
Und das Werkzeug? Ich sehe es lose verwoben mit dem Bildwort Jesu vom »Salz der Erde«. Das Salz, aus dem Toten Meer gewonnen, sollte leicht verderbliches Fleisch vor dem Verderb bewahren. Ich lese auch »Heilsalz« mit. Salz der Erde heißt dann, Wunden heilen, welche die Angst dem Leben schlägt und solidarisches Lieben unterbindet. Das macht die Kirche in der Nachfolge des Heilands zum Heil-Land. Es ist jene Kirche, die Franziskus, der heutige Bischof von Rom, herbeiwünscht. Eine Art Feldlazarett für alle in der einen Menschheit. Für jene, die an Leib und Seele verwundet sind. Den psychisch wie physisch Armen, deren Schrei an Gottes offenes Ohr dringt:
»Ich sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man muss einen Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen.«
»Man muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen. Die Wunden heilen, die Wunden heilen … Man muss ganz unten anfangen.«
»Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, Wunden zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen – Nähe und Verbundenheit.«21
Diese Rückbesinnung des Papstes auf die Berufung der Kirche zum Heilen wärmt auch mein Herz. Zu lange haben wir uns von der Aufklärung die Mystik stehlen lassen. Die Kirche sollte bürgerliche Moral, Autorität und Ordnung liefern. Im Zuge weiterer Aufklärung in demokratischen Diskursgesellschaften hat die Kirche auch diese gesellschaftliche Aufgabe verloren. Bestenfalls für eine paar religiös »Unheilbare« macht kirchliche Moral noch Sinn. Politische »Einmischung« wird der Kirche abgesprochen.
Ich halte aber »Einmischung« der Kirche in die Formung einer humanen Welt seit der Menschwerdung Gottes in Jesus für unumgänglich. Mischt sie sich nicht ein, was auch aus eigener Bequemlichkeit oder Feigheit der Fall sein kann, dann verkommt sie zu einer Kirche der Selbstbeschäftigung. Sie wird krank, so Papst Franziskus als empathischer Kirchentherapeut. Nur wenn sie aus sich herausgeht, eine arme Kirche für die Armen ist, bleibt sie ihrer Berufung zum Heilen treu.
So klar wie ich das heute sehe, habe ich es den chinesischen Studierenden noch nicht vortragen können. Mit meinem Freund und Kollegen Peter Neuner habe ich versucht, den Studierenden den Dank mit einer Art »Lehrbuch über die Kirche« abzustatten.22 Und weil wir beide der Ansicht sind, dass diese Vertiefung der Lehre der Kirche hinein in die jesuanische Weite vor allem im 40 Jahre durch den Kommunismus entwicklungsbehinderten Osteuropa noch nicht abgeschlossen ist, erscheint dieses Buch neben Chinesisch derzeit in einigen osteuropäischen Sprachen: in Slowakisch, Ungarisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch. Bei dem Versuch, die Implementierung des Konzils im Leben der Kirche zügiger voranzubringen, als dies unter Johannes Paul II. und Benedikt XVI. geschehen war, haben wir Franziskus, Bischof von Rom, auf unserer Seite. So berichtete Radio Vatican auf seiner Homepage am 16. April 2013:
»Papst Franziskus feierte die Messe anlässlich des 86. Geburtstages für Benedikt XVI. Zum Beginn des Gottesdienstes, den der Papst mit einigen Mitarbeitern des Governatorats des Vatikanstaates in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta feierte, sagte Franziskus: ›Der Heilige Geist drängt zum Wandel, und wir sind bequem.‹ Papst Franziskus hat in seiner Predigt am Dienstagmorgen deutlich Stellung bezogen und die mangelhafte Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils beklagt. Das sei vor allem ein geistliches Problem, so der Papst:
›Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, weiterzugehen. Aber wir sind wie Petrus bei der Verklärung, ,Ah, wie schön ist es doch, gemeinsam hier zu sein.‘ Das fordert uns aber nicht heraus. Wir wollen, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen ihn zähmen. Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie der Wind, der weht, wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. Es ist dieses ,Vorwärtsgehen‘, das für uns so anstrengend ist. Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser.‹
Wir seien heute viel zu zufrieden mit der angeblichen Anwesenheit des Heiligen Geistes, und diese Zufriedenheit sei eine Versuchung. Das gelte zum Beispiel mit Blick auf das Konzil:
›Das Konzil war ein großartiges Werk des Heiligen Geistes. Denkt an Papst Johannes: Er schien ein guter Pfarrer zu sein, aber er war dem Heiligen Geist gehorsam und hat dieses Konzil begonnen. Aber heute, 50 Jahre danach, müssen wir uns fragen: Haben wir da all das getan, was uns der Heilige Geist im Konzil gesagt hat? In der Kontinuität und im Wachstum der Kirche, ist da das Konzil zu spüren gewesen? Nein, im Gegenteil: Wir feiern dieses Jubiläum und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, aber eines, das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. Wir wollen uns nicht verändern und es gibt sogar auch Stimmen, die gar nicht vorwärts wollen, sondern zurück: Das ist dickköpfig, das ist der Versuch, den Heiligen Geist zu zähmen. So bekommt man törichte und lahme Herzen.‹
Dasselbe gelte für das eigene geistliche Leben: Der Heilige Geist dränge zu einem Leben gemäß dem Evangelium, aber wir seien zu bequem, wir widersetzten uns dem. Dem Heiligen Geist dürfe man sich aber nicht widersetzen, denn er mache die Menschen frei, er gebe ihnen die Freiheit der Kinder Gottes und bringe sie auf dem rechten Weg voran.«23
Praxis-Erweiterung
Welche »Weitung« die chinesischen Studierenden bei mir angestoßen haben, kann ich selbst noch nicht abschätzen. Sie macht sich an vielen Stellen meiner Pastoraltheologie bemerkbar. Einige Zeit konnte ich zusammen mit der Theologin Petra Steinmair-Pösel an dieser Neuausrichtung arbeiten, bevor sie sich entschied, sich als Frau lieber in der Sozialethik denn in der Pastoraltheologie zu habilitieren. Aber unser gemeinsames theologisches Projekt war im Entwurf so weit gediehen24, dass es sich auf meine pastoraltheologische Umorientierung ebenso wie auf Folgerungen für die kirchliche Praxis fundiert auswirken konnte.
Ein Beispiel: Die Verantwortlichen der Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft hatten mich zu ihrer bundesweiten Jahresversammlung für ihre Mitarbeitenden eingeladen. Ich sollte ihnen erklären, was an ihrer Tätigkeit »typisch kirchlich« sei. Ich fragte im Vorfeld, was bei ihnen gemeinhin als kirchlich gelte. Was erwarten beispielsweise Pfarrer, in deren Trägerschaft Kindergärten sind, von ihnen? Martinsumzüge, Teilnahme an Kindergottesdiensten, Binden von Adventkränzen, war die Antwort. Ich versuchte, ihnen auf dem Boden meiner Vision von der Kirche in der Einen Welt von heute zu erläutern, dass ihre Aufgabe viel anspruchsvoller sei. Sie sollten an der Vollendung der ihnen anvertrauten Kinder mitwirken. Vollendung ist aber für mich wahrhafte Liebe. Das gilt unbedingt für alle, auch für die ausdrücklich an Christus Glaubenden. Auftrag von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft sei es daher, unter Einsatz all ihren pädagogischen Fähigkeiten daran mitzuwirken, dass die ihnen anvertrauten Kinder handfest liebende Menschen werden. Zudem sollten sie daran mitwirken, dass eine solche Pädagogik des Reifens zu liebenden Menschen in allen Kindertagesstätten des Landes geschieht. Dann sind sie Licht der Welt und Salz der Erde. Martinsumzüge sind, vergleichsweise, ein leichteres Unterfangen.
Ein zweites vertiefendes Beispiel aus meiner praktischen Arbeit. In den letzten Jahren wurde ich oft zu Führungskräften kirchlicher Sozialeinrichtungen und Krankenhäuser eingeladen. Wie in allen Unternehmen wurden Leitbilder entwickelt. Wieder tauchte die Kernfrage auf: Was ist ein typisch christliches Leitbild für ein Krankenhaus von Barmherzigen Brüdern oder von Kreuzschwestern? Die Vinzenzholding in Wien ist ein riesiger Verbund mehrerer Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft. Sie überschrieb ihr Leitbild lapidar mit »Menschlichkeit«. Wer wollte auch etwas anderes wollen, wenn er sich lang genug in die jesuanischen Erzählungen vertieft hat. Als ich beim Pflegepersonal eines säkularen Krankenhauses eingeladen war – wieder ging es das Leitbild –, erzählte ich stolz, dass die Vinzenzholding »Menschlichkeit« zum Leitwort gekürt habe. Die Reaktion war zu meiner Überraschung Ärger und Befremden. Um Menschlichkeit gehe es selbstverständlich auch in ihrem säkularen Krankenhaus. Um was sonst?
Sie haben Recht. Ich musste in der Folge auch in dieser Hinsicht am kirchlichen Leitbild weiterarbeiten. Typisch kirchlich ist nicht eine exklusive Menschlichkeit. Vielmehr praktizieren kirchliche Einrichtungen als »Licht der Welt« etwas, was Gottes Absicht für alle Krankenhäuser ist. Überall soll der Mensch aufkommen und nicht umkommen, nicht nur in kirchlichen Krankenhäusern. Der Kernauftrag der kirchlichen Einrichtungen ist von da aus zu definieren. Sie werden sich krankenhauspolitisch bemühen, dass im Gesundheitswesen einer Stadt die Menschlichkeit in keiner Einrichtung unter die finanziellen Räder kommt. Sie darf nicht dem Sparstift zum Opfer fallen, weil die Zeit der Ärzte und der Pflegekräfte teuer und daher »einsparend« einzusetzen ist. Die kirchlichen Krankenhäuser können also den anderen sagen: Wir alle haben die gleiche Berufung für die Kranken. In unseren kirchlichen Häusern verpflichten wir uns, dass wir dieser gemeinsamen Berufung trotz aller Hindernisse möglichst gut gerecht werden. Wie diese gemeinsame Berufung unter den heutigen Bedingungen eingelöst werden kann, können wir ein gutes Stück auch von den Bemühungen der nichtkirchlichen Krankenhäuser lernen. Und diese lernen vielleicht auch von uns. Typisch auch für kirchliche Einrichtungen ist also nicht, dass sie abgrenzend kirchlich, sondern entgrenzend universell sind: eben »katholisch« im ursprünglichen Sinn dieses griechischen Wortes. Auf diese Weise wird der Umbau des Christentums von konfessionellen Exklusivklubs zum Licht der Welt und zum Salz der Erde praktisch und konkret.
Orpheus und Eurydike
Meinem Lehrer Rolf Zerfaß verdanke ich den Zugang zum griechischen Mythos von Orpheus und Eurydike und dessen Ausdeutung durch Clemens von Alexandrien.25
Ich habe diese Geschichte und ihre spirituelle Deutung schon unzählige Male vorgetragen und in den »Kirchenvisionen« publiziert.26 Kern dieser Erzählung ist die menschheitsalte Frage, was am Ende stärker ist: der Tod oder die Liebe? Bei Sigmund Freud, einem der vielen Großen aus meiner Heimatstadt Wien, heißt dieses Paar Eros oder Thanatos. 27 Im griechischen Mythos siegt am Ende der Tod über die Liebe. Denn der liebende Spielmann Orpheus blickt noch einmal zurück und verliert seine geliebte Eurydike für immer.
Clemens von Alexandrien, mit dem Evangelium im Herzen, gelangt zur gegenteiligen Antwort: Der wahre Orpheus ist Christus, der liebende Spielmann Gottes. Dieser konnte seine Eurydike zurücksingen in das Land des Lachens, der Hoffnung und der Auferstehung. Denn anders als der griechische Orpheus hat er sich nicht umgeschaut. Eurydike aber ist für ihn die Menschheit, die in der Gewalt des Todes war.
Clemens ist Universalist. Es geht ihm um Gott und die Welt. Die Kirche ist für ihn daher nicht mehr und nicht weniger als ein Instrument: die Lyra in der Hand des Christus-Orpheus, die Christi rettendes Lied bis ans Ende der Zeiten singt. Das ist wahrhaft katholisch und zeugt von der Leidenschaft Gottes für alle, die er geschaffen hat. Es zeugt von katholischer Weite.