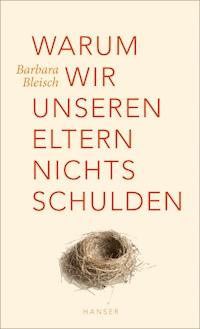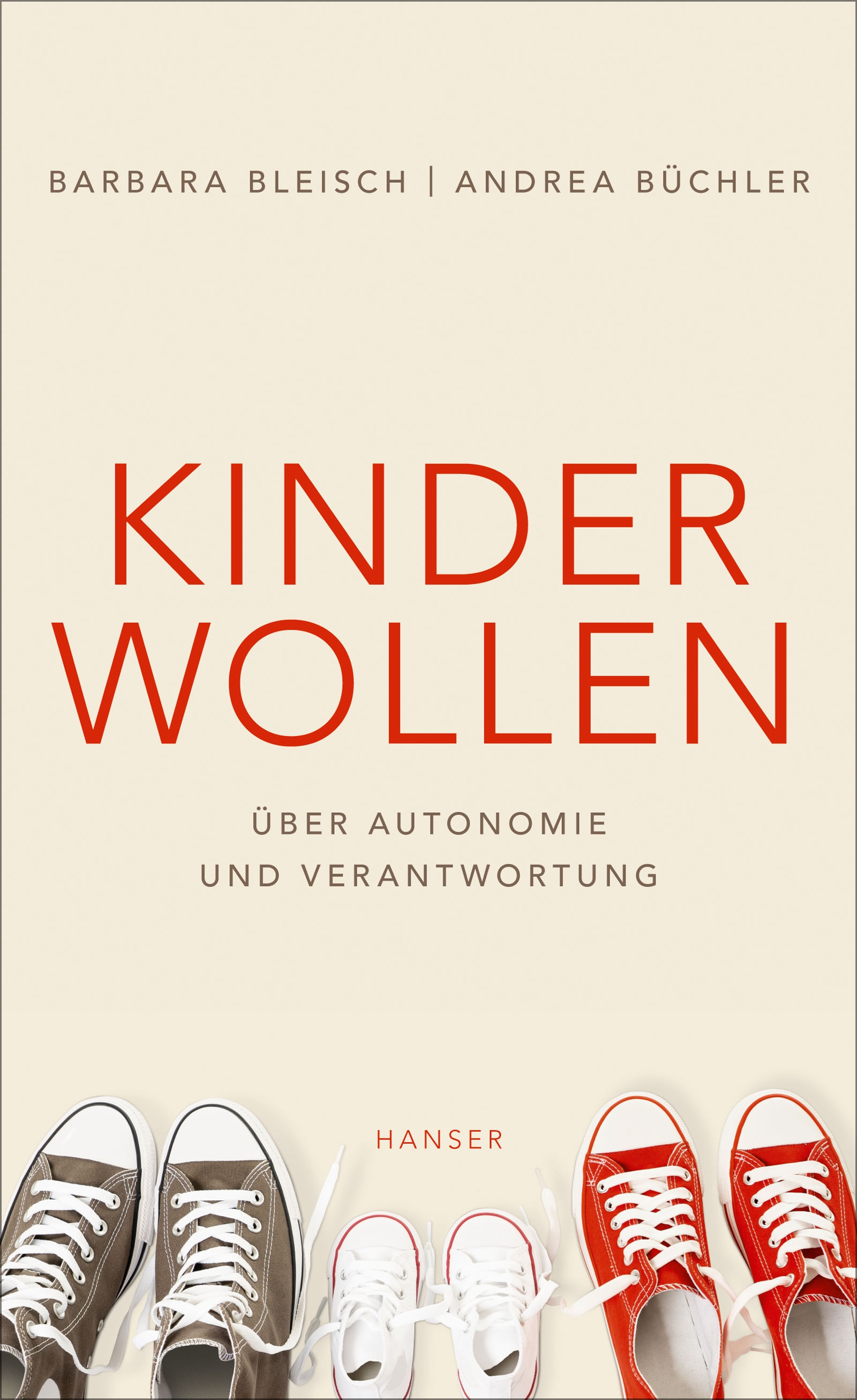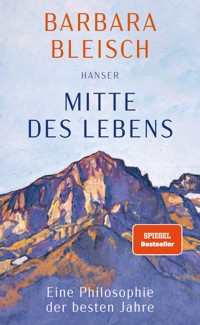
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alle reden vom Erwachsenwerden oder dem nahenden Ende. Aber die Mitte zählt. „Hinter den Krisen, die mit der Lebensmitte einhergehen können, entdeckt Barbara Bleisch die potentiell beste Zeit unseres Lebens.“ Daniel Schreiber Im Leben ist irgendwann vieles entschieden: wen wir lieben, wo wir arbeiten, wie wir wohnen. Manche sind froh, angekommen zu sein – andere fürchten, festzustecken in einem Leben voller Routinen, und fragen sich, ob es das schon war. Wie finden wir neue Lebensziele, wenn vieles erreicht ist? Wie gehen wir damit um, dass sich die Zeithorizonte langsam verengen und einige Züge mittlerweile abgefahren sind? Philosophisch fundiert und voller Bezüge aus dem Alltag denkt Barbara Bleisch nach über Lebenserfahrung, Leichtigkeit und Gelassenheit. Dem Klischee der „midlife crisis“ setzt sie eine Philosophie der Lebensmitte entgegen, die hineinführt in die existenziellen Fragen unserer Jahrzehnte als Erwachsene – und in die beste Zeit unseres Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Im Leben ist irgendwann vieles entschieden: wen wir lieben, wo wir arbeiten, wie wir wohnen. Manche sind froh, angekommen zu sein — andere fürchten, festzustecken in einem Leben voller Routinen, und fragen sich, ob es das schon war. Wie finden wir neue Lebensziele, wenn vieles erreicht ist? Wie gehen wir damit um, dass sich die Zeithorizonte langsam verengen und einige Züge mittlerweile abgefahren sind? Philosophisch fundiert und voller Bezüge aus dem Alltag denkt Barbara Bleisch nach über Lebenserfahrung, Leichtigkeit und Gelassenheit. Dem Klischee der »midlife crisis« setzt sie eine Philosophie der Lebensmitte entgegen, die hineinführt in die existenziellen Fragen unserer Jahrzehnte als Erwachsene — und in die beste Zeit unseres Lebens.
Barbara Bleisch
Mitte des Lebens
Eine Philosophie der besten Jahre
Hanser
Für J.-D.
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Barbara Bleisch
Impressum
Inhalt
1
In der Lebensmitte
2
Ende in Sicht
3
Reue, Bedauern und Ambivalenz
4
In den besten Jahren
5
Alles erreicht
6
War es das schon?
7
Inmitten des Lebens
Dank
Anmerkungen
1
In der Lebensmitte
»Wohl in der Mitte unsres Lebensweges
geriet ich tief in einen dunklen Wald,
so daß vom graden Pfade ich verirrte.«
Dante Alighieri1
»Die ersten Indizien sind subtil, winzig, vernachlässigbar. In Konferenzen sitzen plötzlich Leute mit am Tisch, deren Eltern man sein könnte, und nein, es sind keine Praktikanten.«
Anja Jardine2
Den See erblickt man erst, wenn man zur Mitte des Hochplateaus gelangt ist. Eingerahmt von lichten Lärchenwäldern und dahinter schroff aufragenden Felswänden, liegt er ruhig und dunkel inmitten der Ebene: der Lai Nair, der schwarze See. Seinen Namen hat der Moorsee von der Farbe des Wassers, das je nach Lichtverhältnissen goldbraun bis tiefschwarz schimmert. Das Hochmoor liegt im Schweizer Engadin in einer Senke am Fuß des Piz Pisoc und gibt den Blick frei auf die Gebirgsgruppe der Silvretta, die sich vor zweihundert Millionen Jahren aus Meeresablagerungen an die Oberfläche wölbte. Die ganze Schönheit der Landschaft ist geprägt vom Werden und Vergehen: Im sauren Boden zersetzen sich die abgestorbenen Pflanzen nur langsam und bilden eine Torfschicht, die Jahr für Jahr rund einen Millimeter wächst. Auf dem fruchtbaren Untergrund wachsen immer neue Birken und Föhren, Heidelbeeren und Alpenrosen — der perfekte Lebensraum für Insekten, Schmetterlinge und Vögel, die hier oben ihre Runden drehen.
Ich weiß nicht, wie oft ich den Weg bereits gegangen bin, der auf die Hochebene führt. Ich erinnere mich an das Gefühl als Kind, wie das hohe Gras an den nackten Beinen kitzelte und uns hier und da eine Brennnessel erwischte, wenn wir den Waldweg emporrannten, anstatt langsam zu gehen und auf das Gestrüpp zu achten. Ich erinnere mich auch an die erlösende Kühle im Sommer, wenn wir verschwitzt vom Aufstieg in den Moorsee glitten. Später ging ich mit meinen Kindern denselben Weg, erzählte ihnen Geschichten, um sie davon abzulenken, dass sich der Weg noch eine Weile durch den Wald schlängeln würde. Heute rutscht nur noch dann und wann eine kleinere Hand in meine, warm wie ein weiches Tier. Meist wandern die nun groß gewordenen Kinder voraus und hüpfen geschickt über Wurzeln und umgefallene Bäume. Öfters aber gehe ich inzwischen allein oder in Gesellschaft von Freundinnen und Freunden, froh, nicht jeden Gedanken nach zwei Wendungen unterbrechen zu müssen, manchmal aber auch wehmütig, dass kein Kind mehr zum Weitergehen ermuntert werden muss.
Beim See angekommen, ist der Blick damals wie heute atemberaubend. Wie oft werde ich noch hier stehen und über die vollkommene Schönheit dieser Landschaft staunen? Im Vergleich zum Alter dieses Fleckens ist mein Verbleib auf Erden unfassbar kurz, ein belangloser Wimpernschlag der Ewigkeit, mehr nicht. Manchmal finde ich das tröstlich, weil es mir Distanz schenkt zum eigenen Leben. All die Fragen, die mich umtreiben — wogegen ich ankämpfen, was ich hinnehmen, was noch anpacken, was sein lassen soll —, all diese Fragen scheinen angesichts der zeitlichen Dimensionen der Landschaft um mich an Relevanz zu verlieren. Manchmal finde ich die Einsicht in die ungebührliche Kürze meines eigenen Lebens aber auch zum Verzweifeln, weil das Leben schön ist und ich noch so viel vorhabe — mir aber die Zeit davonzulaufen scheint. Werde ich achtzig Jahre alt, bleiben mir heute noch 1560 Wochen. Das scheint mir erschreckend wenig.
Als ich in meinem Freundeskreis von meiner Arbeit an einem Buch über die Lebensmitte zu erzählen begann, gaben sich einige erstaunt: So alt bist du doch noch nicht! Dabei habe ich, betreiben wir reine Statistik, die Hälfte meines Lebens längst hinter mir. Mit meinem Jahrgang und Wohnort habe ich die Schwelle an meinem neununddreißigsten Geburtstag passiert. Vermutlich waren die Reaktionen schmeichelhaft gemeint: Zwar wollen die meisten alt werden, also ein langes Leben vor sich haben — aber niemand möchte älter werden, zumindest nicht mehr ab einem bestimmten Alter. Einige waren auch peinlich berührt: ein Selbsthilfebuch gegen die »midlife crisis«, eine Art Anleitung für die Wechseljahre? Auch solche Reaktionen überraschten mich. Ich habe die Lebensmitte bis jetzt selten als peinlich oder unangenehm empfunden. Irritierend finde ich eher, dass irgendwann ab dreißig bei jedem Geburtstagsfest irgendein Spaßvogel verlässlich sein Glas hebt und mit dem Geburtstagskind auf ein fiktives Alter anstößt, das es längst hinter sich gelassen hat. Wenn es für die Pubertät zuweilen heißt, sie beginne, wenn die Eltern schwierig werden, gilt für die Phase der mittleren Jahre offenbar, dass sie anfängt, wenn andere einen jünger reden, als man ist — und das als Kompliment verstehen.
Dabei kommen mir meine frühen Erwachsenenjahre im Rückblick um einiges beschwerlicher vor als die Zeiten, in denen ich mich heute befinde. Beruflich war zwischen zwanzig und Mitte dreißig noch vieles offen, um nicht zu sagen: unfertig. Die Konkurrenz in den Bereichen, die mich beruflich interessierten, war hart, die meisten mir vorschwebenden Stellen waren befristet. Ich erwog, mich ins Ausland zu bewerben, um noch etwas von der Welt zu sehen und meine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Zugleich hatte ich das jahrelange WG-Leben eben erst gegen die erste eigene Wohnung eingetauscht und genoss meine Freiheit in vollen Zügen. Allerdings wollte ich auch nicht für immer allein leben. Die Frage nach eigenen Kindern begann mich umzutreiben, und ich fürchtete das viel zitierte Ticken der biologischen Uhr. Es kam mir vor, als müsste ich unzählige Dinge gleichzeitig tun und als würden die Ansprüche, denen ich gerecht werden sollte, zu haushohen Türmen anwachsen, zwischen denen ich ängstlich saß und immer weniger wusste, was ich selbst wollte.
Je mehr ich dann später auf die vierzig und damit auf die statistische Mitte zuging, umso klarer konturiert erschien mir dagegen mein Leben. Einige Fragen hatten sich mittlerweile erledigt, zahlreiche Entscheidungen hatte ich unumkehrbar getroffen. Die Schriftstellerin Lindsey Mead schreibt: »Jetzt, wo wir in den Vierzigern sind, sind viele der Fragen, die uns in früheren Jahrzehnten beschäftigt haben, beantwortet. Das ist natürlich wunderbar und traurig zugleich, denn mit den Antworten schließen sich auch Türen.«3 Die sich allmählich schließenden Türen lösten bei mir aber nur selten Angst oder Schmerz aus. Ich stellte sie mir stets als hinter mir liegend vor, während ich vorwärtsschreitend in neue Räume eindrang, die ich meist freudig gegen das eintauschte, was mir zeitgleich entschwand.
Das hat sich seither nicht entscheidend verändert. Zwar vermisse ich heute bereits einen Menschen schmerzlich, der unerwartet früh verstorben ist — der Tod hat Einzug gehalten in mein Leben. Und während sich befreundete Paare bei Partys früher noch aufteilten, um die Kinderbetreuung zuhause sicherzustellen, sind einige von ihnen mittlerweile für immer getrennt. Bei Einladungen gilt es nun, auf Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Das Leben erscheint mir heute definitiv brüchiger als noch mit dreißig, aber in vielerlei Hinsicht auch tiefer und kostbarer. Immer stärker begann mich angesichts dessen in den letzten Jahren die Frage umzutreiben, worin die empfundene Kostbarkeit und Tiefe bestehen und was wir womöglich gewinnen, wenn wir älter werden. Denn hoffentlich summieren sich die Jahre nicht nur, sondern es lässt sich in ihnen und vor allem auch an ihnen reifen. Bloß: Was bedeutet das eigentlich, und wozu reifen wir in unseren mittleren Jahren heran?
Natürlich gehören zu dieser Lebensphase auch schmerzliche Momente, die mit der schlichten Tatsache zu tun haben, dass das Älterwerden auch körperlich spürbar wird: Wer kann mit Mitte vierzig noch problemlos Nächte durchfeiern und anderntags taufrisch am Schreibtisch sitzen? Die Vorstellung, nur mit Zelt und Schlafsack loszuwandern, hat zwar nach wie vor etwas Romantisches, in erster Linie aber etwas Unbequemes. Und wird einem in der Drogerie plötzlich ein Muster für eine Pflege für »reife Haut« überreicht, ist das zugegebenermaßen nicht der erbaulichste Moment des Tages. Zwar heißt es lapidar, das Beste komme zum Schluss. Aber das stimmt wohl nur, wenn man sich das Leben wie ein orchestriertes Feuerwerk denkt, in einer bombastischen Steigerung, das seinen Höhepunkt im Finale erreicht. In aller Regel macht das pralle Leben mit zunehmendem Alter aber eher dem Leisen und Zerbrechlichen Platz, was sich zwar im Einzelfall als perfekte Vollendung entpuppen kann, mitten im Leben aber selten als erstrebenswertes Ziel erscheint, auf das wir begeistert zusteuern. Wer das Leben liebt, wird öfters bedauern, dass es allmählich, aber unwiederbringlich vorüberzieht und das Reservoir an noch verbleibenden Jahren schwindet.
Allerdings spreche ich, wenn ich »Lebensmitte« sage, nicht vom hohen Alter. Noch bleibt den meisten, die in dieser Lebensphase stecken, sehr viel Zeit. Sind wir nicht mit einer schweren Diagnose konfrontiert und müssen akzeptieren, dass wir die Lebensmitte rein numerisch dadurch viel früher hinter uns gelassen haben, ohne uns dessen bewusst gewesen zu sein, haben wir hoffentlich noch viele Jahre vor uns, in denen wir uns vom Leben mitreißen und verführen lassen können.
Weitermachen oder umsatteln?
Paradoxerweise erfüllt diese Vorstellung nicht alle mit Begeisterung. Manche fühlen sich gerade angesichts der vielen Jahre, die relativ unverplant vor ihnen liegen, eher von bohrenden Fragen belästigt. Für sie bestand das Hauptziel vielleicht lange Jahre darin, sich zu etablieren, einem soliden Gebäude gleich, das in der Landschaft des Lebens befestigt werden muss. Doch was, wenn einem die Landschaft, in die man nun gestellt ist, nicht länger gefällt? Soll man dennoch weitermachen, noch zehn, zwanzig Jahre — oder das Leben noch einmal umkrempeln, noch einmal ganz woanders anknüpfen, sich in unbekannte Gefilde vorwagen? Und selbst wenn alte Liebe, wie man sagt, nicht rostet — reicht das wirklich als Argument, um in einer Beziehung auszuharren? Oder gäbe es weitere Orte des Begehrens, die uns neu und anders erfüllten und die zu entdecken wir jetzt gern auszögen?
Man liest ja immer wieder von Leuten, die mitten im Leben nochmals umgesattelt haben: der Priester, der sich outet; die Büroangestellte, die bei einer Castingshow den ersten Preis gewinnt und mit sechzig einen Plattenvertrag in der Tasche hat; das Paar, das alles verkauft und auswandert und am Ende der Welt eine neue Existenz aufbaut. Sicherlich faszinieren solche Geschichten auch, weil wohl stimmt, was die Hauptfigur Magda in Margriet de Moors Roman Erst grau dann weiß dann blau als Erkenntnis festhält: »Ich habe festgestellt, dass sich ganz in der Nähe des Lebens, in dem man zufällig gelandet ist, ein anderes befindet, das man seelenruhig genauso gut hätte führen können.«4 Das Vexierspiel mit alternativen Existenzen hat etwas Befreiendes: Könnte es, könnte ich nicht ganz anders sein?
Rein theoretisch könnte ich ja durchaus noch die Welt umsegeln, auf eine Alp ziehen oder Medizin studieren. Solche Gedanken wirken heute allerdings seltsam abstrakt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt sind die meisten zu sehr in ihre Leben eingebunden, um alles umzukrempeln. Das gilt erst recht, wenn sie in prekären Verhältnissen leben oder sozial benachteiligt sind und ohnehin kaum Chancen haben, sich frei zu entwerfen, weil ihnen die Mittel und Möglichkeiten dazu fehlen. In sicheren Bahnen zu navigieren vermag zwar, zumindest wenn es selbstgewählt ist, eine befreiende Ruhe ins Leben zu bringen und Raum zu schaffen für eine stille Souveränität, die ich gerade an älteren Menschen so bewundere. Solche Ruhe kann sich aber auch in eine schmerzhafte Starre verkehren, wenn sich die sichere Bahn wie eine klebrige Spurrille anfühlt, aus der man sich Runde für Runde nicht lösen kann. Wie findet man dann die Kraft, sich doch noch einmal loszureißen? Oder ist es klüger, sich mit der Situation zu arrangieren?
All diese Themen und Fragen machen die mittleren Jahre philosophisch relevant: Was ist das für eine Zeit, in der man untrüglich feststellt, dass man älter wird und einige Optionen unwiederbringlich entschwunden sind? Welche Fragen sind mit dem Umstand verbunden, dass man bestimmte Züge genommen, andere ausgelassen oder für immer verpasst hat? Wie gelingt ein produktiver Umgang mit dem Bedauern, das sich angesichts vertaner Chancen einstellen kann? Welchen Preis bezahlen wir, wenn wir doch noch umsteigen und alles hinter uns lassen — und wie lässt man alles hinter sich, ohne sich selbst dabei zu verlieren? Was, wenn wir uns fremd fühlen in der Landschaft des eigenen Lebens und feststellen: Wir kennen uns im eigenen Dasein und mit dem, was wir geworden sind, nicht mehr aus?
»Wenn mehr Zeit hinter einem liegt als vor einem, beginnt man, wenn auch widerwillig und unvollständig, einige Bewertungen vorzunehmen«, schreibt der Schriftsteller James Baldwin. »Zwischen dem, was man werden möchte, und dem, was man geworden ist, klafft eine tiefe Lücke, die sich niemals schließen wird. Und diese Lücke scheint der letzte Spielraum, die letzte Gelegenheit zur Gestaltung zu sein. […] Einige von uns sind gezwungen, in der Mitte ihres Lebens eine Studie über diese verwirrende Geografie zu machen.«5 Dieses Buch unternimmt den Versuch, dieser verwirrenden Geografie Kontur zu geben, die Landschaft philosophisch zu kartografieren und Orientierungshilfe zu schaffen, um den eigenen Weg freizulegen und umso entschlossener einzuschlagen.
Existentielle Umbrüche
Eine solche Kartografie muss sicher damit beginnen, die Landschaft abzustecken: Was genau verstehen wir unter der Region der mittleren Jahre? In Mitteleuropa sind wir im Schnitt knapp vierzig, wenn die numerische Hälfte unserer Lebenszeit hinter uns liegt. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die entwicklungspsychologische Phase der mittleren Jahre, die meist etwa zwischen rund vierzig und fünfundsechzig verortet wird, mit ausgefransten Enden zu beiden Seiten hin.6 Sie endet mit dem frühen Alter irgendwann ab Mitte sechzig, bevor wir ab achtzig ins hohe Alter als letzter Lebensphase eintreten.7
Der wohl bekannteste literarische Held der Lebensmitte dürfte Dante Alighieri sein. Er schildert sich in seiner Göttlichen Komödie aus dem Jahr 1321 als Fünfunddreißigjährigen, der sich in der Mitte seines Lebens — »nel mezzo del cammin« — in einem dunklen, wilden Wald verirrt. Er ist vom rechten Weg abgekommen, wie Dante schreibt, und hat keine Ahnung, welcher Pfad aus dem dunklen Gehölz führen könnte. Wohin sein Blick auch geht — nichts als hoch aufragendes dorniges Gestrüpp. Auf dem Weg, den er schließlich einschlägt, wird er zu allem Übel von wilden Tieren bedroht, die ihm den Durchgang versperren. Weitergehen wie bisher ist für Dante keine Option. Vielmehr muss er sich in der Mitte seines Lebens mit der »verwirrenden Geografie« seiner Existenz abfinden und sich seinen brodelnden Fragen und Ängsten stellen. Aber er hat Glück: Der römische Dichter Vergil erscheint ihm und bietet an, ihn aus dem finsteren Wald zu führen.
Auch wenn sich die numerische Lebensmitte inzwischen später einstellt als noch im vierzehnten Jahrhundert, wird damals wie heute mit dieser Phase ein existentieller Umbruch assoziiert. Dantes Epos ist nur eines von vielen Beispielen, die davon zeugen.8 Der Literaturprofessor William Stoner aus John Williams’ gleichnamigem Roman von 1965 stellte mit zweiundvierzig fest, dass er nichts vor sich sah, »auf das er sich zu freuen wünschte, und hinter sich nur wenig, woran er sich gern erinnerte«.9 Die Philosophin Simone de Beauvoir bezeichnet es als »Albtraum, älter als fünfzig zu sein«, und fühlt sich in diesem Alter, als hätte das Sterben schon begonnen: »Das hatte ich nicht vorausgesehen — daß es so früh beginnt und daß es so weh tut.«10 Und Leo Tolstoi beschreibt in seiner autobiografischen Rückschau die eigene Lebensmitte sogar ganz ähnlich wie Dante in seiner Göttlichen Komödie als ein Sich-Verlaufen in der Wildnis: »Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage des Lebens habe ich das gleiche Gefühl wie ein Mann, der sich im Wald verirrt hat. Er tritt auf eine Lichtung hinaus, klettert auf einen Baum und erblickt einen grenzenlosen, unendlich großen Raum, aber nirgends ist ein Haus zu sehen, und es kann dort auch keines geben.«11 Für Tolstoi gleicht seine Lebenskrise einem angsterfüllten Blick vor und zurück: hinter sich ein ruhmvolles Leben, Bekanntheit, aber auch Stolz und Überheblichkeit, für die er sich schämt; vor sich ein Leben, vor dem er sich ekelt, weil er dessen tieferen Sinn nicht zu erkennen vermag; und nirgends ein schützendes Haus, in das er sich verkriechen könnte. Wer sollte angesichts solcher Gefühle nicht in Panik verfallen?
Heute würde man vielleicht sagen, Tolstoi hatte eine »midlife crisis«. Dieser Begriff geht ursprünglich auf den kanadischen Psychoanalytiker Elliott Jaques zurück, der 1965 beobachtete, dass viele Künstler — er nennt unter anderem den Maler Paul Gauguin, den Dichter Franz Grillparzer oder den Komponisten Ludwig van Beethoven — im mittleren Alter eine entscheidende Persönlichkeitsveränderung durchmachten, die auch ihre Schaffenskraft beeinträchtigte.12 Ob es die »midlife crisis« als statistisch auszuweisende Größe wirklich gibt, ist indes umstritten. Krisenfreie Biografien lesen sich bekanntlich weniger flott, ein bisschen Abgrund und Drama schmeicheln jedem Genie. Die eine oder andere Krise dürfte also von der Nachwelt noch hinzugefügt oder ausgeschmückt worden sein. Wissenschaftlich scheint sich nicht abschließend erhärten zu lassen, dass das mittlere Erwachsenenalter stärker von belastenden Transitionen überschattet wird als andere Lebensphasen. Vielmehr gibt es in jedem Altersabschnitt herausfordernde Veränderungen, etwa in der Jugend den Wechsel von der Kindheit ins Erwachsenenleben oder später den Übergang vom Arbeitsleben ins Rentenalter.13
Auch die oft zitierte U-Kurve der Lebenszufriedenheit wird heute differenzierter diskutiert und vor allem flacher gezeichnet. Diese Kurve besagt, dass die individuelle Lebenszufriedenheit über viele Kulturen hinweg in der Lebensmitte eine Talsohle erreiche, bevor sie allmählich wieder ansteige bis zu einem Knick im hohen Alter, wenn Freunde oder Partnerinnen sterben oder sich die eigene Gesundheit markant verschlechtert.14 Die Senke zwischen vierzig und fünfzig Jahren wird damit erklärt, dass in den mittleren Jahren Lebensträume womöglich für immer platzen und die Bilanzierung im Rückblick weniger rosig ausfällt, als erhofft. Nach einer Scheidung, einer schweren Diagnose oder einer Kündigung gilt es außerdem, sich neu aus- und einzurichten, und das kostet Mühe und Energie. Dazu kommt, dass viele in dieser Lebensphase am Arbeitsplatz und zuhause mit der Betreuungsarbeit von Kindern und eigenen älter werdenden Eltern über Gebühr belastet sind. Wie sich die Zufriedenheit im Lauf eines Lebens verändert, hat dabei nicht allein mit dem Alter der Betroffenen zu tun, sondern auch mit gesellschaftspolitischen Entscheidungen mit Blick etwa auf die außerfamiliäre Betreuung eigener Kinder oder pflegebedürftiger Eltern: Ist man bei der Bewältigung derart anspruchsvoller Zeiten auf sich allein gestellt, dürfte die Lebenszufriedenheit eher einbrechen, als wenn sich die Belastungen teilen oder zeitweise delegieren lassen.
In einem vieldiskutierten Beitrag in der New York Times wurde kürzlich die These vertreten, dass die Wahrscheinlichkeit einer »midlife crisis« nicht zuletzt davon abhänge, welcher Generation jemand angehöre. Gegenwärtig kommt die Generation der Millennials in der Lebensmitte an — und diese könne sich, anders als Generationen vor ihnen, eine Krise gar nicht leisten. Sinnfragen seien nämlich existentiellen Nöten nachgelagert, und davon hätten die Millennials eine Menge, weil sie sich in unsicheren Jobs wiederfänden, mit der Inflation und Wohnungsknappheit kämpften und anlässlich der Klimakrise von Zukunftssorgen geplagt seien. In einer Umfrage der Zeitung gaben viele Vierzigjährige zu Protokoll, sie hätten schlicht keinen Anlass für eine »midlife crisis«, weil sie das »bourgeoise Taubheitsgefühl« der totalen Übersättigung nicht kennen würden, gegen die mit einer solchen Krise opponiert würde. Statt sich nach Abenteuer und Freiheit und nach dem Ausbruch aus dem Ewiggleichen zu sehnen, wünschten sie sich vielmehr Ruhe, Sicherheit und Stabilität — Dinge, die ihnen bisher nicht vergönnt gewesen seien.15
Diese Kritik ist nicht neu. Die »midlife crisis« wurde immer wieder als chauvinistische Entschuldigung gut verdienender Männer gebrandmarkt, die sich in eine junge Frau verlieben, einen Porsche anschaffen oder einen Ironman-Triathlon laufen wollen, sobald sie mit dem Älterwerden hadern. Auch in Elliott Jaques’ Arbeit aus den 1960er Jahren tummeln sich fast ausnahmslos äußerst erfolgreiche Männer, die sich in der Lebensmitte plötzlich fragen, ob es das jetzt schon war. Zweifelsohne spiegeln nicht wenige dieser Erzählungen ein saturiertes, großbürgerliches Leben, das für viele ohnehin unerreichbar bleibt.
Aber zum einen fragen sich sicher auch Menschen in prekären Verhältnissen in den mittleren Jahren, ob sich das Rackern irgendwann auszahlt oder das verheißungsvolle Leben demnächst noch anbricht, ob sie noch einmal etwas Neues wagen oder sich einrichten sollen im Immergleichen, das zwar wenig Sensation, dafür wenigstens Stabilität verspricht. Den Begriff der »midlife crisis« erst richtig bekannt gemacht hat pikanterweise — und oft übersehen — ein feministischer Bestseller: das 1976 erschienene Buch Passages. Predictable Crises of Adult Life der New Yorker Journalistin Gail Sheehy.16 Sie thematisierte in diesem Buch als eine der Ersten den weiblichen Bedeutungsverlust in den mittleren Jahren, das Unsichtbarwerden, von dem so viele Frauen immer wieder geschrieben und berichtet haben, nicht zuletzt auch Simone de Beauvoir. Es war Sheehys Verdienst, diese Krise als eine Phase der Bilanzierung und in der Folge als Phase des Um- und Aufbruchs herauszuarbeiten, die sich in jener Zeit bei Frauen und Männern in ihren jeweiligen traditionellen Geschlechterrollen gegensätzlich vollzog. Während viele Frauen genug hatten von ihrem Hausfrauendasein und sich nach Neuorientierung außer Haus sehnten, blieben Männer häufig unbefriedigt zurück, weil sie zwar vieles erreicht hatten, ihr Leben ihnen aber dennoch seltsam leer vorkam.17
Zum anderen wird in der Kritik an der »midlife crisis« die Krise zu Unrecht auf das Gefühl einer stupiden Sattheit reduziert, wie sie mitnichten alle empfinden müssen. Vor allem fängt die Kritik nicht annähernd ein, worum es bei den existentiellen Fragen in dieser Lebensphase geht. Die Krise oder auch einfach nur das mulmige Gefühl, das viele in den mittleren Jahren dann und wann befällt, kann weit nuancierter und tiefgründiger ausfallen, als es in den flapsigen Bemerkungen zum Kauf von Motorrädern oder zum Tragen von Sneakern und Hoodies bei der Arbeit zuweilen den Anschein macht. Viel eher speist es sich aus dem Umstand, dass Menschen in der Lebensmitte zeitgleich im retrospektiven wie im prospektiven Modus leben: dass sie also zurückblicken und bilanzieren und darob ins Sinnieren geraten — und zugleich nach vorn schauen und prüfen, welche Neuorientierungen ihnen mit Blick auf die Zukunft noch offenstehen.18
Das Leben als Treppe
Im Haus meiner Kindheit hingen Replikate der bekannten Bilder »Das Stufenalter des Mannes« und »Das Stufenalter der Frau« des Malers Fridolin Leiber aus dem neunzehnten Jahrhundert. Sie stellen das menschliche Leben als eine steil auf- und absteigende Treppe dar, beginnend mit der Geburt und endend mit dem Tod.19 Der oberste Absatz ist mit dem fünfzigsten Lebensjahr markiert. Die Bilder haben sich mir tief eingeprägt: Mit vierzig hält der Mann eine Urkunde in den Händen, darunter ist zu lesen: »Mit vierzig Jahr am Ziel der Bahn, / Ohn’ Furcht er sagt: s’ist wohlgethan.« Er blickt entschlossen in die Weite, und man sieht ihm seinen Stolz an. Die Frau gibt im gleichen Alter ihren jugendlichen Kindern den Segen, den Blick demütig gesenkt. Dieselben Rollenbilder mit fünfzig: Der Mann überblickt sichtlich zufrieden seinen Aufstieg und »prüft was kommt und was entschwand«, während sich die Frau an der Geburt eines Enkelkindes freut: »Mit fünfzig ›Stillstand‹ wie man sagt, / Ein Enkel sie jetzt glücklich macht.« Erst nach dem obersten Treppenabsatz beginnen sich die Bilder anzugleichen: Beide Treppen führen steil nach unten, Kleider und Haare werden graubraun, und ich kann mich an nichts Nennenswertes erinnern, was sich auf der rechten Bildhälfte noch abgebildet gefunden hätte. Die zweite Hälfte des Lebens barg in jener Vorstellung offenbar kaum noch Veränderungen, sondern führte über Jahre des Verlusts und der Gebrechlichkeit direkt in den Tod, auf derselben Ebene wie die Geburt angeordnet. Der Lebenskreis schloss sich.
Solche Darstellungen muten heute veraltet und fürchterlich stereotyp an. Schon als Kind befremdeten sie mich, zumal ich mich vor der Zeichnung von Gevatter Tod fürchtete, der an der untersten Treppenstufe die Greise in Empfang nahm. Selbst zu ihrer Entstehungszeit dürfte sich kaum ein Lebenslauf exakt an diese Bilder gehalten haben, zumal sie ausschließlich gutbürgerliche Existenzen spiegelten, die ins Schema der heteronormativen Großfamilie passten.
Mittlerweile haben sich unsere Lebensläufe umfassend pluralisiert und individualisiert. Den Aufstieg nehmen heute viele gemächlicher: Sie reisen oder jobben, bevor sie einen festen Arbeitsvertrag unterzeichnen oder ein Studium in Angriff nehmen, und sie leben in offenen oder wechselnden Beziehungen, ehe sie sich, wenn überhaupt, längerfristig binden. Auch der Arbeitsmarkt hat sich verändert und verlangt ein stetes Umlernen. Wer zu lange auf einer Stelle bleibt, gilt unter Umständen plötzlich nicht mehr als loyal, sondern als wenig experimentierfreudig. Der Abstieg wiederum verläuft auch nicht mehr so rasant, wie die zyklischen Stufenbilder suggerieren. Pensionäre machen sich selbständig als »Senior Consultants«, leisten wertvolle Freiwilligenarbeit oder Care-Arbeit oder unternehmen ausgedehnte Reisen. Der medizinische Fortschritt und die längere Lebensspanne stellen das Bild der steil auf- und absteigenden Lebenstreppe zusätzlich in Frage. Eine über Siebzigjährige kann heute durchaus in der Lage sein, noch einen Marathon zu laufen oder Höhentouren zu unternehmen.
Die Stufen der menschlichen Biografie sind in unserer Zeit und Kultur also nicht nur weitaus flacher angeordnet als früher, sondern manche wechseln auch in beide Richtungen zwischen ihnen hin und her. So wird vielleicht ein Mittfünfziger mit einer neuen Partnerin noch einmal Vater und macht seine bereits erwachsenen Kinder zu Halbgeschwistern, oder eine Bankerin entscheidet sich mit vierzig, ihren Job für immer an den Nagel zu hängen und fortan als Frühstrentnerin von ihrem Vermögen zu leben. Ein Stück weit scheinen wir sogar fast auf dem Weg in eine »altersirrelevante Gesellschaft«20 zu sein, in der wir die Chronologie unseres Lebens immer mehr nach eigenem Gutdünken gestalten und das Lebensalter einer Person an gesellschaftlicher Aussagekraft einbüßt.
Und trotzdem wirken die alterstypischen sozialen Normen, wie sie in den Stufenbildern zum Ausdruck kommen, in unseren Köpfen weiter, und die Vorstellung, dass das ideale Leben einer inneren Ordnung zu folgen habe, die nicht ohne Not durcheinanderzubringen ist, prägt unseren Blick auf andere Biografien unbewusst nach wie vor. In einem bestimmten Alter noch bei den Eltern zu wohnen, keiner geregelten Arbeit nachzugehen, schon Anfang zwanzig geheiratet oder mit vierzig noch keine eigenen Kinder bekommen zu haben, sorgt zumindest in einigen Kreisen weiter für Stirnrunzeln.21 Und auch wenn die neunundsiebzigjährige Maude Kult ist, die im Film Harold and Maude von 1971 den zwanzigjährigen Harold liebt, würde sie im realen Leben kaum goutiert — schon gar nicht in dieser Rollenverteilung. Während Männer oft Verständnis oder gar Bewunderung ernten, wenn sie in der Lebensmitte eine Beziehung zu einer deutlich jüngeren Frau eingehen, werden Frauen, die mit einem jüngeren Mann einen zweiten Frühling erleben, weit kritischer gesehen. Wie schon die Kulturkritikerin und Autorin Susan Sontag betonte, gilt für Frauen im Vergleich zu Männern »zweierlei Maß«, wenn sie älter werden, ein »double standard of aging« also.22
Doch selbst wenn wir solche Stereotype kritisch sehen und in heutigen Haushalten zum Glück keine antiquierten Stufenbilder mehr hängen, lässt sich die Chronologie eines Lebens nicht beliebig durcheinanderbringen. Auch in einer weitgehend liberalisierten Gesellschaft gibt es feste Abfolgen innerhalb eines Lebensvollzugs, die für alle gelten: im Recht etwa das Erlangen der individuellen Mündigkeit, die man je nach Land zwischen sechzehn und zwanzig erreicht, oder der Eintritt ins Rentenalter irgendwann mit Mitte sechzig. Zudem lässt sich die biologische Uhr nicht gänzlich eigenhändig stellen: Wann die Zeit der Fruchtbarkeit beginnt und wann sie endet, wie schnell Zellen, Gewebe und Knochen altern, kann bis zu einem gewissen Grad durch den Lebensstil beeinflusst werden, ist aber zu einem großen Teil durch unsere Gene festgelegt. Nicht alles hat also die Zeit, die wir ihm als Stempel aufdrücken möchten, sondern vieles hat auch eine Eigenzeit, die sich nicht nach unseren Wünschen richtet, sondern nach eigenem Takt voranschreitet. Vor allem aber ist der biografische Lebensvollzug selbst, die Art und Weise also, wie wir unser Dasein organisieren, im eminenten Sinn ein zeitlicher. Dies wiederum hängt nicht nur damit zusammen, dass wir wie alle Tiere altern, und zwar vom ersten Atemzug an, sondern hat seinen Grund insbesondere darin, dass wir als einzige Tiere um dieses Altern und letztlich auch um das eigene Ende wissen.
Das Leben gestalten
Tatsächlich bringen wir Menschen das Leben nicht einfach zu, verharrend in einer zukunftslosen und vergangenheitsvergessenen Gegenwart. Vielmehr führen und gestalten wir es mit Zugriff auf die Zukunft, indem wir planen, entwerfen, verwerfen, justieren, hoffen.23 Während wir früher mehr oder weniger fremdbestimmt den vorgegebenen Stufen einer Treppe zu folgen hatten, eröffnen sich heute vielen von uns weite Entscheidungs- und Handlungsspielräume. Die dadurch entstehende Freiheit überträgt uns aber auch die Verantwortung, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und selbst zu gestalten.24 Unser Leben lebt sich nicht »von selbst«25, sondern es stellt sich uns als eine Aufgabe dar, in der wir als aktiv Gestaltende gefragt sind.
Dabei ist die Zeitdimension stets präsent: Was wir heute entscheiden, entscheiden wir auch mit Blick auf die Folgen, die wir bestmöglich zu antizipieren versuchen, und wir verantworten und baden aus, was wir in der Vergangenheit getan und unterlassen haben. Aber nicht nur, dass wir unser Leben zeitlich strukturieren, sondern auch, dass unser Leben endet, ist von großer Bedeutung für den eigenen Lebensvollzug. Ohne diese zeitliche Begrenztheit würde die Frage, wie zu leben sei, ihre Dringlichkeit nämlich zumindest ein Stück weit verlieren. Erst die Kürze des Lebens zwingt uns offenbar zur Priorisierung und zum Nachdenken über einen sinnvollen biografischen Spannungsbogen, ansonsten ließe sich alles, was wir begehren und erreichen wollen, stets von Neuem auf später verschieben. Angesichts unserer Sterblichkeit ist die Frage nach dem guten Leben immer auch eine danach, »wie wir die begrenzte Lebenszeit am besten verbringen können«.26
Diese Frage spitzt sich in der Lebensmitte gleich doppelt zu: Erstens sind diese Jahre oft eine Zeit der Bilanzierung, in denen sich für die einen erfüllt, worauf sie gehofft und hingearbeitet haben. Sie sind zufrieden auf ihrer Hochebene unterwegs und können aus dem Vollen schöpfen. Für andere fällt die Bilanzierung weniger glücklich aus: Sie realisieren allmählich, dass der Plan des eigenen Unternehmens zwar reizvoll, aber nicht von Erfolg gekrönt war, dass die Ehe für immer gescheitert oder ihre Ausbildung auf dem heutigen Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt ist.27 Ihr Lebensgefühl gleicht dann womöglich jenem, das Friedrich Hölderlin in seinem Gedicht »Hälfte des Lebens« von 1804 so drastisch beschrieben hat: Zeichnet er die Landschaft in der ersten Strophe noch als eine Idylle, in der es an nichts mangelt — die Bäume tragen im Gedicht gelbe Birnen, es blühen wilde Rosen und auf dem »heilignüchterne[n] Wasser« schwimmen »holde Schwäne« —, kommt es in der zweiten Strophe zu einem jähen Bruch, wenn der Winter über das Land zieht und das harmonische Dasein erbarmungslos zerschlägt: »Weh mir, wo nehm’ ich, wenn / Es Winter ist, die Blumen, und wo / Den Sonnenschein […]?«, heißt es nun klagend. Es bleibt lediglich die stumme Einsicht: »Die Mauern stehn / Sprachlos und kalt, im Winde / Klirren die Fahnen.«
Vielleicht steht der Wintereinbruch für die Einsicht, dass unsere Lebenszeit befristet ist? Ihr entspräche die zweite in den mittleren Jahren spürbar werdende Zuspitzung: Je mehr Jahre verstreichen, während wir darauf hoffen, dass es beruflich vorangeht, wir eine Partnerin finden oder endlich etwas mehr zur Ruhe kommen, umso stärker wird die Zeitlichkeit unseres Lebens als Endlichkeit spürbar. Es wird uns deutlich, dass wir nicht ewig Raum haben, das umzusetzen, was wir eigentlich wollten und vielleicht immer noch ersehnen. Insofern ist die Mitte des Lebens auch besonders anfällig für Bedauern und Reue: Was sich in jungen Jahren stets auf später verschieben ließ, muss man sich ab einem bestimmten Punkt vielleicht definitiv abschminken.
Selbst wer nichts bereut und eigentlich zufrieden und glücklich sein könnte, weil sich das Leben ganz nach Plan oder noch weitaus schöner entfaltet hat, kann in den mittleren Jahren eine gewisse Leere verspüren. So lange hat man auf ein Ziel hingearbeitet und sich die Zukunft in buntesten Farben ausgemalt. Und mit einem Mal scheint alles erreicht und abgehakt. Was nun? Lange Zeit lebt sich das Leben ja — anders als vorhin behauptet — doch von selbst! Zumindest die jungen Jahre sind oft geprägt von Ereignissen, die sich mehr oder weniger ohne unser Zutun einstellen. Vieles war außerdem aufregend und oft von Applaus begleitet: der Schulabschluss etwa, Ausbildung oder ein Unidiplom, die erste große Liebe, vielleicht ein Kind. In der Lebensmitte hingegen gilt es, die Ziele eigenmächtig festzulegen, denn sie ereignen sich immer seltener von selbst. Wer sich keine neuen Ziele zu setzen vermag und der kreativen Selbstfindung ermüdet ist, empfindet in der Lebensmitte deshalb möglicherweise eine gähnende Langeweile, wie die Romanfigur des bereits erwähnten William Stoner, der nichts vor sich sah, »auf das er sich zu freuen wünschte«28. Stoners Ehe ist zu diesem Zeitpunkt gescheitert, seine Affäre beendet, seine universitäre Karriere stagniert. Vor ihm liegt das Ödland, das sich »Weiterleben« nennt — der monotone Alltag der immer gleichen Repetition, die die Sinnfrage an die Oberfläche schwemmt: Wozu lebe ich dieses Leben, und was will ich mit den Jahren anfangen, die mir bleiben?
Fragen in der Lebensmitte
Dieses Buch dringt mit der Absicht ins Dickicht der Lebensmitte vor, es philosophisch zu ergründen. Gerade weil die entsprechenden Fragen existentieller Natur sind, ist umso erstaunlicher, dass die Lebensmitte bisher nahezu philosophisches Niemandsland ist und sich kaum ein philosophisches Sachbuch explizit dieser Phase widmet.29 Zwar gab es sporadisch Philosophinnen und Philosophen, die aus persönlicher Sicht von den Turbulenzen berichteten, in die sie im mittleren Lebensalter gerieten, etwa John Stuart Mill in seiner Autobiographie oder Simone de Beauvoir in Der Lauf der Dinge. Für einige war die Mitte des Lebens sogar eine Zeit der persönlichen Bekenntnisse, denken wir an Augustinus oder an Jean-Jacques Rousseau. Doch ihr Nachdenken blieb stets ein selbstbefragendes, autobiografisches, das kaum allgemeine Aussagen macht oder generelle Rückschlüsse auf die spezifischen Fragen der Lebensmitte zuließe.
Die benannte Leerstelle tritt umso stärker zutage, da sie im eklatanten Gegensatz zu den vielen philosophischen Büchern steht, die sich den Randzeiten des Lebens widmen: Die Frage nach einem klugen Umgang mit dem Alter, mit der Gebrechlichkeit und dem nahenden Tod beschäftigt die Philosophie seit der Antike, und gerade in jüngster Zeit erhält sie von Neuem viel Aufmerksamkeit.30 Auch über die Frage des Lebensanfangs und der guten Kindheit und Jugend wurde in den letzten dreißig Jahren viel geschrieben.31 Über die Mitte des Lebens hingegen schweigt sich die Philosophie größtenteils aus.32
Über einzelne existentielle Fragen, die die Lebensmitte aufwirft, wurde gesondert natürlich durchaus und detailreich nachgedacht: über die Bedeutung der Sterblichkeit für ein gutes Leben etwa oder über die Frage, ob es angemessen ist, überhaupt etwas zu bedauern, das sich ohnehin nicht mehr ändern lässt, und schließlich auch über die Leere, die sich einstellen kann, wenn man endlich erreicht hat, was man wollte. Dass diese und andere Fragen bisher nicht zu einer Philosophie der mittleren Jahre zusammengefügt und als solche verhandelt wurden, hat wohl damit zu tun, dass sie nicht spezifisch für diese Lebensphase gelten. Tatsächlich kann man in jedem Alter über die menschliche Sterblichkeit nachdenken oder verpasste Chancen bedauern. Insofern kann eine Philosophie der Lebensmitte nicht mit philosophischen Fragen aufwarten, die sich exklusiv jenen stellen würden, die in etwa zwischen fünfunddreißig und fünfundsechzig Jahre alt sind.
In den mittleren Jahren stellen sich die entsprechenden Fragen aber oft mit neuer Relevanz: Die Einsicht, dass das Leben endlich ist und wir nicht ewig Zeit haben, gewinnt an Dringlichkeit, wenn sich äußere Anlässe häufen, die auf ebendiese Tatsache hinweisen. Vielleicht werden erstmals Freunde oder Freundinnen ernsthaft krank oder werden die eigenen Eltern gebrechlich. Auch mit dem eigenen Älterwerden, dem Schwinden der Kräfte beginnt man sich ab einem gewissen Alter automatisch auseinanderzusetzen: Der Optiker empfiehlt ungefragt Gleitsichtgläser, beim Ausfüllen von Online-Formularen muss man so lange scrollen, dass man sich fragt, ob der eigene Jahrgang überhaupt noch gelistet ist, und wie es Anja Jardine so schön beschreibt: »In Konferenzen sitzen plötzlich Leute mit am Tisch, deren Eltern man sein könnte, und nein, es sind keine Praktikanten.«33
Die meisten spüren spätestens jetzt, dass die Zeit vergeht — und sie ganz langsam in ihr. Wenn man versteht, dass die Zeit, die einem bleibt, begrenzt ist, mischt sich in den Blick zurück vielleicht erstmals eine gewisse Wehmut: Warum habe ich nicht mehr Ausdauer gehabt, weshalb bin ich nicht mutiger gewesen, warum habe ich nicht mehr investiert, um jetzt an einem besseren Ausgangspunkt zu stehen? Andere werden vielleicht wenig bedauern und mit ihrem Leben, wie es sich entfaltet hat, an sich zufrieden sein. Dennoch fragen sie sich möglicherweise: Wird es nun noch zwanzig, dreißig Jahre so weitergehen, mit dieser Person am Küchentisch, in dieser Wohnung, in dieser Stadt, in diesem Job?
Philosophisch über die Lebensmitte nachzudenken, bedeutet aber nicht nur, ihre Krisenanfälligkeit auszuloten, sondern ebenso, zu verstehen, was diese Lebensphase zu einer Zeit der reichen Fülle werden lässt. Denn obwohl von den mittleren Jahren oft als einer Zeit der Krise die Rede ist, wird diese Phase ja auch als »Blüte des Lebens« und als die »besten Jahre« bezeichnet. In der Antike verstand man die mittleren Jahre weitherum als eine Zeit, in der das Beste in einem Menschen zur Reifung gelangen kann. Doch was bedeutet es, in einem philosophischen Sinn zu reifen und die entstehende Fülle für sich zu nutzen? Diese Frage ist gewichtig, denn wie deutlich werden wird, ergeben sich die eigene Reife und entsprechend die Jahre der Fülle nicht von selbst, sondern es bedarf des klugen Umgangs mit der eigenen Lebenserfahrung und mit den Aufgaben, die sich einem in den mittleren Jahren stellen, um zu dieser Fülle vorzudringen.
Dieses Buch trägt den Untertitel »Eine Philosophie der besten Jahre«. Damit soll nicht behauptet sein, die mittleren Jahre seien zwangsläufig und für alle immer die besten Jahre ihres Lebens. Dazu sind unsere Lebensläufe zum einen viel zu unterschiedlich, und manche mag das Schicksal just auf ihrem Zenit besonders hart treffen. Zum anderen ist die Mitte des Lebens mit ihrer Spanne von fünfundzwanzig bis dreißig Jahren sicher zu weitläufig, um ihr ein einziges Gütesiegel aufzudrücken. Vielmehr werden wir wohl alle in dieser Phase gute wie schlechte Zeiten durchleben, aufblühen genauso wie straucheln und stagnieren. Das Anliegen des Buches ist es vielmehr, eine Lebensphase zu untersuchen, die man auch als die »besten Jahre« und als eine Zeit der Blüte bezeichnet, und auszuloten, worin ihre spezifische Qualität besteht. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie es gelingt, aus der Fülle dieser reichen Jahre zu schöpfen. Tatsächlich meine ich, dass es Lebensformen oder Weisen der Orientierung gibt, die dem mittleren Alter in besonderer Weise angemessen sind: die uns in die Lage versetzen, den Herausforderungen dieser Zeit mit Bedacht zu begegnen und die existentiellen Fragen, die in dieser Phase aufbrechen können, klug und gewinnbringend zu bewältigen, sodass wir in den mittleren Jahren zur freisten Zeit unseres Lebens ansetzen können.