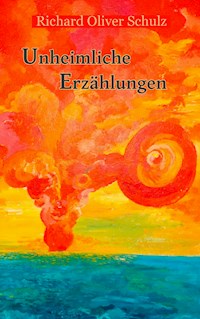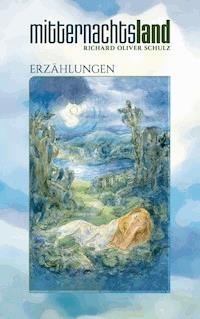
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Parallelzeit im 9. Jahrtausend n. Chr.: Statt sich kreuzigen zu lassen, hat Jeschua die Römer entmachtet und ein Weltreich des Friedens errichtet, das er über siebzig Jahre lang von Jerusalem aus regiert. Als er mit 120 Jahren stirbt, beginnt sich unaufhaltsam ein geistiger und moralischer Zerfall auszubreiten, bis die Welt vom Kannibalentum beherrscht wird. Nur die Stämme der Noroks haben sich die Weisheit der messianischen Zeit bewahrt. Zu ihnen gehört die fünfzehnjährige Jungpriesterin Ilaischa. Als sie dem Kannibalenjungen Elok das Leben rettet, ahnt sie nicht, dass dies der Beginn einer langen Reise ist, auf der das ungleiche Paar eine zukunftsweisende Mission übernehmen wird. (Titelerzählung)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RICHARD OLIVER SCHULZ, Jahrgang 1959, studierte Psychologie, Philosophie und Humanmedizin, bevor er an verschiedenen Kliniken in Bayern eine Facharztausbildung in Psychiatrie und Psychotherapie absolvierte. Mitternachtsland ist seine vierzehnte Buchveröffentlichung.
Inhalt
Sonntagsausflug in die Pfalz
Gespräche mit Ubi
Die Horde der bleichen Riesen
Der Empath
Das Kind in der Fremde
Der schweigsame Junge
Die Mutter
Anderwelt
Der kleine Messias
Moses’ Kampf
Mitternachtsland
Sonntagsausflug in die Pfalz
Meine Mitschülerin Sini Laura war es, die den Einfall hatte, in die Pfalz zu fahren. Sie kam mit ihrem neuen Freund Tobias und dessen Bekannten, zwei hohen Kerlen, lang- und dunkelhaarig, Sini nahm sich zierlich gegen beide aus. Auch Erwin, mein bester Freund, kam mit, auch er erschien beinahe klein gegen die beiden langen, obwohl er ganze sieben Zentimeter größer als ich war. Wir fuhren mit dem Fahrrad, und es war ein langer Weg. Es war ein sonniger Spätsommertag, in den die dunklen Regenwolken wie ein Verhängnis hingen, sonnendurchflutet und golden lagen die Felder entlang des Weges. Wie ein gleißendes Vlies breiteten sie sich zu beiden Seiten vor uns aus, und es glitzerte und vibrierte wie lauteres Gold zwischen den Blättern der Bäume. Wir fuhren einfach dahin. Es wurde kein Wort gewechselt während der Fahrt. Allmählich aber trübte der Himmel ein, er wurde blassblau, wenigstens stellenweise, und Regenwolken ballten sich düster zusammen. Wir mussten mit plötzlichem Regenguss rechnen und so beschlossen wir die Einkehr in ein Gasthaus. Ich bestellte ein Glas Apfelsaft, meine Kameraden ein Glas Bier.
Der Rauch, der in der großen Wirtshausstube lagerte, war eben noch erträglich. Wir saßen zu viert am Tisch und schwiegen, und ringsum lachten und grölten die Wirtshausbesucher. Die wenigen Worte, die Tobias und sein Freund beinahe schüchtern tauschten, schüchtern wie Sini Laura, die leise und hauchend hie und da mal einen Satz einwarf, ging in den bewegten Wogen des allgemeinen Geredes unter. Da saßen Männer, hohe Biergläser an Griffen fassend, und lachten wie Kinder. Es waren gestandene Männer, behäbig breite wie schmale, und in ihren Wangen spielten die Falten, und manche Schläfe war grau. Aber sie lachten wie Kinder, und ganz im Geheimen erschrak ich über ihr Männergesicht. Hatten sie Grund zu lachen? Wie hatten sie es angestellt, dass sie so alt geworden waren, ich aber war noch so jung? Was hatten sie erreicht in ihrem Leben? Wie konnten sie lachen, da doch die Brücke der Jahre, die sie mit mir verband, sie an die Grenze des Todes bringen musste? Hatten sie Angst vor dem Tod? Das unvermeidbare Schicksal, das sie hierhergebracht hatte, würde ihr Leben beenden, wenigstens dann, wenn ich so alt sein würde wie sie. Eine Zeit, die leicht durchmessen sein musste und die sie auch selbst schon leicht durchmessen hatten.
Denn sie verhielten sich jetzt wohl gerade wie damals, als sie so alt wie ich gewesen waren, und sie besaßen keinen Funken Weisheit. Schleichend war die Zeit vergangen, sie aber wiegten sich in Sicherheit, sie merkten den Unterschied nicht. Die Zeit war ein Phänomen, das sie nur schwer begreifen konnten, das sie betrog und immer wieder betrog, und gerne ließen sie sich betrügen. Sie fühlten sich sicher in ihrer eigenen Haut und fanden immer wieder Entschuldigungen und glaubten, dass sie in Zukunft verschont bleiben würden. Diesmal, so glaubten sie gewiss, hätten sie wohl der Zeit sichere Balken gebaut, auf denen sie gehen konnten, heute wie immer. Der Raum der Wirtshausstube barg sie in der Zeit und barg sie vor der Zukunft. Dass die Zeit sie diesmal nicht mehr überraschen würde, dass sie der Zeit ein Schnippchen schlagen würden, dessen waren sie sicher. Sonst hätten sie wenig Grund zum Lachen gehabt. Sie glaubten derart reich an Zeit zu sein, dass sie sie totschlagen konnten. Wenn sie ein Jahr totschlagen konnten, so mochten sie denken, dann hatten sie noch ein weiteres Jahr und immer so fort. Dass sie am Ende selber totgeschlagen würden von der Zeit, das fürchteten sie nicht, so sicher fühlten sie sich in ihrem selbst gezimmerten Jetzt, das von den Wänden der Wirtshausstube begrenzt und gesichert war.
Aber warum, so fragte ich mich, waren sie hier? Warum waren sie nicht einfach sitzen geblieben in den Räumen ihrer Jugend? Bedachte ich es recht, so musste ich sagen: Da konnte doch etwas nicht stimmen! Es hätte ihnen selbst zu denken geben müssen, dass es mit dem Leben unaufhaltsam und gewiss zur Neige ging und dass die Wände der Wirtshausstube nichts nutzen. Aber warum saßen sie dann hier und tranken Bier, sie, die die Erfahrung hatten machen müssen, dass sie in den Räumen ihrer Jugendzeit nicht hatten bleiben können? Unheimlich war das! Unheimlich und unverständlich zugleich. Und sie tranken und krakeelten, ganz als wären sie für alle Zeiten sicher und hier aufgehoben. Keiner von ihnen schenkte dem bewegten Sonnenlicht am Fenster irgendeine Beachtung. Sie gewahrten nicht die dunkle Wolke über ihnen im Raum, eine Wolke, die schon ihre Jugend aufgenommen hatte, merkten nicht, dass sie noch immer über ihnen drohte, sie zu verschlingen. Der Beweis, dass sie es nicht bemerkten, war, dass sie viel älter waren als ich, über die fünfzig hinaus und älter, ich aber war noch so jung. Ein Widerspruch war das, ein Paradox, fast wie das Licht, das jung und ruhig durchs Fenster strömte, ein Rätsel, das nur gelöst werden konnte, wenn die dunkle Wolke draußen weiter ihre Pflicht tat. Da aber saßen sie und akzeptierten ihr Alter, hielten es gar für beständig, lebten dem Augenblick, sie, die es besser hätten wissen müssen, sie, die doch hätten ebenso jung sein können wie ich. An ihrem Bierbrüderdasein fühlten sie sich durch nichts gehindert. Die ganze erschreckende Unheimlichkeit ihres fortgeschrittenen Alters, vor dem mir graute, wurde ihnen nicht bewusst. Ja, es war mir unheimlich, dass diese Leute nun schon derart viele Jahre älter waren als ich und unaufhaltsam eine Zeit vorüberstrich, die sie nicht kannten und kennen konnten. Sie glaubten sie totzuschlagen, glaubten die Herren zu sein, selbst über die Zeit. All dies zeigte sich an ihrer guten Laune, an ihrem Bierglasgepolter und ihren zotigen Reden. Aber ihre Falten zeigten etwas anderes. Diese Leute merkten nicht, wie pausenlos und langsam, wie von einem Dieb bestohlen, sich alles veränderte. Sie ruhten und schliefen, die Zeit aber wachte. Sie wachte in unaufhörlicher Spannung. Sie aber glaubten, die Zeit mit Balken belegen zu können, sie glaubten, Ruhepunkte in ihr zu erschaffen, in denen sie ewig innerlich schlafen konnten. Aber die Ruhe täuschte. Die gesammelte, Ewigkeit heischende Spannung war von fortwährender Auflösung bedroht.
Ich überlegte, ob der Raum im Allgemeinen, besonders aber der Raum der Gaststube, in der wir uns jetzt befanden, selbst ein Stück Zeit war, ein bloßer Übergang von Fasslichem in wesenlose Schatten. Und der begriffene Augenblick, in dem der Raum zu seiner Erscheinung gelangte, der Raum, in dem wir uns jetzt befanden, war nur ein kurzer Ausschnitt aus jenem wahren, größeren Raum, der eigentlich Zeit war, nur für ein einziges, unwiederbringliches Mal zur Wirklichkeit geronnen. Ich begriff mit einem Male, dass der Raum, in dem ich saß, vor mir das Glas mit goldbraunem Apfelsaft, nur einen winzigen Ausschnitt aus einer noch nicht ausgeloteten, weiter gespannten Wirklichkeit verkörperte, einer Wirklichkeit, die mir ein unaufhaltbares, unmerklich fortschreitendes Alter bereitete, einer Wirklichkeit ohne eigentliche Dauer, auch wenn ich mir immer und immer wieder eingeredet hatte, dass die Zeit eine innere Dauer besäße. Nur scheinbar formte sich die Zeit in ihrer scheinbar ruhenden Dauer zu einem tiefen, endlos ausgedehnten Raum, der überall zugleich war und in dem man sich als Mensch in Sicherheit wiegen konnte. Ich saß in diesem Zimmer, jetzt und heute, und das ›Jetzt‹ war eine Zeit mit Tiefendimension, lang gedehnt, weiß, vertieft, wie das Licht, das durchs Fenster hereinkam und die Dielen und Stühle befiel. Und doch war alles, was ich tat, allein für einen kurzen, ganz unbedeutenden Augenblick zum Greifen nah, klar zu erfassen. Die ausgedehnte Zeit hingegen, die mir als einzige dauerhaft schien, lag nur in einem nachträglichen Denken und Besinnen, im Nebel der allgemeinen Erinnerung, und auch in ihm zerfloss das Sein unmerklich, ohne Dauer, ja noch unmerklicher, als wenn ich mich unbefangen dem Augenblick hingab.
Qualm quoll aus den hinteren Ecken der Gaststube, da, wo es einige Fenster gab, eins davon weit geöffnet, sodass frische Luft hereinzog über die schattigen Wände, und raue Stimmen drangen von dort herüber. Es waren weitere Gäste, meist ältere Leute vom Dorf. Gerade gegenüber, vor dem Fenster, saß einer, aschgrau und hager, den faltigen Hals wichtig emporgestreckt. Aber auch weiter hinten, im Halbdunkeln, kaum berührt vom mattgelben Schein des Tages, saßen die Leute beisammen, lachten, erzählten belanglose Dinge. Sie waren viel älter als ich und taten doch so unvernünftig, fröhlich und roh, als stürben sie nie, zumindest auf lange Sicht noch nicht. Und wie ungeheuer dauerhaft und unverbrüchlich erschien ihnen ihr Jetzt! Das Wirtshaus mit seiner Gaststube hielt sie aufrecht in diesem Jetzt, es umschloss sie gänzlich, gab ihnen Sein und Identität. Es grenzte sie ab von dem, was nachher geschehen würde, von den Tagen ihres späteren Lebens. Und in diesem Nebel scheinbar ferner Zeiten, widergespiegelt in den Schwaden muffigen Qualms, der durch die Gaststube zog, lag vielleicht auch irgendwo der Tod, so fern und bleich, dass keiner an ihn dachte. Ich konnte so tun wie sie, so hatte ich oft getan, oft so gedacht, wenn auch stets ohne die unbefangene Fröhlichkeit all dieser Gasthausbesucher. Aber ich wollte, ich konnte nicht mehr. Selbst wenn ich später hinausging, um zu bezahlen – und wer wusste, wann das sein würde, es konnte eine Stunde dauern, und in dieser Stunde war ich dann geborgen –, durfte ich nach diesen Stunden von mir sagen, ich sei siebzehn Jahre alt. So alt war ich. Und das war alt genug. Doch noch umgab ein weißes, trübes Licht die Grenze des Tages. In ihm war Dauer, tiefe, ruhende Dauer, so wenigstens redete ich es mir ein. Dahinter erst lagen die künftigen Wochen, die langen Monate weiterer Jahre, weit hinter der kommenden Nacht. Aber die Dauer lebte von der Zeit und lebte von der grauen Zukunft. Und es war helles, lebendiges Licht, das durch die Fenster schien. Durch die gelben, matt glänzenden Wölbungen kam es herein. Vor mir saß der Langhaarige mit der starken Nase, trank aus seinem Glas – und sagte nichts. Tobias saß inmitten seiner beiden Freunde, ziemlich wortkarg. Er war insgeheim vertraut mit ihnen und sprach nur das Nötigste.
Bald hatten wir bezahlt und das Gasthaus wieder verlassen. Die Zeit war kürzer gewesen als ich vermutet hatte – schon wieder vergangen. Aus war der Traum von der Geborgenheit in Wirtshauswänden. Aber der Himmel hatte sich wieder gelichtet, strahlendes Blau trat hervor und ich atmete erleichtert auf. Wir setzten unsere Radtour fort.
Zwei Stunden später machten wir auf einer Wiese Rast und packten unsere Brote aus. Tobias hatte sich ins Gras gelegt, er hatte die Augen geschlossen, er glaubte zu ruhen, er glaubte die Sonne zu genießen, die ihm ins Gesicht fiel. Aber in der Ruhe quoll untergründig ein Fluss, dessen unheimliches Wesen niemand zu fassen vermochte. Man war nie bei sich selbst, und das Bei-sich-Sein war Illusion, während das Fort-Sein Realität war. Aber das konnte nicht sein. Es konnte nicht die wahre Wirklichkeit sein, es konnte nicht wahr sein. Sowenig die Träume in ihren reißenden Schattenbildern Anspruch auf wahre Wirklichkeit hatten. Träume sind Schattenbilder, die das Nichtsein malt. Doch wo kein Sein ist, da ist auch kein Werden. Träume sind nur Karikaturen der Wesenlosigkeit, in der die Zeit, die wir kennen, besteht. Aber woher wissen wir dann von unserer Ewigkeit? Es ist ein tief empfundenes Wissen. Aber die Ewigkeit in unserer Zeit, die Balken in ihr, sind eine Illusion. So dachte ich jetzt. Und Tobias lag im Gras und dachte nichts. Er sagte jedenfalls nichts. Er hatte nichts zu sagen, er war verloren an die Zeit. Warum denn war nur ich es, dem all dies auffiel? Die unmittelbar erlebte Realität war Illusion, während das alldurchdringende Leben, das immer abwesend schien, die Realität war.
Tobias lag im Gras, während die Hummeln summten, er sagte nichts, er dachte vielleicht nichts, und er genoss die Zeit, die mir wie ein Ungeheuer erschien. Auch Sini sagte nichts, sie schmiegte sich eng an Tobias, wollte mit ihm genießen, seine Gegenwart genießen, die Gegenwart des Nichtssagenden. Und sie schloss träumerisch die Augen an seiner Seite, während sie ihn umarmte. Diese Art der schweigenden Romantik war mir ein wenig zuwider. Ich fühlte, wie untergründig zwischen den Halmen der Heide ein Abgrund tobte. Tobias versank schlummernd in der Schwüle des lauen Spätsommertages zwischen den Weidengräsern, während sich Sini träumerisch an ihn lehnte. Es war wie eine tiefe Dunkelheit, die zwischen den Zeilen des Tages lag. Später erfuhr ich, dass Tobias drogensüchtig war.
Gespräche mit Ubi
In der siebten Klasse konnten die Schüler wählen, ob sie mit Latein oder Französisch als zweiter Fremdsprache beginnen wollten. Eginhard, auch Ago genannt, hatte sich für den Lateinzug entschieden. Französisch als dritte Fremdsprache sollte später noch hinzukommen. Dagegen sollte es für den anderen Teil, der Französisch als zweite Fremdsprache neben Englisch gewählt hatte, bei dieser Fremdsprache bleiben und dafür ein stärkeres Gewicht auf die naturwissenschaftlichen Fächer gelegt werden. Für beide Zweige wurde ein Teil der alten Klasse mit einem Teil der Parallelklasse zusammengelegt. Es stellte sich heraus, dass aus Agos Klasse sich ein geringerer Teil für den sprachlichen Lateinzug, ein größerer Teil aber für den naturwissenschaftlichen Zug entschieden hatte. In der Parallelklasse dagegen verhielt sich dies gerade umgekehrt. Das hatte zur Folge, dass Ago von der 6c in die 7a wechselte und mit einer ganzen Reihe neuer Schüler Bekanntschaft schloss. In der neuen Klasse lernte Ago einen interessanten Mitschüler kennen. Sein Name war Ulrich Vobisch; er sprach ihn einmal im Pausenhof an. Man nannte ihn, auf eine erste Vokabel der lateinischen Sprache zurückgreifend, »Ubi Wobisch«, schon nach drei Wochen des neuen Schuljahrs, wegen der geistigen Abwesenheit, in die er fast immer verfiel. Er hatte dunkles gewelltes Haar und eine feine, spitze Nase in einem klobigen Gesicht. Er zeigte sich als Kritiker und Philosoph, der alles hinterfragte und besonders in den Naturwissenschaften nichts einfach so gelten ließ, was man ihm vorzusetzen bemüht war, doch war er kein Zweifler der üblichen Art, sondern seine Kritik basierte auf einem sicheren Fundament, von welchem Ago den Eindruck gewann, dass er es sich schrittweise erarbeitet hatte und immer weiter erarbeiten würde. Ubi blieb niemals stehen. Er machte seinem Spitznamen alle Ehre. Denn jeden Augenblick hätte man ihn von Neuem fragen können: »Ubi es? (Wo bist du)?« Und die Heisenberg’sche Unschärferelation, von welcher Ago beiläufig in einem außerplanmäßigen Buch gelesen hatte, konnte mit vollem Recht auf ihn angewendet werden, denn der Standpunkt seines Geistes und der Impuls, der seinen Forschungseifer vorantrieb, waren nie gleichzeitig zu bestimmen. Es schien ihm förmlich Freude zu machen, die unterschiedlichsten Weltsysteme aufzustellen und zu kritisieren, und darin glich er Ago, der seinerseits fremd in der Welt stand, und mit jeder Kritik kam Ubi, wie er von sich selbst sagte, der Wahrheit und dem Ziel seines Erkenntnisstrebens einen Schritt näher. Er teilte Ago mit, dass ihm das Lernen wegen seiner kreativen Geistesblitze schwer fiel, aber er besaß eine zähe Ausdauer und Gründlichkeit, die seine Zerfahrenheit ausglich. Auch Ubi malte und zeichnete, vor allem Karikaturen, in denen er auf bissige Weise die Eigenschaften und Borniertheiten der Lehrer darstellte. Es war bezeichnend für Ubi, dass man sich mit ihm nur über Philosophie, Wissenschaft, Literatur und Kunst unterhalten konnte, aber das war schon eine ganze Menge, und Ago sprach gerne mit ihm. Die üblichen Gesprächsthemen seiner Altersgenossen lehnte Ubi entschieden ab. An Spielen beteiligte er sich nicht, weil da nur einer gewinnen konnte und er eine Tätigkeit, bei der nur einer der Glückliche, die anderen aber unglücklich sein sollten, nicht billigen konnte. »Aber es kommt doch gar nicht auf das Gewinnen an, es ist doch die Freude am Spiel, auf die es ankommt«, hatte Ago zu ihm gesagt. »Und ob es auf das Gewinnen ankommt, das ist ja in Wahrheit der Sinn des Spieles«, hatte Ubi geantwortet. »Das Spiel, wie unsere Kultur es kennt, ist eine Perversion der Lebensfreude zugunsten des Egoismus.« Am heftigsten lehnte Ubi den Leistungssport ab. »Nicht nur, dass im Leistungssport das natürliche Bedürfnis, seine körperlichen Kräfte zu messen und frei zu entfalten, zugunsten eines krassen Gruppenegoismus missbraucht wird, es wird auch sein vornehmlicher Zweck, die größere Gesundheit, in sein Gegenteil verkehrt, denn Leistungssport macht krank. Kurt Tucholsky hat völlig recht mit dem, was er über den Schul- und Leistungssport sagt: Der Sport war damals die Vorbereitung zum Militär, das Militär ist sein Ursprung, und das Militär ist die verkörperte, offensichtliche Unmenschlichkeit.«
»Und welche Sportart akzeptierst du?«, fragte ihn Tobias Kumeth.
»Jeden, den man aus Freude treibt und nicht um zu gewinnen, und jeder, der gesund ist. Ich betreibe Schwimmen und Fahrradfahren. Das reicht vollkommen.«
Meist sah man ihn so in Gedanken vertieft, dass er nicht zu sehen schien, was um ihn vorging, und oft mit knapper Not Laternenpfähle streifte. Sein Gesichtsfeld schien eingeschränkt zu sein, aber es waren die scharfen, bohrenden, auf ein Ziel gerichteten Gedanken, die sein Blickfeld auf die Fovea centralis, die schärfste Stelle des Sehens, konzentrierten. Er fuhr sogar Fahrrad mit diesem Geradeausblick. Doch immer entkam er den Hindernissen in der Gestalt von Pfosten, betonierten Blumenbeeten und Laternenpfählen, meistens nicht ohne sich heftig die breiten Schultern zu stoßen, was ihn, der hart im Nehmen war, freilich nicht weiter störte. Es wunderte Ago auch immer wieder, wie Ubi es fertigbrachte, im Straßenverkehr zu überleben.
Ubi glaubte damals an keinen persönlichen Gott. Denn alles Persönliche konnte nach seiner Meinung nicht anders als menschlich gedacht werden, und alles war notgedrungen begrenzt und daher unvollkommen, so argumentierte er. Zu dieser Ansicht war er schon im Alter von zehn Jahren gekommen und hatte sie sich zum Grundsatz gemacht, nachdem er im Religionsunterricht erfahren hatte, wie ungemein grausam, böse und ungereimt der Gott des Alten Testamentes mit Menschen und Tieren verfuhr. Auch Ago hatte das immer gefühlt, im gleichen Alter sogar, und hatte genauso früh den Kinderglauben an Gott verloren. Gott musste eine Macht sein, die unermesslich viel größer, weiser und erhabener war, als alle Menschen sie sich vorstellen oder gar für sich in Anspruch nehmen konnten, eine Macht, die ganz gewiss nicht so begrenzt, menschlich und unwissend war wie offenbar der Gott des Alten Testamentes. Dass Ago Begriffe wie Himmel als Lohn und Hölle als Strafe ablehnen musste, verstand sich von selbst. Nur der menschlich begrenzte Verstand war nicht in der Lage, den Geschöpfen Gottes so wenig Verständnis ihrer Beweggründe entgegenzubringen, dass er sich an ihnen rächen und sie zu ewigen Höllenstrafen verurteilen konnte, während er andere belohnte. Ubi wusste: Gut und auch böse, das waren alle Menschen, keiner war ursprünglich besser oder schlechter als der andere, und ob der eine mehr dem Bösen oder dem Guten zuneigte, hatte daher mit seinem ursprünglichen Wesen nichts zu tun. Denn wenn es damit etwas zu tun gehabt hätte, wäre es Gott gewesen, der schuld daran war. Er hatte schließlich die Menschen geschaffen. Wenn sie aber vom Bösen bloß infiziert waren, dann musste es auch einen Weg geben, sie wieder zum Guten zurückzuführen. Folglich konnte es auch keine ewige Verdammnis geben, jedenfalls nicht ewig in der Art, wie sie die Christen sich dachten. Aber was war es denn: Gut und Böse, so wie die Menschen es definieren zu können glaubten? Es gab gewiss ein Böses, so wahr es Gleichgültigkeit, Unmenschlichkeit und Grausamkeit gab. Was war dann aber das Gute? Darüber herrschte keine Einigkeit. Darüber wurden die Menschen irre. Sie konnten nicht wissen, was gut war. Und darum waren ihre Ansichten über das Gute und Böse immer auch falsch. Das Gute wurde am eindeutig Bösen gemessen. Aber die Menschen kannten das Gute ebenso wenig, wie sie Gott kannten – das war Ubis Überzeugung. Denn Gott war zweifellos gut. Es gab so viele unterschiedliche Ansichten der Wirklichkeit, und aus diesen unterschiedlichen Ansichten hatten die Menschen sich ihre Meinung über Gut und Böse abgeleitet. Die Wirklichkeit selbst kannten sie nicht. Sie waren im Bösen gefangen. Aber wenn der Mensch in Wahrheit böse wäre, sagte sich Ubi, von Grund auf böse, wie der Lutheraner glaubte, dann wäre er auch nicht schuldig. Dann wäre das Böse seine Natur, und schuldig wäre nur Gott. Aber die Menschen machten sich schuldig, indem sie unhinterfragt Begriffe von Gut und Böse sich schufen und ganz nach solchen Begriffen nicht anders als böse handelten, ja ihren eigenen Gott nach solchen Begriffen schufen. Ein Gott, der nicht Mensch, nicht Person, sondern umfassender Geist war, musste jenseits von solchen Begriffen stehen. Gott war nicht böse und gut – nach menschlichem Denken begriffen –, aber er war auch nicht beides zugleich und beides in Einem. Einen Gott, in dem das Gute dadurch mit dem Bösen versöhnt und vereinigt erschien, dass beide in ihm gemischt auftraten, hielt Ubi für den gröbsten Unsinn, den ein Mensch ersinnen konnte. So hatte Hermann Hesse seine jugendlichen Leser an der Nase herumgeführt und führte sie heute noch irre, indem er in seinem Gott »Abraxas« Gutes und Böses vermengte. Auch der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung war dieser Meinung gewesen. Er hatte Gott als eine Macht verstanden, in der Gut und Böse gleichsam zusammengeschmolzen waren, und war auf die Nazis hereingefallen. Der Teufel als Gottes Koch, welcher dem Brei der Schöpfung die rechte Würze verleiht – was für ein Unsinn!
Die Menschen waren weit entfernt von wahrer Wirklichkeit, indem sie solches dachten. Das war Ubis Meinung. Zu allen Zeiten hatten die Menschen für sich in Anspruch genommen, zu unterscheiden, was gut und böse war. Sie hatten sich vorzeitig diese Erkenntnis angemaßt. Sie wurden böse, indem sie das dachten, und spielten das Gute zugunsten des Bösen aus. Das »Jenseits« von Gut und Böse, sofern es ein menschlich verstandenes »Jenseits« war, lag in dem Bösen, das »Jenseits« von Gut und Böse, sofern es ein göttliches war, dagegen im Guten. Aber dieses Gute fassten menschliche Begriffe nicht, darum waren auch »Hölle« und »Himmel« nach einem selbstgezimmerten Gott vom Menschen selber erschaffen. Der Tod, so dachte Ubi noch mit zwölf bis vierzehn Jahren, musste, verglichen mit dem Leben, dessen Gesetzmäßigkeiten und Logik, wohl ein absolutes Nichts bedeuten, und der Zustand im Tode musste dem Zustand vor der Geburt sehr ähnlich sehen. Gott, so lehrte Ubi zu Beginn des Schuljahrs, war Natur, aber Natur war mehr als Materie, sie lag in einem umfassenden, ordnenden Sinn, sie war der Geist, der alles zusammenhielt. Ago erfuhr von Ubi, dass ein gewisser Philosoph, Spinoza mit Namen, auch dieser Ansicht gewesen sei. Aber Ubi war von selbst darauf gekommen. Gott war der Sinn des Ganzen, der alles durchdrang, doch darum war das einzelne Wesen in der Natur noch lange nicht selber Gott, wie Pantheisten es glaubten, auch darin habe man Spinoza missverstanden. Der Sinn des Ganzen, der Gott war, verhalf der Natur zu ihrer Entwicklung, doch es waren die Geschöpfe, und ganz besonders die Menschen, die immer wieder an dieser Bestimmung scheiterten, da sie den Sinn des Ganzen nie voll erfassten und auch niemals voll erfassen konnten. Dass sich die Menschheit noch weiterentwickeln würde, geistig und körperlich gleichermaßen, das stand für Ubi vollkommen fest. Bereits in seinem zwölften Lebensjahr hatte ihn der Gedanke fasziniert, dass die Entwicklung des Menschen nicht abgeschlossen sein konnte, dass wir vielleicht, verglichen mit dem Zukunftsmenschen, nur auf der Stufe von Hominiden standen. Ubi begeisterte sich für das Entwerfen großer Zukunftsvisionen. Er hatte erkannt, dass sich im Laufe der Evolution das Vorderhirn des Menschen vergrößert hatte, folglich auch die Stirn des Zukunftsmenschen sich im Lauf der Jahrmillionen höher wölben musste. Das Kinn dagegen fiel kleiner, feiner und spitzer aus, und dadurch trat auch die Nase noch größer und spitzer hervor. Da, so schloss Ubi weiter, im Zuge der Evolution auch die Behaarung des Urzeitmenschen langsam zurückgegangen war, musste der Mensch der Zukunft sein Haupthaar verlieren. Auch Ago verfolgte solche Ideen mit Interesse. Ubi plante schon, ein Buch darüber zu schreiben. Die ersten Texte und Bildtafeln hatte er angefertigt. Die lateinische Sprache, die er nun lernen musste, vielmehr mit Begierde lernen wollte, kam ihm dabei gut zustatten, und von seinem Vater hatte er, außerhalb des Unterrichtsstoffes, schon einige weitere lateinischen Ausdrücke kennengelernt, mit denen er seine Zukunftsmenschen betitelte: »Homo sapientissimus«, der »weiseste Mensch«, »Homo eruditus«, der »gelehrte Mensch«, oder »Homo felis eruditus«, der »gelehrte Katzenmensch«, denn Ubi ging davon aus, dass sich auch das Fußgewölbe des Menschen weiterentwickeln werde, sodass demselben schon in siebenhunderttausend Jahren der geschmeidige Gang einer Katze eigen sein werde. Nach Ubis damaligen Vorstellungen sollte sich die Menschheit nach größeren und kleineren Rückschlägen noch etwa fünf Millionen Jahre weiterentwickeln, sich dann aber in zwei Haupttypen aufspalten: in den spitzköpfigen Homo Telekinesis, der sich nur telepathisch mit Seinesgleichen verständigen würde, und in den Homo Magnus Eruditus, den großen gelehrten Menschen. Dann sollten beide Typen allmählich degenerieren und in Laufe zahlloser Jahrtausenden auf die Stufe von Steinzeitmenschen zurücksinken. Die Menschheit musste am Ende scheitern, da sie Gott nie erreichen und in ihrem Streben, ihm gleich zu werden, in den Staub zurücksinken musste, hinter diesem Staub aber in das scheinbare Nichts, aus dem sie gekommen war, um so den Kreislauf von Neuem in Gang zu setzen.
Aber bald kam Ubi zu dem Schluss, und dies noch vor dem Ende des folgenden Schuljahrs, dass auch das sogenannte Nichts ein Etwas war, da es nämlich zwangsläufig an die Stelle eines anderen Etwas – des Lebens – treten musste. Und gegen das Nichts des Todes gehalten war das Leben selbst ein bloßes Nichts. Was aber die Gestalt des Zukunftsmenschen betraf, da blieb das Problem der Schönheit zu lösen. Die Evolution hatte gezeigt, dass an die Stelle primitiver Menschenformen immer schönere und individuellere Gestalten traten. Der kahle, bleiche, großstirnige Zukunftsmensch mit hohem, gewölbtem Schädeldach und großer, vorspringender Nase über dem kleinen und spitzen Kinn war aber alles andere als schön zu nennen, und auch nichts Individuelles lag in seinen Zügen, eher waren durch seinen bezeichneten Typus die individuellen Ausdrucksformen in ihren Variationen recht eng begrenzt. Das war ein Widerspruch, wie Ubi feststellen musste, denn nach seiner Auffassung ging jede Höherentwicklung unabdingbar mit einer höheren Differenzierung der Individuen einher. Und je individueller, je ausdrucksvoller und vielgestaltiger ein menschliches Gesicht war, desto schöner sollte es auch erscheinen. Das Gesicht des Zukunftsmenschen aber, wie es Ubi intendierte, war nicht schön. Das war ein echtes Problem. Ubi überlegte lange, wie er den Typus des Zukunftsmenschen gestalten sollte, um auch in ihm die größte Vielfalt menschlicher Formen unterzubringen, ja eine Vielfalt, die noch weitaus größer war, als sie schon heute möglich wäre. Das war beim beschriebenen Typus nicht möglich. Irgendetwas, so ging Ubi auf, schien an dem Gedankengebäude nicht ganz zu stimmen.
Lange Zeit hatte Ubi an einen unpersönlichen Gott geglaubt, an einen zwar wesenhaften, aber keineswegs menschenähnlich gearteten Gott. Am Ende sah Ubi ein, dass ein unpersönlicher Gott grausam und gleichgültig gegen das Schicksal der Menschen und somit auch abgrundtief böse sein musste, so endlos und unerreichbar groß und durchaus erhaben man ihn sich auch vorstellen mochte. Wie Ubi Ago später erzählte, hatte er schon im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren ernsthaft mit dem Gedanken gerungen, ob das Nichts in der Gestalt einer reinen, gefühlsentleerten Information gedacht werden müsse und in dieser Eigenschaft vielleicht der Urgrund aller Dinge sei, oder ob vielmehr der Urgrund in einer Art Uremotion, als höchster Gefühls- und Eindrucksgehalt, bestünde. Er war schon damals bald zu dem Schluss gelangt, Gott sei die »Uremotion«: die höchste Bewegung des Geistes. Die Uremotion habe die gesamte Schöpfung hervorgebracht.
Aber auch über diesen Gedanken musste Ubi hinausdenken, auch diesen Gedanken musste er als menschlich und unvollkommen erkennen.
Es war unter den Schülern der Klasse schon zum geflügelten Wort geworden, dass Ago und Ubi philosophierten. »Da philosophieren Ago und Ubi«, hieß es, wann immer jemand unverständlich sprach. Und böswillige Zungen, an die lateinische Sprache gewöhnt, formulierten sogar: »Da philosophieren Ego und Ubi!«
In den Gesprächen mit Ubi war Ago ganz in seinem Element, er ging dann aus sich heraus, wurde feurig und ernst. Keiner ließ Ago in solche Tiefen schauen, erläuterte das Labyrinth des Lebens in solcher Klarheit wie Ubi. Wenn er nicht philosophierte, sank Ago wieder zurück in den träumenden Zustand, in dem er sich immer befand. Ago war ein Träumer, ein Träumer und Spinner und Weichling, und auch ein Spinner war der ernste Ubi, so glaubten viele im Gymnasium.
Das sollte sich auch nicht ändern, als beide die zwölfte Klasse erreichten. Ago war noch schnell in die Stadt gefahren, um Zeichengeräte und das nötige Papier zu kaufen, da traf er auf einen dunkelblonden, bebrillten, stämmigen Jungen in unauffälligem blaugrauen Pullover – Ernst Georg Zagenhausen. In der elften Klasse hatte Ernst Georg gemeinsam mit Ago am Sportunterricht teilgenommen. Er war eine Klasse weiter als Ago, denn man hatte, mangels Teilnehmern, die elfte und zwölfte Klasse zusammengewürfelt. Ago hatte sich die Sportart wählen können und sich Schwimmen ausgesucht, denn er hatte sich für einen guten Schwimmer gehalten. In der Tat war Ago, wenn auch nicht gar ein so schneller, so doch ein Schwimmer von ungewöhnlicher Ausdauer und mit einem großen Lungenvolumen. Er hätte tagelang schwimmen können, und dies mit unvermindert zügiger Geschwindigkeit, während anderen bereits nach einer Stunde das Wasser zu kalt geworden oder der Atem ausgegangen wäre. Aber leider wurden – wie alle Vorzüge Agos – diese Fähigkeiten in der Schule nicht geschätzt. Da ging es um reine Geschwindigkeit, und die Zeit, in der solche Höchstgeschwindigkeiten zu absolvieren waren, war auf fünf bis zehn Minuten bemessen und umfasste zwei Bahnen von fünfundzwanzig Metern. Zudem war Brust der einzige Schwimmstil, den Ago wirklich beherrschte, und auch da gab’s zu bemängeln, dass er ihn nicht so praktizierte, dass Spitzenleistungen dabei herauszuholen waren, den Mund unter Wasser, bis zu der Nase hinauf, Atemschöpfen nur nach Beenden der Armkreisbewegung und tüchtig sich vorgearbeitet. Da würgte es Ago den Atem ab. Aber er wusste, dass mit diesem Schwimmstil ihm seine Mitstreiter auf längere Strecken hoffnungslos unterlegen waren, denn Ago schwamm ausdauernd mit gleichmäßig mittlerer Geschwindigkeit. So aber wurde er durch das Becken gehetzt, und die Frau Dr. Sprentenhöfer, eine gebürtige Tschechin, gab den Kommandoton an, oft unterstützt durch eine schrille Trillerpfeife. Worin sie eigentlich ihren Doktor hatte, wusste Ago nicht. Ob man überhaupt in Sport den Doktor machen konnte? Vielleicht im Sprinten, dachte Ago bitter. Aber es gab ja noch Zusatzfächer, wenigstens eines, es musste wohl Sportwissenschaften gewesen sein. Ago schluckte Wasser, und Kraul beherrschte er kaum. Außer ihm war es allein Ernst Georg Zagenhausen, der sich ähnlich ungeschickt anstellte. Er war stämmig, aber etwas untersetzt, und sein Bauch wirkte speckig. Die Brille konnte er freilich im Schwimmbad nicht tragen, und die vom Chlor geröteten Augen kniff er sanft lächelnd mit stiller Märtyrermiene zusammen, wenn er wieder, nur leise mit den Füßen wippend, auf dem Sprungbrett stand. Ago hatte in ihm immer einen sanften und stoischen Mitstreiter und Leidensgenossen bewundert, zumal er eine Klasse weiter und ein Jahr älter war als er. Ago bedauerte, dass Ernst Georg dieses – das folgende – Jahr nicht bei ihm im Schwimmen war. Er hatte jetzt gewiss schon Abitur und gehörte zu den Altvorderen, während Ago weiterschwimmen und – leiden musste, begleitet von der schrillen Trillerpfeife der Frau Dr. Sprentenhöfer, der im Eifer des Gefechts die blonden Koteletten um das drahtige Gesicht wirbelten.
»Tag, Ernst Georg«, sagte Ago. Er sagte niemals »Hallo«, wie andere es taten. Alle Modewörter, alle Floskeln, deren Bedeutung ihm undurchsichtig waren, waren ihm schwer verhasst. »Tag, Ernst Georg«, sagte er. Der Angeredete hatte so getan, als sähe er ihn nicht. Jetzt hob er sachte den Kopf und sagte kleinlaut: »Hallo!« Ein dünnes Lächeln spielte um seine Lippen. Er war die Demut in Person.
»Du hast doch jetzt Abitur?«, fragte Ago. Er sagte nicht »Abi«. Er hasste Abkürzungen.
»Ja, Abi hab ich«, antwortete Ernst Georg, als wäre das gar nichts.
»Und? Was willst du studieren?«
»Studieren?« Ernst Georg lächelte spöttisch. »Ich studiere nicht. Ich hab ’n Schnitt von drei-drei, was soll ich denn da studieren! Etwa um Lehrer zu werden?« Ernst Georg lächelte bitter. »Willst du studieren, wenn du Abi hast?«
»Ja … schon«, sagte Ago.
»Ich jedenfalls nicht. Ich will meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen, bis ich fünfzig bin …«
»Das ist doch übertrieben«, wollte Ago rufen, »die paar Jahre Studium. Da bist du noch lange nicht fünfzig.« Aber Ernst Georg fuhr fort: »Ich jobbe natürlich. Man will ja auch ein bisschen Luxus. Einen Fernseher, eine Waschmaschine, jeden Tag sein Frühstücksei. Den Mercedes in der Garage.«
Ago runzelte die Stirn. »Ich weiß nicht, ob ich das will.« Dann gab er dem Rad die Sporen und fuhr davon, entsetzt und bitter enttäuscht von jenem Menschen, der ihm als älterer Gefährte und Mitstreiter gegolten hatte. Zu Hause hörte er Anton Bruckner – die neunte. Er vertiefte sich in die tiefen, dunklen Klänge der Melancholie und fühlte, dass er – trotz besseren Wissens – die Welt und die Menschen in ihrer Banalität unterschätzt hatte. Aber ein weiterer Blick in den Schopenhauer schenkte ihm Gewissheit und Bestätigung.
Die Melancholie war aber nicht ganz bekämpft, als Ago am folgenden Tag bei Ubi vorbeisah. »Ubi, du musst mir helfen«, sagte er, »ich brauche Gewissheit. Wie kommt es nur, dass die Menschen diese dunkle, kleine, enge Welt, die wir beide so sehr verachten, so lieben? Ubi, warum sind alle Menschen so gleich, warum verstehen sie dich und mich nicht? Sind sie wirklich anders als wir? Und warum sehen wir denn immer ein Geheimnis in ihnen, das vielleicht gar nicht vorhanden ist?«
»Sie kennen sich selbst nicht, Ago, das ist der Grund«, erwiderte Ubi nach einigem Nachdenken. »Sie wissen nicht, welche Potenziale in ihnen liegen. Die meisten Menschen haben aufgehört, sich als geistige Wesen zu empfinden, die mit der Ewigkeit verbunden sind. Sie flüchten sich in den Genuss des Augenblicks oder ziehen sich frierend und sicherheitsbedürftig in einen einsamen Winkel dieser Welt zurück, wo sie ihr zeitliches Dasein möglichst ungestört verbringen möchten. Es fehlt ihnen die nötige Hoffnung, die da, wo die natürlichen Anlagen und Talente nicht ausreichen, nur in einer spirituellen Kraft begründet sein kann.
Aber die heutigen Menschen wollen wissen, worin diese Kraft besteht, die sie erfüllen und stärken kann, und sie wollen dies mit gutem Recht. Viele legen sich darüber ja keine Rechenschaft ab, ich denke da nicht zuletzt an die, die sich religiös, im traditionellen Sinne religiös oder christlich nennen. Die vertrauen auf Jesus, aber worin eigentlich dieses Vertrauen besteht, wissen sie nicht zu sagen, es ist ja nicht seine Person, mit der sie in Verbindung treten, denn sie erfahren nur sehr mittelbar über die Bibel von ihm. Es ist vielmehr seine Verheißung, auf die sie vertrauen. Ich will nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu einer wirklichen Verbindung zum persönlichen Jesus, zu seiner Liebe, Weisheit und spirituellen Kraft und damit zur wirklichen Gottheit kommen mag, aber ich frage: was ist die Verheißung eines glückseligen Zustandes wert, die blind geglaubt wird, weil man gefunden hat, dass sie einem gut tut, oder weil man – noch schlimmer – die Drohung der Hölle fürchtet? Hier, meine ich, wird die christliche Lauterkeit von den Außenstehenden zurecht hinterfragt. Und es spricht viel dafür, dass oft gerade die Nüchternen, die Zweifler und Misstrauenden moralisch und damit auch spirituell verglichen mit solchen Gläubigen in der besseren Position sind. Worauf hoffen solche Gläubigen? Auf den Himmel. Aber worin denn nun dieser Himmel eigentlich bestehen soll, außer dass es besser, schöner und einfacher darin aussehen soll, wissen sie gar nicht zu sagen. Und gerade auf eine Beantwortung dieser Frage kommt es ja an. Von ihr hängt alles ab, denn an ihr hängt die Rechtfertigung unseres ganzen misslichen, kleinlichen und sinnlos erscheinenden Daseins auf diesem Planeten. Soll der Himmel und der Seelenfrieden darin bestehen, dass auf diesen ärmlichen, sinnlosen und grausam gebeutelten Zustand auf dieser Erde, in dem wir kaum Gelegenheit hatten, irgendeinen wesentlichen Beitrag zu leisten, nun ein Zustand der ewigen trägen, langweilig-harmonischen Homöostase folgen soll – karikiert durch die Harfe spielenden Englein auf den Wolken –, oder folgt – was logischerweise zu erwarten wäre – ein Zustand unvorstellbar erhöhter, beseligender Aktivität? Was aber ist Aktivität ohne Wagnis, ohne Herausforderung und Abenteuer und ohne die Möglichkeit zu scheitern? Was wäre sie anderes als ein Spiel, wenn das Wagnis fehlte? Wenn aber anders, wenn das Himmelreich kein Spiel, wenn es mit Aufgaben, mit Herausforderungen, mit Abenteuern verbunden wäre? Dann gäbe es auch Misserfolge, Misserfolge im Himmel und folglich auch Leiden und Schmerz. Mit einem Wort: wir kämen niemals aus der Spirale der Unvollständigkeit, der ewigen schmerzlichen Sehnsucht heraus. Und hier stellt sich nun die Frage: Welchen Gefallen hat uns Gott, sofern es einen gibt, wie wir ihn uns vorstellen, mit unserer Erschaffung – wenn es sie gab – getan? Ich meine, rational betrachtet, offenbar letztlich keinen. Er hat uns nur Leiden und Schmerzen und ewige Hölle verursacht, die selbst noch im Himmel uns gähnen. Es gibt ja einige Seher, die im Hinblick auf die Ereignisse, die im einundzwanzigsten Jahrhundert auf uns zukommen sollen, gesagt haben: ›Die Lebenden werden die Toten beneiden.‹ Radikaler und aufs Ganze gesehen sollte man aber sagen: ›Die Seienden sollten die Nichtseienden beneiden.‹ Denn nach allem, was wir wissen, ist – wie ich gesagt habe – das Nichtsein dem Sein in jedem Fall vorzuziehen. Das ist tatsächlich der Vorwurf, den wir Gott nach bestem Wissen und Gewissen machen können. Denn alles Seiende ist begrenzt und trägt in sich die ewige unerfüllte Sehnsucht nach der Fülle des Ganzen und nach dem allumfassenden Bewusstsein, ohne welches letzten Endes immer noch Nacht und Einsamkeit in uns wohnen. Allerdings: es könnte noch eine weitere Möglichkeit geben, die darin besteht, dass ein Nichtsein gar nicht möglich ist. Solange ich das nicht weiß, kann ich Gott keinen Vorwurf machen. Was meinst du dazu, Ago?«
»Ich weiß nicht. Aber ich denke: Wenn so etwas wie die Sehnsucht nach dem Allbewusstsein in uns ist, die Sehnsucht nach Gott, nicht nur das Bedürfnis nach einer trägen Geborgenheit in Gott, sondern nach der engen Verbundenheit mit ihm, nach einem mit ihm Schauen und mit ihm Schaffen, dann muss es auch eine Erfüllung dieser Sehnsucht geben. Jede Sehnsucht ist auf ein Ziel gerichtet, das auch existieren muss. Wenn wir es auch jetzt noch nicht fassen können, heißt das nicht, dass es nicht existiert. Und wahrscheinlich gibt es tatsächlich kein Nichtsein.«
»Ja, Ago, das wäre ein großer Gedanke: es gibt kein Nichtsein. Was folgt daraus: Jedes Wesen ist notwendig und einzigartig und hat nie nicht existiert. Aber warum sind wir dann nicht glücklich und warum existieren wir in dieser armseligen, unvollkommenen, ungerechten Welt?
Soll ich ehrlich sein, Ago? Ich bin ein Gegner des Schöpfergottes, jedenfalls eines Schöpfergottes in der Art, wie die sogenannten Christen ihn sich gemeinhin vorstellen. Ich bin der Meinung, dass es nichts Schlimmeres geben kann als ein einzelnes, abgetrenntes Dasein unter zahllosen Millionen zu führen, und einen Schöpfergott, der uns quasi aus heiterem Himmel hier hineingepflanzt hätte, träfe die ganze Schwere der diesbezüglichen Schuld. Ich meine auch, dass wir durch unser Dasein, zumal auf dieser Erde und in dieser Menschheit, nichts zu gewinnen haben und dass wir denen, die das Unglück hatten, geboren zu werden, mit Nachsicht und Liebe begegnen sollten. Das ist so meine ganz persönliche Meinung dazu, die ich nicht als maßgeblich hinstellen möchte.
Und wenn du mich fragst: Ohne von höheren Gründen zu wissen, würde ich persönlich auf jegliche Zeugung verzichten, da schon beinahe jedes Kinder-in-die-Welt-Setzen, zumal in dieser Zeit und Gesellschaft – von höheren Gründen abgesehen – in meinen Augen ein Vergehen ist. Denn ich könnte mein Kind ebenso wenig vor den zerstörenden Einflüssen dieser Menschheit schützen, wie ich es zu dieser Welt einladen könnte, und ich würde mich selbst und mein Kind belügen, würde ich es trotzdem tun. Es ist also besser, meine ich, nicht geboren zu werden, als das Risiko dieses Lebens überhaupt einzugehen. Nicht dass ich glaubte, dass Menschen erst in dem Augenblick entstehen, in dem sie gezeugt werden, dies wäre des Menschen unwürdig und wäre ein Zugeständnis an einen Schöpfergott der unergründlichen Launen, an den die zeugungswilligen Durchschnittschristen glauben und dessen Grausamkeit sie dadurch unbesehen bejahen. Aber etwas, von dem ich nicht weiß, dass es ist, das kann mich auch nicht berühren, während wir, wenn wir einen Menschen gezeugt haben, auch von seiner Existenz wissen. Wir wissen nicht, wie viele ungeborene Seelen es gibt, aber für einen Menschen, den wir gezeugt haben, tragen wir die Verantwortung. Wir haben ihn in diese Welt gesetzt, sein Dasein ist unausweichlich in Gang gekommen und kann auch durch den Tod nicht getilgt werden. Der Mensch ist verdammt zu sich selbst. Jeder Mensch sollte sich, bevor er Kinder in die Welt setzt, daher über den Sinn und Zweck des menschlichen Daseins im Vorfeld tiefe Gedanken gemacht haben und muss zu einer gründlichen Überzeugung gelangt sein, statt sich mit Gemeinplätzen zufriedenzugeben, sodass er seine Handlung auch von ganzem Herzen bejahen kann.
So gelange ich zu einem weiteren Gedanken: Jedes Verbrechen ist nur ein Versuch, die furchtbare Tatsache vergessen zu machen, dass jeder in seiner Haut gefangen ist oder es zumindest zu sein glaubt.
Darum verdient sogar der schlimmste, gemeingefährliche Verbrecher unser Mitleid, darum eben, dass er so ist und nicht anders sein kann und eben wie wir in seiner Haut gefangen ist. Und wenn er sagt, er habe auch anders gekonnt, er habe es nur nicht gewollt, wer trägt für sein Wollen die absolute Verantwortung? Kann er auch wollen, wie er will?
Sicher, die Gesellschaft muss vor ihm geschützt werden, und ich würde ihn töten, wenn es nötig wäre, und hätte kein schlechtes Gewissen dabei, aber unseren Fluch verdient er nicht für einen Irrtum, der niemals größer sein kann als der Irrtum, welcher in der ganzen Schöpfung latent enthalten ist. Darum kann die Strafe niemals Rache sein, denn wie sollten wir uns rächen für eine Tat, die wir selbst – unter den entsprechenden Voraussetzungen – hätten verüben können? Sie kann auch nicht Buße sein, denn für was soll einer büßen, der seinen Irrtum erkannt hat? Ist ihm die Einsicht in das Leid, das er verursacht hat, nicht Qual genug? Und für was soll einer büßen, solange er uneinsichtig ist? Nein, sondern die Strafe sollte allein dem Schutz all jener anderen armen Wesen dienen, die ebenso wenig wie der Verbrecher wissen, warum sie hier sind, und nichts dafür können, dass sie in ihrer Haut gefangen sind, die darum also unser Mitleid und unsere Liebe verdienen.
Jede Abtreibung ist daher ein Verbrechen, nicht weniger schlimm als ein Mord, denn ein Mensch, der gezeugt wurde, der existiert, wir wissen von ihm und wir haben uns mit ihm verbunden. Und ob das Kind vor dem dritten Schwangerschaftsmonat grausam hingeschlachtet wurde oder erst nach der Geburt, wo ist da der Unterschied? Denn wann beginnt der Mensch, wer kann das sagen? Diese Frage setzt voraus, dass er begonnen habe, dass er in der Zeit erschaffen wurde. Wer sich anmaßt, einen Zeitpunkt der Schöpfung des Menschen festzusetzen, der glaubt an den Schöpfergott und akzeptiert ihn, und wäre er auch ein Atheist. Ob er diesen Schöpfergott nun Geist, Person, Prinzip oder Materie nennt, es bleibt sich gleich, er glaubt und vertraut ihm und lebt nach seinem Gesetz – nach dem Gesetz des Verderbens, denn er verherrlicht das Geschaffenwerden und mit dem Geschaffenwerden das Werden und mit dem Werden das Vergehen und mit dem Vergehen den Tod. Und diese Verherrlichung schafft sich Ausdruck im Morden. Der Mord ist die Verherrlichung des Schöpfergottes, wer er auch immer sei. Darum mordeten Moses, Elias, Samuel und Mohammed, und Abraham wäre beinahe zum Sohnesmörder geworden.
Wer ist schuldiger? Die Ehefrau, die ihrem jahrelangen Unterdrücker, dem Misshandler ihrer Kinder, mit einem Hammer den Schädel zertrümmert, oder die werdende Mutter, die ihr unschuldiges Kind vor seiner Geburt vernichtet? Ich denke, dass sich hier schon jede Diskussion erübrigt, so klar beantwortet dir dein Gewissen diese Frage.
Aber in unserer feinen Gesellschaft geht die abtreibende Mutter straffrei aus, und auch die Frauen, die ihre Kinder kurz nach der Geburt erwürgen, erhalten höchstens zwei Jahre, während die tapfere Mutter, die Verteidigerin ihrer Kinder, die sich ihres Peinigers entledigt, mit lebenslänglich zu rechnen hat. Das sind die Absurditäten unserer Rechtsprechung. Nicht dass ich dafür bin, dass man den Totschlag des eigenen Kindes bestraft, sofern er ein Verzweiflungsakt war. Ohnehin verfehlte hier die Strafe die intendierte Funktion der Abschreckung, die sie im Übrigen auch in allen anderen solchen Fällen verfehlt, und auch ihre einzig sinnvolle Funktion, die des Schutzes der Gesellschaft, tritt hier nicht in Kraft, weshalb sich Freiheitsstrafen in solchen Fällen erübrigen.
Frauen aber, die ihr Kind kurz nach der Geburt ersticken, sollte man sterilisieren, das wäre der einzig wirksame Schutz von möglichen Kindern vor solch einer Mutter. Denn weder eine Mutter, die ihr Kind freiwillig und ungezwungen abtreiben lässt, noch viel weniger eine Kindesmörderin wäre jemals eine gute Mutter künftiger Kinder. Dies gilt umso mehr für solche, die ihr Kind kurz nach der Geburt erdrosselt haben. Jemand, der so etwas übers Herz bringt, ist keine Mutter und kann es nicht werden.
Aber die Formen unserer Rechtsprechung zeigen, dass das Kind in dieser Menschheit und Gesellschaft noch immer nichts gilt. Die Rechtsprechung aller Zeiten unterdrückte das Kind im Menschen. Darum bedeutet auch bei Jesus das Kind so ungeheuer viel, und er sagte über seine Unterdrücker: ›Wer aber einem dieser kleinen etwas zuleide tut, dem wäre besser, man bände ihm einen Mühlstein um den Hals und versenkte ihn an der tiefsten Stelle des Meeres.‹ Denn das ist bloß ein schwacher Vergleich des inneren Zustandes solcher Menschen. Und Petrus schrieb: ›Wir aber erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf welcher Gerechtigkeit wohnt.‹
Die Propheten sagen: ›Es ist ein Gott‹ oder: ›Es gibt keinen Gott außer Gott!‹ Sie füllen ihren Mund mit Tautologien und schönen Worten, hinter denen nichts steht als leere Versprechungen. Sie können nur immer wieder auf ihren Gott hinweisen, aber uns zu ihm führen, das können sie nicht. Und sie glauben uns durch ihre Weisheit, die wir auch ohne sie kennen, weitergebracht zu haben. Wenn wir sie oder ihre Anhänger darauf aufmerksam machen, dass wir auch ohne sie auf ihre Weisheiten kommen, erklären sie uns, dass es die geistige Ausstrahlung des Propheten selbst sei, die uns voranbringt. Aber diese Behauptung bleibt uns jeden Beweis schuldig. Ist es etwa die große Liebe dieser Propheten, die uns das Herz öffnet? Ich denke nicht. Moses war ein Mörder, nicht nur im Jähzorn, sondern durchaus planmäßig und darüber hinaus ein Völkermörder, Elias rief Fluch und Feuer über das Haupt seiner Feinde, die Baalpriester, herab, Abraham war bereit, seinen Sohn zu töten, Mohammed ließ seine Gegner im Schlaf ermorden. Wenn sie von Gott reden, geben sie Bilder von Götzen, und die Schemen dieser Götzen sind es, die Unheil über die Völker gebracht haben.
Jesus bildet da eine Ausnahme. Er machte keine erhabenen Worte und bot sich dem Volk nicht als überlegenen Guru und Führer an. Er gründete keine elitäre Sekte und Religionsgemeinschaft, über die er als Guru herrschte. Seine Jünger waren einfache Leute, die ihm freiwillig folgten, und er behandelte sie wie Freunde. Sie waren Freunde unter Freunden, Gleichgestellte unter Gleichgestellten. Er forderte keine Unterwerfung. Er sprach mit ihnen wie mit Freunden und Geschwistern. Den berufenen Propheten aber trennte durch seine Mission ein ungeheurer Abgrund von seinem Volksgenossen, besonders Propheten als Führer von Völkern, wie Moses und Mohammed es waren. Wer durfte sich ihnen nahen? Und wer es vermochte, der fühlte sich hoch erhoben über den Nächsten. War das nun eine Erhebung zu Gott? Allenfalls die zu einem Götzen!
Darum war Jesus mehr als ein Prophet, wie es auch seine Jünger von ihm sagen. In Jesus sahen die Jünger Gott unter sich wandeln, und es war nicht der Mensch Jesus, den sie vergötterten, Jesus blieb ihnen ein Freund, und vielleicht konnten sie ihn gerade darum so sehr lieben. Durch die Propheten aber blickten die Menschen auf einen strengen Götzen, der Tod und Verderben säte auf alle, die ihn nicht anerkannten. So schufen sich die Menschen Gott zum Bilde ihrer Propheten. Ganz Ähnliches macht man heute mit Jesus. Sie machen ihn zu ebendemselben Götzen, den sie durch die Propheten kennengelernt haben.
Die Propheten glänzten durch mediale Weisheit, sie empfingen Botschaften in ekstatischen Zuständen. Jesus war einfach nur Mensch in der Fülle seiner Menschlichkeit. Den Propheten floss das Maul über, schäumte in Flüchen und dunklen, erhabenen Sprüchen. Können wir einen Ekstatiker lieben? Können wir sagen, er sei ein liebevoller Mensch? – Er verdient ja unser Mitleid!