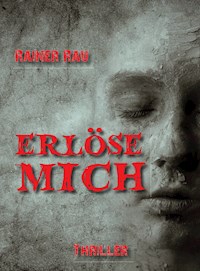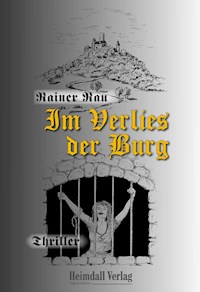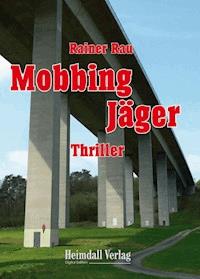
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die sechzehnjährige Patrizia Schmidt findet nach einem Streit mit ihrem Freund, nachts auf dem Spielplatz einen Kopf im Sand. Es ist die Leiche des Richters Martin Werbusch. Es stellt sich heraus, dass es hier um einen Fall von Mobbing geht. Und es ist sehr schnell klar, dass ein "Mobbingjäger" den korrupten Richter getötet hat. Damit ist seine Rache für den Tod seiner Tochter aber noch nicht gesühnt. Er jagt weiter. Und das auf spektakuläre Weise. Eine Brücke und ein Seilzug dienen als Folterinstrumente um ein Geständnis zu erzwingen. Der Fall gipfelt darin, dass ein machtbessesener Polizist vor einem Mord nicht zurückschreckt. Ein leicht zubeeinflussender Kollege schlägt sich auf die Seite des Polizisten und will nun aus gekränkter Eitelkeit ebenfalls töten. Ausgerechnet ein Polizeirevier hat sich der Autor für diesen spannenden Thriller ausgesucht. Da es nicht auszuschließen ist, dass es tatsächlich Fälle von Mobbing in Polizeidienststellen gibt, wurde die örtliche Lage des Reviers nicht näher angegeben. Somit sollte sich keiner wiedererkennen. Alle Namen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Der Autor schliesst nicht aus, dass es in jeder anderen Firma, bei der Bundeswehr, in Arztpraxen, in Versicherungsbüros oder bei Institutionen des Bundes, Landes oder der Kommunen, wie in jedem anderen handwerklichen Betrieb, zu Mobbingsituationen kommen kann. Da Mobbing in den meisten Fällen von Betroffenen nicht bewiesen werden kann, kommt es auch kaum zu Anzeigen gegen die Täter. Durch das Internet ist in den letzten Jahren eine größere Dimension von Mobbing entstanden. Täter können nur sehr schwer ermittelt werden. Menschen, die von einer Mobbingsituation erfahren, sei geraten sich den Opfern solidarisch zu zeigen und Hilfe anzubieten – denn Jeder kann morgen das nächste Opfer sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Rau
Mobbing Jäger
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Danke
1. Kopf im Sand.
2. Der Fall Kowalski.
3. Urteil nach bestem Gewissen.
4. Ein schlagender Richter.
5. Überredung zum Tod.
6. Nötigung oder so gewollt?
7. Die Ausgrabung.
8. Ärger in der Dienststelle.
9. Die Todesursache.
10. Das Tagebuch der Marion Kowalski.
11. Sackgasse.
12. Fehlende Dienstanweisung.
13. Friedensangebot.
14. Hilfe gesucht – Hilfe gefunden.
15. Ein Ausweg.
16. Ratschlag zur Freude.
17. Der Einbruch.
18. Türsteher lieben Baseballschläger.
19. Schlafmittel meets Wein.
20. Geständnis trifft Verständnis.
21. Schläge für Schrankgespenster.
22. Schädelbasis kaputt.
23. Kein Puls – dann tot.
24. Vertrauen bereitet Glücksgefühl.
25. Der Schock.
26. Trennung von Tür und Rahmen.
27. Schmerzliche 30 Euro.
28. Profiler erstellen Profile.
29. Unter Brüdern.
30. Serenas Trauer.
31. Kaltes Wasser gegen Müdigkeit.
32. Ein 200 Euro-Päckchen.
33. Einladung zur Angst.
34. Blöde Kuh verlangt Schmerzensgeld.
35. Treten ist besser denn Beißen.
36. Rauf und runter.
37. Seil zu lang.
38. Das Alibi.
39. Beweishandy.
40. Die Geisel.
41. Verlass auf eine Freundin.
42. Krankes Hirn.
43. Das Manuskript.
Personen:
NACHLESE
ZUR GESCHICHTE.
Impressum neobooks
Danke
Vielen Dank an einen Freund, Hauptkommissar der Kriminalpolizei, der mir bei vielen Fragen mit wertvollen Ratschlägen zur Seite stand.
1. Kopf im Sand.
Es war vier Uhr morgens. Und es war eine sternenklare, milde Sommernacht. Die Party war schön, das Ende der reine Horror.
Der junge Mann fuhr den älteren BMW 316 den Berg hinauf und bog auf den Parkplatz zum Sportplatz ein. Er hatte vor einiger Zeit einen neuen Auspuff montiert, der eine Steigerung der Motorleistung bringen sollte, aber wie es sich schnell herausstellte, lediglich den Geräuschpegel erhöhte. Tagsüber gab ihm das ein Gefühl von Formel 1. Jetzt aber, mitten in der Nacht, war es von Nachteil. So gab er nur wenig Gas. Er wollte die Anwohner nicht auf sich aufmerksam machen. Da auf diesem Parkplatz viele Feste stadtfanden, waren sie gegen Lärm mitten in der Nacht sensibilisiert.
Vor dem Eingang des angrenzenden Spielplatzes, der geschützt hinter einer Hecke lag, blieb er stehen und stellte den Motor ab. Die Anwohner brauchten nicht mitbekommen, was er mit seiner Freundin noch im Auto vorhatte. Er war gut drauf, die Party war gelungen und der Abschluss des Abends wäre nun noch ein »heißer Ritt mit Frau Schmidt« gewesen. So nannte er seine Freundin Patrizia Schmidt, wenn er sie etwas ärgern wollte.
Aber irgendwie spürte er, dass ein Gewitter in der Luft lag.
»Was ist los mit dir?«
Er sah seine Freundin an und schüttelte verärgert den Kopf.
Patrizia hatte ihren 16. Geburtstag mit allen Freunden in einer Diskothek in der Stadt gefeiert. Nun saß sie mit hochrotem Kopf neben ihrem Freund im Auto und war sauer.
»Was los ist? Das frag dich mal. Du machst mit meiner besten Freundin herum und wunderst dich dann, dass ich sauer bin! Das ist los!«
Sven Kaufmann ahnte gerade, dass aus der schnellen Nummer im Auto heute nichts werden würde.
Trotzdem wollte er nicht so schnell aufgeben. Das letzte Mal, als sie Sex hatten, war schon zwei Wochen her und seine Kumpels zogen ihn schon auf wegen der vermeintlichen Hinhaltetaktik seiner Freundin. Da musste er sich Sprüche wie: »Pass auf, dass du nicht den Umweg zu ihrem Bett über den Traualtar machen musst!«, oder Ähnliches gefallen lassen.
Also machte er einen weiteren Versuch.
Er hätte es ja auch seinen Freunden verschweigen oder sie belügen können, was sein Intimleben mit seiner Freundin so hergab. Es war jedoch Ehrenkodex in der Clique, sich die reinen Wahrheiten zu berichten.
Konnte einer seiner Freunde mit einem Schäferstündchen mit einer älteren, verheirateten Dame auftrumpfen und ein anderer mit einer unglaublichen Geschichte von einer wilden Party mit gleich zwei Girls gleichzeitig, so kam er sich schon vor wie »Kevin allein zuhause«.
Er wollte beim nächsten Treffen nicht schon wieder von einem enthaltsamen Abend erzählen.
»Nun komm schon. Das war doch nicht ernst gemeint. Ich wollte doch nur etwas nett sein.«
Kaufmann war neunzehn und sie waren nun schon fast ein Jahr zusammen. Er hatte auf Patrizias Eltern einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht und so hatten diese auch nichts dagegen, dass er ihre Tochter zur Disco abholte. Er hatte sie bisher ja auch immer wohlbehütet heimgebracht.
Nett sein zu Patrizia wollte er auch jetzt. So versuchte er, sie zu küssen, wobei seine Hand an ihrem Hals in Richtung Ausschnitt ihres Oberteils wanderte.
Als sie darin verschwand, stieß sie seinen Arm weg.
»Lass das! Ich bin nicht in der Stimmung, nachdem du mich so verletzt hast.«
Sven wusste mittlerweile, dass sie meistens sehr schnell in Stimmung zu versetzen war und gab so schnell nicht auf.
Allerdings hatte sie erst am Morgen ihre Tage bekommen und war allgemein nicht gut drauf, sonst hätte ihr die Knutscherei von Sven und ihrer Freundin wohl nicht so viel ausgemacht. An solchen Tagen ging es ihr wirklich nicht besonders gut. Meistens nahm sie dann einen oder zwei Tage lang Tabletten ein, die ihr der Frauenarzt verschrieben hatte, und der Normalzustand trat wieder ein.
Auf Sex stand ihr der Sinn im Augenblick nicht. Als er anfing, an ihrem Ohr zu knabbern und seine
Hand unter ihrem Rock verschwand, war ihr aber richtig hundeelend zumute und sie fing an zu schreien und weinte dabei zu allem Leidwesen von Kaufmann auch noch.
Dieser hatte nun doch ein schlechtes Gewissen und wollte sich entschuldigen, was von ihr aber nicht akzeptiert wurde. So gab ein Wort das andere und führte zum Ende des Abends, der mit einer schönen Geburtstagsfete in der Disco begonnen hatte.
Sven gab nun sein Bemühen nach einer schnellen Nummer im Liegesitz des BMWs auf und wollte nur noch nach Hause ins Bett. Er war frustriert und genervt.
Der Zeiger der Uhr neben dem Tacho stand mittlerweile auf 4.50 Uhr.
»Also, wenn du weiter so rumzickst, kann ich ja auch fahren!«
»Ja, kannst du! Brauchst auch nicht wiederzukommen!«
Der Krach war perfekt.
Sie stieg aus und schlug wütend die Beifahrertür zu. Sven machte sich Sorgen, ob er sie hier alleine lassen konnte. Das Haus ihrer Eltern war nicht weit weg und es wurde bald hell. So siegte sein Stolz und er startete den Motor.
Die CD-Anlage zog eine eingelegte Techno-CD und startete mit Lautstärkelevel zehn, was die oberste Grenze war. Die Bassbox im Kofferraum dröhnte und das Auto vibrierte beim Einsetzen des Schlagzeuges. Er schaute noch einmal zu seiner Freundin, die ihm aber den Rücken zukehrte, und so gab er Gas. Jetzt war es ihm egal, ob die Anwohner wach wurden. Der BMW fuhr mit quietschenden Reifen vom Parkplatz auf die Straße und verschwand.
Patrizia Schmidt war nun allein.
Sie war schon ein ängstlicher Typ, da sie aber nicht weit von ihrem Zuhause entfernt war und oft an diesem Ort in Kindheitstagen gespielt hatte, empfand sie jetzt keine Angst. Es dämmerte auch schon und es versprach, ein schöner Tag zu werden.
Sie beruhigte sich langsam und ihr Puls normalisierte sich.
Das sollte sich jedoch sehr schnell ändern.
Mittlerweile war es fünf Uhr morgens. Es war Sommer, doch es hatte sich in der Nacht etwas abgekühlt und so war es angenehm mild.
Wenn sie so verheult nach Hause kommen würde, und irgendeiner aus der Familie benutzte um diese Zeit immer das Klo, wären lästige Fragen angesagt, denen sie aus dem Weg gehen wollte.
So ging sie um die Hecke herum und betrat den Kinderspielplatz. Sie legte ihre Handtasche auf den hölzernen Tisch, an dem an schönen Tagen Mütter saßen, ein Schwätzchen hielten und ihre spielenden Kinder im Sand beobachteten.
Patrizia nahm ein Taschentuch und den kleinen, handlichen Spiegel aus der Tasche heraus.
Als sie sich die Nase putzen wollte, hob sie den Kopf und schaute in Richtung Rutschbahn zu dem großen Sandplatz.
Schlagartig setzte ihr Herzschlag für Sekunden aus und wurde dann wieder rasend schnell.
Ihr Brustkorb hob und senkte sich in schneller Folge. Ihre Augen waren noch tränenverschleiert und sie konnte noch nicht klar sehen.
Aber was sie noch undeutlich sah, ließ sie einen markerschütternden Schrei ausstoßen. Ihre Gedanken hatten noch nicht richtig registriert, was sich in ihren Augen spiegelte. Ihr Unterbewusstsein reagierte aber schlagartig und versetzte ihr zu den schon vorhandenen Bauchschmerzen auch noch zusätzliche Magenprobleme.
Dann sah sie ihn ganz deutlich.
Ein Kopf ragte aus dem Sand zwischen Rutschbahn und Drehkarussell hervor. Durch einen kleinen Windstoß wurden die Haare auf dem Kopf bewegt und so schien es einen Augenblick lang, als ob sich der Kopf selbst bewegte.
Ihr zweiter Schrei, länger und lauter als der erste, bewirkte, dass zwei Häuser weiter ein Rollladen hochgezogen wurde und eine männliche Stimme rief: »He, was ist da los? Mitten in der Nacht! Frechheit, so ein Krach zu machen! Wenn nicht gleich Ruhe ist, rufe ich die Polizei!«
Patrizia Schmidt antwortete dem Rufer mit hysterisch hoher Stimme.
»Hier ist ein Kopf im Sand. Polizei! Rufen Sie die Polizei!«
Sie musste es noch mal wiederholen, dann erst war der Mann überzeugt und griff zum Telefon.
Patrizia lief auf die Straße. Die kurze Strecke zu ihrem Elternhaus legte sie in Rekordzeit zurück.
Als die Polizei ankam, war es mittlerweile hell. Man hatte sich Zeit gelassen. Den Anruf hatte man in der Wache zwar entgegengenommen, aber als Scherz abgetan. Der Einsatzleiter fragte nach, welches Fahrzeug in der Nähe der angegebenen Adresse sei und gab über Funk den Kollegen die Order durch, doch mal dort vorbei zu schauen.
»Dort soll ein Kopf im Sand eines Spielplatzes stecken. Wahrscheinlich ein Scherz Jugendlicher. Ermitteln Sie wegen nächtlicher Ruhestörung. Die hat ein gewisser Manfred Paulis gemeldet.«
Er gab die genaue Adresse des Anwohners durch und beendete den Funkverkehr.
Die Beamten schauten sich an und lachten.
»Ein Kopf! Haha. Ein Fußball mit ’nem Hut drauf. Hahaha.«
Sein Kollege war nicht so gut gelaunt und kommentierte das Ganze ärgerlich.
»Ewig diese Betrunkenen nachts. Saufen bis in die Morgenstunden und meinen sie müssten uns, die schließlich arbeiten müssen, noch zusätzlich Ärger bereiten. Und gegen solche Menschen kannst du gar nichts unternehmen. Die lachen dich noch aus. Na gut. Sehen wir uns den Kopf mal an. Bis Schichtwechsel ist es eh noch ’ne Stunde.«
Als sie mit Blaulicht den Berg hinauf fuhren, standen trotz der frühen Stunde schon einige Menschen auf der Straße.
Sie parkten den Dienstwagen auf dem großen Parkplatz am Sportplatz, stiegen aus und erkundigten sich bei den Versammelten, wer die Polizei gerufen hatte.
Patrizia Schmidt und ihre Eltern machten einen schockierten Eindruck auf die Polizisten.
Diese erkannten nun doch sehr schnell, dass es sich hier um eine ernste Sache handeln musste.
»Wer hat den Kopf entdeckt?«
Patrizias Vater antwortete dem Beamten.
»Meine Tochter hat ihn zuerst gesehen.«
»Aha. Wie alt ist Ihre Tochter? Und was macht sie nachts um vier hier auf dem Spielplatz?«
Herr Schmidt wurde etwas rot im Gesicht. Er wusste genau, was seine Tochter und ihr Freund hier wollten. Allerdings empfand er die Frage des Polizisten als sehr anzüglich und so fiel seine Antwort sehr knapp aus.
»Nun, meine Tochter ist alt genug. Ihr Freund hat sie nach Hause gefahren.«
Die Beamten waren nicht weiter an ihm interessiert und gingen vom Parkplatz um die sichtversperrende Hecke herum.
Sie schauten sich den Kopf aus einiger Entfernung genauer an. Im Strahl des Scheinwerferlichtes ihrer großen Batterieleuchte erkannten sie, dass es sich nicht um einen Fußball mit Hut handelte.
Der Kopf hatte auch keinen Hut auf. Die Haare wurden ab und zu von einer leichten Brise bewegt.
So fiel der Kommentar des einen Polizisten knapp und präzise aus.
2. Der Fall Kowalski.
Zeitsprung zurück.
Marion Kowalski war schon immer ein ruhiges und sehr introvertiertes Mädchen. In ihrer Kindheit hatte sie, gerade weil sie alles über sich ergehen ließ, sehr viel Spott einstecken müssen. Das fing schon im Kinderhort an. Man lachte sie oft aus und zeigte mit den Fingern auf sie, wenn sie wiedermal ihr Kleidchen mit heißer Schokolade bekleckert hatte. Zur Schulzeit wurde sie ebenso sehr oft geärgert. Einmal lästerten die Jungs über ihren kleinen Busen, das andere Mal war es ihr großer Hintern, über den sie sich Witze anhören musste. Ein weiteres Mal wurde sie einfach ignoriert oder ihre Schulfreunde ließen sie am Tages geschehen nicht teilhaben. Es kam auch schon mal vor, dass sie einfach zu einer Party oder einer Veranstaltung nicht eingeladen wurde. So fühlte sie sich ausgegrenzt, was sie im Prinzip dann auch war.
Ihr Selbstwertgefühl fiel in die Tiefe und sie suchte den Fehler bei sich selber.
Sie ergab sich dann immer in ihr Schicksal und erklärte es sich so, dass es Leute gibt, die im Mittelpunkt stehen und Leute, die als Verlierer geboren werden. So zumindest hatte es mal Onkel Karl bei einer Geburtstagsfeier ihrer Mutter und ihr erklärt.
»Das ist so, Marion. Da kannst du gar nichts gegen machen. Es muss ja auch Menschen geben, die sich unterordnen können. Wie um alles in der Welt sollten andere sonst die Ordnung in unserem Lande herstellen? Und so schlimm ist es ja auch nicht, wenn du nicht auf der Gewinnerseite stehst. Glaube mir, das ist auch nicht so einfach wie es aussieht. Um zu gewinnen, muss man sich hart durchbeißen. Sag einfach zu allem ja und geh den anderen aus dem Weg. Dann kommst du gut durchs Leben.«
Marion hatte ihm geglaubt. Sie war noch ein Kind und der Glaube zu den Verlierern im Leben zugehören, nistete sich für lange Zeit in ihren Kopf ein.
Wäre sie mal aus sich herausgegangen und hätte den Lästerern die Stirn gezeigt, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, wie es letztendlich kam.
Das lag jedoch nicht in ihrer Art. Sie schluckte allen Ärger und zeigte eine immer gleichbleibende, ja fast freundliche Miene.
»Es geht schon vorbei«, war ihre Devise. Sie hielt auch allen Ärger von ihren Eltern fern. Die hätten sich sonst große Sorgen gemacht. Insbesondere ihren Vater regte es fürchterlich auf, wenn sie unglücklich war. Er wollte seinen Engel immer glücklich sehen und konnte es nicht ertragen, wenn sie traurig war oder eine melancholische Phase durchmachte. Dann ging es ihm immer schlecht.
Die Zeit, in der sie zur Uni ging, war noch die schönste in ihrem Leben. Zwar wurde sie auch dort von einigen Kommilitonen gemobbt, sie hatte sich aber im Laufe der Jahre ein dickes Fell zugelegt und so nahm sie es gelassen. Nur ab und zu war das Leben doch sehr hart für sie. Beispielsweise wenn ein Student sie um ein Date bat, sie gerührt darauf einging, sich Hoffnung machte und er dann im Hörsaal eine Stunde später laut verkündete, dass sie sich unbedingt mit ihm treffen wollte und er das absolut nicht verstehen könne.
Einer der Studenten meinte es wirklich nicht gut mit ihr. Er machte lautstark Witze auf ihre Kosten.
»Wie sagte schon Sokrates: So frage ich euch, Ihr Gelehrten und Mitfühlenden, warum sollte ich mich mit einem solchen unästhetischen Anblick belasten, an dem mein Augenlicht Schaden nimmt?«
Er hatte es laut und deutlich gesprochen und alle auf den Rängen fielen in ein kollegiales Lachen ein. Keiner machte sich Gedanken darüber, dass Sokrates diesen Satz nie gesagt hatte. Es interessierte sie nicht. Es interessierte sie auch nicht, wie sich Marion Kowalski fühlte bei solchen Attacken.
Hätte sie die Kraft besessen und ihm eine Ohrfeige verpasst oder ihn zumindest verbal als Idioten beschimpft, hätte sie sich sicherlich Respekt verschafft.
So aber verließ sie den Hörsaal mit hochrotem Kopf und stieß am Eingang mit einem Dozenten der Uni zusammen. Sie ließ ihn stehen und Tränen rannen ihre Wangen herunter, als sie von dem Gelände lief.
Der Dozent vermutete, dass man nicht nett zu ihr gewesen war und stellte im Hörsaal die Gretchenfrage: »Was war eben hier los?«
Der Student, der diese Situation herbeigeführt hatte, ergriff das Wort: »Na ja. Sie wissen ja, wie Frauen so sind. Man kann es ihnen manchmal nicht recht machen.«
Das allgemeine Gelächter zeigte dem Dozenten, dass er die Sache nicht so schnell aufklären würde. Am Ende würde er wohl nicht ernst genommen werden.
Er schaute verärgert in die Runde und knirschte mit den Zähnen.
Damit war der Fall erledigt, zumal die Zeit drängte, die nächste Klausur bevorstand und der Lehrstoff noch lange nicht abgearbeitet war.
Ein anderes Mal schüttete ihr eine Studentin heißen Tee auf die Hose, genau dorthin, wo die Hosenbeine zusammengenäht waren. Es war zwar verboten, Getränke mit in den Hörsaal zu nehmen, kontrollieren konnte und wollte das aber keiner. Als dann der Ruf von weit unten erschall: »Oh, schaut nur. Marion Kowalski hat sich in die Hose gemacht!« und ein anderer rief durch den Saal: »Das war nicht notwendig. Der neue Professor ist doch schon verheiratet«, lachte wieder der gesamte Hörsaal.
Marion Kowalski konnte auch dieses Mal an der Vorlesung nicht teilnehmen.
Dann gab es Tage und Wochen, in denen man sie in Ruhe ließ. In dieser Zeit war sie für ihre Kommilitonen einfach Luft. Man sprach nicht über sie, man sprach aber auch nicht mit ihr.
Sie wusste nicht, was schlimmer war. Sie hatte kein Vertrauen zu anderen Menschen und zog sich ganz zurück.
In dieser Zeit, kurz vor ihrem Examen, reifte in ihr der Gedanke, einen Beruf zu wählen, in dem sie autorisiert war, auch eine gewisse Autorität zu zeigen. Ursprünglich wollte sie mit ihrem Lehramtsstudium auch den Weg in das Lehramt einschlagen. Dann aber stellte sie sich eine pubertierende Schulklasse vor, die ihr pausenlos Schwierigkeiten bereiten, sie nicht ernst nehmen und mit ihren Gefühlen spielen würde.
Nein, das ging gar nicht.
»Aber mit einer Uniform erhält man unaufgefordert Respekt«, redete sie sich Mut zu.
Sie bewarb sich bei der Polizei.
Marion Kowalski hatte Glück und konnte die Probe- und Anlernzeit bei der Bereitschaftspolizei einer Dienststelle in Frankfurt antreten. Danach wurde eine Planstelle in einem Präsidium der Schutzpolizei in Berlin frei. Das hatte zur Folge, dass sie auch dorthin ziehen musste. Sie wechselte von Hessen nach Berlin.
Sie fand relativ schnell eine Einzimmerwohnung, die in U-Bahnnähe lag und zog dort ein.
Ihre Rechnung ging auf, was die Mitmenschen auf der Straße betraf. Sie begegneten ihr mit Respekt und Höflichkeit.
Ihre Kollegen allerdings nahmen auf die Frauen in der Dienststelle keine große Rücksicht. Die meisten Frauen sahen darüber hinweg und nahmen es mit den verbalen Wortspielereien der männlichen Kollegen auf. Eine Polizistin hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, dem Kollegen, der sie anmachte, den Stinkefinger zu zeigen. Das hielt denjenigen nicht davon ab, bei nächster Gelegenheit wieder einen derben Spruch zur Frauenfront zu schießen, die Wirkung aber verblasste mit der Zeit.
Derbe und frauenfeindliche Witze waren in der Dienststelle an der Tagesordnung.
Ein Kollege hatte es besonders auf Marion Kowalski abgesehen.
Kai Hübner ließ keine Gelegenheit aus, sie mit anzüglichen Fragen zu verunsichern. Er stellte ihr nach und suchte sie unter einem Vorwand auch in ihrer kleinen Wohnung auf. Als er sie begrabschte, warf sie ihn hinaus. Das hatte zur Folge, dass sie von ihm belästigt wurde, wo immer er sie traf. Dies stellte er so geschickt an, dass es kein Außenstehender bemerkte.
Eines Morgens überraschte er sie im Umkleideraum als sie gerade ihre kugelsichere Weste anlegen wollte, riss ihren Kopf an den Haaren zurück und spuckte ihr ins Gesicht.
»Ich krieg dich noch. Warte nur ab. Dann bist du reif!«
Dann war er wieder verschwunden. Als eine ältere Kollegin in den Umkleideraum kam, saß Marion Kowalski auf der Bank und weinte.
»He, Marion. Was ist denn los? Hat er dich verlassen? Scheiß auf die Männer. Nimm’s nicht so schwer.«
Es war unmöglich, der Kollegin den richtigen Sachverhalt zu erklären.
Marion hielt es in dieser Dienststelle nicht länger aus. Sie schrieb schließlich ein Versetzungsgesuch. Sie hatte gehört, dass in ihrem Heimatort eine Planstelle frei wurde. Sie war der Meinung, hier in der Nähe ihres Vaters würde sie den Nachstellungen des Kollegen entgehen. Warum sie sich dies einbildete, war nur soweit logisch erklärbar, dass sie eine größere Distanz zwischen sich und den jetzigen Kolleginnen und Kollegen bringen wollte. Ihre Mutter verstarb früh, aber weder mit ihr noch mit ihrem Vater hatte sie über ihre Probleme mit anderen Menschen gesprochen. Sie gab sich selbst zum Teil eine Mitschuld an der Situation. Zum anderen konnte sie es nicht ertragen, ihren Vater leiden zu sehen, wenn es ihr schlecht ging. Sie redete auch mit keinem anderen Menschen über ihre Probleme. Abends schrieb sie alles in ihr kleines rotes Tagebuch. Nur ihm vertraute sie sich an.
Sie bekam die Stelle in der Provinz nach einem halben Jahr, kündigte ihre Wohnung in Berlin und zog wieder ins Haus ihrer Eltern, in ihr altes Jugendzimmer ein. Später wollte sie sich eine eigene Wohnung in der Nähe mieten.
Dazu sollte es jedoch nicht mehr kommen.
Sie kam mit ihren neuen Kolleginnen und Kollegen recht gut klar und die Arbeit fing an, ihr zum ersten Mal richtig Spaß zu machen. Bis zu dem Donnerstag im Oktober, als der Dienststellenleiter einen Neuzugang ankündigte. Mit Beginn der normalen Schicht am Morgen betrat Kai Hübner den Raum.
Es war allgemein bekannt, dass neue Kollegen ihren Dienst antreten sollten. Doch wer von welcher Dienststelle wechselte, wusste man nicht. Es hatte sich lediglich herumgesprochen, dass der Neue aus Berlin sein sollte.
So erfuhr Marion Kowalskis erst in diesem Augenblick davon, dass es der Mann war, der sie in Berlin massiv bedrängt hatte.
Ihr Herz setzte aus, als sie ihn sah. Hübner lachte ihr frech ins Gesicht.
Der Chef stellte ihn kurz vor. Dann sagte er beiläufig zu Kowalski gewandt: »Sagen Sie, Frau Kowalski. Sie müssten sich doch eigentlich aus Berlin her kennen? Waren Sie nicht im gleichen Revier tätig?«
Kowalski wollte schon verneinen, da fiel ihr Hübner ins Wort: »Klar kennen wir uns. Wir waren schließlich mal so gut wie zusammen.«
Auch das wollte sie dementieren, nun fiel ihr aber ihr Vorgesetzter ins Wort: »Na. Das wird aus Sicht der Chefetage eigentlich nicht gerne gesehen. Es soll den Dienstablauf stören. Ich sehe das nicht so eng. Hauptsache, Sie kommen gut miteinander aus und die Kollegen stört es nicht. Also, im Dienst keine Intimitäten.«
Hübner legte schnell den Arm um Kowalskis Schulter und beeilte sich zu sagen: »Sicher kommen wir gut miteinander aus!«
Marion Kowalski entzog sich seiner Umarmung. Ihr war schlecht.
Sie konnte es bei der folgenden Einsatzbesprechung einrichten, dass sie nicht mit Hübner in einem Wagen fahren musste, was dem Dienststellenleiter nur recht war. Laut Dienstplan war sie weiterhin einem Kollegen zugeteilt, mit dem sie schon seit geraumer Zeit fuhr. Dies blieb auch die nächsten Tage und Wochen so.
Hübner jedoch ließ in dieser Zeit keine Gelegenheit aus, sie bei den Kollegen schlecht zu machen und ihren Charakter ins negative Licht zu stellen. So erzählte er jedem, der es hören wollte und es wollten fast alle hören, dass Kowalski es in Berlin ja so gut wie mit jedem getrieben hätte.
»Einmal bin ich in den Besprechungsraum gekommen, da lag sie mit unserem ältesten Kollegen auf dem Boden. Nicht, dass es ihr peinlich gewesen wäre. Nein, sie hatte mich genau gesehen und trotzdem die Beine weit von sich gestreckt. Die schreckt vor nichts zurück.«
Einer, der das nicht glauben konnte, äußerte seine skeptische Meinung laut.
»Aber sie ist doch eher der ruhige Typ. Das kann ich gar nicht glauben.«
»Das ist auch nur Show. Sprich sie doch mal darauf an, wenn du mit ihr alleine bist. Oder geh gleich aufs Ganze und leg sie flach. Dann siehst du, ob sie still hält oder nicht. Glaub mir, die will es so!«
Einen Monat später war es genau das, was zwei Kollegen vorhatten. Sie hatten den Lügen Hübners wohl Glauben geschenkt.
Zum Ende der Spätschicht lauerten sie Kowalski im Umkleideraum auf.
Man konnte zwar in Dienstkleidung den Weg zur Dienststelle antreten, doch die meisten Kollegen zogen es vor, sich im ersten Untergeschoss des Gebäudes umzuziehen.
So auch Marion, da sie nach Dienstende oft im Park spazieren ging, was sie sehr gerne tat.
Angestachelt durch die permanente Zerstörung des guten Rufes von Kowalski hatten sie den Mut, nun das mit ihr zu tun, was ja laut Erzählung von Hübner bei ihr an der Tagesordnung sein sollte.
Sie flachzulegen.
Es befand sich außer ihnen niemand im Umkleideraum. Als Marion ihre Spindtüre öffnete, sprangen die beiden Kollegen hervor. Einer der beiden hielt sie fest, der andere riss ihr die Bluse auf und öffnete ihre Hose. Als sie schreien wollte, schlossen sich Finger um ihren Mund. Kowalski wehrte sich heftig. Als der Mann vor ihr ihre Hose und den Slip herunterzog, biss sie dem Mann, der sie festhielt, kräftig in die Hand. Der ließ sie sofort los und fluchte. Auch der andere war sich nun seines Tatendrangs nicht mehr so sicher. Er beschimpfte Kowalski.
»Warum stellst du dich hier so an? Sind wir dir nicht gut genug? In Berlin hattest du damit ja wohl keine Probleme. Da sollst du alles gefickt haben, was dir begegnet ist!«
Marion Kowalski sank auf den Boden und weinte, was die beiden total aus dem Konzept warf.
»Nun hör schon auf mit dem Geheul. Es ist ja nichts passiert. Und dem Chef brauchst du erst gar nichts zu sagen. Der glaubt dir sowieso nicht. Du hast hier nämlich nicht den besten Ruf.«
Während einer der Kollegen den Raum verließ, drehte sich der andere noch einmal um.
»Aber glaub mir, wir sind noch nicht fertig mit dir. Nur für jetzt. Wir kriegen dich noch. Und dann werden wir dir’s schon zeigen, egal ob du dann rumzickst. Heute Abend besuchen wir dich in deiner Wohnung. Du entkommst uns nicht.«
Dann schlug er die Tür zu.
Marion Kowalski beruhigte sich langsam. Sie setzte sich mit dem Rücken an einen Spind. Ihre Gedanken waren nun ganz klar. Ihre Hände aber zitterten. Sie zog ihren Slip und die Hose wieder hoch und steckte ihre Bluse hinein.
Dann nahm sie ihre Waffe, die sie im Spind abgelegt hatte und zog sie aus dem Holster.
Die Walther PPS, eine Selbstladepistole, wurde erst seit 2007 produziert und in der Dienststelle war sie erst vor kurzem gegen das Vorgängermodell, die Walther PPK, ausgetauscht worden. PPS steht für Polizei Pistole Schmal. Sie hat aufgrund des größeren Kalibers eine größere Durchschlagskraft. Dringt eine der 9 mm-Patronen aus kurzer Entfernung in den Brustbereich ein, so ist sie sehr wahrscheinlich tödlich.
Marion Kowalski wusste über die Wirkung eines abgefeuerten Schusses Bescheid. Sie hatte es oft genug beim Schießen auf dem Schießstand gesehen. Sie wusste genau, was passieren würde, wenn sie ihr Vorhaben ausführte. Dicke Tränen rannen ihre Wangen hinunter. Sie weinte lautlos.
Sie lud durch, entsicherte die Waffe, steckte sich den Lauf in den Mund und richtete ihn schräg nach oben. Sie schloss die Augen und drückte ab.
Marion Kowalski war sofort tot.
Die Kugel drang durch den Gaumen, das Kleinhirn und durch die linke Großhirnhälfte. Als sie am Hinterkopf austrat, riss sie einen Teil der Schädeldecke weg, die mit der hellen Gehirnmasse gegen die Blechtür des Spindes geschleudert wurde. Im Spind blieb auch die Kugel stecken.
Ihr Gesicht aber blieb unverletzt. Ihr Vater sollte sie nicht mit entstelltem Gesicht sehen.
3. Urteil nach bestem Gewissen.
Die Nachricht vom Tode seiner Tochter traf Eberhard Kowalski wie ein Blitz. Er hatte körperliche Schmerzen und sein Magen rebellierte. Zwei Tage lang erbrach er sich sofort, wenn er etwas zu sich nahm. Dann kamen seine Lebensgeister langsam zurück und er grübelte über das Geschehen nach.
Hätte er sich besser um seinen Engel kümmern müssen? Wäre dann so etwas nicht geschehen? Seine Fragen blieben unbeantwortet und er machte sich große Vorwürfe.
Nach einiger Zeit ging es ihm etwas besser.
Die Trauerfeier nach der Beerdigung musste er jedoch früher als geplant verlassen, da er den Anblick der Polizisten in Uniform nicht ertragen konnte. Eine innere Stimme sagte ihm, dass sie am Tode seiner Tochter schuldig seien.
Kowalski konnte weiterhin tagelang keinen klaren Gedanken fassen. Warum hatte sie das getan? Warum nur hatte sie sich das Leben genommen? Wer hatte ihr das angetan? Wer hatte ihr das nur angetan? Wer hatte ihr überhaupt was angetan?
Es gab keine Antwort auf diese Fragen. Die aber suchte er. Er wollte wissen, wer seine Tochter auf dem Gewissen hatte.
Das hatte einer! Denn ohne Grund brachte man sich doch nicht so einfach um. Sie hatte nie etwas gesagt, woraus er schließen konnte, dass sie depressiv war.
Dann traf er sich mit Arbeitskollegen seiner Tochter und befragte sie nach den Umständen, die zu dem Selbstmord geführt hatten.
Aber er rannte gegen eine Wand. Keiner der Männer wollte ihm etwas sagen. Alle blockten ab.
Als er im Hof des Präsidiums auf eine Polizistin traf, die gerade den Wagen geparkt hatte und deren Kollege schon im Gebäude verschwunden war, erfuhr er zum ersten Mal andeutungsweise mehr.
Eberhard Kowalski sprach sie an.
»Bitte reden Sie mit mir! Keiner will mir etwas über meine Tochter sagen. Was hat sie dazu bewogen, Selbstmord zu begehen?«
»Ich kann Ihnen auch nichts Näheres sagen. Marion hat sich halt alles so zu Herzen genommen.«
Sie bemerkte ihren Fehler sofort und wollte an Kowalski vorbeigehen.
Der aber hielt sie am Arm fest.
»Was hat sie sich zu Herzen genommen? Bitte sagen Sie es mir! Ich dreh sonst noch durch. Ich bin ihr Vater. Ich muss wissen, warum sie sich umgebracht hat.«
Er tat ihr leid und so war sie bereit, noch etwas zu sagen.
»Na ja. Die Kollegen sind manchmal nicht gerade nett zu uns.«
»Was meinen Sie mit nicht gerade nett?«
»Für manche Männer sind Frauen als Kolleginnen ein rotes Tuch. Sie können einem schon das Leben zur Hölle machen. Dann stellen sie einem nach und versuchen, wo sie nur können, uns irgendetwas reinzuwürgen.«
»Sie wurde gemobbt?«
»Ja, kann man so sagen. Aber ich habe Ihnen das nicht gesagt. Sonst komme ich in Teufels Küche.«
»Von wem? Von wem wurde sie gemobbt?«
»Weiß ich nicht. Da kommen viele in Frage. Am eifrigsten war da ein Kollege, den sie aus Berlin kannte. Von mir haben Sie das aber nicht. So, nun muss ich aber wirklich gehen.«
Sie verschwand ohne weitere Worte.
Kowalski erfuhr den Namen des Kollegen aus Berlin nicht. Er stand fassungslos da und sein Blick richtete sich fragend gegen den Himmel.
Er ließ die nächsten Tage und Wochen keine Ruhe und stand fast jeden Tag vor oder in dem Polizeirevier und befragte Besucher wie Polizisten nach Mobbingvorfällen.
Eberhard Kowalski war einst Bauingenieur und fand nach seinem Studium eine Anstellung bei einer großen Frankfurter Baufirma. Sein Fachgebiet war der Brückenbau. Er wollte, bildlich gesehen, hoch hinaus. Und das konnte er, als seine Firma ein Angebotszuschlag im Sultanat Oman bekam. Er zeichnete, berechnete und baute Modelle für drei riesige Brücken. Dann schickte man ihn in den Staat im Osten der Arabischen Halbinsel, wo er in den folgenden Jahren den Brückenbau überwachte.
Im Oman sollten in den nächsten Jahrzehnten 18 große Brücken gebaut werden. Die meisten davon im Norden des Landes im Gouvernement Musandam.
Als er herausbekam, dass ein Bauleiter Zement abzweigte und anderweitig verkaufte, ließ er Probebohrungen an den Objekten vornehmen. Dabei stellte sich heraus, dass im Ernstfall weder die Brücken noch die großangelegten Straßenzubringer den vorberechneten Werten standhalten würden. Als er seine Chefs in Deutschland darauf aufmerksam machte, kehrte man seine Bedenken hier unter den Teppich und erklärten ihm, dass die Werte noch alle in der berechneten Karenzzone lägen. Man war nicht an einem Skandal interessiert.
Kowalski ließ die Situation aber kein ruhiges Gewissen und er spielte dem seit 1970 herrschenden Sultan Qabus anonyme Informationen zu.
Der Skandal war nun doch perfekt.
Das Sultanat ist eine absolute Monarchie, besitzt aber gleichzeitig eine Verfassung. Die vom Sultan ernannten Minister haben jedoch lediglich eine beratende Funktion. Zwei Minister wurden durch andere ersetzt, was in der Öffentlichkeit keine große Beachtung fand. Es interessierte auch außer den Familienmitgliedern keinen, dass sie nie mehr gesehen wurden. Regresszahlungen in Milliardenhöhe wurden vom Sultan eingefordert und Kowalskis Firma meldete ein Jahr darauf Insolvenz an.
Man entließ ihn vorher schon fristlos, wogegen er mit Erfolg klagte. Die Firma musste ihn wieder einstellen. Danach wurde ihm das Leben zur Hölle gemacht. In diesen Jahren sprach man allerdings noch nicht so sehr von Mobbing. Sein Vorteil war, dass er sich fachlich gesehen besser auskannte als die meisten seiner Kollegen. Schließlich machte man ihm ein Abfindungsangebot, was er annahm. Sein Vertrauen in Bauriesen wurde seither so sehr gestört, dass er keine Beschäftigung mehr annahm.
Er hatte also Zeit. Viel Zeit. Manchmal mehr Zeit als ihm lieb war. Und so wurde mancher Tag unendlich lang. Um sich zu beschäftigen, ging er dann in den Kellerraum, in dem er eine kleine Werkstatt eingerichtet hatte. Hier bastelte er an verschiedenen technischen Utensilien. Beim Brückenbau im Sultanat Oman gab es seinerzeit Probleme mit der Beförderung von Lasten in eine Höhe von über einhundert Metern. Große Metallteile wurden mit einem Helikopter oder mit einem riesigen Krahn transportiert. Kleinere Teile, die weniger Gewicht mit sich brachten, mussten zu dieser Zeit mühsam über drei Etagen mit Flaschenzügen hochgezogen werden, da der Krahn für andere Transporte ständig ausgelastet war. Zwar wurde später ein weiterer Krahn aufgestellt, aber der war entweder defekt oder ebenfalls ausgelastet. Für einen dritten oder vierten Krahn war in der Reichweite des Schwenkarms kein Aufstellungsplatz vorhanden. Da kam Kowalski die Idee, eine elektronisch gesteuerte Seilwinde anzubringen. Die konnte man allerdings in keiner Fachfirma und schon gar nicht in einem Kaufhaus erstehen. Es gab zwar elektrische Seilwinden, diese aber wurden den Anforderungen, die er stellte, nicht gerecht, denn sie mussten präzise auf die vorher eingestellten Höhen automatisch stoppen. Als er sich damals dem Problem annehmen wollte, verstarb seine Frau und er musste zurück nach Deutschland. Er hatte somit keine Zeit mehr für Erfindungen.
Jetzt hatte er Zeit. So viel, dass er von früh bis spät vor dem Polizeirevier stand und Fragen stellte.
Der Amtsleiter der Schutzpolizei erteilte ihm schließlich Hausverbot. Kowalski nahm sich daraufhin einen Anwalt und dieser riet ihm zunächst, eine Klage gegen unbekannt einzureichen.
Das Verfahren zog sich ein halbes Jahr lang hin. Man trug in dieser Zeit alle Aussagen der Polizisten und ihrer Kolleginnen zusammen. Es waren nicht viele, und darunter befanden sich keine konkret verwertbaren Fakten.
Auf einen möglichen Skandal aufmerksam geworden, wurde auch eine interne Ermittlungsakte bei der Polizei angelegt. Diese ergab jedoch keine Erkenntnisse, dass es eine ausufernde Mobbingsituation gegen Kowalskis Tochter gegeben hätte. Sie hatte ihrem Vorgesetzten nie eine Beschwerde eingereicht.
Der Anwalt erachtete die Beweislage schließlich als sehr dünn, um damit einen Prozess zu gewinnen. Er riet Kowalski davon ab.
Einen Prozess zu gewinnen war diesem aber gar nicht so wichtig, er wollte weit mehr. Er wollte Aufklärung und ein Schuldeingeständnis des oder der Verantwortlichen. Hätten sie mit ihm geredet, wäre er eventuell zur Ruhe gekommen. Aber das taten sie nicht und so bohrte er weiter.
Einige negative Pressemeldungen über das zuständige Revier hatte er schon erreicht.
So stand in der örtlichen Tageszeitung ein Artikel mit der Überschrift: »Polizistin nahm sich das Leben – Vater klagt Arbeitskollegen und Vorgesetzte an.«
Sein Anwalt hatte jedoch weiterhin Bedenken.
»Unsere Beweislast ist nicht ausreichend für eine Verhandlung. Ich rate Ihnen, die Klage zurückzuziehen. Noch sind wir in der Zeit.«