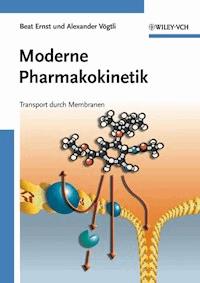
55,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie werden Arzneimittel im Korper verteilt? Wie gelangen sie an den Wirkort und docken an die richtigen Bindungsstellen an? Wie werden sie im Korper metabolisiert und schlie?lich wieder ausgeschieden? Welches sind die Mechanismen, die diesen Transportprozessen zu Grunde liegen? All dies sind essentielle Fragen der Pharmakokinetik, eines der wichtigsten Gebiete der Arzneimittelforschung und -entwicklung.
In didaktisch geschickter Form beantwortet das vorliegende Lehrbuch diese Fragen, und besticht zusatzlich durch sein ansprechendes Layout mit durchgehend vierfarbigen Abbildungen.
Nicht nur ein Muss fur alle fortgeschrittenen Studenten der Pharmazie, Medizinalchemie, Chemie, Pharmakologie und angrenzender Disziplinen, sondern auch ein wertvoller Begleiter fur Dozenten und Mitarbeiter der pharmazeutischen Industrie.
Aus dem Inhalt:
* Der Weg des Wirkstoffs zum molekularen Target
* Gastrointestinale Absorption
* Prozesse an der Leber
* Eliminierung an der Niere
* Verteilung ins Gehirn: die Blut-Hirn-Schranke
* Verteilung zur Plazenta
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Übersicht über das Thema Pharmakokinetik
2 Freisetzung aus der Arzneiform
2.1 Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln
2.2 Freisetzung aus der Arzneiform
3 Gastrointestinale Absorption
3.1 Darm: Übersicht - Transport über Membranen
3.2 Transzelluläre passive Diffusion
3.3 Parazelluläre passive Diffusion
3.4 Transporter
3.5 Peptid-Transporter (PEPT)
3.6 Transporter als Targets: H+/K+-ATPase
3.7 Ionenkanäle
3.8 Medizinisch-pharmazeutische Relevanz der Ionenkanäle
3.9 Efflux: P-Glykoprotein
4 Prozesse an der Leber
4.1 Histologie der Leber und Transport am Hepatozyten
4.2 Transport in die Hepatozyten: Beispiel OATP
4.3 Biotransformation
5 Verteilung zum Target
5.1 Verteilung ins Gehirn
5.2 Targets im ZNS: Neurotransmitter-Transporter
5.3 Verteilung zum ungeborenen Kind: Placenta
6 Elimination an der Niere
6.1 Übersicht über Aufbau und Exkretion durch die Niere
6.2 Sekretion: Organische Anionen-Transporter OAT
Sachverzeichnis
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Vohr, H.-W. (Hrsg.)
Toxikologie
Band 1:Grundlagen der Toxikologie
2010
Softcover
ISBN: 978–3-527–32319–7
Band 2:Toxikologie der Stoffe
2010
Softcover
ISBN: 978–3-527–32385–2
2-Volume Set:
ISBN: 978–3-527–32386–9
van de Waterbeemd, H. und Testa, B. (Hrsg.)
Drug Bioavailability
Estimation of Solubility, Permeability, Absorption and Bioavailability
Second, Completely Revised Edition
2009
Hardcover
ISBN: 978–3-527–32051–6
Ecker, G. und Chiba, P. (Hrsg.)
Transporters as Drug Carriers
Structure, Function, Substrates
2009
Hardcover
ISBN: 978–3-527–31661–8
Mannhold, R. (Hrsg.)
Molecular Drug Properties
Measurement and Prediction
2008
Hardcover
ISBN: 978–3-527–31755–4
Ottow, E. und Weinmann, H. (Hrsg.)
Nuclear Receptors as Drug Targets
2008
Hardcover
ISBN: 978–3-527–31872–8
Groner, B. (Hrsg.)
Peptides as Drugs
Discovery and Development
2009
Hardcover
ISBN: 978–3-527–32205–3
Tang, W. und Eisenbrand, G.
Handbook of Chinese Medicinal Plants
Chemistry, Pharmacology, Toxicology
2010
Hardcover
ISBN: 978–3-527–32226–8
Autoren
Prof. Dr. Beat Ernst
Institut für Molekulare Pharmazie
Pharmazentrum, Universität Basel
Klingelbergstrasse 50
4056 Basel
Schweiz
Dr. Alexander Vögtli
Institut für Molekulare Pharmazie
Pharmazentrum, Universität Basel
Klingelbergstrasse 50
4056 Basel
Schweiz
Abbildungen
Dr. Alexander Vögtli
1. Auflage 2010
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2010 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Cover-Design Adam-Design, Weinheim
Print ISBN 9783527323760
Epdf ISBN 978-3-527-66339-2
Epub ISBN 978-3-527-66338-5
Mobi ISBN 978-3-527-66337-8
Widmung
Für meine LehrerAlexander Vögtli
Für Lenah und ThomasBeat Ernst
Vorwort der Autoren und Danksagung
Dieses Buch geht auf die Zusammenarbeit der Autoren im Rahmen der Vorlesungen “Molekulare Wirkstoffmechanismen” und “Aktiver und Passiver Transport über Membranen” zurück, die an der Universität Basel den Studierenden der Pharmazeutischen Wissenschaften angeboten werden.
Während die pharmakodynamischen Aspekte der Wirkstoff-Target-Wechselwirkung in vielen Lehrbüchern breit abgehandelt wird, fehlen viele Informationen über den pharmakokinetischen Teil. Insbesondere der Transport über Membranen wird dabei nur stiefmütterlich behandelt. So beantworten Lehrbücher Fragen wie “Wie werden Arzneimittel im Körper verteilt? Wie gelangen sie an den Wirkort und docken an die richtigen Bindungsstellen an? Wie werden sie im Körper metabolisiert und schließlich wieder ausgeschieden? Welches sind die Mechanismen, die diesen Transportprozessen zu Grunde liegen?” gar nicht oder nur ungenügend.
Die Pharmakokinetik ist aber auch für die Arzneimittel-Verordnung und insbesondere für das Verständnis und die Gewichtung von Arzneimittel-Wechselwirkungen von zentraler Bedeutung. Deshalb sollte auch bei Fachleuten im Gesundheitswesen, z.B. in der Apotheke, das pharmakokinetische Basiswissen auf dem neusten Stand sein.
Das vorliegende Buch ist sowohl für alle fortgeschrittenen Studierenden der Pharmazie, Medizinalchemie, Chemie, Pharmakologie und angrenzender Disziplinen als auch für Gesundheitsfachleute wie Apotheker und Ärzte, Medizinalchemiker und Pharmakologen gedacht, die an der pharmazeutischen Wirkstoffforschung interessiert sind. Mit den Kapiteln
Der Weg des Wirkstoffs zum molekularen Target
Gastrointestinale Absorption
Prozesse an der Leber
Eliminierung an der Niere
Verteilung ins Gehirn: die Blut-Hirn-Schranke
Verteilung zur Plazenta
wird der Weg eines Wirkstoffs zu seinem Target und die Barrieren, die sich ihm dabei in den Weg stellen, begleitet. Mit zahlreichen Beispielen haben wir ver sucht, die für die pharmakokinetische Phase verantwortlichen strukturellen Eigenschaften einer Verbindung herauszuarbeiten.
Was wären Lehrbücher ohne erhellende Illustrationen und schematische Darstellungen? Bilder sind einprägsam, unterstützen den Lernprozess und machen komplexe Sachverhalte erst richtig begreifbar. Deshalb waren Bilder für dieses Buch von grosser Wichtigkeit und wurden von Alexander Vögtli nach einheitlichen didaktischen Gesichtspunkten neu erarbeitet und gestaltet. Dies setzte natürlich auch voraus, dass das Lehrbuch durchgehend in Farbe erscheinen kann.
Schliesslich haben viele Kollegen direkt und indirekt zu diesem Buch beigetragen. Speziell bedanken möchten wir uns bei Andrea Dür für ihren Beitrag zum Kapitel Verteilung ins ZNS: Blut-Hirn-Schranke und bei Matthias Wittwer für den Text zum Unterkapitel PAMPA. Ebenfalls zu Dank verpflichtet sind wir Frau Dr. Nöthe vom Verlag Wiley-VCH für die kompetente Umsetzung vom Manuskript zum Buch und die ausserordentlich gute Betreuung.
Wir hoffen, dass dieses Lehrbuch viele der eingangs gestellten Fragen beantwortet und wünschen dem Wirkstoff-interessierten Leser viel Vergnügen.
Alexander Vögtli Beat Ernst
Mai 2010 Mai 2010
Basel, Schweiz Basel, Schweiz
Beat ErnstMai 2010Basel, Schweiz
1
Einleitung
1.1 Übersicht über das Thema Pharmakokinetik
In der modernen Arzneimitteltherapie und -forschung gilt der Grundsatz, dass ein pharmazeutischer Wirkstoff an eine molekulare Zielstruktur binden muss, damit ein biologischer Effekt ausgelöst werden kann. Unter Zielstrukturen, auch Targets genannt, werden Rezeptoren, Enzyme, Ionenkanäle und Transporter zusammengefasst. Die Rezeptortheorie (Maehle et al., 2002) wurde durch Paul Ehrlich mitbegründet, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts postulierte, dass bestimmte chemische Strukturen auf der Zelle für die selektive Bindung von Substanzen verantwortlich sind und dass die „Medikamente nicht wirken, wenn sie nicht gebunden sind“ (Corpora non agunt nisi fixata, Ehrlich, 1909, S. 214):
„Beherrscht wird das ganze Gebiet von einem ganz einfachen, ich möchte sagen selbstverständlichen Grundsatz. Wenn in der Chemie das Gesetz gilt: corpora non agunt nisi liquida, so ist für die Chemotherapie maßgebend: corpora non agunt nisi fixata!“
Für Enzyme beschrieb Emil Fischer 1894 das Schlüssel-Schloss-Prinzip am Beispiel der spezifischen Bindung zwischen Enzym und Substrat (Fischer, 1894):
„Um ein Bild zu gebrauchen, will ich sagen, dass Enzym und Glucosid wie Schloss und Schlüssel zu einander passen müssen, um eine chemische Wirkung auf einander ausüben zu können.“
Eine nicht-kovalente Wechselwirkung führt zu einem Komplex zwischen Substrat und Enzym, dessen relative Bindungsstärke man als Affinität bezeichnet. Um der konformationellen Flexibilität der beiden Bindungspartner Rechnung zu tragen, wurde schließlich das Induced-Fit-Konzept („Hand-im-Handschuh-Prinzip“) geprägt (Koshland, 1958).
Ein Beispiel für ein Enzym als Zielstruktur ist die Neuraminidase des Grippevirus, welches sich in den Epithelzellen der Atemwege repliziert. Der antivirale Wirkstoff Oseltamivir (Tamiflu®), der bei der medikamentösen Therapie der Grippe verwendet wird, bindet an die virale Neuraminidase und hemmt dadurch ihre Funktion. Dies führt dazu, dass sich das Virus nach der Replikation nicht mehr von der Wirtszelle lösen und sich deshalb nicht weiter vermehren kann (Wutzler & Vogel, 2000). Die Bindung von Oseltamivir an die Neuraminidase ist in Abbildung 1.1 dargestellt.
Abb. 1.1 Damit ein pharmazeutischer Wirkstoff einen biologischen Effekt auslösen kann, muss er an ein molekulares Target binden. Die Abbildung zeigt den antiviralen Wirkstoff Oseltamivir (Tamiflu®, gelb), gebunden an das Enzym Neuraminidase N1 des Influenza-Virus A vom Subtyp H5N1. Rot eingezeichnet sind die mutmaßlichen inter molekularen Wechselwirkungen, welche der Wirkstoff mit dem Enzym eingeht. Die Bindung blockiert die Active Site des Enzyms und damit dessen Funktion und verhindert die Vermehrung des Virus (Koordinanten aus Russell et al., 2006; Bild erstellt mit PyMOL, http://pymol.sourceforge.net).
Neben der Bindungsstärke, der Affinität zum Target, ist die Selektivität ein weiterer wichtiger Aspekt. Der Wirkstoff soll nur an ein definiertes Target binden (z.B. an Proteine des Grippevirus), nicht aber an andere Rezeptoren (z.B. körpereigene Proteine). Eine unselektive, d.h. gleichzeitige Hemmung verschiedener Targets kann zu Toxizität und unerwünschten Wirkungen führen.
Eine starke und selektive Bindung eines Wirkstoffs an eine Zielstruktur ist aber nur eine Voraussetzung für einen biologischen Effekt und damit eine effektive medikamentöse Therapie. Eine weitere essentielle Bedingung ist, „dass der Wirkstoff den Wirkort überhaupt in ausreichender Konzentration erreicht“ (Clark, 1933). Oseltamivir beispielsweise wird peroral in Form von Kapseln verabreicht und muss aus dem Darm zu den Epithelzellen der Atemwege und zu den Grippeviren gelangen.
Einem Wirkstoff – oder der Gesamtheit aller Wirkstoffmoleküle aus der Arzneiform – stellen sich auf dem Weg aus dem Darm zur Zielstruktur (z.B. der Lunge) zahlreiche Barrieren in den Weg, welche den Transport behindern und die Menge des Wirkstoffs, der schließlich das Target erreicht, signifikant reduzieren können (s. Abb. 1.2, van de Waterbeemd et al., 2001). Unter Barrieren versteht man Transportbarrieren (z.B. Membranen, Efflux-Proteine), physikochemische Barrieren (z.B. Löslichkeit, pH) und biochemische Barrieren (z.B. metabolisierende Enzyme, Plasmaprotein-Bindung). Bereits der Zerfall und die Freisetzung (Liberation) des Wirkstoffs aus der Arzneiform im Darm stellen eine erste Barriere dar. Der Wirkstoff muss im Darm in Lösung gehen, damit er absorbiert werden kann. Hierbei spielen u.a. die Arzneiform (Voigt, 2000), der Inhalt des Magen- Darm-Trakts und die physikochemischen Eigenschaften des Wirkstoffs eine entscheidende Rolle (Hörter & Dressmann, 2001). Wird der Wirkstoff unvollständig aus der Arzneiform freigesetzt, kann nur ein Teil der gesamten Dosis den systemischen Kreislauf und damit die molekulare Zielstruktur erreichen. Säurelabile Wirkstoffe können zudem im sauren Milieu des Magens (pH 1 bis 2) abgebaut werden (z.B. Penicilline, Digoxin, Erythromycin, Protonenpumpen-Inhibitoren). Im Darm kann der Wirkstoff bereits bevor er das Target erreicht, biotransformiert werden und seine Aktivität verlieren (Doherty & Charman, 2002).
Abb. 1.2 Die Abbildung illustriert Beispiele von Barrieren, die sich einem Wirkstoff auf dem Weg zur molekularen Zielstruktur in den Weg stellen. Nur ein kleiner Teil der verabreichten Dosis erreicht tatsächlich das molekulare Target, welches sich hier im Gehirn befindet.
Eine wichtige Barriere ist die Transportbarriere. Wirkstoffe müssen nach der oralen Verabreichung auf dem Weg zu ihrem Target in der Regel mehrere Zellschichten überwinden. Die erste Zellschicht, auf die der oral verabreichte Wirkstoff trifft, ist das einschichtige Oberflächenepithel im Darm, das von den Darmzellen (Enterozyten) ausgebildet wird (Welsch, 2006). Der Prozess der Aufnahme des Wirkstoffs aus dem Darm in die Blutgefäße der Darmzotten wird alsintestinale Absorption bezeichnet. Die verschiedenen möglichen Transportwege an der apikalen Enterozytenmembran sind in Abbildung. 1.3 dargestellt. Wirkstoffe können zwischen den Zellen passieren (sog. parazellulärer Transport). Dieser Transportweg spielt aber eine untergeordnete Rolle und ist auf hydrophile Wirkstoffe mit einem Molekulargewicht von < 200 g/mol beschränkt (z.B. Aciclovir, Paracetamol), da die Zellen in den Zwischenräumen durch Verschlusskontakte (Tight Junctions) eine Barriere gegen den freien Stofftransport ausbilden (z.B. Schnee-berger & Lynch, 2004). Die meisten Wirkstoffe passieren die Zelle transzellulärund müssen dabei hydrophobe Zellmembranen überwinden. Hier sind verschiedene Transportmechanismen möglich. Ein lipophiler Wirkstoff kann passiv über die Membran diffundieren. Für hydrophile und geladene Wirkstoffe ist die Zellmembran – die im inneren Kern hydrophob ist – jedoch eine Transportbarriere. Die physikochemischen Eigenschaften eines Wirkstoffs determinieren deshalb sein Verhalten gegenüber der Transportbarriere.
Abb. 1.3 Die Abbildung zeigt, über welche Transportwege ein pharmazeutischer Wirkstoff die apikale Zellmembran eines Enterozyten im Darm passieren kann.
Oseltamivir beispielsweise ist nur durch einen chemischen Kunstgriff oral absorbierbar. Der Wirkstoff wird nämlich erst nach der Absorption in den Enterozyten und in der Leber durch enzymatische Hydrolyse freigesetzt (s. Abb. 1.4). Die Umwandlung erfolgt nahezu vollständig. Es handelt sich um einen sogenannten Prodrug, ein Begriff, der 1958 von Adrien Albert geprägt wurde:
„Sometimes the substance as administered, is only a ,pro-drug’ which has to be broken down to give the true drug.“ (Albert, 1958, S. 421).
Die polare und im Magen-Darm-Trakt positiv geladene Carboxylatgruppe des aktiven Wirkstoffs wurde mit Ethanol verestert, damit der Wirkstoff intestinal absorbiert wird und als Kapsel oral verabreicht werden kann (Li et al., 1998).
Der Körper ist auf effiziente Mechanismen angewiesen, die auch hydrophile und geladene Nahrungsbestandteile die Membranbarriere passieren lassen, z.B. Ionen, Nukleinsäuren, Aminosäuren, Peptide, Lipide oder Zucker. Das wird mit Transportproteinen, d.h. Transportern und Kanälen, erreicht, die den selektiven Transport bestimmter Substanzen und Substanzgruppen über Zellmembranen durch verschiedenartige Mechanismen begünstigen. Glucose beispielsweise kann aufgrund ihrer hydrophilen Hydroxylgruppen Zellmembranen nicht passiv überwinden. Der Zucker wird deshalb über die Transporter GLUT (Glucose- Transporter, z.B. an der Blut-Hirn-Schranke) und SGLT (Sodium-dependent Glucose Transporter, z.B. im Darm) über Membranen transportiert (Brown, 2000). Transportproteine können auch für den Transport von pharmazeutischen Wirkstoffen über die Membran ausgenützt werden (Amidon & Sadée, 1999).
Abb. 1.4 Aktivierung des Prodrugs Oseltamivir zum aktiven Wirkstoff Oseltamivircarboxylat.
Transporter transportieren aber auch in die Gegenrichtung (sog. Efflux). Lipophile Substanzen, die in die Membran diffundiert sind, werden so wieder aus der Membran zurück in den Darm transportiert. Der am besten charakterisierte Efflux-Transporter ist P-Glykoprotein (P-gp), ein ATP-abhängiger Transporter. Pgp wurde zunächst als Faktor bei der Entstehung der Kreuzresistenz von Tumorzellen gegenüber Zytostatika entdeckt (Gottesman, Fojo & Bates, 2002). Später wurde gezeigt, dass der Transporter auch an physiologischen Geweben, z.B. im Magen-Darm-Trakt, vorkommt (Thiebaut et al., 1987). In den 90er Jahren wurde beispielsweise mit Knockout-Mäusen gezeigt, dass P-gp die Funktion einer Transportbarriere gegenüber Xenobiotika und pharmazeutischen Wirkstoffen wahrnimmt (z.B. Zhang & Benet, 1999). Als weiterer Transportweg ist noch die Rezeptor-abhängige Endo- und Transzytose zu nennen, bei dem Vesikel, die durch einen Einstülpungsvorgang der Zellmembran entstehen, den Wirkstoff einschließen und in und über die Zelle transportieren.
Die diskutierten Transportprozesse an der Zellmembran sind jedoch nicht nur bei der Absorption im Darm relevant, sondern auch bei allen weiteren pharmakokinetischen Prozessen, welchen der Wirkstoff im Organismus ausgesetzt ist, d.h. der Biotransformation, der Verteilung und der Elimination. Bei der ersten Leberpassage (hepatischer First-Pass) strömt das venöse Blut aus dem Darm an den Leberzellen (Hepatozyten) vorbei in Richtung Herz (Welsch, 2006). Neben zahlreichen Funktionen im Stoffwechsel hat die Leber durch ihre strategische Position zwischen Darm und systemischem Kreislauf eine wichtige Entgiftungs- und Ausscheidungsfunktion. Substanzen ohne physiologische Funktionen, sogenannte Xenobiotika (z.B. Zusatzstoffe in der Nahrung, Drogen oder Agrochemikalien) können hier durch Enzyme biotransformiert und der Ausscheidung in die Galle oder der Niere zugeführt werden (Testa, 1995; 2006). So werden lipophile Wirkstoffe beispielsweise besser wasserlöslich gemacht, damit sie effizient eliminiert werden können (Beyer, 1990). Durch diese erste Leberpassage kann ein wesentlicher Anteil des Wirkstoffs inaktiviert und eliminiert werden (z.B. Thummel, Kunze & Shen, 1997).
Eine kausale Bedingung für die hepatische Biotransformation (den Metabolismus) und die hepatische Elimination ist die Aufnahme in die Leberparenchymzellen (Hepatozyten) über deren sinusoidale Zellmembran, da die metabolischen Reaktionen vorwiegend intrazellulär stattfinden. Bei dieser Aufnahme sind wiederum dieselben Transportprozesse involviert, die oben bereits diskutiert wurden. Der biotransformierte und unveränderte Wirkstoff kann wieder zurück ins Blut oder über eine weitere Membran in die Galle transportiert und der Ausscheidung zugeführt werden (Transporter an der Leber: Kullak-Ublick, Stieger & Meier, 2004).
Hat der Wirkstoff nach der ersten Leberpassage schließlich die systemische Zirkulation erreicht, muss er aus dem Blut zu seiner molekularen Zielstruktur gelangen. Wenn diese außerhalb der Blutgefäße liegt, muss er dazu in das Gewebe verteilt werden (Distribution). Je nach Zielstruktur müssen erneut zelluläre Barrieren überwunden werden, zum Beispiel die Blut-Hirn-Schranke, die vom abgedichteten Endothel der Blutgefäße im Gehirn ausgebildet wird. Die Passage aus den Blutgefäßen in das Hirngewebe wird durch diese Barriere erschwert. Wiederum entscheiden die diskutierten Transportprozesse, die Eigenschaften des Wirkstoffs und die spezifischen Eigenschaften der Barriere, ob eine Substanz diese Barriere passieren kann. Die Blut-Hirn-Schranke stellt ein großes Problem für die Entwicklung zentral wirksamer Medikamente dar, da sie generell für Wirkstoffe schlecht durchlässig ist (Pardridge, 2005).
Sobald der Wirkstoff in den Organismus aufgenommen ist, beginnt auch seine Ausscheidung (Elimination). Neben der hepatischen Elimination sind insbesondere die Nieren an der Ausscheidung der Wirkstoffe beteiligt (renale Elimination). Alternative Ausscheidungswege, zum Beispiel über die Lunge, sind möglich und für einige Xenobiotika bedeutsam (z.B. Methanol). Die renale Klärung des Blutes wird von drei Prozessen bestimmt, der Filtration, der Reabsorptionund der Sekretion.
Die Reabsorption und die Sekretion sind erneut Prozesse, bei denen der Wirkstoff eine Zellschicht und Zellmembranen passieren muss (oder parazellulär transportiert wird). Wiederum sind die diskutierten Transportprozesse beteiligt und determinieren zusammen mit den Eigenschaften des Wirkstoffs (und weiteren Faktoren, z.B. der Proteinbindung) das quantitative Ausmaß der Ausscheidung.
Oseltamivir, welches nach der Aktivierung durch Hydrolyse als Oseltamivircarboxylat vorliegt, wird vorwiegend renal ausgeschieden. Es wird sowohl filtriert als auch sekretiert. Da Oseltamivircarboxylat eine negative Ladung trägt, erfolgt die Sekretion vermutlich über Organische Anionen-Transporter (OAT). Da die Sekretion mit Probenecid inhibiert werden kann (Hill et al., 2002) wurde auch spekuliert, dass im Fall einer Grippepandemie das rare Oseltamivir mit Probenecid gestreckt werden könnte (Butler, 2005). Dies analog zu Penicillin, dessen Wirkdauer durch Probenecid signifikant verlängert werden kann (z.B. Burnell & Kirby, 1951).
Zusammenfassend sind Transportprozesse und Transportbarrieren entscheidend am Schicksal eines pharmazeutischen Wirkstoffs im Organismus beteiligt, d.h. an seiner Absorption, der Distribution, am Metabolismus und an der Elimination. Diese Prozesse, die mit der Freisetzung (Liberation) unter dem Begriff der Pharmakokinetik zusammengefasst werden (Dost, 1953; 1968), stehen wiederum in direktem Zusammenhang mit der Pharmakodynamik (d.h. den Effekten des Wirkstoffs, unerwünschten Wirkungen, Interaktionen und Kontraindikationen). Schließlich sind Transportproteine auch selbst interessante Targets für die Pharmakotherapie. So gehören etwa die Protonenpumpen-Inhibitoren (z.B. Omeprazol, Antramups®, Target: H+/K+-ATPase), die Antidepressiva (z.B. Fluoxetin, Fluctine®, Prozac®, Target: Neurotransmitter-Transporter) und die Calcium-Antagonisten (z.B. Amlodipin, Norvasc®, Target: Calciumkanäle) zu den weltweit am meisten verwendeten Medikamenten (IMS Health).
Literatur
Albert A. Chemical aspects of selective toxicity. Nature,1958,182, 421–422.
Amidon G.L. & Sadée W (Hrsg.). Membrane transporters as drug targets. New York: Kluwer Academic, 1999.
Beyer K-H. Biotransformation der Arzneimittel. Berlin, Heidelberg: Springer, 1990.
Brown G.K. Glucose transporters: structure, function and consequences of deficiency. Journal of Inherited & Metabolic Diseases,2000,23, 237–246.
Burnell J.M & Kirby W.M.M. Effectiveness of a new compound, Benemid, in elevating serum penicillin concentrations. Journal of Clinical Investigation,1951,30(7), 697–700.
Butler D. Wartime tactic doubles power of scarce bird flu-drug. Nature,2005,438(3), 6.
Clark A.J. The mode of action of drugs on cells. London: Arnold, 1933.
Doherty M.M. & Charman W.N. The mucosa of the small intestine. How clinically relevant as an organ of drug metabolism? Clinical Pharmacokinetics,2002,41(4), 235–253.
Dost F.H. Der Blutspiegel. Leipzig: Thieme, 1953.
Dost F.H. Grundlagen der Pharmakokinetik. Stuttgart: Thieme, 1968.
Ehrlich P. Chemotherapie von Infektionskrankheiten, 1909. In: Himmelwelt F. The collected papers of Paul Ehrlich. Volume III – Chemotherapy. London, Oxford, New York, Paris: Pergamon Press, 1960.
Fischer E. Einfluss der Configuration auf die Wirkung der Enzyme. Berichte der DeutschenChemischen Gesellschaft,1894,27(3), 2985–2993.
Gottesman M.M., Fojo T. & Bates S.E. Multidrug resistance in cancer: role of atp-dependent transporters. Nature Reviews Cancer,2002,2, 48–58.
Hörter D. & Dressman J.B. Influence of physicochemical properties on dissolution of drugs in the gastrointestinal tract. Advances Drug Delivery Reviews,2001,46, 75–87.
Hill G., Cihlar T., OO C., Ho E.S., Prior K., Wiltshire H., Barrett J., Liu B. & Ward P. The antiinfluenza drug oseltamivir exhibits low potential to induce pharmakokinetics drug interactions via renal secretion – correlation of in vivo and in vitro studies. Drug Metabolism and Disposition,2002,30, 13–19.
Koshland D.E. Application of a Theory of Enzyme Specificity to Protein Synthesis. Proceedings of the National Acadamy of Science,1958,44 (2), 98–104.
Kullak-Ublick G.A., Stieger B. & Meier P.J. Enterohepatic bile salt transporters in normal physiology and liver disease. Gastroenterology,2004,126, 322–342.
Li W., Escarpe P.A., Eisenberg E.J., Cundy K.C., Sweet C., Jakeman K.J., Merson J., Lew W., Williams M., Zhang L., Kim C.U., Bischofberger N., Chen M.S. & Mendel D.B. Identification of GS 4104 as an orally bioavailable prodrug of the influenza virus neuraminidase inhibitor GS 4071. Antimicrobial Agents and Chemotherapy,1998,42(3), 647–653.
Maehle A-H., Prüll C-R & Halliwell R.F. The emergence of the drug receptor theory. Nature Reviews Drug Discovery,2002,1, 637–641.
Pardridge W.M. The blood-brain barrier: bottleneck in brain drug development. NeuroRx,2005,2, 3–14.
Russell R.J., Haire L.F., Stevens D.J., Collins P.J., Lin Y.P., Blackburn G.M., Hay A.J., Gamblin S.J. & Skehel J.J. The structure of H5N1 avian influenza neuraminidase suggests new opportunities for drug design. Nature,2006,443, 45–49.
Schneeberger E.E. & Lynch R.D. The tight junction: a multifunctional complex. American Journal of Physiology - Cell Physiology,2004,286, C1213–C1228.
Testa B. Drug Metabolism. In: Wolff M.E (Hrsg.) Burger’s Medicinal chemistry and drug discovery, Volume 1: Principles and practice. New York (etc.): John Wiley & Sons, 1995.
Testa B. & Krämer S.D. The biochemistry of drug metabolism: an introduction part 1. Principles and overview. Chemistry & Biodiversity,2006,3(10), 1053–1101.
Thews G., Mutschler E. & Vaupel P. Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1991.
Thiebaut F., Tsuruo T., Hamada H., Gottesman M.M., Pastan I. & Willingham M.C. Cellular localization of the multidrug-resistance gene product P-glycoprotein in normal human tissues. Proceedings of the National Academy of Sciences,1987,84(21), 7735–7738.
Thummel E.K., Kunze K.L. & Shen D.D. Enzyme-catalyzed processes of first-pass hepatic and intestinal drug extraction. Advanced Drug Delivery Reviews,1997,27, 99–127.
van de Waterbeemd H., Smith D.A., Beaumont K. & Walker D.K. Property-based design: optimization of drug absorption and pharmacokinetics. Journal of Medicinal Chemistry,2001,44(9), 1313–1333.
Voigt R. Pharmazeutische Technologie. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 2000.
Welsch U. Sobotta – Lehrbuch Histologie. München, Jena: Urban & Fischer, 2006.
Wutzler P. & Vogel G. Neuraminidase inhibitors in the treatment of influenza A and B – overview and case reports. Infection,2000,28(5), 261–266.
Zhang Y. & Benet L.Z. The gut as a barrier to drug absorption. Clinical Pharmacokinetics,2001,40(3), 159–168.
2
Freisetzung aus der Arzneiform
2.1 Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln
Intravenöse Verabreichung
Damit oral verabreichte pharmazeutische Wirkstoffe an ihre Targets binden und im peripheren Gewebe einen Effekt auslösen können, müssen sie im Darm absorbiert werden und das Zielgewebe in ausreichender Konzentration erreichen. Ob ein Wirkstoff an seinen Rezeptoren in therapeutischer Konzentration vorhanden ist, kann beispielsweise durch Biopsien oder bildgebende Verfahren ermittelt werden (z.B. PET, siehe Valk et al., 2003). Einfacher ist jedoch die Messung von Plasmakonzentrationen im Blutkreislauf, da ein Wirkstoff im Allgemeinen über den systemischen Kreislauf in das Gewebe diffundiert oder transportiert wird. Es muss allerdings beachtet werden, dass der Nachweis des Wirkstoffs im Blut noch keine Garantie dafür ist, dass der Wirkstoff sein Target auch tatsächlich erreicht!
Bei einer intravenösen Gabe (Injektion oder Infusion) erscheint die gesamte Dosis im Blutkreislauf. Abbildung 2.1 zeigt den Konzentrationsverlauf bei verschiedenen Applikationen. Bei Kurve A wird die gesamte Dosis innerhalb kurzer Zeit injiziert. Der exponentielle Abfall der Kurve reflektiert die sofort einsetzende Elimination aus dem Plasma. Kurve B und C stellen den Plasmakonzentrationsverlauf bei Dauerinfusionen dar.
Der Pädiater Friedrich H. Dost (1910–1985), der Wortschöpfer und Mitbegründer der Pharmakokinetik (Dost, 1953; siehe auch Dost, 1968), hat gezeigt, dass die Fläche unter der Kurve des Konzentrationsverlaufs (AUC, Area Under the Curve) unabhängig von der Geschwindigkeit und vom Ort der intravenösen Injektion ist. Ein solches Experiment ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Einem 10-jährigen Kind wurde eine Dosis von 720 mg p-Aminohippursäure (PAH) in einer schnellen Injektion (Kurve A), einer Dauerinfusion von 90 Minuten (Kurve B) und einer Dauerinfusion von 180 Minuten verabreicht (Kurve C) verabreicht. Die Fläche unter der Kurve bleibt innerhalb der statistischen Grenzen immer gleich (108 cm2, 93 cm2, 92 cm2). Die Fläche AUC ist also direkt proportional zur injizierten Dosis (Dost & Gladtke, 1963; siehe auch Dost, 1968). Wird die Dosis verdoppelt, verdoppelt sich auch die AUC. Die AUC kann demnach als Maß für die injizierte Dosis betrachtet werden.
Abb. 2.1 Experiment von Dost und Gladtke (1963). Unabhängig von der Geschwindigkeit der intravenösen Gabe (Injektion oder Infusion) bleibt bei gleicher Dosis -Aminohippursäure (PAH) die Fläche unter der Kurve (AUC) identisch. Während Kurve A den Plasmakonzentrationsverlauf bei einer intravenösen Applikation darstellt, zeigen Kurve B und C denjenigen von zwei zeitlich unterschiedlichen Dauerinfusionen. Die Pfeile (→) markieren das Ende der Infusionen nach 90 bzw. 180 Minuten. Die Extinktion E (Ordinate) ist ein Maß für die Plasmakonzentration (Bild nach Dost & Gladtke, 1963).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























