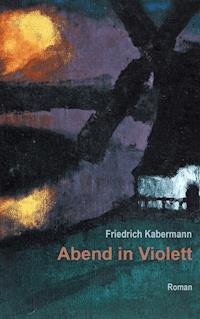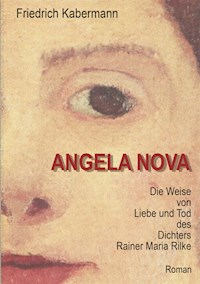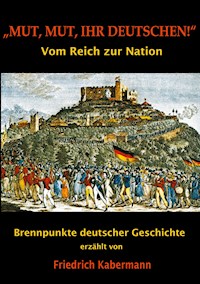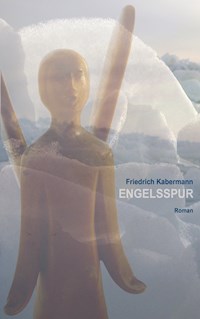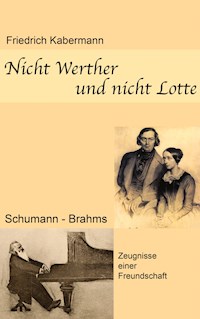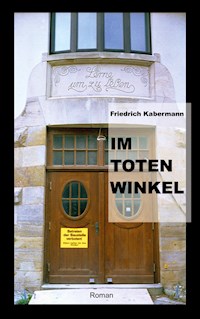Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine neue Eiszeit bedroht die Welt, die Kälte frisst sich nach innen, das Leben erstarrt. Selbst die Sonne scheint nachzulassen - Stefan Winter glaubt, schwarze Flecken zu erkennen. Steht eine Sonnenfinsternis bevor? Ihm ist unheimlich zumute, er spürt, wie auch bei den Menschen die Wärme ständig abnimmt. Überall wird mit Energie gespart, vor allem mit Lebensenergie. Wer will die Menschheit kaltstellen? An seinem zwölften Geburtstag ist Stefan wie so oft allein zuhause. Ohne dass er weiß, wie ihm geschieht, wird er entführt und nach Terrania ins Land der Drei Eisheiligen verschleppt. Er gerät mitten zwischen die Fronten eines furchtbaren Krieges, den die Terranier gegen Floranien, das Reich der tausend Blumeninseln, führen. Mit einem gewaltigen Heer Weißer Riesen und einer Armee aus Kältetechnikern versucht Dr. Z., der Hochmeister von Terrania, die Welt einzufrieren. Sogar die Zeit soll zu Eis verwandelt werden. Herrscht erst die Eiszeit überall, hat Dr. Z. sein Ziel erreicht: die absolute Macht - er will sein wie Gott. Stefan ist geblendet von der terranischen Macht, immer schon wollte er ein Held, ein Kriegsheld sein. So schließt er mit Dr. Z. einen Teufelspakt: Als General Winter tritt er in seine Dienste - der Blumenkrieg weitet sich aus zum Sternenkrieg. Da greift Moira ein und gibt der Geschichte eine Wende. Stefan muss sich entscheiden, denn Liebe und Macht sind unvereinbar. Nur wer über seinen Schatten zu springen vermag, kann Floranien vor dem Untergang retten. Das ist der springende Punkt der Geschichte - der Kältetod der Menschheit geht jeden an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch
An seinem zwölften Geburtstag ist Stefan Winter wie so oft allein zuhause. Ohne dass er weiß, wie ihm geschieht, wird er entführt und nach Terrania, ins Land der Drei Eisheiligen, verschleppt. Er gerät mitten zwischen die Fronten eines furchtbaren Krieges, den die Terranier gegen Floranien, das Reich der Tausend Blumeninseln, führen.
Mit einem gewaltigen Heer Weißer Riesen und einer Armee aus Kältetechnikern versucht Dr. Z, der Hochmeister von Terrania, die Welt einzufrieren. Sogar die Zeit soll zu Eis verwandelt werden. Herrscht erst die Eiszeit überall, hat Dr. Z sein Ziel erreicht: Die absolute Macht – er will sein wie Gott.
Stefan ist geblendet von der terranischen Macht, immer schon wollte er ein Held, ein Kriegsheld sein. So schließt er mit Dr. Z einen Teufelspakt: Als General Winter tritt er in seine Dienste – der Blumenkrieg weitet sich aus zum Sternenkrieg. Da greift Moira ein und gibt der Geschichte eine Wende. Stefan muss sich entscheiden, denn Liebe und Macht sind unvereinbar.
Nur wer über seinen Schatten zu springen vermag, kann Floranien vor dem Untergang retten. Das ist der springende Punkt der Geschichte – der Kältetod der Menschheit geht jeden an.
Ist „Moira“ eine Science Fiction-Story oder eine Traumerzählung, ein Agententhriller oder ein Fantasy-Roman? Vielleicht alles dies zusammen – jedenfalls ein Schlüsselroman, der uns die Welt von heute in ihrer ganzen Hintergründigkeit erschließt.
Friedrich Kabermanngeboren 1940, arbeitete im Medienbereich und publizierte wissenschaftliche und belletristische Bücher.
Über das Buch
„Ein geistig-poetisches Abenteuer...
Ich habe selten ein so universales Buch gelesen... Ein Entwicklungsroman besonderer Art, der an Lao-tse und den ‚Parzival‘ denken lässt... Stefan Winter erlebt und erleidet exemplarisch die Konflikte des Menschen, entsprechend den aktuellen Problemen unserer Welt... Wer sich MOIRA ausliefert, dem könnte etwas Verschüttetes wieder aufgedeckt und etwas Vereistes aufgeschmolzen werden...“
Erika Ruckdäschel, „Nürnberger Nachrichten“
„Ein Welt-Mythos...
Noch niemand hat das Bild (der Eiszeit) so gründlich bearbeitet wie Friedrich Kabermann und der Zeichner Dieter Zirkel... Man muß das schon selber lesen, um zu sehen, was der Autor alles an Philosophie aus Ost und West, aus Nord und Süd sowie an Märchenmotiven in seinen Mythos geflochten hat. Mein Buch ist voll von Randbemerkungen, weil jeder Satz, fast jedes Wort einen doppelten Boden haben...“
Rudolf Herfurtner, „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt“
„Wie auf Marmorklippen...
Erzählt wird von einer abenteuerlichen, gefährlichen, für die ganze Welt wichtigen Reise, von Bedrohung und wundersamer Rettung, von fürchterlichen Mächten und wunderbarer, rettender Stärke, von Feinden und Freunden, von ‚Freund und Feind‘... Wie düster das Geschick auch dräut – etwas Unbesiegbares umschwebt den Jungen von Anfang an... Ein Roman, der seine Leser unmerklich in seinen Bann zieht...“
Jürgen Busche, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“
„Spannend bis zur letzten Seite...
Ist dieser phantastische Roman. Trotz aller Spannung aber auch sehr tiefgründig... Wer phantastische Literatur liebt, die auch eine Aussage macht, wird an diesem Buch seine helle Freude haben...“
Michael Sick, „Saarländische Schulzeitung“
Für Bimal
Inhalt
EISZEIT
Die Diamantene Stunde
Invasion der Weißen Riesen
Der Große Blumenkrieg
Wintersonnenwende
AM KÄLTEPOL
Die Eisheiligen
Der Rote Springer
Operation Schattenriss
General Winter
LICHTJAHRE
Am Nullmeridian
Áksala in Sicht
Unter dem Polarstern
Mitternachtssonne
DIE FEUERTAUFE
Im Blütenrausch
Schattenspiele
Aktion Morgenstern
Das Silberne Echolot
Was sind Talismane, Amulette?
Hoffe nicht, dass dich ein Fremdes rette.
Was an dir ist von den Salamandern,
Wird die Flamme unverletzt durchwandern.
Feuer hebt dich, und du wirst nicht bangen,
Nicht vor Skorpionen, nicht vor Schlangen.
Heil wie du auf diese Welt gekommen,
Unzerstörbar wirst du fortgenommen.
Friedrich Georg Jünger
Eiszeit
Die Diamantene Stunde
Ihr alle kennt die Blaue Stunde, die in der Dämmerung beginnt, wenn Licht und Schatten sich umarmen, bis sie die Nacht dann wieder trennt. Das ist die Stunde der Geschichten, wenn draußen tiefer Winter herrscht – der Abend zieht durchs weite Land, schon tauschen Tag und Nacht sich aus: Die Welt wird durchsichtig bis auf den Grund.
In einer dieser Blauen Stunden kam Moira einst zu mir, um nach Prinz Tutilo zu fragen; und damit fängt die Geschichte an, die ich erzählen möchte. Vielleicht hört so meine Geschichte auch auf – vielleicht mit der Frage: Wo ist Moira?
Der Tag liegt Wochen zurück, doch erinnere ich mich genau, weil es kurz vor Stefans Geburtstag am 12. Dezember war. An diesem Tag fiel auch der Winter ein, der Umsturz kam über Nacht. Es hatte lange zuvor geregnet, wie so oft um den Ersten Advent. Der stürmische Westwind war mild wie im März, wenn die Erde durch die Schneedecke bricht.
Doch dann, eines Morgens, wachte ich auf, und alles war totenstill. Reif lag auf den Wiesen und Feldern, die Pfützen im Garten waren vereist. Sie glänzten in der Sonne wie Silbertaler, die der Frost verloren hatte, als er ins Land eingedrungen war.
Es war windstill ringsum, nichts rührte sich, kein Laut war zu hören, die Vögel blieben stumm. Ich ging in den Garten und legte Zweige auf die Beete, zum Schutz vor noch strengerem Frost. Die Blätter waren hart gefroren, sie trugen einen weißen Pelz und konnten zerbrechen wie Glas, wenn man nicht zart mit ihnen umging.
Es war unheimlich draußen, ich war ganz allein. Die Sonne stand tief am verhangenen Horizont, ihr blasses Licht warf keinen Schatten. Zähe Nebel hingen über der Stadt, nirgendwo waren Menschen zu sehen, die Gärten und Straßen lagen leer, ausgestorben im milchigen Dunst.
Als ich zum Schuppen ging, um Holz für den Kamin zu holen, sah ich Nachbar Bölle auf dem Balkon. Er war im Morgenmantel und trug einen Schal um den Hals, die Pelzmütze auf dem Kopf reichte weit über Ohren und Stirn. Geistesabwesend starrte er in die Ferne, als sähe er ein schreckliches Bild. Dann rieb er sich vergnügt die Hände und lachte lautlos in sich hinein.
„Glauben Sie, dass es ernst wird?“ rief ich zu ihm hinauf. Doch er antwortete nicht, sondern wies mit der Hand zum Himmel und schüttelte drohend die Faust.
„Hat keinen Sinn, Olaf Söderboom!“ schrie er, als er sah, wie ich die Blumenrabatten abdeckte und die Geranienkübel zum Keller trug. „Mit den Blumen ist’s aus, nichts zu machen…, alles nur Eisblumen noch…!“
Er lachte schrill auf, als wäre er nicht richtig im Kopf, schüttelte wieder die Faust und wandte sich langsam ab. Ich kannte ihn schon seit Jahren, doch verstand ich nicht, was er meinte und arbeitete weiter am Haus; die Fensterläden mussten noch gesichert werden. Bevor aber Bölle ins Zimmer zurückging, fiel mir sein Gesicht auf: Es war merkwürdig weiß, wie mit Rauhreif bedeckt; als hätte Bölle die Nacht im Eisschrank verbracht.
Wahrscheinlich ist er krank und hat eine Kopfgrippe bekommen, dachte ich, denn in der Morgenzeitung war zu lesen gewesen, dass eine Welle von Erkältungen das Land überrollte, und den Apothekern schon die Medikamente ausgingen. Viele Fabriken und Büros hatten geschlossen, weil man Ansteckungsgefahr fürchtete. Selbst in den Schulen wurde überlegt, ob die Kinder nicht nach Hause geschickt werden sollten. Da hatte es wohl auch Bölle erwischt. Während ich ihm nachsah, fuhr ein scharfer Windstoß durch den Garten. Die großen Fichten am Zaun bogen sich, die Kellertür fiel krachend ins Schloss. Ich packte die Holzscheite in den Korb und wollte gerade den Schuppen abschließen, als mir auffiel, dass die Fenster vom Nachbarhaus über und über mit Eisblumen bedeckt waren – als ob Bölle weiße Gardinen vorgezogen hätte. Die Scheiben der anderen Häuser waren eisfrei, und auch bei mir zeigten die Fenster nur blankes Glas.
Merkwürdig, dachte ich, und setzte den Holzkorb ab, als wenn es bei ihm besonders kalt wäre. Aber dann ging ich ins Haus, schüttete Kohlen in den Kachelofen und machte mir keine Gedanken mehr über Bölle.
Eben hatte ich mich an den Tisch gesetzt, um einige Briefe zu schreiben, als mich ein dumpfes Grollen aus meinen Gedanken riss. Blitze zuckten am Himmel, Donner rollte über das Haus, es krachte, als ob Eisberge zusammenstießen; Regen und Sturm brachen los. Ein Gewitter um diese Jahreszeit hatte ich noch nie erlebt; das Thermometer stand auf Null. Dichte Eisschauer gingen nieder, Salven von Hagelkörnern fegten heran, Breitseiten großen Kalibers wurden auf das Haus abgefeuert. Der Winter schoss aus allen Rohren.
Es war zehn Uhr morgens, als das Kältegewitter begann, und es hielt noch am Abend an. Schon seit Mittag war der Himmel blauschwarz, es wurde früher dunkel als sonst. Der eisige Nordwind trieb die Flocken in dichten Staffeln heran, deckte Rasen und Beete zu und häufte im Garten Verwehungen auf. Ich stand am Fenster und blickte ins tosende Grau. Wo am Morgen noch Büsche und Beete gewesen waren, konnte man nur noch Hügel erkennen, die kahlen Gräbern glichen. Der Garten war zu einem Friedhof geworden, die Schneelast erstickte alles Leben. Die Tannen am Zaun hatten sich in weiße Gestalten verwandelt und sahen wie Riesen in Tarnanzügen aus, die lauernd auf Wache standen. Fuhr der Wind hindurch, bewegten sie die schweren Glieder, als rückten sie unmerklich auf das Haus zu. Im Dunkel schlossen sich die Reihen, die Mauer wurde undurchdringlich und hoch. Das Haus glich einer Festung – eine lange Belagerung stand bevor.
Mir war kalt, ich ließ die Briefe liegen und setzte mich an den Kamin. Lange starrte ich in die Flammen und musste an Stefan denken. Wie es wohl jetzt bei ihm zu Hause aussah? Im Radio hatte ich gehört, dass das ganze Land im Schneesturm versunken war. Vielleicht fürchtete er sich und war allein? Wie oft ließen ihn die Eltern zu Hause zurück, wenn es die Geschäfte verlangten, manchmal sogar tagelang. Nicht für jeden ist die Blaue Stunde eine angenehme Zeit; für einen zwölfjährigen Jungen kann sie zur Hölle werden. Auch Erwachsene geraten dann leicht ins Grübeln und empfinden die Einsamkeit besonders stark. Manchen wird unheimlich, andere bekommen Angst und schließen sich sogar ein.
Besonders schlimm war es bei solchem Wetter, das einer weißen Invasion glich. General Winter setzte zum Sturm an, und niemand konnte vorhersagen, wann dieser Angriff enden und ob man ihn überstehen würde. Leitungen waren bereits zerstört, Straßen verweht, Dörfer und Städte von der Außenwelt abgeschnitten. In manchen Orten wurde die Energie schon knapp – das Radio brachte ständig neue Katastrophenmeldungen. Im Fernsehen wurde von einem Kamerateam berichtet, das spurlos im Schnee verschollen war.
Auch meine Stimmung war nicht die beste – ich hatte Stefan zum Geburtstag besuchen wollen, aber daran war nicht mehr zu denken.
Ich stand auf, legte Holz nach und rückte die Teekanne ans Feuer. Dann zündete ich mir eine Pfeife an und blickte den Rauchschwaden nach, die wie Nebelbänke im Raum lagerten. Als ich ein großes Stück weißen Kandis in die Tasse tun wollte, spürte ich, wie sich im Zimmer eine Veränderung vollzog, ohne dass ich hätte sagen können, was eigentlich vorging. Der Sturm setzte mit einem Schlage aus, als hielte er den Atem an. Schwere, nasse Flocken fielen senkrecht vom Himmel und glitten wie Kristalle am Fenster vorüber.
Ich hielt den Kandis gegen das Feuer, er leuchtete wie ein Diamant. Es war, als würde er immer größer, als sprühte er Funken in meiner Hand: Jeden Augenblick musste er zerspringen, in einer gewaltigen Explosion … Da erkannte ich auf einmal Moira – es war der schönste Augenblick in meinem Leben.
Ich habe diese Stunde die Diamantene Stunde genannt, weil sie jedem nur einmal im Leben schlägt und daher kostbar ist wie ein Edelstein, wie ein seltener Diamant. Genau so verhält es sich mit der Geschichte, die mit Moira in dieser Stunde begann. Nicht ich, sondern Stefan hat sie erlebt und mir später genau berichtet. Ich schrieb sie nur auf, weil ich glaube, dass sie weitererzählt werden muss.
Die Windstille währte nur kurz, das Sturmloch war rasch vorüber, neue Böen rasten heran. Sie schienen drüben vom Wald zu kommen, mit unverminderter Wucht, als habe der Sturm neue Kräfte gesammelt. Er heulte im Kamin, das Haus ächzte, wenn sich der Wind zwischen Giebeln und Erkern fing und unter das überhängende Dach fuhr.
Ich aber hörte das alles aus weiter Ferne, denn Moira war zu mir gekommen. Nur den Stundenschlag der schwarzen Standuhr nahm ich wie im Traume wahr, viermal klang es durch den dämmrigen Raum – hell und rein wie von silbernen Glocken.
Invasion der Weißen Riesen
Auch Stefan hörte es vier Uhr schlagen. Dumpf klang es von der Michaeliskirche herüber; der Schnee dämpfte die Geräusche, als läge die Stadt unter einer wattierten Decke.
Er stand auf dem Marktplatz gegenüber von Bäcker Freeses Konditorei und fror. Drüben im Café traf er sich oft mit den Freunden, wenn sie nicht in Ziffernellis Eisdiele gingen. Doch heute hatte er sich mit Christoph am Benediktbrunnen verabredet. Der Marktplatz und die Straßen waren menschenleer. Hier und da gingen in den Geschäften die Lichter an. Es schneite schon seit dem Morgen, der Wind hatte die Hauseingänge verweht. Schimpfend stapfte ein dicker Mann, der sich mit beiden Händen den Hut festhielt, die Treppen empor. Auch Stefan schimpfte und zog sich verdrossen seine Kapuze über den Kopf. Nie konnte Christoph pünktlich sein.
Drüben in der Konditorei flammte ebenfalls Licht auf, Bäcker Freese kam mit einem Besen heraus und begann, den Schnee fortzuräumen. Stefan glaubte, ihn fluchen zu hören – da stand wie aus dem Boden gewachsen eine große Gestalt in langem weißen Kapuzenmantel neben ihm, legte die Hand auf seine Schulter und sprach ein paar Worte mit ihm, die Stefan aber nicht verstand. Bäcker Freese duckte sich, stellte den Besen fort, nickte einige Male erschrocken und verschwand wieder in seinem Laden. Der Weiße Riese schlenderte weiter, wie einer, der Zeit hat und sich im Schneesturm erst richtig wohlfühlt. Langsam bog er in die Rosengasse ein.
Stefan hatte das Gesicht nicht sehen können, doch der Kapuzenmann musste ein Polizist sein. Verrückt, heute Schnee zu fegen, dachte er und gab dem weißen Polizisten recht.
Genauso verrückt war es, bei diesem Wetter auf dem Feldkamp eine Demonstration zu veranstalten. Aber wer hatte den Wintereinbruch voraussehen können? Der Protestmarsch war schon seit Wochen geplant, Stefan hatte noch nie bei einer solchen Aktion mitgemacht. Er war bisher nicht einmal auf dem Campus gewesen, auf dem die neue Universität gebaut wurde. Aber Chris und Alexander hatten vorgeschlagen, an der Aktion teilzunehmen. Dem konnte er sich nicht entziehen, auch wenn er Angst hatte und lieber zu Hause in „Kampf um Rom“ weitergelesen hätte.
Er trabte um den Benediktbrunnen, der in der Mitte des Marktplatzes stand, und schlug die Arme um die Brust. Seit Mittag war das Thermometer um 6 Grad gesunken, nun stand es auf minus 5 Grad. Er blickte zum Heiligen Benedikt empor, der, in der Mitte des Brunnens auf einen Stab gestützt, zum Rathaus hinüberstarrte. An Nase, Haaren und Kinn hatten sich Eiszapfen gebildet, an der Windseite war die Kutte bis in die letzten Falten voller Schnee. Von hier sah er aus wie der weiße Kapuzenmann, der mit Bäcker Freese gesprochen hatte.
Auch im Rathaus gingen die Lichter an, erst im Treppenhaus, dann im Sitzungssaal, schließlich herrschte im ganzen Gebäude Festbeleuchtung. Da bog Chris aus der Rosengasse auf den Marktplatz ein und winkte schon von weitem wild mit den Armen.
„Katastrophensitzung!“ keuchte er und zeigte auf das Rathaus. „Los, komm! Auf dem Feldkamp ist der Teufel los!“
Er wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. „Ich hab es von Alex, der die anderen holen will. Heinrich und Till sind schon da …Tausend Polizisten, und dann noch die Kapuzenmänner. Los, mach schon!“
Sie rannten an Bäcker Freeses Laden vorbei zur Haltestelle und erreichten noch eben die Straßenbahn, die in den Wiesendamm eingebogen war. Die Wagen waren fast leer.
„Die ganze Stadt scheint leer zu sein,“ keuchte Stefan. „Sind die denn alle auf dem Campus?“
Christoph nickte. „Vor allem da, wo das Institut für Energieplanung gebaut werden soll. Dort ist die Hölle los! Die meisten sind Studenten, aber auch Erwachsene von der Bürgerpartei und die halbe Schule sind da. Sogar der Ravenswald soll für das Kernforschungszentrum abgeholzt werden!“
„Endstation!“ rief der Fahrer, „weiter geht es heute nicht. Vereiste Weichen, viel zu gefährlich!“ Er hob bedauernd die Schultern und öffnete die Drucktüren. Eine Wolke von feinen Eiskörnern schlug herein.
„Wenn das so weitergeht, fahren sie morgen überhaupt nicht mehr,“ schimpfte eine Frau und schlug ihren Mantelkragen hoch. Alle stiegen aus. Draußen pfiff der Wind über den Platz, die Fahrbahn war spiegelglatt.
Chris rannte, ohne sich umzudrehen, die Kaiserallee bis zur Kreuzung „Neue Post“ hinunter; Stefan trottete missmutig hinterher. Wieder dachte er an sein Zimmer, an die Bücher und die Schallplatten. „Kennst du ‚Kampf um Rom‘?“ rief er Chris zu, der tief gebückt gegen den Sturm ankämpfte, ihn aber nicht richtig verstanden hatte.
„Rom?“ schrie er zurück und schlug sich mit der Hand an die Stirn. „Bist du verrückt? Da…!“ er zeigte mit dem Fausthandschuh auf die Kreuzung, wo die Kaiserallee in die Lange Elle mündete und das neue Universitätsviertel begann.
Auf der Kreuzung hielt ein Feuerwehrwagen, auf dessen Dach ein Mann in weißer Montur kniete und sich an den Ampeln zu schaffen machte. Unten standen zwei Kapuzenmänner in langen weißen Mänteln und fingen die wenigen Autos ab, die über die Kreuzung wechseln wollten; Blaulicht huschte über den Schnee. Der Monteur auf dem Wagen gestikulierte mit den Armen und schrie etwas hinunter. Dann holte er aus seinem Overall weiße Säcke hervor, stülpte sie über die Ampeln und zog sie unten fest zu.
„Komm,“ stieß Christoph hervor, „die Schneemänner dürfen uns nicht erwischen!“
Sie drückten sich in den Häuserschatten und rannten dann um die Ecke. Die Kapuzenmänner hatten gerade einen Lieferwagen gestoppt, sich vom Fahrer die Papiere zeigen lassen und waren ganz mit der Kontrolle beschäftigt, so dass die beiden unbemerkt in den Feldkamp einbiegen konnten. Als Stefan sich noch einmal umdrehte, sah er, wie der Monteur auf dem Auto mit der Faust hinter ihnen herdrohte. Die Polizisten hatten den Lieferwagen an den Straßenrand gewinkt und schienen ihn von innen und außen zu untersuchen. Der Fahrer stand frierend im Schneetreiben und hielt die Hände über den Kopf. Sein blauer Kittel flatterte am Körper wie eine Fahne bei Sturm. Der Mann war lang und dünn, Stefan glaubte zu hören, wie er um Hilfe schrie. Aber das bildete er sich vielleicht nur ein.
Endlich hatten sie den Campus erreicht, das Gelände mit den Neubauten lag vor ihnen. Die Hochhäuser hoben sich wie Scherenschnitte scharf vor dem verschneiten Ravenswald ab. Die meisten Gebäude standen im Rohbau da, Bagger und Betonmaschinen waren halb verweht, Kräne streckten die Hälse wie Riesengiraffen in den schwarzen Himmel; schwer pendelten die Haken am Seil.
Hinten am Waldrand, wo das neue Kernforschungszentrum gebaut werden sollte, sah man blaue Lichter rotieren, eine schwarze Menschenmenge wogte hin und her. Stefan hörte auch Polizeisirenen, neue Mannschaftswagen rückten an. Jetzt waren sie so nahe, dass er die Polizisten in ihren Kampfanzügen erkennen konnte. Sie hatten Plastikhelme auf, mit heruntergeklapptem Visier und durchsichtige Schilde am Arm, in der Rechten schwangen sie Gummiknüppel; wie Prätorianergarden rückten sie vor. Stefan musste an die römischen Legionäre denken, die in „Kampf um Rom“ die Goten vernichten wollten.
Aber da war König Totila, der nur zehn Jahre älter war als er und alle Niederlagen in Siege verwandelte. Das war ein Held! Stefan stellte sich Totila mit langen blonden Locken vor, mit blitzenden, blauen Augen, in einer Rüstung aus purem Gold. Bestimmt war er einen Kopf größer als die Römer und nahm es gleich mit mehreren von ihnen auch ohne Waffen auf.
„Los, hierher!“ hörte er Christoph rufen, fühlte sich am Ärmel gepackt und fortgerissen. Zwei Polizisten hatten sie erblickt und stampften wie Roboter auf sie zu. Die beiden stolperten über einen Bauplatz, auf dem leere Tonnen und Eisenträger für die Betondecken lagen, und gerieten mitten in eine Gruppe von Demonstranten, die Steine nach den Polizisten warfen. Andere suchten sich Bretter und Stangen, als sie sahen, wie eine Kette von Beamten im Laufschritt auf sie zukam.
„Macht, dass ihr fortkommt!“ schrie ein bärtiger Mann, „das ist nichts für Kinder! Los, haut ab, sonst mach ich euch Beine!“
Ein Scheinwerfer leuchtete auf und schwenkte über die Köpfe hinweg. Da erkannte Stefan im Gewühl Heinrich Wenger, der meistens Henry genannt wurde, sowie Till und Alexander und die anderen aus der Klasse, die Chris umringt hatten und ihm zuwinkten.
„Nichts wie weg hier,“ keuchte Heinrich, als Stefan heran war, „das wird eine Schlacht!“
„Erst war es ganz friedlich,“ berichtete Alex, als sie sich einige Häuserblocks weiter in einen Eingang gedrückt hatten: „Langsamer Marsch, Transparente und Sprechchöre. Auch die Polizisten blieben ruhig, nur kleines Geplänkel, wie bei einer Schneeballschlacht. Aber dann kamen die Typen vom Sicherheitsdienst und fuhren gleich Wasserwerfer auf. Da…,“ er zeigte auf ein weißes Kettenfahrzeug, das eine Mischung aus Panzer und Lastwagen war und eben um einen Häuserblock bog. Drohend rollte es auf sie zu. Oben auf dem Dach kreisten zwei Scheinwerfer, die das Gelände nach Demonstranten absuchten und alles, was sie erfassten, mit kalkweißem Licht überzogen. Hinter ihm tauchte ein zweiter Panzerwagen auf, der große Lautsprecher an den Seiten und oben zwei Wasserwerfer montiert hatte. Eine metallene Stimme wiederholte in monotonem Rhythmus: „Sofort das Gelände räumen! Sofort das Gelände räumen!“ Scharfe Wasserstrahlen schossen in die Menge und wirkten dort, wo sie trafen, wie eine Ladung Eis.
Langsam zogen sich die Demonstranten zurück und zerstreuten sich zwischen den Baubuden, den Stahlgerüsten und Lagerhallen, die sich bis hin zum Waldrand zogen. Jetzt tauchten auch einige der weißen Gestalten auf, die Stefan schon bei Bäcker Freese und dann auf der Kreuzung „Neue Post“ gesehen hatte.
„Verdammt, wo kommen die Schneemänner her?“ rief Alexander. „Hauen wir ab, bevor es zu spät ist!“
Sie drängten sich durch die Tür eines Neubaus, stolperten den langen Flur hinunter und sprangen an der Rückseite aus dem Fenster. Hier warteten sie einen Augenblick, Chris spähte vorsichtig um die Ecke.
„Das sind die Typen von der IPERA,“ japste Henry außer Atem. „Die sollen jetzt überall ihre Finger drin haben.“
„Und wer ist das?“ fragte Stefan.
„Mensch, liest du keine Zeitung?“ Henry fasste sich an den Kopf und schaute zu Chris hinüber, der ihnen ein Zeichen gab. Sie blieben stehen und warteten. „‚Internationale Planungsbehörde für Energie- und Rohstoff-Angelegenheiten‘,“ hustete er. „Das sind doch die Ober-Multis: Ob du Licht machst, Auto fährst, die Wohnung heizt oder Batterien für den Recorder kaufst – überall stecken die dahinter. Außerdem hängen sie mit den Computerleuten zusammen: Die einen steuern die Energie, die anderen das Wissen. Wenn die sich zusammentun, können sie alles machen!“ Er blies sich in die Hände, denn er hatte keine Handschuhe an.
In diesem Augenblick winkte Chris heftig und startete quer über das offene Gelände; Alexander, Tilmann und Henry hinter ihm her. Als Stefan ebenfalls um die Ecke bog, prallte er mit einem Polizisten zusammen, wurde zur Seite geschleudert und landete benommen in einem Graben.
„Verschwinde!“ brüllte der bullige Typ und kam mit erhobenem Gummiknüppel auf ihn zu. „Wie heißt du?“
Doch ehe er bei ihm angelangt war, hatte sich Stefan aufgerafft und war über verschneite Bretter und Drahtmatten auf den nächsten Häuserblock zugerannt. Mehrmals wurde er von entgegenkommenden Demonstranten angerempelt, die entsetzt: „Die Wasserwerfer!“ schrieen.
Da Stefan nicht wusste, wohin die Freunde geflohen waren, hielt er beim Neubau inne, der wie ein Turm in die Nacht ragte. Keuchend sah er sich um; kein Polizist war mehr hinter ihm her. Dafür aber hörte er Motorengeräusche, und um die Ecke der vor ihm liegenden Baracke bog ein Kettenpanzer, der Scheinwerfer und Wasserkanonen zugleich kreisen ließ. Er trieb eine dunkle Menschentraube vor sich her, die sich schreiend und fluchend den Campus hinunterwälzte. Als Stefan sich umdrehte, sah er entsetzt, dass von der anderen Seite eine Polizistenkette näher kam, die sich über die gesamte Breite der Straße spannte – sie waren eingekreist. Schritt für Schritt rückten die Beamten vor; der Schlagstock pendelte am Handgelenk.
Ausgepumpt und mit schmerzendem Knie presste sich Stefan an die Hauswand, die nach feuchtem Mörtel roch. Unaufhaltsam kam der Panzerwagen näher. Wieder und wieder trafen Salven harter Wasserstrahlen die Demonstranten, in den nassen Sachen mussten sie sich den Tod holen. Da fühlte sich Stefan am Ärmel gepackt und ins Dunkel des Hauses gezogen.
„Psst,“ flüsterte eine Stimme. Als sich seine Augen an die Finsternis gewöhnt hatten, erkannte er die hellen Umrisse eines Mädchengesichts.
„In den Keller,“ sagte die Stimme, „die kommen bestimmt hier herein.“ Damit zog ihn das Mädchen vorsichtig die Treppe hinunter, die an den Seiten mit Brettern verschalt war.
Kaum waren sie unten und hatten sich auf einen der Zementsäcke in der Ecke gesetzt, als sie über sich schwere Stiefel durch die Räume stampfen hörten und eine Stimme: „Alles klar!“ rief. Kurz darauf zuckte der Schein einer Taschenlampe an der Treppenwand entlang, verschwand aber rasch wieder, ohne dass ein Polizist hinuntergestiegen wäre. Auch der Panzerwagen musste vorüber sein, denn draußen war es still geworden, nur aus der Ferne klangen noch Lautsprecher, Geschrei und Motoren herüber. Stefans Atem ging stoßweise, er rührte sich nicht. Auch das Mädchen lauschte gespannt in die Nacht.
„Sie sind weg,“ stieß sie hervor. „Wie spät ist es?“
Stefan versuchte, das Leuchtzifferblatt seiner Uhr zu erkennen. „Zehn nach sechs, glaube ich.“
„Dann muss ich nach Hause,“ sagte sie unruhig. „Bei uns sind heute alle Blumen erfroren; die Heizung im Gewächshaus ging kaputt. Und das bei der Kälte!“ Stefan hörte kaum zu, sondern stieg vorsichtig die Treppe nach oben und blickte ins Freie hinaus. Das Mädchen folgte ihm, ein Brett löste sich unter ihrem Fuß und polterte in die Tiefe.
„Ist was passiert?“
Sie schüttelte den Kopf. Beide standen auf dem Vorplatz, der verlassen in der Dunkelheit lag.
„Monika,“ sagte sie, „ich heiße Monika Florens. Aber die meisten nennen mich Moni.“
Florens? dachte Stefan, komischer Name.
„Und du?“ Moni lachte ihn an, ihre Augen blitzten, schief hing die Pudelmütze in die Stirn.
„Winter, Stefan Winter. Ich bin in der Siebten. Mathematik ist am schlimmsten, Dr. Zebura…“
„Ich weiß,“ fiel Moni ein, lief in den Flur zurück, nahm Anlauf und sprang mit einem Satz über den Graben vor der Tür. Das Brett, das zuvor da gelegen hatte, war in der Zwischenzeit verschwunden. Stefan sprang hinterher.
Es hatte aufgehört zu schneien, auch der Nordwind blies nicht mehr so scharf. Aber es war noch kälter geworden. Es tat weh, wenn man die Luft einatmete, als stächen Nadeln in die Brust.
„Ich bin in der Fünften,“ rief Moni und zog Mütze und Schal zurecht. „Bei Zebura haben wir Biologie. Man kriegt eine Gänsehaut, wenn er über Blumen spricht. Bestimmt sind sie bei ihm zu Hause aus Plastik, und er wischt Staub von Blättern und Blüten.“ Sie zeigte nach der rechten Seite des Waldrands, wo einzelne Lichter in der Nacht funkelten: „Fliederweg, da ist unsere Gärtnerei. Der Blumenladen in der Rosengasse gehört uns.“
Stolz schwang in ihrer Stimme, doch Stefan bemerkte es nicht.
„Verdammt!“ keuchte er und fasste sich an den linken Knöchel. „Ich glaube, ich habe mir das Gelenk verstaucht.“ Er bückte sich und betastete seinen Fuß, aber im Dunkeln konnte man nichts erkennen.
„Am besten, wir sehen zu Hause nach, das sind nur zehn Minuten. Meine Mutter hat essigsaure Tonerde, und die…“
„Essigsauer … was?“ fragte Stefan verdutzt und lief hinkend hinter Moni her, die schon einige Schritte voraus war.
„Damit macht man Umschläge, wenn etwas weh tut,“ rief sie. „Das ist viel besser als Schmerztabletten.“
Vorsichtig gingen sie weiter und schauten um jeden Häuserblock, aber niemand verfolgte sie; Lichter und Lärm waren weit hinter ihnen zurückgeblieben. Die Neubauten mit ihren Stahlgerüsten, den Kränen und Aufzügen schimmerten matt im Streulicht; wie Totengerippe sahen sie aus. Durch die Skelette schien ein blasser Mond. Die Wolkendecke war aufgerissen, einzelne Sterne leuchteten wie Diamanten auf nachtschwarzem Samt. Die Milchstraße zog sich als Silberstreifen über den Himmel – weit spannte sich der Bogen, von Horizont zu Horizont.
„Tausend mal tausend mal tausend Sonnen,“ flüsterte Moni und blickte nach oben. „Jedenfalls eine Zahl mit unendlich vielen Nullen.“ Ihr Atem glich einer Wolke, die über ihr in der klaren Luft stand. Wie eine Lokomotive unter Dampf, dachte Stefan, doch da schüttelte Moni sich und zog die Schultern hoch.
„Kalt!“ Sie musste niesen und blieb stehen. „Glaubst du, dass auf den Sternen auch Leben ist?“ Laut putzte sie sich die Nase.
„Planeten,“ verbesserte Stefan. „Auf den Sternen ist es so heiß wie auf der Sonne. Da kann nichts leben. Aber die meisten Sterne haben Planeten, und da ist es etwas anderes.“
Moni ließ sich jedoch von ihren Gedanken nicht abbringen. „Als mein Vater noch lebte, sagte er oft: ‚Wenn wir tot sind, werden wir alles wissen. Deshalb müssten wir uns darauf freuen…‘ Aber ich weiß nicht…“ Sie hustete. „Ich glaube, ich habe nasse Füße.“
Nur langsam kamen sie im Schnee voran. Sie mussten durch hohe Verwehungen, überall waren Löcher und Gräben, sie stolperten über Drahtmatten, die man unter der Schneedecke nicht erkennen konnte. Endlich waren sie am Fliederweg. Das Haus lag in einem Garten und war vom Weg aus kaum zu erkennen. Als sie hinten herum in den Keller gingen, sah Stefan die langen Gewächshäuser, die wie weiße Tunnel im Mondlicht glänzten.
„Das Gemüse ist auch kaputt,“ sagte Moni traurig, als sie sich die Schuhe auszogen. Dann gingen sie nach oben.
„Kind!“ rief Frau Florens schon in der Küchentür. „Wie gut, dass du da bist! Du solltest dich da auch nicht einmischen!“ Sie wies mit dem Kopf zum Feldkamp hinüber. „Ändern können wir doch nichts. Sollten wir diesen Winter überstehen, dann müssen wir ohnehin von hier fort. Ohne den Ravenswald…“ – sie seufzte – „und dafür das neue Kraftwerk … Nee…!“ Sie wollte gerade wieder in die Küche gehen, als sie Stefan entdeckte.
„Oh – du hast dir ja einen Ritter mitgebracht. Na, wie es scheint, hat es etwas genützt und du bist heil zurückgekehrt.“
Stefan fühlte, wie er heiße Ohren bekam, es war überhaupt sehr heiß im Flur. Moni lachte: „Aber das ist doch Stefan! Sein Vater hat das Kaufhaus in der Bahnhofsallee.“
„Na, dann zieht mal die nassen Sachen aus, ich bringe euch heißen Malvenblütentee. Der wird euch gut tun.“
Mutter Florens drehte sich um, Stefan schaute ihr nach. Er wusste nicht, was er von ihr halten sollte. Wie oft schon hatte er seine Unsicherheit verwünscht! Mutter Florens trug eine gelbe Schürze mit Blumen, Vögeln und schwarzen Notenköpfen. Um den Hals hing ein Kettchen mit silbernem Schlüssel, im Nacken hatte sie einen Haarknoten, den ein feines Netz umspannte.
„Wo bleibst du?“ rief Moni aus dem Wohnzimmer, Stefan sah sie zum ersten Mal bei vollem Licht. Sie stand am Kachelofen und rieb sich die steifen Finger. Ihre Backen glühten, die braunen Haare hingen zerzaust in die Stirn. Sie hatte eine Stupsnase mit Sommersprossen und große helle Augen.
Eigentlich ist sie nicht hübsch, dachte er, als sie an der Ofenbank saßen und den weinroten Tee schlürften. Oder vielleicht doch, nie ist man sich da bei den Mädchen sicher! Er ärgerte sich über seine Befangenheit, sie brachte ihn zum Schwitzen, das Schwitzen steigerte wieder den Ärger. Von seinem Knöchel spürte er nichts mehr. „Der ist nicht verstaucht,“ stellte Mutter Florens fest, „sonst wäre er schon angeschwollen.“
Es war gemütlich im Zimmer: Der Kachelofen, die Stehlampe, die Bücherregale, in der rechten Ecke ein Notenständer – Stefan fühlte sich wohl und unwohl zugleich. Er vermied es, Moni ins Gesicht zu sehen und betrachtete statt dessen die Pflanzen, den Gummibaum neben dem Klavier, die vielen Kakteen auf der Fensterbank und den Weihnachtsstern auf dem Esstisch, dessen innerster Blätterkranz im Halbdunkel rot leuchtete. Die Tür zum Nebenraum stand offen, ein Lichtstreifen fiel auf Monis Bett. Auf dem Kopfkissen saßen drei Tiere, Stefan konnte den glänzenden Kopf eines Seehunds erkennen.
„Denk dir nur, Moni,“ sagte Mutter Florens, „niemand konnte die Heizung reparieren. Wir müssen das Geschäft schließen, und das vor Weihnachten!“ Moni wurde blass und biss sich auf die Lippen. Ihre Augen verengten sich für Sekunden zu Schlitzen, aus denen es wie bei Schießscharten aufblitzte.
„Willst du noch?“ fragte sie und deutete auf die Teekanne. Stefan verneinte und sah auf die Uhr. „Ich muss gehen.“ Er spürte, wie ihm bei dem Gedanken, wieder in die Kälte hinaus zu müssen, ein Schauer über den Rücken lief.
„Wahrscheinlich warten deine Eltern mit dem Abendessen,“ meinte Mutter Florens, doch Stefan schüttelte den Kopf und stand auf.
„Die sind heute im Theater.“
„Und die Geschwister?“
Wieder schüttelte er den Kopf.
„Na, dann komm gut nach Hause und ruf an, wenn du willst.“ Sie reichte ihm den Anorak, der inzwischen getrocknet war und gab ihm die Hand. Sie fühlte sich rissig und hart an, wie Erde, die ausgedörrt ist. Moni stand neben der Mutter und verfolgte Stefans Bewegungen, als hätte sie noch nie jemanden gesehen, der sich eine Jacke anzieht, an der der Reißverschluss nicht zugeht. „Weiß der Teufel, warum nicht!“ Stefan fluchte im Stillen. Sonst ging er immer wie geschmiert.
„Hier,“ sagte Moni und gab ihm ihren grünen Schal, der eher ein Halstuch war. „Das hält warm. Du kannst ihn mir morgen in der großen Pause zurückgeben.“
Stefan nickte, zog sich die Kapuze über und lief die Treppe zum Vorgarten hinunter. Am Tor drehte er sich noch einmal um und hob die Hand. Moni stand im hell erleuchteten Flur und winkte zurück.
„Am Kiosk!“ rief sie und schloss die Tür.
Stefan trabte in die Dunkelheit, lief den Fliederweg hinunter, erreichte den Wall, durchquerte den verlassenen Schlossgarten und bog in die Rosengasse ein. Es hatte wieder zu schneien begonnen, auch der Wind war aufgefrischt, keine Menschenseele weit und breit; an den Laternen tanzten die Flocken im Lichtkreis. Da war auch das Geschäft: „Emilie Florens – Blumen, Kränze, Gestecke,“ las Stefan und versuchte, in das Schaufenster zu blicken, aber die Scheiben waren von innen mit Rauhreif bedeckt, als wäre Milchglas eingesetzt.
„Gut so, die erwischt es zuerst,“ sagte plötzlich eine tiefe Stimme mit fremdem Akzent neben ihm. Als wäre er aus dem Nichts aufgetaucht, stand vor der Ladentür ein baumlanger Kerl in einem weißen Kapuzenmantel. „Aber wozu noch Blumen,“ fuhr er lachend fort und klopfte mit den Fingern ans Glas.
Erst jetzt sah Stefan, dass dort ein Thermometer hing. „Gut, sehr gut!“ rasselte die Stimme des Weißen Riesen. Sein Gesicht steckte so tief in der Kapuze, dass nichts zu erkennen war. „Temperatursturz…“ Wieder klopfte er an die Scheibe: „Und dabei nicht einmal isoliert! Maximaler Wärmeverlust; kann tödlich sein. Na, …was stehst du hier herum?“ Die Stimme klang jetzt metallisch scharf, ein Klicken war zu hören, wie wenn bei Handschellen das Schloss zuschnappt.
Der Kapuzenmann wandte sich langsam um. Da fiel Licht auf sein Gesicht – es war aber nur eine weiße Stoffmaske zu erkennen und eine blaue Brille, wie Blinde sie tragen. Wild hörte Stefan sein Herz klopfen. Erst jetzt erwachte er aus seiner Lähmung, drehte sich blitzschnell um, rannte ohne zurückzusehen die Rosengasse hinunter, dann über den Marktplatz, am Benediktbrunnen vorbei, die Goetheallee hinauf, kürzte den Weg beim Parkhochhaus ab und bog vom Pirkheimer Platz in die Bahnhofsallee ein. Zwischendurch rutschte er aus, raffte sich auf, rannte weiter und beruhigte sich erst, als er schon längst zu Hause war und den Schlüssel zur Flurtür herumgedreht hatte.
Keuchend setzte er sich auf die Treppe, er spürte heftige Seitenstiche, auch Kopfschmerzen stellten sich ein. Noch immer hörte er das: „Auf Wiedersehen!“ und das höhnische Lachen des Kapuzenmannes, das wie die Ketten der weißen Panzerwagen auf dem Campus rasselte.
Das Haus war dunkel und leer, die Mutter schon fort, es war viertel vor acht. Erneut überfiel Stefan Angst, als ihm bewusst wurde, dass er ganz allein war. Er dachte an Moni und Mutter Florens und malte sich aus, was sie wohl gerade machten. Er spürte, wie er langsam ruhiger wurde, knipste Licht an und ging in die Küche. Dort fand er auf dem Tisch einen Zettel:
„Die Brote sind im Kühlschrank, Vater kommt gleich vom Geschäft ins Theater. Bleib nicht zu lange auf, bei uns wird es spät. Den Wecker habe ich schon gestellt. Wenn es zu kalt ist, stell die Heizung höher. Gute Nacht. Mutter.“
Er ging mit den Broten und einem Glas Milch in sein Zimmer hinauf, zog sich aus und legte sich ins Bett. Eine Weile las er noch in „Kampf um Rom“, doch schon bald fielen ihm die Augen zu. König Totila hätte keine Angst vor den Weißen Riesen, dachte er beim Einschlafen. Aber in Italien ist ja auch fast immer Sommer!… Nur gut, dass der Kapuzenmann nicht Monika, sondern ihm begegnet war. Was der mit ihr gemacht hätte…!
Im Halbschlaf hörte er den Sturm ums Haus toben und wühlte sich tiefer ins Federbett. Ihm war nicht bewusst, dass er noch immer Monis Halstuch trug. Als er schon in die Traumwelt eingetaucht war und auf einmal ein Heer Weißer Riesen auf zehntausend blitzenden Schlitten mit Scheinwerfern und doppelläufigen Kanonen aus dem Ravenswald hervorbrechen sah, da tastete sich seine Hand zum Nachttisch hinüber, warf den Wecker um und bekam ihn dann doch zu fassen, den weißen Affen Fips. Er war viel älter als Stefan und älter noch als die Eltern, die nicht einmal wussten, wo er herkam – ob aus Amerika, aus Indien oder Afrika. Da er ein weißes Fell hatte, stand für Stefan fest, dass er aus Alaska kommen musste, von dort her, wo es Eisbären und Polarfüchse gab: Fips war ein Schneeaffe.
Während er im Traum mit klopfendem Herzen die Invasion der Kapuzenmänner verfolgte und sich unruhig hin und her wälzte, zog er Fips, den weißen Affen, zu sich heran und presste ihn an das heiße Gesicht. Das hatte er schon seit Jahren nicht mehr getan.
Der Große Blumenkrieg
„SCHNEEKATASTROPHE!“ stand in riesigen Lettern auf der ersten Seite der Zeitung, die sich der Vater beim Frühstück dicht vor das Gesicht hielt.
„Viele Orte von der Außenwelt abgeschnitten,“ las Stefan: „Energielage spitzt sich zu … Öffentliches Leben erstarrt.“
Weiter kam er nicht, denn der Vater ließ die Zeitung sinken und reichte der Mutter die Kaffeetasse. „‚Blumenkrieg‘, auch so eine neue Wortschöpfung,“ brummte er missmutig und zeigte auf eine Überschrift: „Der Große Blumenkrieg beginnt.“ Darunter stand: „Heftige Auseinandersetzungen bei Umweltdemonstration.“
„Was die sich so zusammenschreiben – hört mal zu!“ Er glättete das Blatt mit der Überschrift „Lokales“ und las mit erhobener Stimme: „…Trotz des heftigen Schneesturms demonstrierten am Freitagnachmittag Tausende von Bürgern, Studenten und Schülern auf dem neuen Universitätsgelände gegen die Errichtung des Kernforschungszentrums sowie gegen die geplante Abholzung des Ravenswaldes zwecks Errichtung des Kalküler Atomkraftwerks. Im Verlaufe der Demonstration kam es zu massiven Ausschreitungen, deren Heftigkeit die Polizei überraschte. Erst nachdem die neu gebildete Sicherheitsgruppe der IPERA – wegen der weißen Mäntel im Volksmund die ‚Schneemänner‘ genannt – massiv eingriff, konnten die Auseinandersetzungen beendet werden…“
Der Vater nahm einen Schluck Kaffee und biss in ein Brötchen, aus dem die Kirschmarmelade quoll. Dann las er kauend weiter und blickte Stefan hin und wieder über den Rand seiner Brille bedeutungsvoll an.
„…Wie schon früher berichtet, ist die mobile Einsatztruppe der IPERA aus dem Kampf gegen anarchistische Elemente hervorgegangen und hat die Aufgabe, die Erforschung, Gewinnung und Versorgung mit Energie sicherzustellen. Sie wird dabei von der ‚Internationalen Vereinigung für Verhaltensforschung‘ unterstützt, die die Schattenseiten unserer Gesellschaft beleuchtet und aufklärt. Wie verlautet, wurden vom Sicherheitsdienst der IPERA eine unbekannte Zahl von Demonstranten festgenommen, darunter Jugendliche und Schüler von zehn und zwölf Jahren. Die Zahl der Verletzten ist noch nicht bekannt. Wie Sprecher der Bürgerparteien erklärten, gehe der Kampf um den Ravenswald unter dem Motto ‚Kampf dem Blumenkrieg‘ weiter…“
Der Vater legte die Zeitung beiseite und strich sich nachdenklich über die Glatze. Dann zündete er sich eine Zigarette an und blies einen breiten Nebelstreif über den Tisch. „Dass ich dich nicht mal dabei erwische!“ drohte er Stefan: „Was die anderen machen, ist mir gleichgültig – du jedenfalls nicht! Aber ich muss los, es ist höchste Zeit!“
Er sah auf die Armbanduhr, da klingelte das Telefon.
„Ich gehe schon ran!“ rief Stefan, nahm den Hörer ab und wurde blass. Diese Stimme, die wie eine Panzerkette rasselte, kannte er.
„Was ist denn los?“ fragte die Mutter, als Stefan aufgelegt hatte.
„Städtisches Elektrizitätswerk…,“ murmelte er: „Die wollen von morgen an täglich um 14.00 Uhr für eine Stunde den Strom abschalten, später auch noch länger. Ebenso das Gas!“
„Das kann ja heiter werden!“ rief die Mutter und griff nach der Zeitung.
„Sag ich ja.“ Der Vater drückte die Zigarette aus und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch: „So ein Schwachsinn! Nicht weniger, sondern mehr Kraftwerke brauchen wir! Wer weiß, vielleicht gibt es eine neue Eiszeit? Man hört, dass die Polkappen sich verschieben und nach Süden wandern.“
Er stand auf, klopfte Stefan auf die Schulter und wollte ihm gerade einen Kuss auf die Stirn drücken, als die Mutter hell auflachte. „Das ist was für dich, Erwin: ‚Ein Blumenkrieg ganz anderer Art‘,“ las sie, mit dem Zeigefinger den Text unterstreichend, „‚ergibt sich für die Gärtner und Blumenhändler. Wie bei vielen Bürgern in Haus und Garten, sind auch in den Gewächshäusern und Blumengeschäften die Pflanzen durch den plötzlichen Kälteeinbruch erfroren. Nach einer Blitzumfrage sind viele Verbraucher unter dem Eindruck des Klimaumsturzes bereit, auf künstliche Blumen umzusteigen…‘ “
„Ist ja meine Rede!“ lachte der Vater und drückte der Mutter strahlend den Abschiedskuss auf die Backe: „Synthetics! Plastikblumen! Gut, dass wir uns schon vor Wochen damit eingedeckt haben – unvergänglich, halten ewig! Das ist die Branche, die bald am besten floriert!… Wir sollten noch Eisblumen dazunehmen!“ Er war schon in der Tür und winkte jovial zurück: „Bin zum Mittagessen wieder zurück,“ dann knallte die Tür.
Auch die Mutter, die in einer Buchhandlung arbeitete, machte sich fertig. „Und du?“ fragte sie Stefan.
„Ich muss erst zur zweiten Stunde.“
„Dann feg bitte den Hauseingang noch!“
Als Stefan sich auf den Schulweg machte, dämmerte es. Bestimmt ist heute alles so grau wie gestern, dachte er und blinzelte in die Flocken, die der Wind ihm ins Gesicht trieb. Es schneite noch immer, mühsam kämpften sich die Menschen durch die Straßen. Die Schneepflüge waren pausenlos im Einsatz, doch ihre Arbeit blieb sinnlos. Hinter ihnen löschte der Wind die Spur, heulend tobte er durch die Stadt. Neue weiße Schleier legten sich über Fahrbahn und Bürgersteig.
Als Stefan am gelben Bushalteschild vorbeikam, sah er, dass ein roter Streifen darüber geklebt war mit der Aufschrift: „Vorübergehend eingestellt!“
„Das kann ja lustig werden!“ schimpfte eine Frau, die ihren Schal festhielt, damit er nicht vom Wind weggerissen wurde. „Wenn wir das alle machen würden, wäre bald die ganze Stadt wie tot!“
„Kann ja noch alles kommen!“ rief ein junges Mädchen, das mit einem großen Paket am Straßenrand stand und dann im Zickzack über die Fahrbahn lief. Sie hatte weiße Hosen und einen weißen Kittel an, der sich im Wind wie ein Segel blähte.
Komisch, sogar die Schuhe sind weiß, dachte Stefan. Dann aber fiel ihm die Schule ein: Mathematik, Latein, Deutsch – wenn er daran nur dachte! Überhaupt, er hatte zu nichts Lust. Alles war immer dasselbe: Aufstehen, Frühstücken, Unterricht; nachmittags Schularbeiten, im Garten helfen oder mit Chris und Alexander ins „Happy End“, das Eiscafé von Ziffernelli. Chris ging manchmal auch in die Disco „Down Town“, aber das hatte ihm der Vater verboten: „Werd du erst mal konfirmiert, dann sehen wir weiter!“
Bei Bäcker Freese traf er Henry und Christoph. „Wo bist du denn gestern geblieben?“ rief ihm Chris schon von weitem zu. „Wir haben noch schön mitgemischt!“
Stefan erzählte die Sache mit dem Polizisten, und wie er sich im Keller versteckt hatte. Von Moni erwähnte er nichts und wunderte sich selbst darüber. Das war überhaupt das Beste am heutigen Tag: In der großen Pause würde er sie wiedersehen! In Gedanken versunken trottete er neben den Freunden her und fühlte in der Manteltasche nach dem Tuch, das sie ihm gegeben hatte. Aber bis zur Pause musste noch Zebura überstanden werden, der heute bestimmt die Arbeit zurückgab. Stefan seufzte, als er daran dachte; Chris und Alex ging es nicht anders. Auch sie machten sich Sorgen, wenn sie an den Mathematikunterricht dachten.
Und dann stand Dr. Zebura vor der Klasse, lang und hager, mit blassem Gesicht. Verständnislos sah er auf Stefan herab: „Mangelhaft, Stefan Winter,“ sagte er leise mit hohler Stimme. Es klang, wie wenn man an ein leeres Fass schlüge: „Du bist und bleibst eine mathematische Null, Stefan Winter, eine Null!“
Der Satz kam wie ein Peitschenhieb, so dass sich Stefan duckte. „Ein Nichts… ! Kein Sinn für Zahlen, kein Gefühl für Gleichungen, für das Gleiche im Ungleichen, für die Wiederkehr des Gleichen überhaupt … Von der Geometrie ganz zu schweigen!“
Er knallte Stefan das Heft auf den Tisch, strich sich mit einer fahrigen Bewegung durchs eisgraue Haar, das an den Seiten schon weiß wurde, und hob beschwörend die Arme: „Mathematik – das ist nicht irgendeine, das ist die Wissenschaft, die Sprache der Welt! Alles besteht aus Zahlenverhältnissen, aus klaren Formeln, sauber und schön!“
Chris, der neben Stefan saß, gab diesem einen Rippenstoß und grinste hinter der Hand. Das kannten sie schon. Wenn Dr. Zebura ins Schwärmen geriet, dann war kein Halten mehr. Er singt philosophische Arien, nannten sie das. Seine Bewegungen bekamen etwas Großartiges: Er malte Kreise, Linien, Achten in die Luft und hieb Geraden, Waagerechten und Senkrechten dazu, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Das Beste daran war, dass der Unterrichtsstoff auf der Strecke blieb.
„Mathematische Nullen!“ rief Dr. Zebura aus. „Warum bin ich mit so vielen Nullen geschlagen?“ Beschwörend blickte er in die bedrückte Runde: „Ohne Mathematik keine Wissenschaft, keine Philosophie; ohne Geometrie keine Welt, kein Universum! Kreise, Linien, Ellipsen, Dreiecke – das sind die wahren Ideen der Welt! Und der Mensch? Eine Gleichung mit X Unbekannten, ein Null-Komma-Nichts in der Bruchrechnung der Zeit!“
Er ging in der Klasse auf und ab und hob und senkte die Arme wie ein Storch vor dem Start, der Luft unter die Flügel bekommen will, um abheben zu können. Draußen schneite es. Henry, der mit Alexander vor Stefan und Christoph saß, blätterte unter der Bank in der neuen Ausgabe von „Disco World“, in der die Platten des Monats vorgestellt und über Stars und Hits berichtet wurde. Alex studierte ein zerfleddertes „Superman“-Heft, das „Im Zentrum des Orion“ hieß. Wie sehr sich Stefan aber auch anstrengte, er konnte die Sprechblasen nicht entziffern.
„Dreiecke, Stefan Winter, jawohl, Dreiecke,“ donnerte jetzt Dr. Zebura, der sich noch längst nicht beruhigt hatte, „waren für den großen Platon die Grundbausteine der Welt!“ Er nahm ein Stück Kreide und malte eine Gerade an die Tafel, deren Endpunkte er mit A und B bezeichnete. „Wer A sagt, muss bekanntlich B sagen.“ Seine Stimme hatte einen Flüsterton angenommen und klang feierlich, voller Andacht. „Aber das ist nur die lineare Dimension, der endliche Horizont dieser Welt: Wir müssen auch C sagen können!“ rief er aus, zeichnete triumphierend das C über der Geraden ein und verband es mit den Punkten A und B zu einem gleichseitigen Dreieck. „Das ist die Transzendenz, die Unendlichkeit, das, was über uns hinausweist – das Hohe C!“
Er hustete ausgiebig, offensichtlich hatte er sich verschluckt. „Das Hohe C“ – er griff nach den anderen Heften und verteilte sie – „ist das Ewige in uns! Selbst die Parallelen, ihr Nullen… – Vier minus, Elisabeth Martens…,“ Zebura hob bedeutungsvoll die Stimme, „mit einem Minuszeichen bis zum Feldkamp… Nichts als Aufstand und Rebellion im Kopf…,“ das Heft fiel von oben senkrecht vor Lizies Nase auf den Tisch – „…selbst die Parallelen, ihr Minusmacher, schneiden sich im Unendlichen!“
Mit Schwung drehte sich Dr. Zebura um und malte eine Schleife, eine liegende Acht, das Zeichen für „Unendlich“, an die Tafel, als es an der Tür klopfte und Direktor Füllhorn die Klasse betrat. Er gab Musik, wurde meist „Direx“ genannt und war beliebt bei den Schülern. Er winkte und besprach sich mit Zebura.
„Hört mal zu,“ meinte er kurz darauf: „Nach Rücksprache mit dem Oberschulrat wird der Unterricht ausfallen, solange die Kältewelle anhält. Es muss nämlich Energie gespart werden.“
Er machte eine Pause, ein Aufatmen ging durch den Raum, dann fuhr Füllhorn fort: „Außerdem nehmen die Erkältungen und Grippeerkrankungen zu.“ Er musterte die gelichteten Reihen. „Übrigens auch unter den Lehrern. Latein fällt in der nächsten Stunde aus, denn den Kollegen ‚Ora et labora‘“ – er lächelte, die Klasse feixte – „hat es ebenfalls erwischt. Ich werde ihn vertreten, danach ist bis auf weiteres frei. Nur der Sport heute Nachmittag wird noch stattfinden. Ihr könnt Wintersport treiben, das käme dem Schulhof zugute. Schaufel und Besen sind vorhanden. Also um 15 Uhr alle zum Schneeschippen!“
Es klingelte, der Direx gab Zebura die Hand, nickte mit einem: „Bis gleich!“ der Klasse zu und verschwand. Stefan stürmte auf den Schulhof und hinüber zum Kiosk auf der anderen Straßenseite, wo es Süßigkeiten, „Superman“-Hefte, Schreibsachen und Zeitungen gab.
„Was soll’s denn sein, Stefan?“ fragte Sülzenbecher, der die meisten Schüler mit Namen kannte. Er hatte das Schiebefenster einen Spalt weit geöffnet und schielte missmutig ins Freie. Seine Augenklappe hatte ihm den Spitznamen „Brillanten-Ede“ eingebracht.
„Nichts,“ stotterte Stefan verlegen. „War Monika Florens schon da?“
„Nee! Bin ich ein Auskunftsbüro?“ Er knallte das Fenster zu und kaute an seiner Zigarre, die er nie anzuzünden pflegte. Stefan fror und starrte in den trüben Wintertag. Zwar war es nicht mehr so kalt wie gestern, doch schneite es noch immer in einem fort. Vielleicht, bis wir alle ersticken, dachte er und fühlte in der Tasche nach dem Halstuch. Die Augen schmerzten bereits, aber er konnte Moni nirgends entdecken.
Schon klingelte es wieder, er musste zurück. „Verdammt!“ fluchte er, überquerte den Hof und lief die Treppe hinauf. Als er den Flur entlang ging, sah er Bienchen, die in der selben Klasse wie Moni war. „Ist Monika Florens noch nicht da?“ fragte er.
Bienchen schüttelte den Kopf und klopfte sich den Mantel ab. Ihre braunen Augen sahen ernst und übernächtigt aus. Das Gesicht war käseweiß, die Lippen schimmerten blau.
„Krank,“ rief sie, „ganz plötzlich!“ drehte sich um und lief die Treppe zum ersten Stock hinauf.
„Die hat es auch erwischt,“ murmelte Stefan und fühlte, wie seine Laune auf Null sank; ihm war flau. Wie sehr hatte er sich auf das Wiedersehen gefreut. Ob auch Moni ihn gern mochte? Vielleicht war ja alles bloß dummes Zeug, von Freundinnen hielt er nicht viel. Nie wusste man, woran man mit den Mädchen war; das sagten auch Chris und Henry. Manchmal waren sie allerdings auch nützlich, denn Schularbeiten machten sie besser, und abschreiben konnte man von ihnen auch. Aber schon bei einer Schneeballschlacht waren sie kaum zu gebrauchen und standen nur dauernd im Weg.