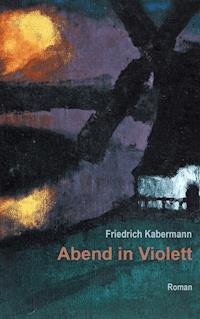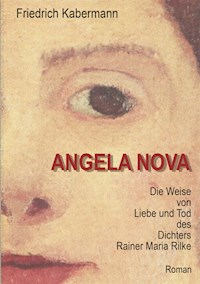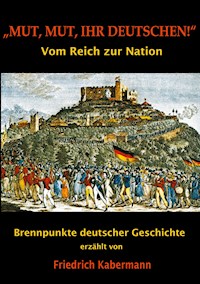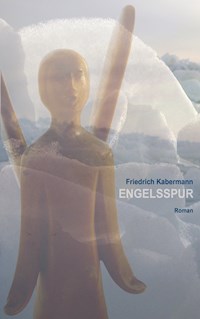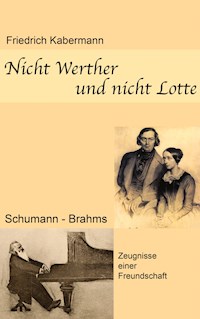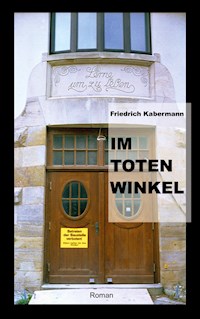Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Der Titel soll zum Ausdruck bringen, dass die Welt ein Mixtum compositum ist, ein sich Durchdringen von Hell und Dunkel, das aus unendlichen Übergängen besteht. Manche dieser Interferenzen spiegeln sich in den Essays wider, so dass es scheint, als wären auch sie aus Licht und Schatten gewebt. Das Buch ist Georg Picht gewidmet – neben Heidegger der andere große Denker der Zeit. Bei Picht geht es nicht mehr um das ewige Sein, dem Fundament der Metaphysik, sondern um die Erkenntnis: „Die Zeit ist selbst das Sein“. Das bedeutet ein Überdenken unseres gesamten Welthorizonts, auch des Grundes, auf dem die Wissenschaft steht. Durch die Bemühung, hierzu einen Beitrag zu leisten, ergab sich im Lauf der Jahre jene Nähe zu Picht, die zu den Voraussetzungen der Essays gehört. Das gilt vor allem vom letzten, dem Versuch über das Glück, der aber keinen Abschluss darstellt. Vielmehr soll er den Denkweg zu einem vorläufigen Ende führen, so dass die Bewegung, die ihn ausmacht, unter dem Lebensbaum zur Ruhe kommt. Wo Schatten ist, ist auch Licht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
I. Denken und Dichten
Krise und Kritik
Umrisse einer vorläufigen Nachdenklichkeit Seite 11
Experimentum Mundi
Essayistisches über den Essay Seite 17
Fenster sein, nicht Spiegel
Entwurf einer poietischen Vernunft Seite 31
Angela Nova
Wer ist Rilkes Engel? Seite 61
II. Sein und Werden
Requiem in C-Dur
Adnoten zur Ökologie der Kunst Seite 85
Gewissen der Welt
Was ist Terranautik? Seite 129
Im freien Fall
Über die Macht der Ohnmacht Seite 145
Sonnenmittagszeit
Gorch Fock in Szene gesetzt Seite 159
III. Wissen und Glauben
Flagge zeigen
Laudatio auf Europa Seite 185
Schattenrisse
Raumschiff Erde im Gegenlicht Seite 199
Ökumenopolis
Aufklärung und Theologie Seite 255
Baum des Lebens
Versuch über das Glück Seite 267
Nachweise Seite 291
I.
Denken und Dichten
Krise und Kritik
Umrisse einer vorläufigen Nachdenklichkeit
„Es gibt einen Augenblick des Glückes, der uns jäh überfällt. Er verdrängt die Gedanken wie das absolute Licht den Schatten; die Sterne müssen günstig stehen“.
So lautet der vorletzte Absatz von Ernst Jüngers Roman „Die Zwille“. Ich habe ihn dem Aufsatz „Scherenschnitte“ zugrunde gelegt, der 1990 in „Dunkel-Zeiten“, dem ersten Essay-Band, erschien. Augenblicke des Glücks gehören nicht zu den Glücksgütern, durch deren Konsum sich die Industriegesellschaft die politische Legitimität erkauft. Sie verweisen auf eine Erfahrung des Glücks, die nicht von dieser Welt ist.
Zum philosophischen Thema wurde sie in Platons „Höhlengleichnis“, das im VII. Buch der „Politeia“ steht. Platon spricht dort von den Mühen, die der Höhlenbewohner auf sich nehmen muss, wenn er dem Schattendasein der Gefangenschaft entkommen und das Licht der Unsterblichkeit erblicken will. Dabei helfen ihm weder Wissen noch Weisheit, wichtig ist allein, dass der beschwerliche Weg, ein Mensch zu werden, immer wieder neu gewagt wird. Das aber bedeutet, wie es im „Phaidon“ heißt, Sterben zu lernen, was nur möglich ist, wenn die Seele eine „Metanoia“ vollzieht, eine Kehrtwende von der vergänglichen Welt des Scheins hin zur ewigen Wahrheit des Seins. Gelingt diese Umkehr, erfährt der Mensch, was Glück ist.
Das ist der Zusammenhang, den Ernst Jünger vor Augen hat, wenn er eine solche Glückserfahrung mit dem absoluten Licht vergleicht, das keinen Schatten wirft.
Die Höhle ist Platons Bild für die Welt der Menschen, deren Wesen die Vergänglichkeit ist. Das klingt 2000 Jahre später noch bei Nietzsche an, wenn er von den „Dunkel-Zeiten“ spricht – nun allerdings in der Umkehrung: Nicht die Ewigkeit ist wirklich, sondern die Endlichkeit dieser Welt. Von ihr können wir uns nicht befreien, sie ist die Bedingung, die Notwendigkeit des Lebens schlechthin.
„Lichte Schatten“ – der Titel des neuen Essay-Bandes bringt zum Ausdruck, dass die Wirklichkeit eine Mischung aus Licht und Schatten ist, gleichsam ihre Interferenz. Dem versuchen die einzelnen Arbeiten gerecht zu werden, wobei thematische Überschneidungen und Wiederholungen nicht zu vermeiden sind. Zudem muss offen bleiben, ob die Aufhellung zwischen „Dunkel-Zeiten“ und „Lichten Schatten“ bloßer Schein ist oder nicht.
Im Zeitalter der Metaphysik wird das Denken von Platon bis Hegel durch die Trias Unum, Verum, Bonum bestimmt, der die Dreieinigkeit von Welt, Mensch und Gott entspricht. Danach erscheint die Welt als eine Einheit, der Mensch als das Lebewesen, das nach der Wahrheit fragt und Gott als die Idee des Guten, als das höchste Gut überhaupt. Entsprechend handeln die Essays „Experimentum Mundi“ von der Einheit der Welt als Geschichte, „Fenster sein, nicht Spiegel“ von der Wahrheit in der Form der Transparenz und „Requiem in C-Dur“ vom Tod Gottes, dem Ende der Metaphysik. In dieses Gefüge ordnen sich die übrigen Arbeiten ein und umreißen so den Horizont der Gegenwart.
Das gilt auch von den politischen Beiträgen, vor allem den „Schattenrissen“, der die Form eines Entwurfes hat. Sie stammen aus dem Umkreis des Gesprächsbuches „Das Maß der Dinge“, wobei sich in der Zwischenzeit die Systemkrise der Politik auf eine Weise verschärft hat, die mit „Dunkel-Zeiten“ oder „Lichten Schatten“ kaum mehr umschrieben werden kann. Eher träfe die Vorstellung einer fensterlosen Finsternis zu, die in Kafkas Bild vom „Schacht von Babel“ anklingt. Wir graben uns nicht nur ein, wir beerdigen uns selbst.
Doch gilt das nicht absolut, anders würde die Hoffnung verleugnet, die den Blick in die Zukunft lenkt; ohne sie ist Leben nicht möglich. Nach Georg Picht handeln wir falsch, weil wir falsch denken, nicht umgekehrt. Der Punkt, an dem sich nachweisen lässt, wie in der Politik aus falschem Denken falsches Handeln entsteht, lässt sich historisch genau angeben. Er wird durch Carl Schmitts Schrift über den „Begriff des Politischen“ markiert, die bis heute die Gemüter fasziniert. Sie erschien 1932 und stellt das Wesen des Politischen als existentielles Freund-Feind-Verhältnis dar, das die physische Vernichtung des Feindes einschließt. Ob „Kommunist“ oder „Faschist“, „Kapitalist“ oder „Terrorist“ – im Rahmen einer solchen „politischen Theologie“ ist jeder ein möglicher Feind und kann als „Häretiker, als ein Un-Mensch, vernichtet werden. Daran wird deutlich, dass weniger die Inhalte als die Formen des Denkens entscheidend sind. Deshalb wird die Krise der Hightech-Zivilisation nur dann zu lösen sein, wenn ihr im Zuge einer inneren Evolution der Abschied vom Feind gelingt. Damit ist die Voraussetzung genannt für jene politische Kunst, das „Raumschiff Erde“ zu steuern, die hier als „Terranautik“ bezeichnet wird. Anders muss das Experimentum Mundi scheitern, womit sich der Themenkreis der Essays schließt.
Krise und Hoffnung – in ausgesprochenen „Dunkel-Zeiten“ machen wir nach Nietzsche nicht nur düstere Erfahrungen, sondern auch solche einer „schwer zu beschreibenden Art von Licht, Glück (und) Erleichterung“ – so als würden wir von einer neuen „Morgenröte“ angestrahlt: „Unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung – endlich erscheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, dass er nicht hell ist, endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt, das Meer, unser Meer liegt wieder offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer“.
Das ist Nietzsches Vision vom Homo Novus, jenem kommenden, unzeitgemäßen Menschentypus, der die Krise der Industriegesellschaft nicht nur nicht verdrängt, sondern in sich überwunden hat und so zu neuen Ufern aufbricht. Sie findet sich unter dem Titel „Wir Furchtlosen“ in der „Fröhlichen Wissenschaft“, die zusammen mit dem „Zarathustra“ stark auf die Generation zwischen den Weltkriegen eingewirkt hat. Das sollen die Arbeiten zu Rilke, Paula Bekker-Modersohn und Gorch Fock verdeutlichen, die thematisch den Romanen „Angela Nova“ und „Letzter Vorhang“ zuzuordnen sind.
Den Anstoß zum letzten und jüngsten Essay gab eine Stelle in Jüngers „Zwille“, an der zu mitternächtlicher Zeit über Gott und die Welt meditiert wird. Es kam, so heißt es, „die Stunde der ungehaltenen Predigten. Sie wurden konzipiert, ohne je formuliert zu werden, wie flüchtige Pläne eines Architekten, dem der Bauherr fehlt“. In der Tat, wer kennt sie nicht, die durchwachten Nächte, die jeder für sich zu bestehen hat? Sie ähneln der Situation des Priesters, der die Messe zur Not allein zelebriert. Der Laie nimmt teil, doch notwendig ist er nicht. Der Sinn des Gottesdienstes liegt im Dienst.
Ich nahm die Stelle zum Anlass, eine der eigenen ungehaltenen Predigten zu formulieren, gleichviel, ob der Bauherr fehlte oder der Architekt. Dabei ist der lapidare Stil, der auf Nachweise verzichtet, insofern der Sache geschuldet, als ihm das innere Muster der Nachtwache, der Vigilia matutina, zugrunde liegt. Mitunter ähnelt die Form auch dem Selbstgespräch, das am Ende um die Frage kreist, was es denn mit diesem Selbst auf sich hat, das uns so selbstverständlich ist. Damit endet der Denkweg zwischen Licht und Schatten, den jeder der Essays dokumentiert. Der letzte will keinen Überblick geben, sondern die Vorläufigkeit der Arbeiten betonen, so dass die Bewegung des Denkens, die dem Weg zugrunde liegt, unter dem Baum des Lebens zur Ruhe kommt.
Das Buch ist Georg Picht gewidmet – neben Martin Heidegger der andere große Denker unserer Zeit. Sein Werk umfasst sechzehn Bände und begleitete mich nicht nur en passant, sondern ein halbes Jahrhundert hindurch. Die Beschäftigung begann während des Studiums mit der Abhandlung über „Die Erfahrung der Geschichte“. Durch sie wurde mir klar, dass meine eigene Denkarbeit erst beginnen konnte, wenn ich den Bannkreis der Subjektivität verlassen hatte. Diese ist dem Wesen nach identisch mit jener technokratisch verfassten Wissenschaft, die überall auf der Erde ihr Unwesen treibt und inzwischen den Planeten in einen „Irrstern“ verwandelt hat. Noch immer hat sich diese dogmatische Form der Wissenschaft nicht von der Metaphysik emanzipiert, die seit Parmenides durch die Identität, die Einheit des Seins, das Denken bestimmt. Bei Picht geht es nicht mehr um das zeitlose Sein, auch nicht wie bei Heidegger um „Sein und Zeit“, es geht um die Erkenntnis: „Die Zeit ist selbst das Sein“.
Da die Philosophie seit eh und je als die Wissenschaft von der Wissenschaft gilt, werden im Horizont der Zeit sämtliche überlieferten Grundvorstellungen wie „Wahrheit“, „Vernunft“, „Erkenntnis“, „Natur“ fragwürdig und müssen neu gedacht werden. Das gilt auch für Fragen wie die, was denn künftig unter „Kategorien“, „Begriffen“, „Theorien“ und „Systemen“ verstanden werden soll – Vorstellungen, die von der Wissenschaftslehre des Aristoteles bis hin zu Niklas Luhmanns „Systemtheorie“ zeitlos gedacht worden sind. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie lässt sich die Wahrheit denken, wenn sie nicht mehr Einheit des Seins, sondern Einheit der Zeit ist?
Die Antwort von Picht lautet: Nicht als Identität, sondern als Differenz zwischen phänomenaler und transzendentaler Zeit. Das sind nicht zwei verschiedene Zeiten, sondern zwei Formen, wie ein und dieselbe Zeit in der Differenz ihrer Modi (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) erfahren wird. Durch mein Bemühen, diese Fragen denkend nachzuvollziehen, ergab sich im Lauf der Jahre eine Nähe zu Picht, die die Voraussetzung sämtlicher Essays darstellt, vor allem des letzten über den „Baum des Lebens“. Einer der ersten Sätze, die ich von Picht las und nicht vergaß, steht im Vorwort seiner philosophischen Studien „Wahrheit – Vernunft – Verantwortung“ und lautet: „Der Begriff des geistigen Eigentums ist nicht nur ein Spiegel unserer Anmaßung, er enthält auch eine Negation des Geistes“.
Persönlich bin ich Picht dreimal begegnet: Zuerst 1976 auf einer Tagung der „Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft“ in Arnoldshain, die beiden anderen Male bei ihm zu Hause in Hinterzarten auf dem Birklehof. Korrespondiert haben wir bis in sein letztes Lebensjahr hinein, Picht starb am 7. August 1982 mit neunundsechzig Jahren. Damals, Mitte der siebziger Jahre, plante ich, mich mit Nietzsche zu habilitieren und fragte bei Picht an, ob er die Arbeit begleiten würde. Er sicherte mir seine Unterstützung zu, riet aber von einer Hochschullaufbahn ab. Die Gründe erläuterte er wenig später in einem langen Brief, wie er wohl nur einmal im Leben geschrieben und empfangen wird. Darin steht der Satz: „Wir sind in ein Zeitalter übergetreten, in dem die großen Bewegungen des Denkens sich nicht mehr im Rahmen der Universität, sondern in ganz anderen Zusammenhängen abspielen“ (10.9.1976).
Da sich auch meine Bedenken verstärkten, entschloss ich mich, jener aggressiven Mentalität den Rücken zu kehren, die mit der heutigen Wissenschaft identisch ist. Ihr Wesen liegt darin, dass sie zerstört, was sie erkennt, ohne zu erkennen, was sie zerstört. Zwar ahnte ich nicht, wie schwer es sein würde, aus der Schattenhöhle der Subjektivität ins Freie zu gelangen, doch habe ich die Mühen nicht bereut. Dabei half mir das Glück, durch Georg Picht zu erfahren, was Denken heißt, auch was ein Denker ist.
(2014)
Experimentum Mundi
Essayistisches über den Essay
I.
Was ist ein Essay? In Meyers Großem Enzyklopädischen Lexikon beginnt der entsprechende Artikel mit dem Hinweis, dass das Wort eigentlich Versuch bedeute. Im Essay werde „das Denken während des Schreibens als Prozeß, als Experiment entfaltet“, als „fragende Wahrheitssuche“, die prinzipiell „unabgeschlossen“ sei. Danach ist nicht der Inhalt entscheidend, sondern die Form, die in dem Artikel durch die drei Worte „Versuch“, „Prozess“ und „Wahrheit“ umrissen wird. Der Essay ist demnach ein Versuch, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Da die Wahrheit aber nicht etwas ist, das man wie einen Gegenstand finden und bei sich tragen kann, hat die Suche nach ihr die Form eines unabgeschlossenen Prozesses. Jeder Essay ist deshalb ein Versuch mit dem Versuch.
Ist das nicht Tautologie? Der Begriff Tautologie enthält die beiden griechischen Worte to auto, dasselbe, und logos, die Aussage. Tautologisch ist eine Aussage dann, wenn sie nichts als dasselbe sagt. Die Selbigkeit heißt im Lateinischen Identität. Ein wissenschaftlicher Sachverhalt gilt in der Regel als richtig, wenn Sache und Aussage identisch sind. Das letzte große System der abendländischen Metaphysik ist Hegels sogenannte Identitätsphilosophie. Sie ist eine Erneuerung der Philosophie des Aristoteles, dessen Denken die Wissenschaft begründet hat. Aber Aristoteles’ Logik der Wissenschaft, als deren oberste Regel noch heute der Satz vom Widerspruch gilt, ist ohne die Ontologie des Parmenides nicht möglich. Auf ihr beruht nicht nur die abendländische Metaphysik, sondern auch die neuzeitliche Physik, die zum Paradigma der Wissenschaft geworden ist. Ihr Fundament ist von Parmenides in dem berühmten „Satz der Identität“ formuliert worden und lautet in der landläufigen Übertragung: Dasselbe ist, Denken sowohl wie Sein.
Wenn dieser Satz wahr ist, dann bedeutet er, dass Wissen nur möglich ist, wenn klar ist, was Sein heißt. Im Zeitalter der Metaphysik, von dem jeder heute zu wissen meint, dass es vorüber sei, wurde das Sein absolut, das heißt zeitlos, als Ewigkeit gedacht. Martin Heidegger hat aber in seinem Werk „Sein und Zeit“ gezeigt, dass Sein nur im Horizont der Zeit erscheinen kann, und Georg Picht hat daraus die Konsequenz gezogen: Sein ist Zeit oder: Sein = Zeit. Demnach müsste der Satz der Identität heute lauten: Dasselbe ist, Denken sowohl wie Zeit. Denken, das Wahrheit für sich beansprucht, wäre dann nur möglich, sofern es dem Wesen nach mit der Zeit dasselbe wäre. Das ist der Fall, wenn in allem, was gedacht wird, die Geschichte und ihre Zeitlichkeit immer mit bedacht werden. Mit Geschichte ist jener Bereich des Daseins gemeint, der als kollektives Gedächtnis menschliches Leben überhaupt erst ermöglicht. Ohne Gedächtnis kann der Mensch nicht Mensch sein.
Begegnet das griechische Wort auto auch im Wort Autor? Verhielte es sich so, wäre der Autor ein Mensch, der fortwährend dasselbe sagt. Aber Autor leitet sich vom lateinischen auctor ab, das Urheber, rechtmäßiger Verfasser, bedeutet. Ein Autor, der den Umschlag vom Sein zur Zeit nachvollzogen hat, könnte sich also autorisiert fühlen, die Zeit als transzendentale Bedingung allen Wissens immer mit zu denken. Dazu brauchte er aber nicht Historiker, also Wissenschaftler zu sein, es wäre sogar die Frage, ob die Historie ihn nicht gerade daran hinderte, die Geschichte als solche zu erfahren? Ist der Autor Dichter oder Denker? Sind Dichten und Denken voneinander unterschieden oder zwei Seiten derselben Tätigkeit? Dass Dichten mit Denken zu tun hat, wird kaum jemand bestreiten. Ob aber Denken auch notwendig Dichten ist, ist eine Frage, die im Zeitalter der Wis senschaft verneint wird. Der Begriff des Denkens wird von dem des positiven Wissens bestimmt. Deshalb ist uns heute, anders als in allen früheren Epochen, nicht die Einheit von Dichten und Denken wichtig, sondern die Differenz. Diese lässt sich symbolisch als Gedankenstrich darstellen, genauer als Bindestrich, der zugleich bindet und trennt. Er entspräche als Zeichen der Stellung des Autors in der Welt, die in der Vermittlung von Dichten und Denken besteht. Leben und Werk würden mithin beides repräsentieren, sowohl die Einheit wie die Differenz. Ihre Ambivalenz stellte sich im Autor gleichsam selber dar, durch sie würde seine Existenz geschichtlich transparent.
Um zu erkennen, was das bedeutet, müsste allerdings klar sein, was Dichten, was Denken heißt. Dichten ist etwas anderes als das Gedicht, Denken etwas anderes als der Gedanke. Beides sind Tätigkeiten, ein Prozess, und zu unterscheiden von dem hervorgebrachten Produkt. Schwieriger scheint es mit dem Wissen zu stehen, weil fraglich ist, ob von Wissen gesprochen werden kann, ohne zugleich das Gewusste in diesem Wissen mitzudenken. Wissen, das um sein Wissen weiß, heißt Wissenschaft. Der reine Wissende dagegen ist der Weise. Ihm ist nicht das Wissen als solches wichtig, sondern das, was es im Leben bewirkt. Ihm kommt es nicht so sehr auf den Inhalt als die Form an, die Lebensform ist: „Geprägte Form, die lebend sich entwickelt“, wie Goethe in den „Urworten, orphisch“ sagt.
Unter Dichten ist das gesprochene Wort zu verstehen, ursprünglich ist Dichtung Gesang. Das geschriebene Wort ist Literatur. Wer schreibt, ist ein Schriftsteller, ein Literat, der aus seinen Werken vorliest, während der Dichter seine Dichtung vorträgt. Gustave Flaubert formte seine Sätze in einer solchen Lautstärke, dass die Schiffer auf der Seine, die an seinem Landhaus in Croisset vorbei floss, erstaunt die Köpfe hoben. Wie die Musik lebt auch die Dichtung von der Melodie, vom Rhythmus der Sprache. Darin ist sie ein Spiegel der Seele, wie die Griechen sagten, oder des Gemüts, wie die Romantiker formulierten. Für uns Heutige ist daraus die Innenwelt des Subjekts geworden, die einem Spiegelreflex der zerstörten Außenwelt gleicht.
Für die Bewegung der Seele gelten die Regeln der Logik nicht. Ein Gedicht, eine Komposition, ein Bild mag missfallen und abgelehnt werden, negiert werden kann es nicht. Kunst, die negiert wird, ist trotzdem vorhanden und wirkt auf ihre eigene, souveräne Weise fort. Kleists Dichtung, Schuberts Musik, Nietzsches Denken, van Goghs Malerei wurden von den Zeitgenossen ignoriert; erst Jahre oder Jahrzehnte später stellte sich das Echo ein. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssen dagegen erfolgreich sein. Werden sie negiert, scheiden sie aus dem seriösen Diskurs aus. Künstlerische Produkte sind wahr oder unwahr, wissenschaftliche Erkenntnisse richtig oder falsch. Deshalb haben weder der Satz vom Widerspruch noch dessen ontologische Begründung, der Satz der Identität, in der Sphäre der Dichtung Gültigkeit. Die Kunst ist nicht von dieser Welt. Was Dichtung ihrem Wesen nach ist, kann die Wissenschaft nicht sagen, nur die Dichtung selbst:
„Über allen Gipfeln ist Ruh,
in allen Wipfeln spürest du
kaum einen Hauch.
Die Vögel schlafen im Walde,
warte nur, balde
ruhest du auch.“
Das gibt nicht nur die Stimmung am Abend des 7. September 1780 auf dem Kickelhahn bei IImenau wieder, als Goethe dort die Verse auf die Bretterwand der Jagdhütte schrieb, sondern die Abendstimmung überhaupt. Warum? Weil mit dem Gestimmtsein an diesem Tage zugleich auch jenes abendliche Gefühl Sprache wird, das eine Antizipation des Todes darstellt und daher dem Abend der Zeit als solchem gilt. Denn das Factum brutum des Lebens ist der Tod. Die Kunst vermag mithin eine Wirklichkeit darzustellen, die alle Realitäten der Wissenschaft transzendiert. Sie ist das, was sie wahrnehmbar macht, zugleich von dieser Welt und nicht von dieser Welt.
Die Wissenschaft befragt die Welt auf ihre Begründbarkeit hin, die Kunst stellt sie in ihrer Abgründigkeit dar.
Wie steht es mit dem Denken, das weder Dichten noch Wissen ist? Martin Heidegger hat gesagt, das Fragen sei die „Frömmigkeit“ des Denkens. Mit Frömmigkeit hat die Wissenschaft nichts im Sinn, die Wissenschaftsgläubigkeit unserer Zeit ist umgekehrt dogmatische Profaneität. Auch in der Physik ist die Zeit der frommen Denker vorbei, sie reichte von Newton über Einstein bis zu Niels Bohr und Werner Heisenberg. „Die Wissenschaft denkt nicht“, das ist ein oft missverstandener Satz, mit dem Heidegger diesen Sachverhalt formuliert. Dabei ist Frömmigkeit kein theologischer Begriff, ein frommer Mensch muss nicht gläubig sein, jedenfalls nicht im Sinne einer Lehre und der ihr entsprechenden Konfession. Die Frömmigkeit ist eine Welt-Religion, wie die Geschichte der Dichter und Denker von Anbeginn zeigt. Orpheus, die musische Gestalt schlechthin, wurde von den Griechen nicht nur der Sänger, sondern der Theologe genannt. Novalis, der als Denker bis heute unbekannt ist, sagt entsprechend: „Erst dann, wenn der Philosoph als Orpheus erscheint, ordnet sich das Ganze in echte Wissenschaften zusammen“. Darin kommt nicht die Meinung eines romantischen Poeten zum Ausdruck, sondern jene gewaltige geschichtliche Notwendigkeit, durch die zu Beginn der Moderne Dichten und Denken wieder zusammengeführt werden.
Zur gleichen Zeit emanzipiert sich die Wissenschaft von der Dichtung und Philosophie, sofern diese nicht bloß Theorie der Politik oder wissenschaftliche Grundlagenforschung ist. Sie wird positiv, das heißt angewandte Wissenschaft, deren Ziele theoretische Evidenz und praktische Effizienz sind. Das geht auf Kosten der Selbstreflexion. Die Wissenschaft weiß daher weder, wer sie ist, noch, was sie tut. Dabei setzt sie die eigene Evidenz positiv voraus und ihre gewaltige Effizienz negativ ein. Wie die Welt aussieht, die diesen Einsatz zu verkraften hat, zeigt sich im Horizont globaler Ökologie. Georg Picht sagt daher von der Physik: Eine Wissenschaft, die das, was sie erforscht, zerstört, kann nicht wahr sein.
Zerstörung ist die gewaltsame Form der Negation, die Negation selbst das Wesen jener zweiwertigen Logik, die seit Aristoteles die Wissenschaft bestimmt und heute über ihre operationellen Strategien die Wirklichkeit digitalisiert, das heißt durch entsprechende Computerprogramme in alternative Ja-Nein-Disjunktionen auflöst. Die Bemühungen um eine „Nicht-Aristotelische Logik“ mehrwertiger, zeitlicher Aussagen (Gotthard Günther) sind dagegen bescheiden geblieben. Der Grund liegt in dem Satz des Descartes: „Cogito ergo sum.“ Wer sich die theologischen Voraussetzungen dieser Selbst-Ermächtigung der Vernunft klarmacht, weiß, dass es sich nicht um einen evidenten Satz handelt, sondern um eine Behauptung, ein Credo, eine Konfession. Ihr voraus geht jene Gleichung, die eine Generation zuvor Francis Bacon formuliert hat, und die den dogmatischen Grund der Weltzivilisation manifestiert: Wissen = Macht.
Was hat das mit dem Essay zu tun? Zunächst dies, dass sich unabhängig vom Inhalt jeder Essay mitsamt seinem Autor im Spannungsfeld der wirklichen, das heißt der geschichtlichen Welt befindet, die durch die Antagonismen von Poesie – Philosophie – Technologie bestimmt wird. Ihnen entsprechen die drei Tätigkeiten: Dichten – Denken – Wissen. Die entsprechenden griechischen Grundworte lauten: Mythos – Logos – Nomos. Das Dichten verdichtet sich im Gedicht, das Denken formt sich zu Gedanken, die Wissenschaft gründet auf Gesetzen. Für Heraklit präsentierte sich im „Gesetz“ der Natur jene Einheit der Vielfalt in den Erscheinungen, die nicht nur das Wissen, sondern die Welt als solche konstituiert. Im Gegensatz dazu wird in der neuzeitlichen Philosophie aus dem Nomos der Welt die Auto-Nomie der Vernunft. Dabei liegt das Vermögen, sich selbst das Gesetz zu geben, nicht in der Vernunft, sondern im Willen des Subjekts. Nach Kant gründet die Autonomie in der „Beschaffenheit des Willens, dadurch derselbe ihm selbst ein Gesetz ist“. Nietzsche hat Kant präzisiert: Dieser Wille zu sich selbst sei „Wille zur Macht“ – der Wille als Lebens-Macht.
Was durch die Autonomie der Wissenschaft übermächtigt wird, ist die Einheit von Dichten und Denken, in der sich die andere Seite der Einheit von Natur und Geschichte zeigt. Der Name dieser Einheit lautet „Geist“, der von Natur und Geschichte „Welt“. Was beide verbindet, ist die Einheit der Zeit, die der Mensch geschichtlich repräsentiert. Diese in der Differenz der drei Modi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darzustellen, ist seine eigentliche Möglichkeit. Wird sie zur Wirklichkeit, ist der Mensch „Autor“, und die Vermittlung zwischen Natur und Geschichte gelingt. Dabei verwandelt sich die logische in die poetische Vernunft, was Wissenschaft war, wird so zu Kunst.
II.
Was ist ein Essay? Ein Versuch, durch den sich das „Denken während des Schreibens als Prozess, als Experiment entfaltet“. Aber nicht nur die Tätigkeit der Vernunft hat, wie Kant sagt, den Charakter des Entwerfens, auch das Dasein des Menschen ist Experiment, ein Entwurf, der die Gestalt des Prozesses hat. Experimentum Mundi – der dafür geläufige Begriff heißt Evolution.
Die logische Vernunft baut auf die Identität, die das Fundament der Metaphysik ist. Die poetische Vernunft repräsentiert die Geschichte, die zur Zukunft hin offen ist. Die Transzendenz der Metaphysik ist das absolute Sein, die Transzendenz der Geschichte das unendliche Nichts. Der Zusammenbruch der Metaphysik und der Anbruch der Welt-Geschichte sind zwei Seiten ein- und desselben Vorgangs. Von ihm hat schon Nietzsche behauptet, dass seine Kunde noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen sei. Das gilt aber nur von den Wissenschaftlern, nicht von den Künstlern, die das epochale Ereignis schon zu Hamanns und Jean Pauls Zeiten erfahren haben. Mithin ist die logische Vernunft noch der Metaphysik verhaftet und nach rückwärts, die poetische Vernunft dagegen nach vorn orientiert. Sie ist vorläufig, progressiv, jene rückläufig, regressiv. Da die offene Gestalt der Zeit keine subjektive Einbildung, sondern der Horizont der Wirklichkeit selbst ist, erscheint die Welt in der zeitlosen Erkenntnisform der Wissenschaft so, wie sie von sich aus nicht ist. Die logische Vernunft ist, um mit Kant zu reden, „perversa ratio“, eine verkehrte Vernunft. Diese Verkehrtheit zeigt sich in ihren Werken, in der humanökologisch perversen technischwissenschaftlichen Zivilisation.
Novalis hat in seinen Fragmenten gesagt, die „Idee“ der Philosophie müsse ein „Schema der Zukunft“ sein. Historisch gesehen steht er an der Schwelle zwischen Neuzeit und Moderne und erlebt jenen ungeheuren Umbruch mit, der die Metaphysik vom Zeitalter der Welt-Geschichte trennt. Das gleiche hat Novalis aber auch von der Dichtung gefordert: Diese müsse künftig „transzendentale Poesie“ sein. Transzendental sind Dichten und Denken dann, wenn sie in ihren Handlungen stets von der kritischen Frage nach der eigenen Ermöglichung begleitet werden. In den Systemen der Metaphysik bedarf die transzendentale Reflexion des ewigen Seins, im Zeitalter der Welt-Geschichte führt sie dagegen ins unendliche Nichts. Denn das Wesen des von Novalis anvisierten neuen Dichtens und Denkens kreist, so Schelling, um die Frage, was eigentlich „jenseits des Seins“ sei. Es werde die Zeit kommen, heißt es in der „Philosophie der Offenbarung“, wo der Mensch „von allem Wirklichen sich frei zu machen hat, um in eine völlige Wüste des Seins zu fliehen, wo nichts irgendwie Wirkliches, sondern nur noch die unendliche Potenz allen Seins anzutreffen ist“.
Die positive Wissenschaft denkt genau umgekehrt. Ihr geht es nicht um die unendliche Potenz, sondern um die faktische Realität allen Seins. Erst durch die Revolution der Mikrophysik ist die Wissenschaft in jenen von SchelIing erwähnten Bereich vorgedrungen, der im Vergleich zu dem der klassischen Physik als ein unendliches Nichts bloßer Möglichkeiten erscheint. Das wurde in der Dichtung schon über 100 Jahre zuvor antizipiert, weniger dem Inhalt nach als der Form. Auch in der „unendlichen Melodie“ der Romantik spricht sich das neue Lebensgefühl aus. Zugleich wird das Bild als Paradigma der Kunst abgelöst durch die Musik. Dem entspricht, dass nicht mehr das einheitliche System Vorbild des Denkens ist, sondern der offene Prozess. Analog dazu erkennt die poetische Vernunft die Idee der Endgültigkeit des künstlerischen Werks als Trug. Das Fragment wird die Form, die der Erfahrung der Vorläufigkeit entspricht – sowohl im Sinn des Vorauslaufens in die Zukunft wie dem der Fragwürdigkeit allen Seins.
Damit ist klar, dass das unendliche Nichts nicht mit jenem Nichtigen verwechselt werden darf, das im Gefolge von Schopenhauer und Richard Wagner zu einem romantisch-pessimistischen Nihilismus stilisiert worden ist. Vielmehr ist das Nichts das Gegenteil jenes ewigen Seins, das durch Descartes in ein absolutes Bewusstsein verkehrt wurde. Francis Bacons Formel „Wissen = Macht“ bedeutet keine Erkenntnis, sondern ein Postulat, dessen der neuzeitliche Mensch zu seiner Selbstbehauptung bedarf. Dagegen die Erkenntnis des Sokrates: „Ich weiß, dass ich (im Angesicht Gottes) nichts weiß“. Das ist keine nihilistische Weltanschauung, sondern die Einsicht eines Weisen, der dem die Ehre gibt, was „jenseits des Seins“, des Wissens ist, also nicht von dieser Welt.
Was die Unendlichkeit des Nichts für die „transzendentale Poesie“ bedeutet, zeigt der dichtende Denker Nietzsche in seinem Lied „Nach neuen Meeren“:
„Dorthin will ich, und ich traue
mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
treibt mein Genueser Schiff.
Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit.
Nur dein Auge – ungeheuer
blickt mich’s an, Unendlichkeit.“
Die Ungeheuerlichkeit, die im Anblick der Unendlichkeit liegt, treibt auch das transzendentale Denken des Dichters Heinrich von Kleist um. Sein Stück „Über das Marionettentheater“ kann als vollkommener Essay bezeichnet werden, weil sich Dichten und Denken in ihm die Waage halten, der Gedanke also Erzählung geworden ist: „Als ich den Winter 1801 in M … zubrachte“, berichtet der Erzähler, „traf ich daselbst eines Abends, in einem öffentlichen Garten, den Herrn C. an, der seit kurzem, in dieser Stadt, als erster Tänzer der Oper angestellt war und bei dem Publico außerordentliches Glück machte“. Das Gespräch, das sich entwickelt, kreist um die Schönheit, also um die Wahrheit der Kunst, die beim Tanz in der Gestalt der Grazie erscheint. Der Ausgangspunkt ist das Puppentheater sowie der Tanz der Marionetten, der, so die Überzeugung des Fremden, vollkommener sein kann als der menschliche Tanz, da eine Puppe „sich niemals ziert“. Sie hat kein Bewusstsein, es sei denn, das des Künstlers, der sie dirigiert. Anders die Menschen, die mit dem Wissen um sich selbst geschlagen sind, „seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo offen ist“.
Mit „Welt“ ist hier nicht mehr die göttliche Physis von Goethe gemeint, sondern die Welt als Geschichte, als elementarer Prozess innerhalb einer undurchschaubaren Evolution. Das ist der Grund, warum die Zeitgenossen Kleist nicht verstanden und er auch späteren Generationen fremd und von unheimlicher Modernität erschien. Die „Reise um die Welt“ kann der Geist daher nur in der Zeit machen, als Vorlauf in die Zukunft der Geschichte, die alles Endliche transzendiert und von Kleist deshalb „Unendlichkeit“ genannt wird. Für sie bedarf es eines besonderen Mutes, da sich der Geist in eine Sphäre aufmacht, die dem Alltagsverstande, dem Logos, als ein unendliches Nichts erscheint. Kleist erläutert die transzendentale Struktur dieser Reise durch das Bild des Hohlspiegels, das, „nachdem es sich ins Unendliche entfernt hat“, plötzlich wieder dicht vor uns hintritt. So fände sich auch, wenn „die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen sei, die Grazie wieder ein“. Die Wahrheit des Endlichen, deren Erscheinung die Schönheit ist, offenbart sich der Erkenntnis mithin nur im Durchgang durch das Unendliche. Anders als bei den Romantikern verliert sich aber der Geist nicht, sondern gewinnt sich erst im Unendlichen, so dass er verwandelt zurückkehren kann.
Kleists Stück endet mit einem Ausblick auf die Welt-Geschichte, der die eschatologische Dimension der transzendentalen Poesie aufleuchten lässt: „Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müssten wir wiederum von dem Baume der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? – Allerdings, antwortete er; das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt“.
III.
Was ist ein Essay? Eine besondere Form der Literatur, durch die sich das „Denken während des Schreibens als Prozess, als Experiment entfaltet“. Aber Denken und Dichten sind nicht bloß Worte, Begriffe, Kategorien der Wissenschaft, sondern reale Tätigkeiten, elementare Formen des Lebensvollzugs. Deshalb stellt der Essay nicht nur dieses oder jenes belletristische Experiment dar, sondern das Experimentelle des Lebens selbst. Experiment womit? Die Antwort aus Meyers Enzyklopädischem Lexikon lautet: Mit der Wahrheit, genauer: mit der „unabgeschlossenen fragenden Wahrheitssuche“.
Als Lebensvollzug ist das Schreiben aber nicht nur Experiment eines individuellen, sondern auch jenes generellen Lebensprozesses, der Natur und Geschichte umgreift und Evolution heißt. Dem trägt Kleist am Schluss seines Stückes insofern Rechnung, als er den Blick des Lesers von der Bühne des Puppentheaters auf die Bühne der Welt-Geschichte lenkt, deren Horizont die Zeit ist – nicht die abstrakte Zeit der Physik, sondern, wie Kleist sagt, die der „organischen Welt“. In dieser Welt sei es so, dass im selben Maße, in dem „die Reflexion dunkler und schwächer“ werde, „die Grazie immer strahlender und herrschender“ hervortrete.
Die organische, die natürliche Zeit hat mithin nicht die simple Struktur eines linearen Parameters, sondern ist, wie Georg Picht formuliert hat, gleichsam asymmetrisch gebaut: Das, was vergangen ist, ist unaufhebbar; es präsentiert sich so, wie es geworden ist, in seiner Notwendigkeit. Das, was zukünftig ist, liegt noch nicht fest; es zeigt sich im offenen Spielraum der Möglichkeit. Dort, wo Zukunft und Vergangenheit aufeinander treffen, geschieht Wirklichkeit. Diese enthält die Zeitmodi der Zukunft und der Vergangenheit so in sich, dass sie sie in ihrer gegenseitigen Verschränktheit jeweils vergegenwärtigt. Die organische Zeit hat mithin weder eine lineare noch eine kreisförmige, sondern eine zur Zukunft hin offene Gestalt, die in jeder Biographie wiederkehrt. Leben ist zur Zukunft hin ausgerichtet, es ist diese Ausrichtung der Zeit selbst. Begrenzt wird es durch die absolute Zukunft, den Tod, von dem wir weder die Form noch den Zeitpunkt kennen; nur dass er kommt, seine harte Faktizität.
Da der Mensch das einzige Lebewesen ist, das um seinen Tod weiß, hat seine Lebenszeit nicht nur die organische Gestalt der natürlichen, sondern auch die biografische Form der geschichtlichen Welt. Denn sein ganzes Dichten und Denken, sein Handeln und Hoffen, ist untergründig von der Erwartung des Todes bestimmt. Wäre es anders, gäbe es keine abendländische Dichtung und Philosophie. Da nach Kant die eigentliche Tätigkeit der Vernunft das auf Zukunft hin angelegte Entwerfen ist, bedeutet das menschliche Dasein im Ganzen einen Entwurf, der gelingen oder misslingen kann. Weder das eine noch das andere ist festgelegt, vielmehr markieren die Gegensätze den Spielraum der Freiheit, deren Horizont die Verantwortung ist. Im Maße, in dem der Verantwortung entsprochen wird, ist der Mensch „Autor“, er nimmt sich selber als Wissenden wahr. Im Wissen um den Tod liegt der Grund der Freiheit. Darin sind Dichten und Denken eins, nicht nur abstrakt, sondern konkret - wenn, so Novalis, „der Philosoph als Orpheus erscheint“.
Was für die Geschichte des Einzelnen gilt, gilt auch für die Geschichte der Welt. Gleicht der Autor dem Bindestrich zwischen Dichten und Denken, so der Mensch dem zwischen Natur und Geschichte – nicht nur im Sinne einer Metapher, sondern des wirklichen, geschichtlichen Vorgangs. Das Experimentum Mundi ist die Biografie von Mensch und Natur, ein Versuch, der sich in jedem Lebensvollzug wiederholt. Der Möglichkeit nach sollte daher jeder Essay das Experimentum Mundi in nuce repräsentieren und wie diese Skizze ein Essay über den Essay sein, ein Versuch mit dem Versuch, das Experimentum Mundi en miniature.
Experiment womit? Mit der Wahrheit der Weltgeschichte, die nach Kleist nur im Durchgang durch die Unendlichkeit zu gewinnen ist. In einem Entwurf zum „Zarathustra“ schreibt Nietzsche: „Wir machen einen Versuch mit der Wahrheit! Vielleicht geht die Menschheit daran zugrunde! Wohlan!“ Heute ist jedem klar, was es bedeutet, wenn das geschichtliche Experiment mit der Wahrheit zu scheitern und den Menschen mitsamt seiner Welt in den Abgrund zu reißen droht. Zugleich ist deutlich, dass die Wahrheit keine Frage der Theorie noch der politischen Praxis ist, sondern der geschichtlichen Tat, die die beiden anderen Formen umgreift. Da der Mensch nie zuvor über die Macht verfügt hat, das Experimentum Mundi scheitern zu lassen, ist der transzendentale „Ort“, an den sich die Vernunft versetzen muss, um Wahrheit zu erkennen, nicht mehr die Ewigkeit, sondern die Zukunft. Diese ist auch die Instanz jeglicher Verantwortung. Nietzsches „Wohlan!“ stellt daher keinen Ausdruck von Leichtfertigkeit dar, sondern will angesichts des drohenden Scheiterns Mut machen, den Versuch mit der Wahrheit wieder neu zu wagen. Wer diesen Versuch wagt, der ist der Versuch. Er vollzieht in seiner Existenz die Biografie von Mensch und Natur nach, die so „essayistischen“ Charakter erhält: Sie ist ein Versuch mit dem Versuch. „Die Nützlichkeit des Lebens liegt nicht in seiner Länge, sondern in seiner Anwendung“, sagt Montaigne, der als Vater des modernen Essays gilt; sie liegt in der Wahrheit der Tat. „Wir ma chen (sonst) nichts als Anmerkungen über einander, alles wimmelt von Kommentaren. An Originalautoren ist großer Mangel“.
Original-Autor ist der Mensch dann, wenn er seinen Lebensversuch mit der Wahrheit so ins Experimentum Mundi einbringt, dass er durch die Tat wird, was er immer schon ist: der Bindestrich zwischen Natur und Geschichte, sich selbst und der Welt ein offenes Experiment. Dann sind Dichten und Denken getrennt und verbunden, der Essay des Lebens ist die Biografie. Im Original-Autor schreibt sich das Leben selber fort, es wird durch ihn, was es ist: Auto-Biografie.
(1992)
Fenster sein, nicht Spiegel
Entwurf einer poietischen Vernunft
I.
„Fenster sein, nicht Spiegel“, so der Haupttitel – ein Zitat; „Zu Paula Modersohns Rilke- Portrait“ der Untertitel – ein Kommentar. Er weist darauf hin, dass über ein Bild gesprochen werden soll, obwohl die einzig sachgemäße Form, mit einem Bild zu kommunizieren, nicht das Reden, sondern das Hinblicken ist. Ich habe daher meine Überlegungen in fünf verschiedene Blickweisen unterteilt:
Einblick in die historische Konstellation
Durchblick auf das Thema
Überblick über die Geschichte der poietischen Vernunft
Anblick von Paula Modersohn-Beckers Portrait
Ausblick auf uns, hier und jetzt.
Jeder glaubt zu wissen, was ein Fenster ist, ein Spiegel, ein Bild, erst recht, was mit Worten wie Mitteilung und Kommunikation gemeint ist. Doch der zweite Teil des Untertitels deutet an, dass sich im Horizont einer poietischen Vernunft die Bedeutungen verändern, und wir Entdeckungen machen, die uns zuvor verschlossen waren. Freilich lässt sich nur entdecken, was vorhanden ist. So hat Martin Heidegger die Aletheia, die Wahrheit des Seins, wieder entdeckt, deren Struktur das Entbergen und Verbergen ist. Sie war, wie Heidegger sagt, seit Platon vergessen. Er hat sie nicht erfunden, sondern wieder gefunden, was durch die Geschichte von Metaphysik und Wissenschaft unserem Blick verstellt war.
Auch die poietische Vernunft ist wieder entdeckt worden, nicht von Heidegger, sondern von Georg Picht. Sie taucht zuerst fragmentarisch bei Aristoteles auf, ist dann 2000 Jahre lang wie verschollen, um schließlich bei Kant und Nietzsche wieder aufzutauchen. Schon der Name sagt, dass sie Dichten und Denken vereint. Daher wird sie neben den genannten Denkern auch von Dichtern wie Hölderlin, Novalis und Rilke wieder entdeckt.
Wer über Blickweisen spricht, muss den eigenen Blickwinkel angeben, die Bedingung seiner Möglichkeit, wie die Philosophen sagen. Aber ich bin weder Philosoph noch Denker, auch kein Dichter, wie es die Ankündigung meines Vortrags verheißt. Zum wenigsten kann ich mich als Rilke- oder Paula Modersohn-Spezialist bezeichnen – ich bin Autor und als solcher ein Liebhaber sowohl von Paulas wie Rilkes Kunst. Im Hintergrund meiner Überlegungen steht die von Hölderlin aufgeworfene und in Heideggers Rilke-Analyse aus dem Jahre 1946 radikalisierte Frage: „Wozu Dichter in dürftiger Zeit?“1 Die immer noch weiter wachsende Dürftigkeit unserer Zeit verweist uns mithin in die Geschichte, in der wir uns nicht nur auszukennen, sondern die wir als eigene Geschichte zu leisten haben. Aus diesem Grund werden im folgenden drei konkrete Daten von mir genannt. Das erste lautet:
Paris, Hôtel Biron, den 31. Oktober 1908, nachts:
„Ich habe Tote, und ich ließ sie hin
und war erstaunt, sie so getrost zu sehn,
so rasch zuhaus im Totsein,
so gerecht, so anders als ihr Ruf … “
Das ist der Beginn von Rilkes längstem Gedicht, das er in dieser Nacht begonnen und an den beiden folgenden Tagen vollendet hat. „Nur du“, heißt es weiter, „kehrst zurück; du streifst mich, du gehst um, du willst an etwas stoßen, dass es klingt von dir … “
Wer ist das Du? Der Titel nennt es nicht, er lautet: „Requiem für eine Freundin“. Requiem – ruhe sanft in Frieden? Im Gegenteil: In keinem Gedicht Rilkes ist die Unruhe, ja Bestürzung „bis ins Gebein“ so deutlich wie in dieser Elegie, diesem Klagelied über den Tod einer Freundin. Irgendeiner Freundin? Nein, dem von Paula Modersohn-Becker, der Freundin schlechthin, die ein knappes Jahr zuvor, am 20. November 1907, drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Mathilde, mit 31 Jahren an einer Embolie in Worpswede gestorben war. „Sie ist die einzige Tote, die mich beschwert“, gesteht Rilke der Frau seines Verlegers Kippenberg2 ein – worin liegt der Grund? In jener schwerwiegenden Tatsache, dass, wie das Requiem sagt, „eine alte Feindschaft“ aufgerichtet ist zwischen dem Leben und der „großen Arbeit“, dem künstlerischen Werk. Ihr ist die Freundin zum Opfer gefallen, nicht wissentlich, doch willentlich. Denn aus der Einsamkeit ihrer großen Arbeit in Paris, in der sich Rilke mit ihr verbunden wusste, kehrte sie nach Worpswede zurück zu ihrem Mann Otto Modersohn, den sie ein Jahr zuvor verlassen hatte. Warum? Nicht aus Liebe, wie sich der Dichter sicher ist, denn „Lieben heißt allein sein“, schreibt er, und „Künstler ahnen manchmal, dass sie verwandeln müssen, wo sie lieben“.
Rilke fühlt sich nun alleingelassen, nicht von irgend jemandem, sondern von der Freundin schlechthin, die „mehr verwandelt hat als irgend eine Frau“. Deshalb schließt die Elegie mit dem Ruf: „So hör mich: Hilf mir“.
Worin könnte die Tote ihm, dem Lebenden, helfen? Darin, dass sie ihm als Beispiel dient, als ein Vor-Bild, auf dass nicht auch er, wie er sagt, aus dem Fortschritt seiner Arbeit weggleiten möge in den Traum eines Daseins, „drin wir sterben, ohne zu erwachen“. Die Bitte wird in den letzten beiden Zeilen wiederholt: „Doch hilf mir so …, wie mir das Fernste manchmal hilft: in mir“.
Das Fernste – kein Begriff, kein Bild, ein Wort, ein Zeichen, das in eine Richtung weist. Wohin? Aus der Welt hinaus, in sie hinein? Beides, sowohl als auch. Denn wer wollte leugnen, dass der Tod uns das Nächste und Fernste zugleich ist? Ist er uns ein Spiegel, schrekken wir vor ihm zurück, da wir so nichts als unsere Totenmaske zu Gesicht bekommen. Gleicht er einem Fenster, blicken wir durch ihn hindurch in jenen Horizont der Zukunft, den wir mit Hoffnung bezeichnen. Diese richtet sich darauf, dass das Leben im Tode nicht verenden, sondern sich vollenden möge, da es anders nicht bestanden werden kann. Denn eine Welt ohne Hoffnung ist die Hölle, wie Dante in der „Göttlichen Komödie“ sagt.
Nicht nur im frühen Text des Cornets Christoph Rilke, sondern auch in allem, was der Dichter Rainer Maria Rilke sonst geschrieben hat, sind Leben, Dichten und Denken eine einzige „Weise von Liebe und Tod“. Vollendet wird diese Weise im Spätwerk der „Sonette an Orpheus“, und einzig ist sie deshalb, weil sie in den „reinen Bezug“ ihrer „innigen Schwingung“ zurück steigt, wie es im 13. Sonett des II. Teils heißt.
„Sei – und wisse zugleich des Nicht-Seins Bedingung,
den unendlichen Grund deiner innigen Schwingung,
dass du sie völlig vollziehst dieses einzige Mal“.
Sei und wisse, Wissen und Sein – Rilke wandelt den berühmten Satz der Identität, der bis heute das Fundament unseres Denkens bildet, ab. Bei Parmenides lautet er: Dasselbe ist, Denken sowohl wie Sein. Bei Rilke heißt er in die Prosa des Denkens übersetzt: Denken und Sein gründen nicht in der Selbigkeit einer Identität, sondern in jenem unendlichen Grund des Nicht-Seins, welcher die Bedingung jeder einzelnen innigen Schwingung unseres Daseins ist und dieses so einzigartig macht. In eine Formel gepresst heißt das: Das Nicht-Sein ist die Bedingung von Wissen und Sein oder kürzer noch: Das Nichts ist die Bedingung des Seins.
Das ist der Grundgedanke, den sieben Jahre später Martin Heidegger in seiner berühmt gewordenen Freiburger Antrittsvorlesung
„Was ist Metaphysik“? ausgeführt hat.3 Der Hinweis soll nicht gelehrte Parallelen aufzeigen oder nachweisen, wie hier, historisch gerechnet, das Denken dem Dichten folgt, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass Heideggers Rilke-Interpretation von 1946 unter dem Titel „Wozu Dichter?“ nicht vom Himmel der Metaphysik gefallen, sondern aus jener geschichtlichen Frage erwachsen ist, die bereits Schelling in seiner Philosophie der Offenbarung gestellt hat: „Irgendeinmal, um mich so auszudrücken“, heißt es da, „an irgendeinem Punkte seiner Entwicklung, wird der menschliche Geist das Bedürfnis empfinden, gleichsam hinter das Sein zu kommen … zu sehen nicht was über, denn dies ist ein ganz anderer Begriff, aber was jenseits des Seins ist.4 In Nietzsches Umsturz der Metaphysik ist er erreicht und zeigt sich nun vor allem in der Kunst: in der Dichtung Mallarmés, in der Malerei van Goghs und der Musik Arnold Schönbergs. In dessen zweiter Kammersinfonie von 1906 bricht der zweieinhalb Jahrtausende alte tonale Kosmos zusammen. Die moderne Musik wird atonal, entsprechend ungegenständlich die Malerei, die bildende Kunst.
Die wissenschaftliche Revolution, die sich zugleich mit Darwin, Freud, Planck und Einstein vollzieht, kann nur angemerkt werden. Das epochemachende Werk, in dem sich der gesamte Umwand-lungsprozess philosophisch zusammenfasst, ist Martin Heideggers Buch „Sein und Zeit“, das kurz nach Rilkes Tod im Frühjahr 1927 erschien. Auf die von Schelling aufgeworfene Frage, was denn jenseits des Seins sei, antwortet Heidegger so, dass er sie noch radikaler fasst. „Sein und Zeit“ endet daher seinerseits mit einer Frage: „Offenbart sich die Zeit selbst als Horizont des Seins“?5 Wenn ja, dann geriete nun sie, die Zeit, als die Wahrheit des Seins in den Blick. Sie wird von Heidegger später als die sich entbergende und verbergende Lichtung des Seins interpretiert und von Georg Picht in der Formel zusammengefasst: „Die Zeit ist selbst das Sein“. Auch Pichts Denkweg, der dem Wesen der Zeit gilt, durchläuft Jahrzehnte. Das Werk, das ihn beschließt, erschien im Herbst 1999 als elfter Band der „Vorlesungen und Schriften“. Der Titel lautet: „Von der Zeit“.6
II.
„Gesang, wie du ihn lehrst“, so die Anrede an Orpheus im 3. Sonett des I. Teils, „ist nicht Begehr, nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes; Gesang ist Dasein“.
Damit stellt sich im zweiten Abschnitt die Frage nach dem Durchblick auf das Thema: Wie soll der Gesang als Dasein für den Sterblichen möglich sein? Selbst wenn er gelänge, wäre er doch nur ein Vor-Gesang, wie das 19. Sonett sagt. Warum? Weil so weder die Notwendigkeit, mit der Leben und Leiden zusammengehören, zu erkennen ist, noch auch gelernt werden kann, was Liebe heißt. Am wenigsten aber ist klar, „was im Tod uns entfernt“, denn vor ihm sind wir ständig auf der Flucht.
Leben und Leiden, Liebe und Tod – Rilke hat der entscheidenden Frage nach dem eigentlichen Tod, dem durch Selbstverfehlung, einen späten Text gewidmet, der den Titel „Testament“ trägt. Er hat die Dichte der Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge und ist im April 1921 verfasst worden. Rilke bezeichnet die Frage dort als den einzigen Konflikt seines Lebens, alles andere seien bloß „Aufgaben“. Die Angst, sein Dasein als Gesang zu verfehlen, begleitet ihn zu dieser Zeit bereits vierzehn Jahre. Erst ein knappes Jahr später, im Februar 1922 auf Muzot, erfolgt die Vollendung der Elegien und entstehen zugleich die Sonette an Orpheus, in denen der Gesang als Dasein endlich gelingt.
Heidegger hat die Elegien und Sonette als das eigentlich „gültige Gedicht“ bezeichnet,7 doch erblicken wir so nur das Ziel, nicht den Weg, den Rilke auf der Wanderung durchs „Reich der Neige“ zurücklegt. Dieser beginnt mit dem Tode Paula Modersohn-Beckers und wird neben den Briefen im Requiem deutlich. Zur gleichen Zeit beschäftigt Rilke der Malte, der als der erste „moderne Roman“ in deutscher Sprache charakterisiert worden ist.8 Nach den Korrekturen im Frühjahr 1910 bei Kippenberg in Leipzig weilt Rilke im Spätsommer bei Sidonie Nádherný in Böhmen auf Schloss Jano-witz. Ihm ist klar, dass sich sein gesamtes Dichten und Denken von Grund auf wandeln muss, wenn er als Dichter nicht verstummen soll. Aber wie?
„So hör mich: Hilf mir“
Doch die Beschwörung der toten Freundin gelingt nicht mehr. War sie nicht die eigentliche Verkörperung der Hoffnung und alles an ihr erwartende Zukünftigkeit? Und doch, in jenen Wochen weichen die Schatten der Angst zum ersten Mal, wie ein Gedichtfragment bezeugt:
„Wo sind die Forderungen, die dich schreckten?
Dein Herz versammelt sich im Unentdeckten
Und in der Zukunft liegt das Lied“.9
Auch über die Freundin kehrt sich das Urteil um. Es ist, als habe sich der Blick um 180 Grad gedreht – eine Umkehr der Seele, wie sie Platon im Höhlengleichnis geschildert hat, doch nicht in der Dimension des Raumes, der Welthöhle, sondern der Zeit: Abkehr von der Vergangenheit, Hinkehr zur Zukunft. Als die erste schmale Ausgabe der Lebenszeugnisse Paulas erscheint, schickt Rilke am Ostermontag, den 24. März 1913, an den Bruder Kurt einen Brief, der im Ton und Sprachduktus in Rilkes gesamtem Brief-Opus nicht seinesgleichen hat.10