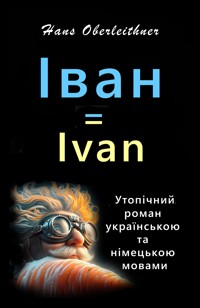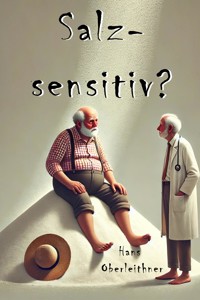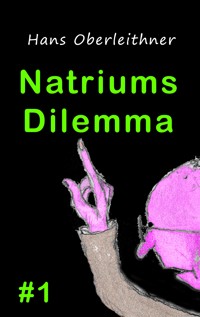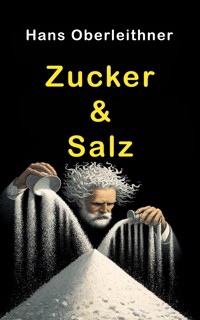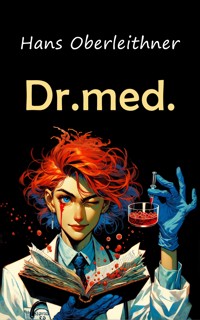0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Science meets Fiction
- Sprache: Deutsch
Jan, Spross des verblichenen Exzentrikers Professor Wunderlich, entdeckt im Blut von Molchen einen Stoff, der grenzenlose Empathie erzeugt. Gegengift und Empathietöter ist weißes Gold. Die Entdeckung gelangt ungewollt an die Öffentlichkeit und wird von den Mächtigen der Welt zur Manipulation der Menschen missbraucht. Jan und sein Forschungsteam werden zunehmend Opfer ihrer eigenen Forschung. Doch eines Tages endet dieser Alptraum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Oberleithner
Molchsblut
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Um das Jahr 2033
Molche
Salzberg
Salzlos
Schlieren
Selbstversuch
Empathie
Ernte
Nachts
Danach
Schaben
Ausbruch
Würmer
Grunzen
Rekonstruktion
Ego-Trip
Rückblende
Fliegen
Flackerlicht
Regenwald
Termiten
Später
Future
Flake News
Fake News
Jagd
Entdeckung
Nymphen
Wandlung
Salzkur
Sofa
Spuren
Kakerlos
Erwachen
Viele Jahre später
Exil
Molchsgold
Übrigens
Erlösung
Impressum neobooks
Um das Jahr 2033
Jan Wunderlich, aufstrebender Jungforscher aus Europa, sitzt im Bauch einer Boeing 797. Durch das Bullauge blickt er hinab auf die Eiswüste des Nordatlantiks und denkt an seinen Vater, Professor Wunderlich, der inmitten seines obsessiven Forscherlebens vor langer Zeit in diesen Fluten zu Tode kam. Stunden später rast Jan in einem silbergrauen Van über den Highway 95 North seinem Ziel entgegen, dem berühmten Think-Tank an der amerikanischen Ostküste.
Molche
Jan findet Forschung mittlerweile öde. Schon seit mehreren Jahren, tagein tagaus, forscht Jan an Nieren, genauer gesagt an Molchnieren. Morgens angelt er sich einen Aalmolch aus dem Wassertank, tötet ihn, schneidet eine Niere heraus und legt sie unters Mikroskop. Hin und wieder macht er Notizen in seinem Laborbuch, Halbsätze wie Filter zu oder Kanäle offenoder Urinfluss mager - und das war‘s dann.
So richtig weiß er gar nicht mehr wonach er forscht. Spätestens um 11 Uhr vormittags befällt ihn heftige Müdigkeit, die er erst wieder mittags abschüttelt wenn er in den Tuna-Sandwich beißt, den er täglich in der Kantine vertilgt. Danach verschwindet er wieder für ein paar Stunden in seiner engen Forschungskoje, stochert mit Nadeln in den Nieren herum, bis nur mehr ein elendes Häuflein Fleisch vor ihm liegt, das er dann gegen 17 Uhr in den Abfalleimer kippt.
Eigentlich wollte er nie an diesen urinösen Organen forschen. Irgendwie ist er da hineingeschlittert. Jetzt ist er drin und mittlerweile zu energielos, um sich daraus wieder zu befreien. Mit großen Erwartungen ist er damals zum Think-Tank gereist und hat in emotionalem Überschwang alles akzeptiert was man von ihm verlangt hat. Erst spät, zu spät hat er gemerkt, dass ihm das wohl langweiligste Forschungsobjekt, die Niere des Schwanzlurchs, zugeteilt worden war. Aber da war sein anfängliches Feuer schon längst erloschen. Inzwischen hat er realisiert, dass es auch recht bequem sein kann, ohne Ziel zu forschen. Es gibt dann keinen Anfang und kein Ende, in Besprechungen verhält man sich still, nickt hie und da zustimmend und, um seine Existenz nicht zu gefährden, liefert man von Zeit zu Zeit einen Datensalat ab, der dann, wohl wegen seiner Irrelevanz, in irgendwelchen Schubladen verschimmelt. Jan erinnert sich noch gut wie er damals im Think-Tank ankam und von der Obersten Leitung sein Forschungsthema bekam. Es war mit einer Unschärfe formuliert, die für die vermeintliche Exzellenz und weltweite Reputation des Think-Tanks typisch ist.
Tötet Natrium Molche?
Dieses Thema hat man ihm zugeworfen wie einen Happen Fleisch, ihn in eine Forschungskoje gesteckt und dann allein gelassen. Dass die Oberste Leitung just dieses Thema für ihn ausgewählt hatte, kam nicht von ungefähr. Obwohl die Gebeine seines Vaters schon dreißig Jahre lang irgendwo in der Tiefe des Atlantiks schlummerten, war Professor Wunderlichs obskure Forschung um das Wesen Natrium immer noch präsent, zumindest in den Köpfen älterer Forscher. Salz bzw. sein Hauptprotagonist Natrium wurde zum dubiosen Markenzeichen der Wunderlichs, ein unsichtbares Brandmal auf der Stirn dieser geburtsschwachen Dynastie, deren einziger Nachkomme Jan war und der nun auszulöffeln hatte, was ihm vor langer Zeit sein Natriumbesessener Vater eingebrockt hatte. Gezwungenermaßen musste er die Nieren dieser Tiere erforschen, weil angeblich dort die Wurzel allen Übels – der Natriumschaden – zu suchen war. Diesen Hinweis hatte man ihm noch auf den Weg ins Ungewisse mitgegeben. Und auf diesem Weg wandelt er immer noch, müde und ziellos. Doch eines Tages geschieht etwas, das Jan aus seiner Lethargie holt.
Jan verbringt viel Zeit damit, seine Molche durch die Glasscheibe des Aquariums zu beobachten bevor er sich ein Tier herausholt und daran arbeitet. Im Laufe der Zeit hat er sich zwei Wassertanks eingerichtet, einen mit Süßwasser und einen zweiten, gleich daneben, mit Salzwasser. Die Molche im Süßwasser nennt er salopp Süßmolche, die im Salzwasser Salzmolche.
So sitzt er morgens sicherlich eine halbe Stunde vor den beiden Wassertanks und verfolgt gelangweilt das lautlose Molchleben hinter der Glaswand, während er an seinem Pappbecher mit American Coffee nippt. Von Zeit zu Zeit wirft er ein paar Bröckchen gefrorener Hühnerleber ins Wasser und sieht dabei den Tieren beim Fressen zu.
Er weiß, dass diese Aalmolche in der Wildnis mehr oder weniger im Brackwasser leben und hat sich deshalb diese beiden Extreme – Süß- und Salzwasser – ausgesucht, um gewissermaßen Grenzsituationen auszutesten. Und so blickt er, Jan der Kurzsichtige, aus wenigen Zentimetern Entfernung in die lidlosen Augen der Molche und versucht, wohl eher aus Zeitvertreib als aus wissenschaftlichem Interesse, aus diesen Augen etwas herauszulesen. Es sind stille Momente, in denen sich Jans Blick mit einem der Molche kreuzt und so etwas wie eine stumme Botschaft ausgetauscht wird.
Jan hat darin bereits eine ziemliche Fertigkeit erreicht, sodass er meint, durch eine neue Art von Blickdiagnostik ihre momentane Befindlichkeit erkennen zu können.
Ja, er macht sogar kurze Notizen in sein Laborbuch:
Molch blickt hungrig
Molch blickt traurig
Molch blickt satt
Im Laufe der Zeit werden seine Eintragungen zunehmend farbiger:
Molch blickt flehend
Molch blickt arrogant
Molch blickt frech
Nach einiger Zeit fällt ihm auf, dass Salzmolche generell kalt blicken. Anders als die Süßmolche. Sie, so erscheint es ihm, blicken warm. Belustigt trägt in sein Laborbuch ein:
Salzmolche blicken kalt
Süßmolche blicken warm
Anfangs meint er, das sei pure Einbildung und seine Wahrnehmung abhängig von seiner persönlichen Tagesverfassung. Aber je häufiger er in die beiden Aquarien blickt, umso mehr ist er überzeugt, dass es so ist: Der Salzmolchblick ist kalt, der Süßmolchblick ist warm. Zudem bemerkt er, dass sich die Salzmolche voneinander fernhalten, während die Süßmolche kuscheln.
Und da, in dieser Abgeschiedenheit, fern jeglicher äußerer Einflüsse taucht in Jans Kopf plötzlich wie aus dem Nichts ein Gedanke auf, der ihn nicht mehr los lässt,
… Salz zerstört Empathie.
Stimme aus dem Off
Oberflächlich betrachtet ist Jans Gedanke nicht nachvollziehbar, er ist unglaubwürdig und skurril. Von den Augen eines Molchs Empathie abzulesen erscheint ‚krank‘. Jan allerdings ist nicht krank sondern durch Erlebnisse geprägt, die ihn zu dieser Schnelldiagnose geführt haben. Es sind Erlebnisse seiner frühen Kindheit, deren er sich nicht mehr bewusst ist. Sie schlummern in ihm und steuern seine Gedanken ohne, dass er es merkt. Er wundert sich manchmal, dass er urplötzlich klar sehen kann und sich in ihm ein Urteil bildet, welches er oft selbst nicht begründen kann. Seine Diagnose ‚Salz zerstört Empathie‘ basiert wohl auf einem Erlebnis als Jan fünf Jahre alt war.
Salzberg
Wochenlang hatte sein Vater schon davon gesprochen. Er werde Onkel Theos langersehnten Wunsch erfüllen und mit ihm ein Salzbergwerk besuchen. Ein unterirdischer Berg, in dem es ein Labyrinth von Tunnels gäbe, die durch Rutschen miteinander verbunden seien. Und wenn man ganz unten sei im Stollen, dessen enge Wände aus Salz bestünden, die im Licht der am Kopf montierten Grubenlampen rosa schimmerten, werde man nach einem langen Marsch durch dunkle Gänge an einen Salzsee gelangen. Der sei schwarz und das einzige wahrnehmbare Geräusch werde das von der unsichtbaren Salzdecke tropfende Wasser sein. Dort würden sie eine Weile innehalten, von feuchtheißer Luft umgeben und sich dann auf den Rückweg machen. Die Erdoberfläche würden sie erst am Abend erreichen und deshalb eine Nacht in einem kleinen Gasthof nahe dem Stolleneingang verbringen. Diese Nächtigung sei notwendig, hat sein Vater Jan erklärt, weil der Abstieg in das Innere des Salzbergs und besonders danach der Aufstieg über tausende Stufen sehr anstrengend sei, zumal die salzige heiße Luft im Stollen das Atmen schwer mache.
Wochenlang hat Jan diese Geschichte immer wieder hören wollen, meistens abends vor dem Einschlafen und den Vater so lange gebettelt bis er klein beigab. Immer wieder muss er die Geschichte erzählen und jedes Mal wenn er mit seiner Erzählung beim schwarzen Salzsee angelangt ist, verstummt er für ein paar Sekunden und drückt Jans Ärmchen. Und immer wenn er mit gedämpfter Stimme schildert, wie die großen Wassertropfen von der unsichtbaren Salzdecke in den schwarzen See platschen, kneift er ihn ganz leicht in seine Lenden, während Jan sich fröhlich-fröstelnd an seinen Körper schmiegt. Wenn Jans Augenlider schwer werden und er, eingehüllt in seine Daunendecke, allmählich in den Schlaf versinkt, folgen Träume, die oft damit abrupt enden, dass er sich kerzengerade in seinem Bett aufrichtet und das gegenüberliegende vertraute Fensterkreuz so lange ansieht, bis er die Gewissheit hat, wo er ist, in seinem Zimmer, seinem Bett, zusammen mit seinem Teddybär. Dann kriecht er wieder unter die Decke, den Teddy eng an sich gedrückt und schläft ein. Das wiederholt sich mehrmals in der Nacht und erst wenn das Morgenlicht durchs Fenster eindringt, findet er seine innere Ruhe.
Dann schließlich kommt der Tag, an dem der Vater abfährt. Onkel Theo, der von weit her anreist, würde er direkt vor dem Stolleneingang des Salzbergs treffen. Jan bleibt zurück bei seinem Kindermädchen Frieda und seiner Mutter. Letztere ist für Jan wenig sichtbar, eine Poetin, die oft wochenlang in der Abgeschiedenheit ihres Dachstübchens an einzelnen Wörtern feilt und für Jan nicht mehr als eine eher zufällige Mitbewohnerin seines kindlichen Universums darstellt. Mit Frieda verhält es sich kaum anders. Zwar ist ihr magerer Körper zumindest tagsüber stets in Jans Hörweite, doch ihr Geist irrt in kinderfernen Sphären herum, auf der rastlosen Suche nach einem Leben außerhalb dieser vier Wände. Jan verbringt die Nacht, in der sein Vater fort ist, mehr oder weniger sitzend in seinem Bett. Immer wieder erscheint ihm das Bild seines Vaters, wie er durch die unterirdischen Gänge des Bergwerks irrlichtert, hört wie das Salz von der Decke rieselt, und ihn und Onkel Theo mit einer klebrigen Kruste überzieht.
Am darauffolgenden Tag richtet sich Jan ein Plätzchen am Fenster seines Kinderzimmers ein, so, dass er die Straße unter sich sehen kann, auf der sein Vater zurückkommen sollte. Und schließlich kommt er. Sein erster Blick gilt aber nicht seinem Fenster und seine ersten Worte sind nicht an ihn gerichtet. Durch die Tür hört er ihn mit gedämpfter Stimme ins Telefon sprechen und danach verschwindet er in seinem Zimmer ohne nach ihm zu suchen. Am Abend taucht er wieder auf, setzt sich ihm gegenüber an den Tisch in der kleinen Wohnküche und berichtet ihm seine Erlebnisse im Bergwerk. Die Geschichten gleichen den Erzählungen, die er schon kennt. Nur die Wärme fehlt auf einmal, die Hingabe, die nötig wäre, um die ausgestandenen Ängste des fünfjährigen Jan zu zerstreuen. Jan erfährt nie, dass Onkel Theo bloß ein Phantom war und der Ausflug mit ihm im Salzbergwerk eine Erfindung, um ein Stelldichein mit einer Unbekannten zu verschleiern. Jan aber verbindet in seiner kindlichen Vorstellung den plötzlich auftretenden Verlust von Zuwendung, die kühlen Blicke seines Vaters, die während seines Berichts ruhelos im Zimmer umherwandern, mit dem Salz, das auf sie heruntergerieselt ist, ja er empfindet Salz als einen Dämon, der in einem Berg lebt und seinem Vater das Wichtigste geraubt hat, die väterliche Wärme.
Salzlos
Jan lümmelt am Küchentisch seines Apartments und entwirft den Speiseplan. Kein Essen mehr in der Kantine, keine Pizza, kein Schinken, kein Käse, kein Brot. Statt dessen Haferflocken, Nüsse, Obst, Frischfleisch, Gemüse – alles weitgehend Natrium-frei. Zum Glück, denkt er, ist er Single, er kann rücksichtslos vorgehen, braucht nur an sich zu denken, niemand kommt ihm in die Quere.
Sein Umfeld respektiert seine No-Salt-Marotte. Ist er bei Freunden eingeladen, wird salzfrei gekocht. Der Salzstreuer zirkuliert dann möglichst unauffällig an ihm vorbei wie ein obszöner Fetisch. Im Restaurant geht Jan in die Küche und bittet den Koch, sein Gericht salzfrei zuzubereiten. Um dieser Bitte Nachdruck zu verleihen, schildert er drastisch die akute Atemnot, die ihn befallen würde, wenn sich auch nur ein Körnchen Salz in seinem Gericht befände. Er fasst sich dabei an die Kehle und sperrt den Mund weit auf, einem Molchmaul verblüffend ähnlich. Irritiert geht dann der Koch ans Werk und bereitet murrend das salzlose Mahl.
Nach Restaurantbesuchen schwitzt Jan reuevoll in der Sauna oder quält sich am Laufband, um das versteckte Restaurantsalz, die verborgenen Salzkrümel, die allerletzten Natriumatome möglichst auch noch loszuwerden. Glücksmomente hat Jan, wenn er sein durchgeschwitztes T-Shirt auf die Wäscheleine hängt oder die weißen Flecken sieht, welche die Salzkristalle auf seinen dunkelblauen Shorts hinterlassen. In dieser salzlosen Phase ist Jan ungewöhnlich emsig. Er sitzt nächtelang am Computer und stöbert im Netz, sucht geradezu gehetzt nach Methoden, wie er seine eigene Empathie messen kann. Schließlich entscheidet er sich für einen Test, welcher von einem internationalen Konsortium anerkannter Psychologen entwickelt worden war. Der Test besteht aus zehn Fragen. Das empathische Empfinden steigt mit der Zahl. Je höher die Zahl desto stärker die Empathie.
Habe ich den Mitmenschen in die Augen geblickt?
Habe ich darin ihre Befindlichkeit zu erkennen gesucht?
Habe ich das Bedürfnis empfunden, ihre Sorgen mit ihnen zu teilen?
Haben mich ihre Sorgen in Träumen heimgesucht?
Beschäftigt mich ihr Schicksal mehr als mein eigenes?
Werde ich mutlos, wenn sie mutlos sind?
Werde ich depressiv, wenn sie depressiv sind?
Habe ich das Bedürfnis, genauso wie sie zu handeln?
Habe ich diesem Bedürfnis bereits einmal nachgegeben?
Ist ihr Schicksal mein Schicksal?
Diese Fragen stellt er sich täglich und protokolliert die Antworten in seinem Laborbuch.
Schlieren
Jans natriumfreies Leben hält ihn keineswegs vom Experimentieren ab. Im Gegenteil. Er findet es spannend und fair, an Molchen wie auch an sich selbst zu experimentieren wenngleich sein Schicksal weniger dramatisch ist als jenes der Tiere.
So liegt ein kopfloser Molch rücklings vor ihm auf einer Korkplatte, die Bauchhöhle ist geöffnet, in der Tiefe glänzen die Nieren. Das Herz schlägt noch. Den Rumpf hat er mit einem Faden abgeschnürt, sodass das Blut durch den kopflosen Rest des Molchkörpers strömt.
Im Mikroskop beobachtet er das Leben in den Tiefen des offenen Rumpfes. Durch ein weit verzweigtes Aderwerk, dem Straßennetz einer Großstadt ähnlich, strömt Blut, zäh und pulsierend, im Rhythmus des Herzens. Da bemerkt er, wie schmutzig gelbe Schlieren durch die Blutbahn wabern und plötzlich spurlos verschwinden. Jans Blick wandert zurück zum Ursprung dieser Schlieren. Er entdeckt gelbliche Flecken an den oberen Polen der Nieren, die gerade wegschmelzen wie kalbende Gletscher. Bei genauerem Hinsehen erkennt er, dass die mäandernden Schlieren aus Tausenden winziger Partikel bestehen, die schließlich zwischen den Kanälchen der Nieren verschwinden.
Jan ist verblüfft, seine Miene versteinert. Der Kopf des dekapitierten Molchs steckt noch in einem kleinen Leinensäckchen, dem Fangsack direkt unter dem Fallbeil der Miniaturguillotine. Er holt ihn mit zwei Fingern heraus und betrachtet ihn. Die lidlosen Augen des Süßmolchs blicken ihn an, ihr Ausdruck ist warm. Ein Vollempath, schießt es Jan durch den Kopf.
In dieser Nacht guillotiniert Jan Dutzende Süß- und Salzmolche. Die Gelben Schlieren findet er nur bei ersteren. Er legt die Molchköpfe in zwei gegen-überliegenden Reihen auf den Labortisch, links die Köpfe der Süßmolche, rechts die der Salzmolche. Hier die warmen Augen, dort die kalten. Empathen links, Soziopathen