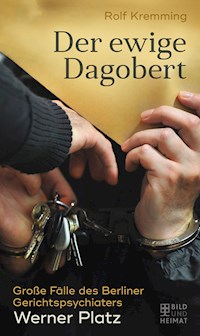Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurzgeschichten zum Nachdenken und Lachen. Es geht um Mord, um Beobachten von Menschen und Charakteren. Eine Zusammenfassung lustiger Kurzgeschichten, zum Spaßhaben und Wundern... Wer ist schneller. Der Kommissar mit dem alten Klappbrett oder sein junger Kollege mit dem I-Pad? Wer langsam denkt, stirbt als Erster. Beobachtungen auf dem Berliner Kudamm.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wer kennt sie nicht, die Menschen, die uns täglich in der U-Bahn begegnen, im Supermarkt, auf den Ämtern oder in unserer Fantasie?
Rolf Kremming, Reporter und Neugieriger hat sie belauscht, beobachtet und beschrieben.
Solange man sich nicht entschlossen hat, zaudert man, und die Möglichkeit, uns zurückzuziehen, verurteilt uns zur Wirkungslosigkeit. Für alle Initiativen gilt eine grundlegende Wahrheit, deren Unkenntnis großartige Pläne zunichte macht; dass nämlich in dem Augenblick, in dem man sich entschließt, auch die Vorsehung ihr Teil beiträgt. Alle möglichen Dinge kommen uns zu Hilfe, die sonst niemals eingetreten wären. Unser Entschluss setzt einen ganzen Strom von Ereignissen in Gang und lässt uns Zufälle und materielle Unterstützung zu Hilfe kommen, wie wir sie nicht im Traum erwartet hätten. W. H. Murray
MORDUNDANDERELUSTIGE
GESCHICHTEN
VON ROLF KREMMING
Rolf Kremming, Jahrgang 1944, lebt als Reporter in Berlin. Mit vierzehn fing er an zu fotografieren, mit dreißig begann er zu schreiben. Hunderte von Reportagen und mehrere Bücher sind erschiene...
Das Klappbrett
Sie lagen dicht aneinander gekuschelt im Gras. Wie es eben Verliebte tun. Die Gesichter einander zugewandt, die Hände verflochten, die nackten Füße berührten sich. Es roch nach frischer Birke und geschnittenem Heu. Zwei Schwalben turtelten, ein Kuckuck rief, ein Hase hoppelte über das Gras. Sanft wie ein leichter Nebel umhüllte das Abendlicht das Paar. Es gab der Szene Ruhe und Beschaulichkeit. Ein romantischer Anblick. Nur dass das Pärchen tot war, störte die Idylle ein wenig. Jeweils ein Schuss in die Schläfe hatte ihre Leben beendet. Auch das Umfeld war nicht geeignet, Romantik zu vermitteln. Da war das alte Auto in Mattgrün und den roten Rallyestreifen. Die abgebrochenen Äste einer Kastanie waren Zeugen eines überstandenen Orkans. Doch am wenigsten idyllisch waren die roten Rinnsale, die zwanzig Zentimeter von den Köpfen entfernt im Boden versickerten. Es war 17.08 Uhr. Für Kriminalhauptkommissar Pinne, der morgen um diese Zeit Pensionär sein würde, sah die Geschichte nach Mord und Selbstmord aus. Er wollte die letzten vierundzwanzig Stunden seines vierzigjährigen Ermittlerlebens nicht mit einem neuen Fall verbringen. Kriminalassistent Böttcher dagegen witterte seinen ersten großen Einsatz. Vor einer Woche von der Vermisstenstelle in die Mordkommission versetzt, hatte ihn das Fieber gepackt. Ähnlich dem, das er empfand, wenn er einer Frau begegnete, die ihm mehr als nur gut gefiel. Hier wie da wollte er sich beweisen. Da mit männlichem Charme, hier mit seiner Logik und den neuesten technischen Möglichkeiten.
Beide Kriminalsten standen seitlich neben den Opfern, von denen der Gerichtsmediziner meinte, sie wären seit zwei Stunden tot; plus/minus dreißig Minuten.
Hauptkommissar Pinne klappte sein dreißig Jahre altes Schreibbrett zusammen, während Böttcher auf sein iPad einhämmerte. 1.698 Euro hatte er dafür bezahlt. Aus eigener Tasche. Doch die Geldausgabe würde sich lohnen; davon war er überzeugt.
Kriminalhauptkommissar Pinne hatte den Tatort inzwischen unbemerkt verlassen. Er saß im Einsatzwagen der uniformierten Kollegen und streckte die Füße aus. Ein Schnürsenkel hatte sich gelöst. Nach langer Betrachtung desselben, bückte er sich widerwillig und band eine Schleife. Lass den jungen Spund bloß keine Eingebung haben, die meiner widersprach, dachte er. Das konnte nur ins Auge gehen. Pinne griff zum Handy und rief seine Frau an. In spätestens einer Stunde würde er auf seiner karierten Kücheneckbank sitzen, Wurstsalat und Soleier mit süßem Senf essen. Zwischendurch würde er ein Stück von der Nugatschokolade lutschen. Dann vielleicht noch ein wenig geriebenen Käse über die geschnittenen Tomaten mit Basilikum streuen und in die Mikrowelle schieben. Sein Geschmack war sehr speziell, wie seine Gattin seit fast vierundvierzig Jahren behauptete. Dabei hatte er sich von seiner Lieblingsspeise, Magermilchpulver, eingerührt in flüssiger Sahne, schon lange verabschiedet. Damit kann man Tapete an die Wand kleistern, aber doch nicht essen, pflegte Barbara zu bemerken. Nun wenn Elvira, die gemeinsame Tochter aus Wanne Eickel, sie besuchte, gönnte er sich ein bis zehn Löffelchen, die ihn an seine Kindheit erinnerten.
Der Leichendoktor und die KTU verabschiedeten sich. Zwei Zinkwannen brachten das Liebespaar in die Rechtsmedizin. Eigentlich müsste es für solche Fälle eine Doppel-Zinkwanne geben. So wie er und Barbara sich im Urlaub ja auch ein Doppelzimmer nahmen. Der Gedanke kam ihm abwegig vor. Umso älter er wurde, desto öfter kamen ihm solche verdrehten Gedanken in den Kopf.
Noch dreiundzwanzig und eine halbe Stunde. Über Pinnes ergrautes Gesicht huschte ein Lächeln. Eine halbe Stunde Fahrt nach Hause, eine Stunde Essen, zwei Stunden auf dem Sofa vor der Glotze und acht Stunden Schlaf. Den Rest von 12 Stunden bis zur morgigen Verabschiedung mit Urkunde und Präsentkorb würde er auch noch rumkriegen. Aber nicht mit Arbeit. Davor musste er sich hüten. Jedenfalls nicht mit unnützer. Dass in seinem Hinterkopf jedoch bereits der alte Spürhund klopfte, merkte er allerdings nicht.
Pinnes Telefon klingelte. Die KTU teilte ihm die Namen der Toten mit; das Ergebnis der Fingerabdrücke. Claus Hofer und Dana Behrendt. Immobilienmakler für gehobene Ansprüche und Kundin mit Geld. Beide verheiratet, doch nicht miteinander und einem außerehelichen Abenteuer nicht abgeneigt. Also waren zwei getrennte Zinnsärge doch die bessere Option.
Am nächsten Morgen kam Pinne zwei Stunden zu spät. Er hatte schlecht geschlafen. Das Essen war es nicht gewesen, umtriebige Gedanken hatten ihn immer wieder geweckt. Nach einem kurzen Besuch im Büro, war er gleich wieder verschwunden und war die übrige Zeit unterwegs gewesen. Der macht sich seine letzten Stunden auch nicht mehr schwer, dachten die einen. Die anderen, und das waren die, die ihn besser kannten, wunderten sich nicht. Assistent Böttcher war ebenfalls den ganzen Tag nicht zu sehen. Ehrgeiziger Junge, dachten die Einen. Die Anderen, die ihn näher kannten, dachten dasselbe. Zweimal passierte es dem jungen Kommissar, dass er Leute befragte, die sich darüber wunderten, warum sie alles zum zweiten Mal erzählen sollen. Doch weil sie schwiegen, erfuhr Böttcher nichts davon. Schließlich wusste er genug, setzte sich in seinen schwarzen BMW und fütterte sein 1.698 Euro iPad mit den neuesten Infos. Das Ergebnis war zufriedenstellend. Er lächelte. Die Kollegen würden sich wundern, dass er, der Neuling, den Fall bereits nach wenigen Stunden gelöst hatte. Als er vor der Tür des Täters ankam, wurde der gerade in Handschellen abgeführt. Auf dem Bürgersteig stand Pinne und klappte zufrieden seine dreißig Jahre alte Schreibunterlage zusammen. Noch eine Stunde und zwölf Minuten, dann würde er die Hände der Kollegen schütteln. Bis dahin war noch Zeit für einen Cafe. Schließlich hatte er, der Alte, den Fall ganz alleine gelöst. Ganz ohne Technik, nur mit Kopf und Klappbrett.
Wendepunkt
Es war drei Uhr morgens, als sie ihn holten. Sie waren zu viert und sie trugen die Nässe der Nacht in den Flur und ins Schlafzimmer hinein. Ein Blitz erhellte für einen Moment die Einfamilienhäuser der dunklen Straße. Es roch nach feuchtem Laub. Ein alter Mann schleifte seinen lustlosen Dackel über den Bürgersteig. Wo die vier Männer standen, bildeten sich dunkle Flecken auf dem fast nagelneuen Teppichboden. Der Größte von ihnen zog Handschellen vom Gürtel und legte sie dem Mann um die Handgelenke. Der Stahl war kalt und der metallische Klick erschreckte ihn.
„Kommen Sie bitte“. Der Polizist mit den Handschellen war freundlich. Seine Stimme war sanft. Er war dick. Von der Mütze tropfte es nass auf die Erde. Wilhelm Schröder verfolgte die Tropfen mit traurigen Augen. Perlend rannen sie über den grünen Stoff der Polizeimütze, fielen, wie die Physik es verlangte, artig von oben auf den Plastikschirm der Mütze, hielten kurz inne, um dann im Zick-Zack zur vorderen Kante zu rollen. „Kommen sie bitte“, sagte der Polizist noch einmal, berührte den Verhafteten am Arm und schob ihn in Richtung Flur. Dabei ging er mit hastigen Schritten links an Schröder vorbei. Damit verstellte er ihm den Blick ins Schlafzimmer, wollte ihm den furchtbaren Anblick im Ehebett ersparen.
Das war vor vier Stunden gewesen. Jetzt saß Wilhelm Schröder zusammengesunken auf einen Stuhl in der Psychiatrie. Zusammengesunken, wie er sein bisheriges Leben verbracht hatte. Geduckt, bereit sich auf den Kopf schlagen zu lassen und voller Angst vor den Folgen, die er nicht kannte aber befürchtete. Sein Chef hatte immer leichtes Spiel mit ihm gehabt. Er widersprach selten, sagte nie nein, wenn es um Überstunden ging. Er war für die miesesten Arbeiten gut genug, tat sie ohne murren. Doch wenn es um eine Gehaltserhöhung ging, war er der Letzte, der sie bekam. Er nahm alles hin, klagte mal hier mal da, aber immer so leise, dass es kaum jemand hörte. Noch nicht einmal er selbst. Und die Frauen in Wilhelms 45jährigen Leben, es gab nur zwei, hatten ihn wie einen Lippenstift behandelt. Rausdrehen, benutzen und wieder reindrehen. Versuchte er mal ein „Ja, aber...“, so klang es zaghaft und niemand nahm es ernst. Doch das Lächeln einer Frau löste in Wilhelm rauschende Gefühle aus. Er fühlte sich angenommen, fühlte sich wichtig und war bereit, dafür alles zu tun und auf sich zu nehmen. Er ließ sich beschimpfen, demütigen, erniedrigen und sogar schlagen; wenn nur dieses Lächeln ihn wieder versöhnte. Manchmal schien es ihm sogar, als würde sein ganzes Leben nur darin bestehen, dieses Lächeln zu suchen und ohne zögern zu folgen. Egal wohin, egal zu welchen Bedingungen. Er wollte nicht allein sein. Er konnte den Schmerz der Einsamkeit nicht ertragen und das Lächeln einer Frau vertrieb das Gefühl, der Einsamkeit und gab ihm Hoffnung für die restlichen Stunden des Tages, für morgen und vielleicht auch für übermorgen.
Auch Irene hatte immer gelächelt: Wenn sie etwas von ihm wollte. Zum Beispiel einen neuen Pelzmantel, das schicke schwarze Ballkleid oder ein flottes Auto. Sie wusste ihn zu nehmen und sie nutzte es aus. Seinen letzten Euro gab er für sie aus, hatte sich sogar das Rauchen abgewöhnt. Bei ihr hatte er seine Einsamkeit, die ihn von Kindheit an durchs Leben trieb nicht gefühlt. Irene verstand es, seine Ängste zu schüren, um sie kurz darauf mit einem Lächeln und ein wenig Zuneigung wieder aufzulösen. Er war ihr ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Es war keine sexuelle Abhängigkeit, die ihn an seine Frau kettete. Es war die Untertänigkeit eines ängstlichen Menschen, der einen anderen brauchte, um sich zu spüren und eins mit ihm zu werden. Es gab kein Entrinnen für ihn - es sei denn...
Nun wurde der rote Sportwagen vor der Tür nicht mehr gebraucht. Und der Pelzmantel ebenfalls nicht. Irene war tot! Und das schicke Schwarze war blutdurchtränkt. Ihre blauen Augen würden ihn nie wieder anlächeln, ihn nicht mehr erlösen von dem Übel, das Einsamkeit hieß.
Was hatte er getan? Er wusste es nicht mehr. So sehr er sich anstrengte, die Erinnerung an den letzten Abend hatte bis auf ein paar Belanglosigkeiten sein Hirn verlassen. Da war der Streit gewesen, die Beschimpfungen. Er solle sich die Schuhe ausziehen, sollte den Abwasch machen und Zwiebeln schneiden. Sollte, sollte, sollte! Er kniff die Augen zusammen, bis ihm schwarz wurde und der Kopf schmerzte. In seinen Schläfen pochte es. Wo war sie, die Erinnerung? Es dröhnte in seinen Ohren, er hörte förmlich das Dunkel um sich herum, roch die Wärme des Blutes, aber er sah nichts. Absolut nichts.
„Was habe ich getan?“ Seine Stimme war leise, sein Blick gesenkt. Seine Finger krallten sich in die Lehne des Stuhls. Er schluckte. Mund und Kehle waren trocken.
„Mit dem Messer. Sie taten es mit dem Messer.“ Die Stimme des Arztes hinter dem Schreibtisch war teilnahmslos. Er blätterte in den Akten und jedes Mal, bevor er ein Blatt umschlug, befeuchtete er Daumen und Zeigefinger. „Sie haben siebzehnmal zugestochen. Mit einem Küchenmesser.“ Die Worte drängten sich wie ein polternder LKW in seine Ohren. „Sie haben siebzehnmal zugestochen.“
Er war also ein Ungeheuer. Ein grausames Etwas. Plötzlich schmeckte er das Blut auf der Zunge, auf den Lippen, in seiner Kehle, fühlte den kalten Griff des Messers in seiner Hand und sah sich zustechen... Einmal, zweimal, dreimal, zehnmal - siebzehnmal! Er stöhnte. Das Grauen kam wie eine nasse Wolke, weich, nebulös und brachte ihm dem Wahnsinn immer näher. Verzweifelt schüttelte er den Kopf, dann ließ er ihn nach vorne fallen, als würde er ihn nicht mehr brauchen. Die wenigen dünnen Haare, verdeckten sein Gesicht. Sein schmaler Körper fing zu zittern an. Erst nur die Schultern, dann der Brustkorb, die Beine und schließlich der gesamte Körper.
„Nein, nein“, stöhnte er noch einmal, diesmal höher im Ton und schauriger als das Mal zuvor. Die Hand des Arztes blätterte weiter. Er hob den Kopf, schaute kurz zu Wilhelm Schröder hinüber, dann blickte er wieder in die Papiere. Der Polizist legte Wilhelm die Hand auf die Schulter.
„Haben sie was gesagt?“ Der Mann im weißen Kittel hob nicht einmal den Kopf, um Wilhelm anzusehen. Der Druck der Hand auf seiner Schulter verstärkte sich für einen Moment. So als wolle sie sagen, alles wird gut. Wilhelm spürte die Wärme und die Beruhigung, die von der Geste des Polizisten ausging. Er fühlte etwas Vertrautes, etwas, das ihm Mut machte weiter zu fühlen. Wieder sah er das Blut, hörte Irenes Schreie, sah ihre angstvollen Augen. Er sah sie flehen, wie sie um Hilfe riefen, diese kalten, abweisenden, blauen Augen. Nie wieder würden sie ihr grausiges Spiel mit ihm treiben, ihn verspotten und kaputtmachen. Er schluchzte. Was er sah, war nicht er. Nein, das konnte er gar nicht sein. Wilhelm der Leisetreter, der ewige Ja-Sager, der Kriecher und Dienernde.
Er hatte ihr nie genügen können. Sie wollte immer mehr haben, als er geben konnte. Für sie war er nur der kleine, poplige Angestellte, einer der nichts zu sagen hatte, und der nur dazu diente, getreten zu werden. Auch von ihr. Jemand, den keiner für voll nahm. Ein Niemand, den man, kaum dass man ihn gesehen hatte, auch schon wieder vergaß. Warum sie ihn geheiratet hatte? Das hatte er sich oft gefragt. Die Antwort war leicht, jedenfalls für alle anderen. Wilhelm hatte geerbt. Ein Haus in der besten Gegend, für 200 000 Euro Aktien und Anleihen und fast eine halbe Million in bar auf einem Luxemburger Konto ohne Zugriff des Finanzamts. Doch Wilhelm, der Mann, der sich nach Zärtlichkeiten und Geborgenheit sehnte, wehrte sich gegen diese Wahrheit. Es durfte nicht sein. Kein Mensch könne so schlecht und so gierig sein und nur sein Geld wollen. Schon gar nicht Irene. So hatte er auch seine Augen geschlossen, als er sie im Cafe mit einem Anderen sah. Er hielt den Atem an, wenn er den Geruch ihrer Liebhaber in der Nase spürte. Er zog seine Hände zurück, wenn er ihr kaltes Fleisch fühlte. Und er hörte weg, wenn die wenigen Freunde, die er noch hatte, ihn aufklären wollten.