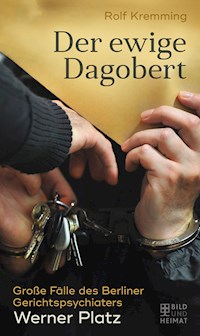Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Carola, jung, hübsch und von Beruf Sekretärin, ist nach einer enttäuschten Liebesbeziehung Abenteuern nicht abgeneigt. Im Café Nord in Prenzlauer Berg lernt sie Norbert aus Westberlin kennen, der ihr nach einer gemeinsamen Nacht fünfzig Westmark auf dem Küchentisch hinterlässt. Nach anfänglicher Wut beginnt für Carola ein neues Leben voller Luxus … In der DDR galt die Prostitution als Übel des Kapitalismus, seit sie 1968 nach dem »Asozialen«-Paragrafen 249 des Strafgesetzbuches verboten wurde, nicht zuletzt um die beunruhigende Verbreitung von Geschlechtskrankheiten einzudämmen. Dennoch war sie weiterhin vom Staat geduldet, oftmals wurden die anstoßerregenden Frauen als sogenannte Honigfallen vom Staatssicherheitsdienst dazu genötigt, ihre Westkundschaft auszuspionieren. Doch das horizontale Gewerbe florierte nicht nur in den Interhotels und Nachtbars von Rostock über Berlin bis Leipzig, sondern blühte auch auf dem illegalen Straßenstrich gegen Ostgeld. Der Journalist Rolf Kremming stützt sich bei seinen spannenden Betrachtungen auf zahlreiche Materialien des Stasi-Unterlagen-Archivs sowie auf persönlich geführte Gespräche mit Zeitgenossen von der Volkspolizei, aus dem Milieu – und vor allem mit den Frauen selbst, die ihren Körper zu DDR-Zeiten gegen Geld angeboten haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf Kremming
Von Straßenstrich bis Honigfalle
Wahre Geschichten über Prostitution in der DDR
Bild und Heimat
Vorwort
Von Felicitas Schirow
Als mir die Lektorin dieses Buches das Manuskript zuschickte und mich fragte, ob ich das Vorwort schreiben könne, bat ich um zwei Wochen Bedenkzeit zum Lesen. Es war ein Mittwochabend, als ich mit dem ersten Kapitel begann, und es war Donnerstagmorgen, als ich das Buch nach dem letzten Kapitel wieder zuschlug. Vieles erinnerte mich an meine eigene Zeit, vieles war mir neu, einiges erschreckte mich auch. Als Verfechterin der freiwilligen Prostitution frage ich mich, wie die Frauen sich wohl gefühlt haben, die im Auftrag der Stasi mit Männern ins Bett gehen mussten. Welche Alternative hatten sie? Wenn sie nicht dem Ministerium für Staatssicherheit gehorchten, drohten ihnen Knast und Wegnahme der Kinder durch den Staat als den größten Zuhälter. Mich bewegten die anschaulich geschilderten Schicksale von Frauen, die sich der politischen Gewalt beugen mussten. Gut nachvollziehen konnte ich aber auch die Schicksale derjenigen, die es freiwillig taten, teils aus finanziellen Gründen, teils aus Spaß am Sex und Erlebnishunger. Mal eben in einer Nacht mehr verdienen als die ehrbare Nachbarin, hat auch seinen Reiz!
Auch heute ist die Prostitution nicht nur aus einer Sicht zu verstehen. Genau wie heute gab es damals Edelprostituierte, nur hießen sie in der DDR »Honigfallen«, ein recht zutreffender Begriff. Welcher Mann lässt sich nicht gern auf süße Art verführen, greift in die Brieftasche, lässt sich ausgiebig verwöhnen und vergisst, dass er dafür bezahlt hat. Das macht eine gute Prostituierte aus. Sie gibt dem Mann das Gefühl, er sei der große Frauenverführer. Dabei ist er in den Händen der Holden willenlos und vergisst, dass er verheiratet ist, plaudert auch mal vertrauensvoll Geheimnisse aus.
Keine Frau, die sich freiwillig für die Prostitution entscheidet, darf diskriminiert werden. Ich mag starke Frauen, die sich gegen Zwangsprostitution und Zuhälter wehren. Sie haben meine volle Unterstützung. Jede Frau, die sich aus Lust, ihre Sexualität auszuleben, Erlebnishunger und/oder aus finanziellen Gründen für den Sexberuf entscheidet, muss respektiert werden, so unterschiedlich die Motive auch sind. Vielleicht ist sie auch auf einen Zuhälter, oder Loddel, wie wir in meiner Jugend sagten, hereingefallen. Vielleicht war sie einfach naiv. Sie verdient mit ihrem Körper ihr Geld, wie viele andere, nur mit einem anderen Körperteil. Ist der Kunde zufrieden, gibt es moralisch an ihrer Tätigkeit nichts auszusetzen. Verwerflich verhält sich hingegen ein Partner, welcher der Prostituierten schöne Augen macht, eine gemeinsame Zukunft verspricht und sie dabei ausbeutet. Aber mal ehrlich: Gibt es das umgekehrt nicht auch schon seit Menschengedenken?
Meist ist es wohl eine Mischung aus allem. Die einen möchten sich einen Urlaub auf den Malediven leisten, andere ihre Wohnung schick einrichten oder ein tolles Cabrio fahren. Wer Prostitution moralisch nicht in Ordnung findet, sollte sie trotzdem respektieren. Wir alle kennen reichlich andere Tätigkeiten, die wir kritisch beäugen. Aber sie gehören zu unserer Gesellschaft, weil einfach auch ein Bedarf da ist.
Wen geht es etwas an, wenn sich zwei oder mehr Menschen einig sind, ohne dass jemand anderes dabei gestört wird oder Nachteile erleidet? Gerade Späteinsteigerinnen haben mir oft berichtet, der Sex für Geld sei ja auch nicht anders als der, den sie sonst immer hatten. Und dass sie dann noch zwei Scheine bekamen, machte einen gewissen Reiz aus. Auch ist es kein Zufall, dass Prostituierte oft aus pflegerischen und pädagogischen Berufen kommen. Die Gewissheit, jemand anderen glücklich gemacht zu haben, bringt ihnen selbst ein gutes Gefühl.
Die Idee, Hure zu werden, wurde beim heimlichen Lesen des Romans Josefine Mutzenbacher geboren. Ich stellte mir vor, wie ich mit relativ wenig Zeiteinsatz viel Geld verdienen würde. Aber einfach Hure werden, reizte mich nicht, nein, ich wollte, wenn ich schon am Rande der Gesellschaft lebte, auch die berühmteste Hure Deutschlands werden. In den siebziger Jahren gab es noch einen Straßenstrich auf der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg. Ich war Schwesternschülerin im Paulinenkrankenhaus und sah dort immer auf dem Weg in die Disco eine »Bordsteinschwalbe« in einer Kaninchenfelljacke mit silbernen Nieten stehen. Genau so eine Jacke wünschte ich mir schon lange. Da dachte ich mir, bald kannst du dir auch solch eine Jacke leisten. Auf dem Weg in die damals angesagteste Disco Sound in der Genthiner Straße gab es einen weiteren Straßenstrich. Ich stieg immer Kurfürstenstraße aus und wurde regelmäßig angesprochen. Kein Wunder, so wie ich aussah, aufgetakelt bis zum Gehtnichtmehr! Es war die Zeit der Discomode, Glitzer und Glimmer, Plateausohle und superkurze Minis! Ich kannte niemanden, den ich fragen konnte, und hatte Riesenglück, dass ich keinen Ärger bekam. Schließlich war die Kurfürstenstraße schon damals der Drogenstrich, und wohl jede der Frauen hatte ihren Zuhälter, der für ein bestimmtes Gebiet zuständig war.
Als Anfängerin wusste ich nicht, dass der Freier vorher zahlen muss. Es ist wie mit dem Essen. Wer satt ist, denkt anders als einer, der noch Hunger hat. Nachdem mein erster Freier »satt« war, gab er mir die ausgemachten fünfzig Mark nicht. Mit anderen Worten, für mich war es eine Luftnummer.
Die Geschichten, oder besser gesagt, die Schicksale der Frauen im Buch haben mich bewegt. Es sind ähnliche Schicksale, die es auch heute gibt. Nicht jede Frau ist für diesen Job gemacht und einige gehen auch daran kaputt. Selbst Alkohol, Tabletten und harte Drogen können ihnen nicht helfen. Im Gegenteil, der Abstieg geht nur noch schneller. Deshalb ist Beratung und Hilfe wichtig. Doch es gibt auch gute Seiten an der Prostitution. Was sich Prostitutionsgegner nicht vorstellen können: Viele Frauen haben Spaß am Sex. Zum Beispiel die junge Frau, die bei mir im Café Pssst! arbeitete. Ich will sie Cindy nennen. Aus verständlichen Gründen möchte sie nicht erkannt werden. Sie mag Männer und sie mag Sex. Aber sie mag keine Beziehung mehr führen. Ihr Ex nörgelte und rechnete ihr vor, wie lange es schon zu Hause keinen Sex mehr gegeben hatte. Doch Cindy wollte nicht Tag für Tag Sex mit demselben Mann. Der Reiz war schon lange weg. Bei ihren Freiern, heute sagt man lieber »Gäste«, kam sie meistens zum Orgasmus und ging befriedigt nach Hause. So ganz nebenbei hatte sie auch noch das Geld für die Klassenfahrt ihrer Tochter verdient.
Das Kapitel über die Geschichte der Prostitution und dass es die käufliche Liebe schon immer gegeben hat, fand ich spannend; egal, ob man die Frauen Tempeldienerinnen, Hetären, Konkubinen, Liebesdienerinnen, Huren oder Nutten nannte. Wer glaubt, die Prostitution abschaffen zu müssen, lebt auf einem falschen Stern. Einseitige Argumente verhärten nur die Fronten und führen zu keinem Ergebnis.
Beim Salon Kitty musste ich schmunzeln. Auch ich habe dort als Achtzehnjährige angeschafft. Damals hieß das Bordell allerdings Pension Florian und ich war fasziniert von den Geschichten, die ich hörte. Es waren überwiegend Männer jenseits der siebzig, die dort verkehrten. Ich kann nicht sagen, dass ich mich körperlich zu diesen Männern hingezogen fühlte, aber sie waren sehr weise und erzählten von der Zeit, als die Gründerin des Bordells noch lebte, die berühmte Kitty.
Im Laufe meines Lebens habe ich viele einfühlsame und starke Frauen kennen- und schätzen gelernt. Studentinnen, die sich mit Männerbekanntschaften ihr Studium finanzierten, sexhungrige Ehefrauen und Frauen, die ihre Haushaltskasse aufbessern wollten oder mussten. Ich kenne ältere Frauen, die sich genau wie ich gern von älteren Männern buchen lassen, weil diese nicht das Gefühl haben wollen, mit ihrer Tochter ins Bett zu steigen. Und nach so einem bewegten Leben kann man die Stunden mit einem Freier auch wegen der Zweisamkeit, also des Austauschs von Zärtlichkeiten, und vor allem der gepflegten Gespräche genießen; selbst wenn der Sex mal nicht der beste ist. Das muss der Gast nicht wissen. Im Ehebett wird auch oft genug geflunkert.
Prostituierte sind Menschen wie du und ich. Und irgendwie prostituieren wir uns doch alle, oder?
Nach dem Lesen fragte ich mich, wie ich in der DDR reagiert hätte. Eine Antwort habe ich jedoch nicht gefunden …
Zur Person: Felicitas Schirow, geborene Weigmann, fünfundsechzig, ist eine deutsche Prostituierte und Prostitutions-Aktivistin. Seit dem 1. Dezember 2000 gilt sie als streitbarste Hure Deutschlands. Sie gewann den Prozess gegen das Berliner Bezirksamt Wilmersdorf, das die Schließung ihrer (im Beamtendeutsch) »Anbahnungsgaststätte« »Café Pssst!« angeordnet hatte. Die Begründung des Verwaltungsgerichts: In der heutigen Zeit sei Prostitution, freiwillig ausgeübt und ohne kriminelles Umfeld, nicht mehr sittenwidrig. Das Urteil wird als Präzedenzfall betrachtet, es war 2002 entscheidend für Änderungen in der Strafgesetzgebung und sorgte für die Anerkennung der Prostitution als Beruf. Wer sich vorher wegen der Förderung der Prostitution strafbar gemacht hatte, weil er den Prostituierten ein angenehmes Umfeld geschaffen und womöglich noch Präservative ausgelegt hatte, der hat inzwischen die Pflicht, all das zu tun. Sonst riskiert er eine Geldbuße oder den Verlust der Konzession.
Das Zustandekommen des Prostituiertenschutzgesetzes von 2017, das Felicitas kritisch betrachtet, war dann das Ergebnis der Verhandlungen um geplante Änderungen und der Anerkennung der Prostitution als berufliche Tätigkeit. Zwei Jahre lang wollte man beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Ihrer Meinung nach wurde versäumt, nach zwei Jahren des Beobachtens zu beurteilen, wie sich die Situation für die Prostituierten geändert hatte.
Felicitas Schirow kämpft, diskutiert und führt noch heute Streitgespräche in öffentlichen Veranstaltungen und Talkshows gegen die soziale Diskriminierung von Prostituierten, für die Anerkennung als berufliche Tätigkeit und ihre soziale Absicherung. Seit der Schließung des »Café Pssst!« Ende 2015 arbeitet sie selbst auch wieder als Prostituierte.
Die Kunst der käuflichen Lieben
Zur Geschichte der Prostitution
Ein Buch über die Prostitution in der DDR zu schreiben, bedeutet, sich mit der Geschichte der käuflichen Liebe im Allgemeinen zu beschäftigen. Es heißt, die Prostitution wäre so alt wie die Menschheit, das älteste Gewerbe der Welt. Doch ob der keulenschwingende Neandertaler-Mann für Sex eine Gegenleistung bot, bleibt im Dunkel der Wissenschaft verborgen. Ob sich Fred Feuerstein mit seinem berühmten Ausruf »Yabba Dabba Doo« auf eine Hure stürzte und Ehefrau Wilma betrog, ist ebenfalls nicht bekannt. Doch Ausgrabungen und alte Schriften zeigen, wie und wo sich das älteste Gewerbe der Welt von der Antike bis heute entwickelt hat.
Griechenland gilt als Land der Philosophen, der Weisen und Gelehrten. Aber auch als das Land, in dem die freie Liebe und der Sex einen hohen Stellenwert besaßen. Männer mit Männern, Männer mit Frauen. Die Gesellschaft war nicht prüde, Hauptsache es machte Spaß und man konnte es sich finanziell auch leisten. Das Einzige, was Moral und Anstand verlangten: kein Sex mit einer Prostituierten im Hause der Ehefrau, Mutter oder Schwester. Es sind Fälle überliefert, in denen sich Frauen scheiden ließen mit der Begründung, ihr Gatte habe nicht genügend Diskretion gewahrt.
Die Mehrzahl griechischer Prostituierter arbeitete in Athen. Der Hafen Piräus mit seinen sexuell ausgehungerten Seeleuten war ein heißes und begehrtes Pflaster zum Geldverdienen. Straßendirnen an jeder Ecke. Willige Frauen in jeder Schänke. Aufreizende Frauen vor jeder Herberge. Es gab sogar Sklavinnen in staatseigenen Bordellen. Ein Stündchen Entspannung war billig und moralische Vorbehalte gab es keine. Man(n) tat nichts im Geheimen und nicht selten besuchten Männer gemeinsam ein Bordell. Allerdings machten sich Männer, die allzu häufig ein Hurenhaus besuchten, zum Gespött ihrer Freunde.
Die Geschichte von Neaira, einer käuflichen Frau aus dem 4. Jahrhundert v. u. Z., unterscheidet sich lediglich durch ihren griechischen Namen von dem, was heute als Edelhure bezeichnet wird. Als die Bordellwirtin Nikarete aus Korinth sie zum ersten Mal sah, wusste sie: Dieses Kind wird der Star in meinem Bordell. Sie kaufte Neaira, gab sie ab sofort als ihre Tochter aus und bildete das zierliche Mädchen mit den kleinen Brüsten zur Hetäre aus. In den Überlieferungen des Athener Redners Apollodoros heißt es, dass sie bereits vor ihrer Pubertät von ihrer angeblichen Mutter vermarktet wurde.
Sie lernte den richtigen Umgang mit Männern, deren Lüste zu befriedigen, und ihre »Mutter« unterrichtete sie in den unterschiedlichsten Sexpraktiken. Sie lernte ihren Körper zu pflegen, das sorgfältige Schminken und das Parfümieren an den richtigen Stellen. Sie lernte schnell und bald war sie die berühmteste Hetäre Korinths. Im Gegensatz zu den meisten griechischen Frauen damals war sie gebildet und konnte ihre Kunden, die zum großen Teil der reichen Oberschicht entstammten und Politiker, Sportler, Dichter oder Philosophen waren, nicht nur sexuell, sondern auch geistig befriedigen. Waren Straßenmädchen für den schnellen Sex zuständig, entstanden zwischen einigen Männern und Hetären auch längerfristige Beziehungen. Doch der Umgang mit den Damen war recht teuer und nur die Reichen konnten sich ein solches Vergnügen auf Dauer leisten. Deshalb beschlossen zwei von Neairas Freiern, sie zu kaufen. Schließlich wäre das billiger, als für jedes Treffen einzeln zu bezahlen. Für dreitausend Drachmen, das fünffache Jahreseinkommen eines Arbeiters, wechselte Neaira von der Bordellwirtin zu den beiden Männern. Als diese heiraten wollten, kaufte sie sich für zweitausend Drachmen frei. Das Geld lieh ihr Phrynion, ein Lebemann aus Athen, dem sie sich anschloss und den sie regelmäßig zu seinen Ausschweifungen begleiten musste. Einmal praktizierten sie sogar öffentlichen Geschlechtsverkehr, der viel Aufregung erzeugte und sich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitete. Während eines Festes betrank sich Neaira so stark, dass sie nicht mehr wusste, was sie tat. Es heißt, sie wäre von einem Dutzend Männern vergewaltigt worden. Aus Wut darüber, dass ihr Liebhaber sie nicht beschützt hatte, verließ sie Phrynion bei Nacht und Nebel und stahl kostbare Vasen und Schmuck.
Etwa zur selben Zeit lebten zwei weitere berühmte Hetären. Die sanfte Lais von Korinth und Phryne, »Kröte«, die den Namen ihrer olivfarbenen Haut verdankte. Über Lais ist bekannt, dass der Lohn, den sie für ihre sexuellen Gefälligkeiten verlangte, bereits in ihrer Anfangszeit zehntausend Drachmen betrug. Doch ihre Vorzüge rechtfertigten diesen hohen Preis. Sie war außerordentlich schön, ihre Liebhaber schwärmten von ihren anschmiegsamen, weichen Brüsten und von einer Haut wie Milch und Honig. Die Männer liebten den Rhythmus ihres Körpers, der sich beim Liebesspiel dem eigenen anpasste, und bewunderten ihr Geschlecht, das weder zu eng noch zu weit war. Doch sie war nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt, sondern auch wegen ihrer Bildung und ihres Charmes. Von vielen ihrer Liebhaber wurde sie nicht nur bezahlt, sondern zusätzlich auch reichlich beschenkt, so dass sie bald ein eigenes Haus und wertvolle Möbel besaß. Nur ein Mann durfte sie unentgeltlich lieben. Der Philosoph Diogenes. Als ihre Schönheit im Alter verblasste, tröstete sie sich mit dem Alkohol und starb einsam und verarmt.
Phryne kam in Thespia am Fuße des Berges Helikon zur Welt. Zunächst arbeitete sie als Kapernhändlerin, gelangte aber 371 v. u. Z. nach Athen, wo sie aufgrund ihres schönen Körpers bald zur Hure wurde und viel Geld verdiente. Ihr Vermögen erlaubte es ihr, zurückhaltend zu leben, keine öffentlichen Bäder zu besuchen, keine Schminke zu verwenden und lange, geschlossene Gewänder zu tragen. Durch ihren Reichtum wollte sie sich ein Denkmal für die Ewigkeit setzen. Sie bot an, das durch Alexander den Großen zerstörte Theben auf ihre Kosten wieder aufzubauen. Doch wegen ihrer Forderung, die Inschrift »Alexander hat sie zerstört, die Hetäre Phryne wieder aufgebaut« anzubringen, wurde ihr Vorschlag abgelehnt. Legendenumwoben ist ihr Auftritt vor dem Areopag. Als ihr wegen Frevel gegen die Götter eine Verurteilung drohte, soll sie ihren Busen entblößt haben und die Richter sprachen sie frei, weil sie glaubten, dass Aphrodite persönlich vor ihnen stünde.
Was den Griechen recht, war den Römern billig. Auch sie huldigten der Prostitution. Nicht nur Neros Gelage sind überliefert, auch die der einfachen Bürger. Von günstig bis teuer, das Angebot war groß. An den Ausfallstraßen vor den Stadttoren neben den Friedhöfen boten sich Frauen der Unterschicht für die Unterschicht an. »Gräberdirnen« wurden sie genannt. Es waren Frauen, von denen man behauptete, sie würden es mit den Totengräbern auf dem Friedhof treiben. Ihre Verruchtheit zog die Freier ebenso an wie der geringe Liebeslohn, den sie forderten.
Was heute Internet, Zeitungsanzeigen und das Fernsehen für die Werbung bedeuten, waren im Römischen Reich die Wandmalereien. Um Freier anzulocken, wurde offensiv um sie geworben. Erotische Malereien mit unterschiedlichen Stellungen, Phallussymbole als Türöffner und Reliefs weiblicher Geschlechtsteile lockten die Kunden in die Häuser der Lust. Graffiti an den Mauern zeigten, wie auf einer Speisenkarte, das Angebot des jeweiligen Etablissements an. Einige Dirnen warteten mit nackten Brüsten auf der Straße und zeigten in natura, was sie anzubieten hatten. Anfassen war erlaubt, es steigerte Neugier und Verlangen. Dirnen ohne Schamhaar standen hoch im Kurs und boten in aller Pracht ihren Venushügel an. Die Männer sollten sehen, was zwischen den Schenkeln auf sie wartete.
Als Königsdisziplin galt damals der Oralverkehr. Eine Praxis, die ein römischer Mann seiner Ehefrau nicht zumuten wollte. Graffiti von Frauen, die vor einem Mann knien und sein Glied zwischen den Lippen halten, lockten neugierige Männer ins Bordell. Sparsame Freier taten sich zusammen und teilten sich die Gunst der Frau, wie zahlreiche Wandmalereien aus Pompeji beweisen.
Eine besonders raffinierte Art der Kundenwerbung war das Hinterlassen von Fußabdrücken von präparierten Schuhsohlen mit erotischen Motiven, die den Männern signalisierten, ihnen bitte doch zu folgen. Eine andere Art Werbung war in den Abendstunden auf Roms Straßen zu sehen. Männer, die durch die Gassen liefen und Gutscheine verteilten. Für einen Zirkusbesuch, für eine Handvoll Getreide oder für einen Bordellbesuch mit aufgemalten Sexstellungen und aktuellen Preisen.
Reiche Bürger und Senatoren ließen sich Kurtisanen in ihre Villen bringen. Ebenso Tänzerinnen, Musikerinnen und Sängerinnen, die nach ihrem künstlerischen Auftritt auch sexuelle Gefälligkeiten anboten. So wurde aus manchem Geigenspiel ein fröhliches Gefiedel im Bett und der Gesang zum Blaskonzert.
Die in der Oberschicht beliebten Kurtisanen ließen sich, genau wie die griechischen Hetären, auf längere Beziehungen mit nur einem Mann ein. Was auf Neudeutsch unter »Sugardaddy« läuft, war auch damals schon bekannt. Viele amicae teilten das Bett einiger bedeutender Männer wie Scipio dem Jüngeren, Pompeius und Marcus Antonius.
Im Mittelalter wurde die Versorgung der Frau durch die Familie oder durch Heirat gesichert. War sie ledig oder hatte keine Verwandten mehr, blieben ihr nur zwei Überlebenschancen: Bettelei oder Prostitution. Nicht selten zogen Prostituierte deshalb ihre eigenen Töchter zur Dirne heran, um sie für sich arbeiten zu lassen und im Alter ein gesichertes Auskommen zu haben.
Die Prostitution war im Mittelalter zwar gestattet, doch Huren wurden von den meisten Bürgern verachtet, weil ihre Existenz der Fleischeslust galt. Sex wurde zwischen Unrat und herumlaufenden Ratten im Freien praktiziert oder in mit Ungeziefer verseuchten Betten. In vielen Städten durften die Frauen nur außerhalb der Stadtmauer ihrem Gewebe nachgehen. Um das stundenlange Stehen auf dem nassen Boden erträglich zu machen, trugen sie »Stelzenschuhe«, aus denen sich im Laufe der Jahre die heute so beliebten High Heels entwickelten.
Zum Schutz von Jung- und Ehefrauen und sonstigen »ehrbaren« Frauen hatten Prostituierte die Pflicht, sich zu kennzeichnen. Deshalb war die Kleidung der Huren des 14. und 15. Jahrhunderts bunt und von weitem gut sichtbar. In Leipzig mussten Dirnen ein gelbes Tuch an ihre Kleidung nähen.
Da in Deutschland erst im Spätmittelalter die ersten öffentlichen Bordelle entstanden, waren Badestuben der Treffpunkt für Freier und Huren. In einem lateinischen Gedicht von um dreizehnhundert wird der Besuch einer solchen Badestube in Erfurt genussvoll beschrieben. »›Hübsche Jungfräulein‹ badeten den Ankommenden und massierten ihn. Trat er aus dem Bade, so kam ein freundlicher Barbier und rasierte, dann legte sich der Gast auf ein Ruhebett, und wieder trat ein hübsches Fräulein ein und kämmte und kräuselte ihm die Haare.«
Soldatendirnen zogen mit dem Heer übers Land, oft war der Hurentross größer als die Armee. Angefangen von der Mätresse des Obersts bis hin zu den zahlreichen jungen Frauen für die kämpfende Truppe.
Es war auch die Zeit der Wanderhuren, die durchs Land reisten und überall ihre Dienste anboten. Einige von ihnen erkannten schon früh die sexuellen Bedürfnisse der Kaufleute, die sich in den Messestädten Frankfurt am Main und Leipzig trafen und Geschäfte machten. Liefen die Geschäfte gut, floss der Wein in Strömen und Huren versüßten ihnen den Erfolg. Liefen sie schlecht, ertränkten die Kaufleute ihren Frust im Alkohol und ließen sich von Huren trösten.
Die ersten »Meßhuren« trafen meist zeitgleich mit den Kaufleuten ein. In dem Buch Leipzig im Taumel (1799) heißt es: »Ich komme auf ein Hauptprodukt, das ganz vorzüglich die Leipziger Messen verschönert, auf die Legion in- und ausländischer, schöner und minder schöner, geputzter und zerrissener, parfümierter und barfüßiger, reiner und angesteckter Freudenmädchen, welche alle nach Standes Gebühr und Würden sich bemühen, junge und alte Wollüstlinge in ihre Venuswinkel einzuladen. Die meisten derselben kommen aus unserem lieben Berlin, aus Dresden, Frankfurth, Dessau, Halle, Jena, kurz aus allen Theilen der Welt …« Suchte ein Angereister ein sexuelles Abenteuer, erhielt er den Rat: »Offenbare dich deinem Friseur, der wird dir schon was zuführen.« Und der Weg zu einer Dirne war oft nicht weit. Viele Friseure schnitten nicht nur Haare oder rasierten den Bart. In ihren Hinterzimmern warteten oft Damen mit raffinierten Massagekünsten. Allroundbedienung von Kopf bis Fuß.
Auch Gastwirte und Hausknechte dienten mit Adresslisten schöner Frauen, die zum Zweck der Hurerei in der Stadt weilten, fuhren ihre Gäste zum Liebesnest und warteten.
Finanziell gut gestellte Dirnen machten Postkutschen zu fahrenden Bordellen. Die meist gebildeten Frauen suchten ihre Freier in mondänen Bädern, saßen in den Kaffeehäusern, lasen Zeitung und flirteten mit alleinstehenden Herren an den Nachbartischen. War man sich einig, ließ sich Paar von einem Postillion durch die Gegend fahren. Wobei das Pärchen hinter den zugezogenen Vorhängen wenig von der Landschaft sah. In einer Reisebeschreibung aus dem Jahr 1817 heißt es, dass eine Postdirne regelmäßig zwischen Darmstadt und Heidelberg hin- und herfahre und sich für Geld den Reisenden hingebe.
Pfiffige Droschkenkutscher stellten gegen ein Entgelt ihr Fahrzeug gern für ein Stelldichein zur Verfügung. »Porzellankutscher« wurden sie genannt, weil sie so langsam fuhren, als hätten sie Porzellan geladen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in Preußen staatlich überwachte Bordelle zugelassen. Die Berliner Regierung ließ zweiundfünfzig Etablissements an der Klosterstraße als Bordelle zu, die in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts aber wieder abgerissen wurden, weil die Prostitution verboten wurde. Doch der Erfolg war mäßig. Was vorher in den Häusern geschah, zeigte sich jetzt in aller Öffentlichkeit. Die Straßenprostitution blühte und die Zahl der leichten Mädchen in Berlin stieg ständig. Die Not war groß und Anfang des 20. Jahrhunderts boten fünfzigtausend Huren ihren Körper an. Vom billigen Sex für ein oder zwei Mark hinter dem Schlesischen Bahnhof bis zu teureren Liebesdiensten für zwanzig Reichsmark in der vornehmen Friedrichstraße. In einem Zeitungsbericht heißt es: »Auf der Jungfernbrücke bieten sich bereits bei Sonnenaufgang zahlreiche Mädchen mit flotten Sprüchen an.«
Es folgte die Doppelmoral der Nazis, die, ebenso wie später die SED, die Prostitution zwar verboten, doch für ihre Zwecke nutzten. Prostituierte galten als asoziale Elemente, die von der Straße mussten und ins Gefängnis oder Arbeitslager gehörten. Doch Ausnahmen fanden sich immer. Da war zum Beispiel Kätchen Emma Sophie Schmidt, gelernte Klavierlehrerin, die den Braunen gut ins Konzept passte. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS verpflichtete sie, ihren Salon Kitty in Berlin-Charlottenburg dem Geheimdienst zur Verfügung zu stellen. Alle Räume des Bordells wurden verwanzt, Mikrofone hinter durchsichtigen Spiegeln, in den Badezimmern und unter den Betten platziert. Man filmte aus Vasen heraus und von den Deckenlampen in den Schlafzimmern. Die Sicherheitspolizei suchte gezielt nach »Frauen und Mädchen, die intelligent, mehrsprachig, nationalistisch gesinnt und mannstoll« waren. Die Frauen wussten, was zu tun war, wussten, dass Sex und Alkohol die Zungen ihrer Freier lockerten. Mit ihrem Körpereinsatz sollten sie Regimefeinde enttarnen, aber auch SS-Funktionäre auf ihre Regimetreue testen.
Um dem Salon einen exklusiven Rahmen zu geben, waren nie mehr als acht bis zehn Mädchen anwesend. Darüber hinaus gab es Fotoalben mit Bildern von Prostituierten, die auf Abruf zur Verfügung standen und innerhalb einer halben Stunde in den Club kamen. Doch nicht nur die leichten Mädchen dienten hier dem Staat. Auch Hausangestellte und Kellner waren ausgebildete Geheimagenten, die ihre Ohren und Augen überall hatten.
Regelmäßige Gäste in Heydrichs geheimen Betten waren der Chef von Hitlers Leibstandarte Sepp Dietrich, Reichsaußenminister von Ribbentrop und NSDAP-Reichsorganisationsleiter Robert Ley. Auch der italienische Außenminister und Schwiegersohn Mussolinis Galeazzo Ciano war regelmäßiger Gast bei Kittys Frauen. Gegenüber seinem Dolmetscher äußerte er: »Heydrich muss sehr dumm sein, wenn er glaubt, dass ich nicht von seinen Herren im Nebenzimmer weiß. Er sollte die Mikrofone nicht gerade unter den Kopfkissen verstecken.«
Die letzten Bomben waren gefallen, hatten Angst, Schrecken und Tod gebracht. Berlin, Dresden, Leipzig und ganze Landstriche lagen in Schutt und Asche. 5533000 deutsche Soldaten waren im Krieg umgekommen, ließen Kinder ohne Väter, Frauen ohne Ernährer und auf sich allein gestellt zurück. Auf den Schwarzmärkten Deutschlands wurde getauscht, gekauft und gehandelt. Den Anzug des in Russland gefallenen Sohnes gegen ein Huhn. Die Schuhe des toten Ehemanns gegen eine Schachtel Zigaretten. Was nicht mehr gebraucht wurde, ging für Nützliches weg.
Hunger beherrschte die Gesellschaft und ein knurrender Magen siegte oft über die Moral. In Deutschland lebten sieben Millionen Frauen mehr, als es Männer gab. Trümmerfrauen klopften nicht nur Steine und räumten Schutt zur Seite. Einige wurden nach Einbruch der Dunkelheit oftmals zu Teilzeitprostituierten. Sex gegen harte Dollar, um die Kinder zu ernähren. Verkaufte Liebe für ein Paar Nylonstrümpfe, für ein Pfund Kaffee oder für eine Schachtel Lucky Strike. Reichtum wurde am Besitz von Zigaretten gemessen, und die Bereitschaft, sich auf ein schnelles sexuelles Abenteuer einzulassen, erleichterte manchen Frauen das Überleben. Russen vergewaltigten, die Alliierten in Westdeutschland dagegen waren beliebt. Einige heirateten, andere wurden schwanger und viele Väter verschwanden in Richtung Texas, Paris oder London. Es war keine gute Zeit, so kurz nach dem Krieg.
Die Straßenprostitution blühte und war nicht zu übersehen. Im zerstörten Berlin boten sich die Frauen in Hauseingängen, auf zerbombten Hinterhöfen und an Straßenecken an. Man liebte sich in kalten Wohnungen, in einer Absteige oder auf der eigenen Matratze. Im Hurentreffpunkt Mulackritze, in der Mulackstraße 15, konnten sich Dirnen und Stricher für eine halbe Stunde ein Bett im Haus mieten. Charlotte von Mahlsdorf schreibt in ihren Memoiren: »Zwei Betten standen rechts und links vom Fenster, darunter ein kleiner Tisch, links von der Tür ein kleiner Kanonenofen, daneben noch eine Chaiselongue … ›Det war die Hurenstube. Immer in Betrieb. Unten dat Geschäftliche besprochen, schnell hoch, auf’n halbes Stündchen, manche haben det ooch in zehn Minuten gemacht.«
1951 wurde die Ritze dicht gemacht und 1964 abgerissen. Mit dem Handkarren transportierte Charlotte von Mahlsdorf die Möbel von Berlin-Mitte nach Mahlsdorf und baute die Hurenstube originalgetreu im Gründerzeitmuseum wieder auf.
Es war der 7. Oktober 1949, als viereinhalb Monate nach der Gründung der Bundesrepublik die DDR entstand. Das geteilte Deutschland war geboren. Zwei Staaten, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Nur auf einem Gebiet waren die Unterschiede kaum sichtbar. Käuflichen Sex gab es in beiden Staaten. Der Straßenstrich in Ostberlin war auch für viele Westberliner ein Anlaufpunkt für eine schnelle Nummer im Auto, bezahlt mit Ostgeld, schwarz umgetauscht, war es ein billiges Vergnügen. Doch obwohl bis 1968 nicht verboten, passte die Prostitution nicht ins sozialistische Weltbild der Ulbricht-Regierung. Die DDR, moralisch überlegen, wollte anders sein als der sündige Westen. Sex gegen Geld war ein Monster des Kapitalismus und verstieß gegen das sozialistische Frauenbild. Doch selbst nach dem Verbot der Prostitution am 12. Januar 1968 blühte sie im Geheimen nicht nur weiter, sondern wurde bald vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bewusst eingesetzt. Auf der Leipziger Messe schliefen sich »Mielkes Jungfrauen« zielgerichtet mit Wirtschaftsbossen aus dem nichtsozialistischen Ausland durch die Betten oder brachten hochrangige westdeutsche Politiker zum Reden. Champagner, Sex und attraktive Frauen schalteten manchem Mann den Verstand aus und öffneten stattdessen seine Hose.
August Bebel schrieb im zwölften Kapitel seines Buches Die Frau und der Sozialismus: »Die Ehe stellt die eine Seite des Geschlechtslebens der bürgerlichen Welt dar, die Prostitution die andere … Findet die Männerwelt in der Ehe keine Befriedigung, so sucht sie dieselbe in der Regel bei der Prostitution … Daß die Frau die gleichen Triebe hat wie der Mann, ja, daß diese in gewissen Zeiten ihres Lebens sich heftiger als sonst geltend machen, beirrt sie nicht … Durch nichts kann drastischer, aber auch in empörenderer Weise die Abhängigkeit der Frau von dem Manne dargetan werden, als durch diese grundverschiedene Auffassung und Beurteilung der Befriedigung desselben Naturtriebs … Die Prostitution wird also zu einer notwendigen sozialen Institution für die bürgerliche Gesellschaft, ebenso wie Polizei, stehendes Heer, Kirche, Unternehmerschaft … Keinem der Genannten kommt der Gedanke, daß durch eine andere gesellschaftliche Ordnung die Ursachen für die Prostitution verschwinden könnten …«
Ähnlich sah es auch der Leipziger Polizeiarzt Dr. Julius Kühn. 1892 schrieb er: Die Prostitution ist ein nicht nur zu duldendes, sondern ein notwendiges Übel, denn sie schützt die Weiber vor Untreue und die Tugend vor Angriffen und somit vor dem Falle.«
Auch wenn heute diese Ansichten als veraltet gelten und uns schmunzeln lassen; in der DDR wurde ein Familienbild geprägt, in dem die Prostitution keinen Platz hatte.
»Unsere DDR ist ein sauberer Staat. In ihr gibt es unverrückbare Maßstäbe der Ethik und Moral, für Anstand und gute Sitte«, erklärte Erich Honecker 1965 in seiner »Kahlschlag«-Rede auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED. Drei Jahre darauf folgte auch das Verbot der Prostitution nach Paragraf 249 des Strafgesetzbuchs, im Volksmund »Asozialenparagraf« genannt. Eine sozialistische Frau hat nicht zu viel Spaß an Sex und prostituiert sich nur dann, wenn es dem Staat nützt. So könnte man den Umgang der DDR mit Prostitution beschreiben.
Die Duldung der Prostitution war kein Geheimnis. Fast jeder DDR-Bürger kannte eine Frau im Bekanntenkreis oder auf der Arbeitsstelle, die nebenbei in den Devisenhotels als Prostituierte arbeitete. Einige von ihnen dienten auch der Stasi als Inoffizielle Mitarbeiterin (IM). Voraussetzung für die Sexarbeiterinnen im Auftrag des MfS war: Sie mussten jung, attraktiv, unverheiratet und gebildet sein, keine Kinder haben, über Fremdsprachenkenntnisse verfügen und dem Staat treu ergeben sein.
Die Orte in Ostberlin, die regelmäßig von Prostituierten und Westfreiern zur Anbahnung besucht wurden, waren die Interhotels Palasthotel, Stadt Berlin und Metropol, in den achtziger Jahren die Diskothek Yucca-Bar oder die Alibi-Bar am Senefelderplatz. Neugier, Abenteuerlust und Westgeld reizte viele Frauen, sich zu verkaufen.
Vierhundertneunundneunzig Diplomarbeiten haben MfS-Mitarbeiter an der Humboldt-Universität zu Berlin verfasst. Im Landesarchiv Berlin fand ich eine Arbeit von zwei MfS-Mitarbeitern an der Sektion Kriminalistik. Sie schrieben über gefährdete Bürger in der DDR im Hinblick auf den Paragrafen 249. Aus den Gesprächen mit den Gefährdeten zogen sie den Schluss: Wer keiner geregelten Arbeit nachgehe (Fehlgeleitete), sollte so früh wie möglich beeinflusst werden, um denjenigen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Innere Angelegenheiten führte die HU auch mehrere Studien durch. Eine Soziologiestudentin kam nach Befragungen von hundertfünfzig Personen zu dem Ergebnis, dass dreiundsechzig Prozent von ihnen gegen die verordneten Auflagen des Betreuungsprogramms verstießen. Sie nahmen keine Tätigkeit auf, tranken zu viel Alkohol, kamen zu spät oder fehlten unentschuldigt von der Arbeit.
Im Westteil der geteilten Stadt entwickelte sich die Prostitution im Laufe der Jahre zu einem eigenen Wirtschaftszweig. Zuhälter übernahmen den Strich und die Bordelle. Frauen auf der Kurfürstenstraße mussten Standgebühren von bis zu hundert D-Mark zahlen. Zehn Schritte nach links. Zehn Schritte nach rechts. Beim elften Schritt gab es Ärger. Berlins Luden ordneten Geschäftszeiten an. Im Sommer von zwanzig Uhr bis der letzte Freier bedient war. Im Winter ging der »Betrieb« eine Stunde später los.