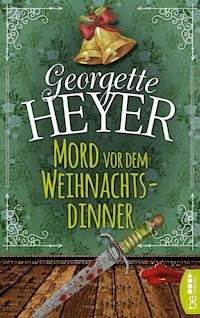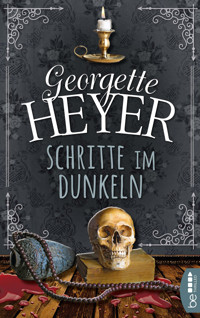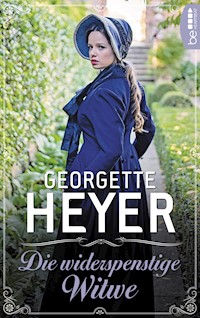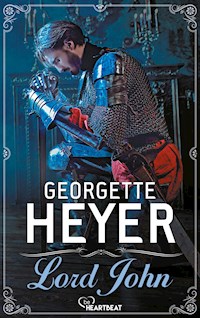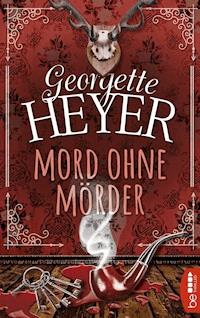
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georgette-Heyer-Krimis
- Sprache: Deutsch
England 1939: Eine illustre Gesellschaft hat sich auf Lady Ermyntrudes Landsitz versammelt: ein russischer Fürst, die exzentrische Tochter der Lady und eine Reihe mehr oder weniger wohlgesonnener Herrschaften aus der Nachbarschaft. Als Höhepunkt der Zusammenkunft findet eine Jagd auf dem Anwesen statt. Doch der Ausflug endet abrupt, als Lady Ermyntrudes Ehemann Wally erschossen wird. Inspektor Hemingway steht vor einem Rätsel. Keiner der Anwesenden hat etwas gesehen oder war in der Nähe, als der Mord geschah. Aber fast alle haben ein Motiv ...
Ein raffiniert ersonnener Mordfall mit angelsächsischem Witz und knisternder Spannung - jetzt als eBook bei beTHRILLED.
"An Heyers Figuren und Dialogen habe ich immer wieder meine helle Freude." Dorothy L. Sayers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Über dieses Buch
England 1939: Eine illustre Gesellschaft hat sich auf Lady Ermyntrudes Landsitz versammelt: ein russischer Fürst, die exzentrische Tochter der Lady und eine Reihe mehr oder weniger wohlgesonnener Herrschaften aus der Nachbarschaft. Als Höhepunkt der Zusammenkunft findet eine Jagd auf dem Anwesen statt. Doch der Ausflug endet abrupt, als Lady Ermyntrudes Ehemann Wally erschossen wird. Inspektor Hemingway steht vor einem Rätsel. Keiner der Anwesenden hat etwas gesehen oder war in der Nähe, als der Mord geschah. Aber fast alle haben ein Motiv …
Über die Autorin
Georgette Heyer, geboren am 16. August 1902, schrieb mit siebzehn Jahren ihren ersten Roman, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit hat sie eine lange Reihe charmant unterhaltender Bücher verfasst, die weit über die Grenzen Englands hinaus Widerhall fanden. Sie starb am 5. Juli 1974 in London.
Georgette Heyer
Mord ohne Mörder
Aus dem Englischen von Susanna Rademacher
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der Originalausgabe: No Wind of Blame
© 1939 by Georgette Heyer, Copyright © renewed 1966
by Georgette Rougier
Copyright der deutschen Erstausgabe:
© 1975 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Maria Seidel, atelier-seidel.de unter Verwendung von Motiven © iStock: minmiphotoart | Lisa_L | Cyano66
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4325-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
»Der Fürst kommt mit dem Einuhrfünfundvierzig. Das heißt, er wird rechtzeitig zum Tee hier sein. Ist das nicht nett?«
Da hierauf keine Antwort erfolgte, wiederholte die Dame, die am Frühstückstisch präsidierte, ihre Frage und setzte hinzu: »Er wird dir bestimmt gefallen. Er ist durch und durch ein Gentleman – verstehst du?«
Miss Cliffe hob den Blick von ihrer eigenen Post. »Entschuldige, Tante Ermyntrude – ich habe nicht aufgepasst. Der Fürst – ja richtig! Dann muss der große Wagen zum Bahnhof geschickt werden. Ich werde dafür sorgen.«
»Ja, mein Liebes, tu das.« Mrs. Carter steckte den Brief des Fürsten in den Umschlag zurück und reckte den molligen Arm nach dem Toastständer. Sie war eine stattliche Frau, die sich in ihrer Jugend goldblonden Haars und eines rosigweißen Teints erfreut hatte. Die Zeit war an diesen beiden Attributen nicht unbemerkt vorübergegangen, aber der reichliche Gebrauch von Wasserstoffsuperoxyd und den Produkten einer berühmten Kosmetikfirma hatte wirklich Wunder vollbracht. Vielleicht schimmerte der Goldton ihres sorgfältig gewellten Haares ein wenig metallisch, doch die Farbe ihrer Wangen war genauso blühend – wenn nicht blühender – wie eh und je. Künstliches Licht war vorteilhafter für sie als Tageslicht – eine ärgerliche Tatsache, die sie aber nicht hinderte, allmorgendlich großzügig, aber gekonnt ihr Rouge aufzulegen, eingedenk jener Zeit, da sie in der ersten Reihe des Chors gestanden hatte, und ihre Wimpern mit Mascara oder in kühneren Augenblicken mit einem lebhaften Blau zu färben, um das natürliche Blau ihrer Augen noch zu vertiefen.
Die Anstrengungen dieser Gesichtstoilette schienen ihre morgendlichen Kräfte zu erschöpfen, denn sie legte ihr Korsett nie an, ehe sie nicht ein stärkendes Frühstück eingenommen hatte, und erschien im Frühstückszimmer stets in einem Gewand aus Seide und Spitzen, das sie ihr Negligé nannte. Mary Cliffe konnte den Anblick von Ermyntrudes Ärmel, die lässig die Butterdose streiften oder, wenn ihre Tante besonders unachtsam war, in ihren Kaffee stippten, nur schwer ertragen und hatte ihr darum einmal mit vollendetem Takt vorgeschlagen, im Bett zu frühstücken. Doch Ermyntrudes heiterer und geselliger Gemütsart entsprach es mehr, den Vorsitz am Frühstückstisch zu führen und sich über die Pläne zu informieren, die ihre Familie für den Tag hatte.
Mary Cliffe nannte Ermyntrude zwar Tante, war aber nicht ihre Nichte, sondern die Cousine ihres Mannes Wally Carter, der zugleich ihr Vormund war. Sie war eine gutaussehende junge Frau von Anfang zwanzig mit einer tüchtigen Portion gesunden Menschenverstands und von aufrechter Gesinnung – Eigenschaften, die durch die jahrelange Verbindung mit Wally Carter nur noch gestärkt worden waren. Sie brachte Wally eine gemäßigte Sympathie entgegen und war keineswegs blind für seine Fehler und hatte auch nicht die geringste Eifersucht empfunden, als er vor fünf Jahren ziemlich überraschend Ermyntrude Fanshawe heiratete. Dank eines kleinen, aber sicher angelegten eigenen Vermögens war sie in einem angesehenen Pensionat erzogen worden, während sie die Ferien, da Wally ein unstetes Leben führte und häufig insolvent war, in verschiedenen schäbigen Pensionen verbringen musste, nur belebt durch die Besuche von Gläubigern und die immer wiederkehrende Befürchtung, dass Wally den Reizen der einen oder anderen Pensionswirtin erliegen könnte. Als er während einer kurzen Periode relativen Wohlstands in einem eleganten Badeort ein großes Hotel frequentiert und das Glück gehabt hatte, die außerordentlich reiche Witwe Ermyntrude Fanshawe für sich zu gewinnen, hatte Mary mit dem ihr eigenen gesunden Menschenverstand diese Heirat als ein Gottesgeschenk betrachtet. Ermyntrude war zweifellos etwas auffallend und mitunter ein wenig ordinär, aber gutmütig und äußerst großzügig; weit entfernt davon, an Marys Existenz Anstoß zu nehmen, kam sie dem jungen Mündel ihres Mannes äußerst freundlich entgegen und wollte nichts davon hören, dass Mary ihren Vormund verließ, um sich selbst ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn Mary arbeiten wolle, sagte sie, könne sie es ja als ihre Sekretärin und Hausdame in Palings tun. »Und außerdem, mein Liebes«, hatte sie hinzugesetzt, »wirst du für meine Vicky eine richtig nette Gesellschafterin sein.«
Mary hatte das Arrangement annehmbar gefunden, wenn sie auch, als sie Vicky Fanshawe kennen lernte – ein frühreifes Pensionsgänschen, fünf Jahre jünger als sie –, nicht das Gefühl hatte, dass sie zu Herzensfreundinnen bestimmt wären.
Vicky hatte eine ungeheuer kostspielige Erziehung genossen, erst in einer vornehmen Schule an der Südküste Englands und später in einem noch vornehmeren Pensionat in der Schweiz. In den letzten beiden Jahren war sie in den Ferien mit Ermyntrude ins Ausland gereist, so dass Mary ihr kaum begegnet war. Jetzt, da ihre Erziehung als abgeschlossen galt, lebte sie zu Hause, für ihre Mutter eine ständige Quelle des Stolzes und der Freude, aber für Mary, die sich über sie abwechselnd amüsierte und ärgerte, nicht gerade die ideale Gefährtin.
An diesem warmen Septembermorgen überlegte sie, dass die Anwesenheit eines russischen Fürsten Vickys ärgerlichsten Possen Vorschub leisten würde, und nichts Gutes ahnend, erkundigte sie sich nach dem Alter des erlauchten Gastes.
»Nun, ich würde nicht direkt sagen, dass er jung ist«, antwortete Ermyntrude, sich Marmelade nehmend. »Ich finde, er ist gerade im richtigen Alter, verstehst du? Du kannst dir nicht vorstellen, wie distinguiert er ist – und dann seine Manieren! Also, diese Art Schliff sucht man in England vergebens – nicht dass ich mein Land schlechtmachen will, aber es ist nun einmal so.«
»Die Russen sind mir nicht besonders sympathisch«, sagte Mary ein bisschen störrisch. »Ich finde, sie reden viel und tun wenig.«
»Sei nicht so engherzig, Liebes. Übrigens ist er gar kein richtiger Russe, das habe ich dir schon ein Dutzend Mal gesagt. Er ist Georgier – er hat früher ein schönes Besitztum im Kaukasus gehabt, irgendwo am Schwarzen Meer, glaube ich.«
In diesem Augenblick trat Wally Carter ein. Er war von mittlerer Größe, mochte als junger Mann gut ausgesehen haben, hatte aber jetzt seine besten Tage hinter sich. Seine blauen Augen waren häufig blutunterlaufen, und der Mund unter dem hängenden Schnauzbart war schlaff. Damals, als er Ermyntrude umworben hatte, war seine Vorliebe für harte Getränke noch nicht so ausgeprägt, dass er sein Äußeres vernachlässigt hätte, aber fünf Jahre im Wohlstand hatten einen beklagenswerten Verfall bewirkt. Er war von Natur aus schlampig, seine Anzüge schienen nie richtig zu sitzen, sein Haar war nie ordentlich gebürstet. Im Allgemeinen war er liebenswürdig, aber oft brummig, nicht aus schlechter Laune, sondern eher in sanfter Beschwerde, worauf aber keines von den Familienmitgliedern reagierte.
»Da bist du ja!«, begrüßte ihn seine Frau. »Klingle doch mal, Mary, sei so gut! Wir könnten kein schöneres Wetter haben, nicht wahr, Wally? Obgleich Palings natürlich am schönsten ist, wenn der Rhododendron blüht, wie ich immer sage.«
»Wen erwartest du denn?«, erkundigte sich Wally, mit einem glanzlosen Blick zum Fenster.
»Aber Wally! Als ob du nicht genauso gut wüsstest, dass heute der Fürst kommt!«
Diese Mahnung schien Wallys Verdruss zu besiegeln. Er ließ die Zeitung, hinter der er sich verschanzt hatte, sinken und fragte: »Doch nicht der Kerl, den du in Antibes aufgelesen hast?«
Ein Fünkchen Ärger glomm in Ermyntrudes Augen. »Es gibt, soweit ich sehe, nicht den geringsten Anlass zu solch ordinärer Ausdrucksweise. Ich will doch sehr hoffen, dass ich in meinem Alter es nicht darauf anlege, Männer aufzulesen! Alexis ist mir durch Lady Fisher vorgestellt worden, damit du’s nur weißt!«
»Alexis!«, stieß Wally hervor. »Du glaubst doch nicht etwa, dass ich den Kerl mit diesem blöden Namen anreden werde.«
»Du wirst ihn mit Fürst Warasaschwili anreden, und damit ist der Fall erledigt«, sagte Ermyntrude streng.
»Das werde ich nicht. Erstens gefällt mir der Name nicht, und zweitens kann ich ihn nicht behalten.«
»Ich muss schon sagen, daran kann man sich die Zunge zerbrechen«, bemerkte Mary. »Du wirst mir den Namen aufschreiben müssen, Tante Ermy.«
Wally fragte: »Was hat dieser Bursche denn in Antibes gemacht? Sich von irgendeiner reichen Frau aushalten lassen, schätze ich!« Er merkte, dass sein Mündel ihn mit einem raschen Blick streifte; vor Verlegenheit errötend fügte er hinzu: »Ja, ich weiß, was du denkst, aber ich werde eines Tages ein reicher Mann sein – es ist also ein ganz anderer Fall. In dem Moment, wo meine Tante Clara stirbt, werde ich Ermyntrude jeden Penny zurückzahlen.«
Mary enthielt sich jeder Bemerkung. Sie kannte Wallys Tante Clara, die seit zehn Jahren in einer Nervenheilanstalt untergebracht war, vom Hörensagen recht gut, denn sie hatte Wally als Entschuldigung für seine verschiedenen Extravaganzen gedient, solange Mary denken konnte.
Ermyntrude lachte leise vor sich hin. »Ja, Liebling, wir alle wissen von deiner teuren Tante Clara. Ich kann nur sagen, hoffentlich kriegst du ihr Geld, aber dass zwischen uns etwas zurückgezahlt wird, kommt nicht in Frage; und wenn du behaupten willst, ich missgönne dir etwas, so kann ich dir nur wiederholt versichern, dass ich dir keinen Penny missgönne, es sei denn das Geld, das du manchmal für Dinge vergeudest, über die wir lieber nicht sprechen wollen.«
Diese finstere Anspielung, begleitet von einem Ansteigen der Stimme seiner Frau, beraubte Wally der Sprache. Hastig reichte er ihr seine Tasse mit der Bitte um noch etwas Kaffee und begrüßte mit unverhohlener Erleichterung den plötzlichen stürmischen Eintritt seiner Stieftochter.
Das junge Mädchen wurde sozusagen auf einer Woge von Hunden ins Zimmer getragen. Zwei Cockerspaniels, Ermyntrudes Pekinese und ein übergroßer Barsoi umsprangen sie, und da einer der Wachtelhunde anscheinend im Wasser gewesen war, verbreitete sich sofort starker Hundegeruch im Zimmer.
»Aha, die Sportlerin!«, bemerkte Mary nach einem erfahrenen Blick auf Vickys Anzug.
Dieser bestand aus langen Hosen, einem luftigen Hemd und Sandalen, die zwei Reihen rotlackierter Zehennägel sehen ließen.
»Oh, Liebling, nicht die Wachtelhunde! War Hektor etwa wieder im Wasser?«, rief Ermyntrude schmerzlich.
»Die armen Lieblinge!«, girrte Vicky, während sie die Hunde aus dem Zimmer scheuchte. »Meine schönen, schönen Hündchen, nein, nicht jetzt! Leg dich, Roy! Guter Roy, schön hinlegen!«
»Was denkst du dir dabei, diese ganze Meute zum Frühstück mitzubringen?«, fragte Wally, die Zärtlichkeiten des Barsois abwehrend. »Leg dich, wird’s bald? Ich will schließlich nicht in einer Menagerie frühstücken!« Nach einem Blick auf Vickys Kostüm setzte er hinzu: »Außerdem verdirbt deine Aufmachung mir den Appetit. Ich verstehe nicht, dass deine Mutter so etwas erlaubt.«
»Ach, lass sie in Ruhe, Wally!«, sagte Ermyntrude. »Ich finde, sie sieht bildhübsch aus, sie kann anziehen, was sie will. Für mich wären Hosen natürlich nichts.«
Vicky nahm auf dem Stuhl Mary gegenüber Platz. Sie lächelte zerstreut und begann ihre Briefe zu lesen, während ihre Mutter sie zärtlich anhimmelte.
Sie war wirklich ein sehr hübsches Mädchen mit weizenfarbenem Blondhaar, das sie ziemlich lang und im Nacken zu einem dicken Bündel von Ringellocken zusammengefasst trug; dazu große blaue Augen, die unschuldig unter dunkelgefärbten Wimpern hervorblickten. Selbst die rücksichtslos ausgezupften und zu zwei unwahrscheinlich hohen Bogen nachgezogenen Brauen konnten ihrer Schönheit keinen Abbruch tun. Ihr Teint wechselte je nach Stimmung oder Kleidung, aber ihre von Natur helle Haut benötigte keinen Puder.
»Ich nehme an, du weißt von dem Besuch dieses Fürsten?«, brummelte Wally. »Keine Ahnung, was deine Mutter sich davon verspricht, aber wahrscheinlich bist du ebenso schlimm wie sie und findest es sehr fein, einen Fürsten im Haus zu haben.«
Ermyntrude, die den nächsten Brief aufgeschlitzt hatte, rief plötzlich jubelnd: »Ah! Es geht doch nichts über einen Fürsten! Die Derings haben zugesagt!«
Darüber schien selbst Wally sich zu freuen. »Wetten, dass der junge Dering zu Hause ist!«, sagte er, Mary scharf ansehend.
Mary errötete, antwortete aber ruhig: »Das erzählte ich dir doch gestern schon.«
Vicky erwachte aus anscheinend seligen Träumen und fragte: »Wer ist denn das?«
»Ein alter Freund von Mary«, antwortete Wally.
»Ihr Freund?«, fragte Vicky interessiert.
»Nein, nicht mein Freund«, sagte Mary. »Seine Eltern wohnen im Gutshaus, und ich kenne ihn, seit wir hier wohnen. Er ist Anwalt beim Kanzleigericht. Du erinnerst dich sicher an ihn!«
»Nein, aber das hört sich furchtbar spießig an«, sagte Vicky.
»Er ist ein sehr netter junger Mann«, sagte Wally. »Und wenn er Mary heiraten will, habe ich nichts dagegen. Nicht das Geringste. Und im Übrigen werde ich ihr mein gesamtes Geld hinterlassen.«
»Falls du es kriegst«, sagte Ermyntrude kichernd. »Ich hoffe wirklich, dass er Mary um ihre Hand bittet, denn es wäre eine ausgesprochen gute Partie, und außerdem kann der Mann, der dich heiratet, meine Liebe, von Glück sagen, wie seine Leute auch darüber denken mögen.«
»Danke!«, sagte Mary. »Aber da er nicht um meine Hand gebeten hat, brauchen wir uns, glaube ich, nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, wie seine Leute darüber denken, Tante Ermy.« Sie merkte, dass sie heftig errötet war, und beeilte sich, das Thema zu wechseln; sie sah Vicky an und fragte: »Übrigens, was hat dich denn heute so früh aus dem Bett getrieben? Ich hörte dich schon zu nachtschlafender Zeit im Bad fröhlich singen.«
»Ja, ich wollte ein Kaninchen schießen.«
Um Marys Lippen zuckte es. »Dacht ich mir’s doch, dass du heute die Sportliche spielst! Hast du was geschossen?«
»O ja, beinah!«
»Darin schlägst du nach deinem Vater, Schätzchen«, sagte Ermyntrude. »So ein sportlicher Mann! Dreimal war er in Afrika auf Großwildjagd. Natürlich ehe er mich kennen lernte.«
»Du meinst also, sie schlägt nach ihrem Vater, weil sie danebenschießt?«, fragte Wally. »Da muss ich widersprechen. Mir scheint, ihr Vater hat nie danebengeschossen. Sehr schade, wenn du mich fragst, denn sonst brauchte ich vielleicht nicht in einem Haus zu leben, wo überall wilde Tiere – oder ein Teil von ihnen – herumhängen und -stehen. Wahrscheinlich gibt es Leute, die Elefantenbeine als Schirmständer und in Walrosshauer gerahmte Gongs schön finden und mit Rhinozeroshaut überzogene Tische und Leopardenfelle auf dem Sofa und Tierköpfe an den Wänden – aber ich gehöre nicht dazu, und ich habe das auch nie behauptet. Da könnte man ja gleich ins Naturhistorische Museum ziehen!«
»Ich glaube, Alan würde gern zu der Party kommen«, murmelte Vicky.
Ermyntrude verzog einen Augenblick den Mund. »Kann ich mir denken«, sagte sie. »Ich will nicht sagen, dass ich etwas gegen ihn oder seine Schwester habe, aber Harold White hier zusammen mit den Derings – nein, das kommt nicht in Frage.«
»Ja, ich hasse Mr. White!«, stimmte Vicky zu.
»Sieh mal, Schätzchen, ich kann doch nicht Alan und seine Schwester ohne ihren Vater einladen. Ich meine, du weißt doch, was er ist, so eine Art Kumpel von Wally, und das ist eine richtige Abendgesellschaft. Es ist etwas anderes, als wenn man die jungen Leute zum Tennis herüberbittet, da erwartet er gar nicht, aufgefordert zu werden.«
»So ist’s richtig«, sagte Wally. »Immer an dem armen, alten Harold herumnörgeln! Hab mir schon gedacht, dass es nicht lange dauern wird, bis du damit anfängst. Was hat er dir denn getan?«
»Ich mag ihn nicht«, sagte Ermyntrude. »Aber man könnte sogar sagen, er hat mir alles Mögliche getan, alles, wozu er dich verführt hat, aber das ist kein Thema für den Frühstückstisch. Ganz zu schweigen davon, wie er sich da im Dower House eingenistet hat.«
»Du hattest nicht das Geringste dagegen, es ihm zu überlassen.«
»Nein, weil du mich in Anbetracht deiner Verwandtschaft mit ihm darum gebeten hattest, ihm das Haus zu vermieten. Aber wenn ich gewusst hätte, was für einen Einfluss er auf dich haben würde und dass er mit dir ungefähr so verwandt ist wie der Mann im Mond –«
»Da hast du eben unrecht, er ist wirklich mit mir verwandt«, unterbrach Wally sie. »Ich habe vergessen, wie, aber ich weiß, dass wir denselben Ururgroßvater haben. Oder irre ich mich? Vielleicht war es der Urururgroßvater, aber das ist nicht so wichtig.«
»Ahnen«, sagte Vicky.
Ermyntrude weigerte sich, einer offensichtlich falschen Fährte zu folgen. »Für meine Begriffe ist das überhaupt keine Verwandtschaft, und du weißt sehr gut, dass ich nicht deswegen gegen Harold White bin, wie sehr du dich auch bemühst, davon abzulenken.«
»Die Derings sind engstirnig«, sagte Vicky plötzlich.
»Lady Dering nicht. Sie ist ein guter Mensch, das ist sie immer gewesen, und gegen mich hat sie sich damenhafter benommen als sehr viele andere, die ich nennen könnte.«
»Und Hugh Dering ist ebenfalls engstirnig«, sagte Vicky störrisch. »Das wird eine blöde Party.«
»Nicht mit dem Fürsten«, sagte Ermyntrude.
»Falls jemand meine Meinung hören will«, warf Wally ein, »so wird dein Fürst noch das Tüpfelchen auf dem i sein. Aber mir kann’s ja egal sein, bloß erwarte nicht, dass ich ihn unterhalte!«
Ermyntrude sah ein wenig beunruhigt aus. »Aber Wally, du wirst nicht viel mehr zu tun brauchen, als ihn zur Jagd mitzunehmen.«
Wally stand vom Tisch auf und nahm die Zeitung unter den Arm. »Kommst du schon wieder damit! Ich habe es dir bereits wiederholt gesagt, dass die Jagd nichts für mich ist. Dabei fällt mir ein, dass ich Harold mein Jagdgewehr geborgt habe. Er hat es noch nicht zurückgebracht, ich kann also gar nicht auf die Jagd gehen, selbst wenn ich wollte.«
Das war zu viel, selbst für eine Frau von Ermyntrudes heiterer Gemütsart. Hitzig sagte sie: »Dann wirst du Harold White eben sagen, er soll es zurückbringen, Wally, und wenn du’s nicht tust, dann tue ich es! Wie kommst du überhaupt dazu, Geoffreys Gewehr zu verborgen, ohne auch nur zu fragen!«
»Vielleicht hätte ich eine spiritistische Sitzung veranstalten sollen«, sagte Wally.
Ermyntrude errötete und sagte, den Tränen nahe, mit schwankender Stimme: »Wie kannst du nur so reden? Es ist dir wohl ganz egal, ob du meine Gefühle verletzt!«
»Also wirklich, du bist grässlich brutal!«, rief Vicky.
»Schon gut, schon gut.« Wally zog sich in Richtung Tür zurück. »Deswegen braucht ihr nicht gleich hochzugehen! Wenn man mit jeder völlig harmlosen Bemerkung eine Szene riskiert – hör auf zu heulen, Ermy! Du hast gar keinen Grund. Man könnte meinen, Harold würde dem Gewehr etwas tun!«
»Er soll es zurückbringen!«, sagte Vicky. »Wie kannst du Mutter so schrecklich aufregen!«
»Jaja, schon gut!«, erwiderte Wally gereizt. »Um des lieben Friedens willen!«
Kaum hatte er das Zimmer verlassen, gab Vicky die Pose der Beschützerin auf und widmete sich wieder ihrem Frühstück. Ermyntrude sah Mary reumütig an und sagte: »Entschuldige, Mary, aber erst dieser White, der wirklich lästig ist, und dann noch die Flinte von meinem armen ersten Mann – das ging mir einfach über die Hutschnur. Ich wollte, die Whites zögen aus und ließen sich anderswo nieder. Sie verleiden mir den ganzen Besitz hier.«
»Es ist, als ob man Harold Whites Einfluss spürte«, sagte Vicky mit kunstfertigem Erschauern.
Mary stand auf. »Bring deine Rollen nicht durcheinander!«, rief sie. »Das passt nicht zu deiner sportlichen Aufmachung.«
»Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich Hosen anhabe!«, sagte Vicky, nicht im Geringsten beleidigt. »Ich glaube, ich werde mich umziehen.«
Mary hatte zu dieser frühen Morgenstunde keine Lust, sich auf Vickys Kapricen einzulassen; sie holte einen Korb und eine Schere und ging in den Garten, um frische Blumen zu schneiden.
Es war ein ausnehmend schöner Morgen. Als Mary durch den Garten ging, blickte sie zum Dower House hinüber. Eigentlich war nichts dagegen zu sagen, aber seit der jetzige Bewohner Harold White dort eingezogen war, wirkte das Haus so unheimlich, dass sie beim Anblick des durch die Bäume schimmernden grauen Daches gelegentlich einen Schauder empfand; ja, ihre Abneigung ging neuerdings so weit, dass sie sich gelegentlich weigerte, den gewundenen Pfad durch das Rhododendrondickicht zu dem einfachen Holzbrückchen hinunterzugehen, das den Bach überquerte. Diese Brücke war ursprünglich als bequeme Verbindung zwischen den beiden Häusern über den Bach geschlagen worden, zweifellos eine Annehmlichkeit für die früheren Besitzer von Palings, für Ermyntrude jedoch eine Quelle ständigen Ärgers, weil sie einen freien Blick auf das Dower House bot. Sie hatte verschiedentlich erwogen, die Brücke abreißen zu lassen, und wenn sie auch nicht so weit gegangen war, so hatte sie doch vor ein paar Monaten dafür gesorgt, dass auf ihrer Seite des Baches ein Pförtchen angebracht wurde. Das hätte deutlich genug sein sollen, aber Harold White kehrte sich nicht daran, sondern fuhr fort, die Brücke zu benutzen, sooft er Wally besuchte.
Zum Glück geschah das nicht oft. Im Gegensatz zu Wally war White kein Privatier, sondern Geschäftsführer einer kleinen Gruppe von Kohlengruben. Seine Tochter Janet führte ihm den Haushalt, und sein Sohn Alan, ein paar Jahre jünger als Janet, wohnte zu Hause und war bei einem Anwalt in dem Nachbarstädtchen Fritton in der Lehre. Vor Wallys Heirat mit der reichen Mrs. Fanshawe hatte White, dessen Gehalt nie mit seinen Ausgaben in Einklang zu bringen war, ziemlich unkomfortabel in einer kleinen Villa im Ort selbst gewohnt; doch als Wally nach Palings übersiedelte, hatte Harold White bald entdeckt, dass sie entfernt miteinander verwandt seien. Das Übrige war leicht gewesen. Wally hatte Ermyntrude ohne Schwierigkeiten dazu überreden können, das Dower House – das zufällig gerade leer stand – White zu einem günstigen Mietpreis zu überlassen. Von da an datierte – das ließ sich nicht bestreiten, und Ermyntrude behauptete es steif und fest – Wallys zunehmende Vorliebe für starke Getränke, und auch seine Ausflüge in weniger respektable Bereiche nahmen zu jener Zeit ihren Anfang. Harold White ermutigte ihn dazu, mehr zu trinken, als für ihn gut war, verleitete ihn zum Wetten und vermittelte ihm unerwünschte Bekanntschaften.
Wenn Mary Harold White auch äußerst unsympathisch fand, so pflichtete sie Ermyntrude jedoch nicht darin bei, er sei Wallys böser Geist. Da sie viele Jahre mit Wally zusammengelebt hatte, machte sie sich weniger Illusionen und hatte längst gemerkt, dass es ihm an Charakterstärke gebrach. Er fühlte sich von Natur aus zu schlechter Gesellschaft hingezogen und ging todsicher bei jeder Gelegenheit den Weg des geringsten Widerstandes. Mary musste anerkennen, dass er sich als Vormund ihr gegenüber sehr gütig verhalten hatte, doch sie kannte ihn zu gut, um nicht zu wissen, dass das kleine Einkommen, das ihr vierteljährlich für Unterhalt und Ausbildung ausgezahlt wurde, Wally sehr zupassgekommen war.
Während Mary ihren Korb mit Rosen ins Haus trug, dachte sie, dass Wally jetzt, da sie erwachsen und heiratsfähig war, zu einer gewissen Belastung für sie wurde.
Sie hatte bestritten, dass sie mit Mr. Hugh Dering mehr als nur gut bekannt sei; streng genommen stimmte das, und doch hatte sie das Gefühl, mit Hugh nicht nur durch langjährige Bekanntschaft, sondern durch echte Sympathie verbunden zu sein. Obwohl Dering in London wohnte, wo er vermutlich mit hübscheren, reizvolleren und bestimmt standesgemäßeren Mädchen als Mary Cliffe zusammenkam, schien keine dieser unbekannten jungen Damen sein Herz gewonnen zu haben, und wenn er zu seinen Eltern zu Besuch kam, suchte er stets sofort Mary auf. Wie seine Mutter, die als vorurteilslose Frau bekannt war, darüber dachte, wusste Mary nicht, aber Sir William Dering hegte bestimmt keine große Sympathie für Wally Carter. Jedenfalls war es überraschend, dass sie Ermyntrudes Einladung angenommen hatten. Ob Hugh dahintersteckte?
2. Kapitel
Sir William Dering fand es ebenso überraschend wie Mary Cliffe, dass er demnächst in Palings dinieren sollte. Er starrte seine Frau unter seinen furchterregenden buschigen Brauen an und begehrte zu wissen, ob sie den Verstand verloren habe.
»Keineswegs – ich bin völlig bei Sinnen«, erwiderte Lady Dering, ohne sich von Sir Williams kriegerischem Ton imponieren zu lassen. »Das lasse ich mir nicht um die Welt entgehen! Die erstaunliche Ermyntrude hat einen russischen Fürsten ausgegraben!«
»Guter Gott!«, rief Sir William. »Du willst mir doch nicht etwa erzählen, dass du diese Einladung bloß wegen dieses lächerlichen ausländischen Fürsten angenommen hast?«
In Lady Derings freundlichen grauen Augen blitzte es humorvoll. »Nein, nicht nur. Aber ein russischer Fürst in dieser Umgebung! Du kannst nicht verlangen, dass ich mir etwas so Pikantes entgehen lasse!«
Diese Antwort besänftigte Sir William keineswegs. Bestürzt fragte er vielmehr: »Meine liebe Ruth, lässt du dich nicht von deinem Sinn für Humor zu weit fortreißen? Zum Kuckuck, du kannst doch nicht die Gastfreundschaft dieser Leute annehmen, bloß um dich über sie lustig zu machen!«
»Mein Dummchen!«, sagte Lady Dering zärtlich. »Das will ich ja gar nicht.«
»Du hast gesagt –«
»Nein, Liebling, nichts dergleichen. Ich mache mich nie über jemanden lustig, außer über dich. Aber ich gedenke mich prächtig zu amüsieren.«
»Also, das gefällt mir gar nicht. Ich habe nichts gegen Mrs. Carter, abgesehen davon, dass sie eine ziemlich gewöhnliche Person ist, angemalt bis dorthinaus und viel zu stark parfümiert, doch diesen Carter kann ich nun einmal nicht ausstehen. Wir haben immer Abstand gewahrt, und nun – weiß der Himmel, worauf wir uns da einlassen!«
»Hin und wieder eine Einladung zum Essen.«
»Aber wieso?«, fragte Sir William. »Sag nicht, dass es wegen dieses russischen Fürsten ist!«
»Lieber William, du bist reizend, wenn du so dummes Zeug redest. Die erstaunliche Ermyntrude wird unser Krankenhaus bauen.«
»Was?«
»Ja, sie wird uns einen Scheck über einen anständigen Betrag geben. Das ist mit ein paar Abendeinladungen nicht zu teuer erkauft, finde ich.«
»Ich nenne das widerlich!«, sagte Sir William heftig.
»Nenn es, wie du willst, mein Lieber, aber du weißt genauso gut wie ich, dass die Dinge so gemacht werden. Ermyntrude hat ein gutes Herz, aber sie ist nicht dumm, und sie hat eine Tochter, der sie einen Start geben muss. Ich habe absolut nichts dagegen, ihr nützlich zu sein, wenn sie unser Krankenhaus ermöglicht.«
»Meinst du damit, dass du mit dieser Frau ein schmutziges Geschäft machen willst?«
»Guter Gott, nein! Nichts dergleichen. Ich werde ihr lediglich sagen, dass wir uns freuen würden, wenn sie dem Komitee beiträte, und dass wir hoffen, dass sie und ihr Mann nächsten Monat zum Essen zu uns kommen können, wenn Charles und Pussy bei uns sind. Keine Rede von einem schmutzigen Geschäft, das verspreche ich dir!«
»Zum Übelwerden!«, erklärte Sir William. »Am besten gehst du gleich noch einen Schritt weiter und sagst Carter, dass wir entzückt sein würden, sein Mündel in unsere Familie aufzunehmen.«
»Das wäre übertrieben«, erwiderte Lady Dering gelassen. »Im Übrigen weiß ich gar nicht, ob ich so restlos entzückt wäre.«
»Du überraschst mich!«, sagte ihr Gebieter sarkastisch.
Das Gesprächsthema wurde nicht weiterverfolgt, da ihr Sohn und Erbe den Schauplatz betrat. Hugh Dering in grauen Flanellhosen und einer alten Tweedjacke schlenderte über den Rasen und setzte sich neben seine Mutter auf die hölzerne Gartenbank.
Er war ein stattlicher, recht gut aussehender junger Mann von Ende zwanzig und stand im Begriff, sich beim Kanzleigericht eine Praxis aufzubauen. Er hatte die Augen seiner Mutter, aber den strengen Mund seines Vaters und konnte, je nach Stimmung, äußerst liebenswürdig, aber auch sehr ablehnend sein.
Im Augenblick war er liebenswürdig. Er stopfte sich seine Pfeife und bemerkte fröhlich: »Nun, Ma? Geheime Beratung?«
»Nein, kein bisschen. Vater und ich sprachen gerade über die morgige Party.«
Hugh grinste anerkennend. »Vielleicht ganz nützlich, würde ich denken. Bist du auch zur Jagd eingeladen, Vater?«
»Nein«, erwiderte Sir William, »und wenn ich’s wäre, hätte ich abgelehnt.«
»Ich war nicht ganz so stolz«, sagte Hugh, sanft den Tabak in den Pfeifenkopf pressend.
»Willst du damit sagen, dass du morgen auf diese Jagd gehst?«
»Freilich! Warum nicht?«
Sir William versank in Schweigen, während seine Frau Hugh fragte, ob er Vicky Fanshawe schon begrüßt habe.
»Nein, das Vergnügen habe ich noch vor mir. Mary sagt, man muss sie sehen, um sie zu glauben.«
»Wieso?«
»Sie scheint eine Nummer für sich zu sein. Eine richtige Komödiantin.«
»Sie sieht sehr niedlich aus. Wie ich höre, sind die jungen Leute aus der Nachbarschaft alle ganz verrückt nach ihr.«
»Blondinen bevorzugt – die alte Wahrheit«, sagte Hugh, ein Streichholz anreißend. »Kommt der russische Fürst in die engere Wahl?«
»Meine Güte, das weiß ich nicht! Eine reizende Idee! Es wird morgen bestimmt amüsant!«
»Ich wollte wirklich, du hättest dich nicht verleiten lassen, die Einladung dieser Frau anzunehmen!«, sagte Sir William.
»Da bin ich anderer Meinung!«, widersprach Hugh. »Ich bin fest entschlossen, mich zu amüsieren. Eine betörende Blondine und ein russischer Fürst – das verspricht doch einen ganz besonderen Abend. Mary fürchtet sich etwas vor dem russischen Fürsten, wie sie mir sagte, aber andererseits muss sie natürlich die Komik der Situation anerkennen. Hoffentlich entspricht der Fürst unseren Ansprüchen. Er dürfte inzwischen angekommen sein.«
Der Fürst war in der Tat angekommen, und gerade in diesem Augenblick beugte er sich über die weiche Hand seiner Gastgeberin. Er war sehr dunkel und von unbestimmtem Alter, aber er sah außerordentlich gut aus mit seiner vorbildlich schlanken Figur und den blitzenden Zähnen, und seine Manieren waren wirklich höchst elegant. Als er Ermyntrudes Hand an die Lippen führte, konnte sie sich nicht enthalten, ihrem Mann und Mary einen triumphierenden Blick zuzuwerfen.
»Meine liebe gnädige Frau!«, murmelte der Fürst. »So strahlend wie eh und je. Ich bin hingerissen! Und die kleine Vicky! Aber nein! Das ist ja gar nicht die kleine Vicky!«
Er hatte sich, die wohlmanikürte Hand ausgestreckt, zu Mary gewandt. Sie reichte ihm die Hand, die er festhielt, wobei er Ermyntrude mit seinen lächelnden dunklen Augen fragend ansah.
»Nein, das ist das Mündel meines Mannes, Miss Cliffe«, sagte Ermyntrude. »Und dies ist mein Mann. Wally, das ist Fürst Warasaschwili.«
»Hocherfreut!«, sagte der Fürst, Marys Hand loslassend und Wally die Hand drückend. »Von Ihnen habe ich schon viel gehört!«
Wally sah ganz erschrocken aus, aber bevor er fragen konnte, wer ihm etwas über ihn erzählt haben mochte, wandte Ermyntrude sich an den Fürsten und erbot sich, ihn in sein Zimmer zu geleiten.
Seine harmlose Bemerkung hatte Wallys Vorurteil gegen ihn erheblich gesteigert, und kaum war der Gast in Ermyntrudes Kielwasser die Treppe hinauf im Obergeschoß verschwunden, als Wally sein Benehmen, seinen Anzug und seine ganze Erscheinung zu kritisieren begann. »Ein richtiger Gigolo!«, sagte er zu Mary. »Wo nimmt er eigentlich das Geld her, um so aufgedonnert herumzulaufen? Kannst du mir das bitte sagen?«
Das konnte Mary nicht, aber da Ermyntrude ihr nicht verraten hatte, ob der Fürst einer einträglichen Beschäftigung nachging, konnte sie sich des Gefühls nicht erwehren, dass an Wallys Vermutung etwas Wahres sein könnte. Da sie noch nie über Englands Grenzen hinausgekommen war, schrieb sie die etwas zu elegante Aufmachung des Fürsten der Tatsache zu, dass er Ausländer war. Auf einem englischen Landsitz wirkte er etwas fehl am Platz, fand sie, und obgleich sie ihm gegenüber zu jeglicher Nachsicht bereit war, hoffte sie, dass sein Besuch nicht von langer Dauer sein werde.
Ermyntrude hatte ihren Gast inzwischen in das beste Gästezimmer geführt und die innige Hoffnung ausgesprochen, er möge sich dort wohl fühlen. Er versicherte ihr, dass er sich selbstverständlich wohl fühlen werde, küsste ihr noch einmal die Hand und sagte, sie festhaltend: »Nun endlich sehe ich Sie in Ihrer eigenen Umgebung! Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie bezaubernd ich alles finde. Und Sie! So schön! So anmutig!«
Niemand hatte je so zu Ermyntrude gesprochen, nicht einmal der selige Geoffrey Fanshawe in der ersten Glut seiner Verliebtheit. Eigentlich war sie eher an scharfe, kritische Bemerkungen über ihre mangelhafte Erziehung gewöhnt; und da sie eine sehr demütige Frau war, hatte sie das Urteil ihrer Mitmenschen stets akzeptiert. Kein Wunder also, dass diese schmeichelhaften Worte sie entzückten, zumal sie aus dem Munde eines echten Fürsten kamen, und dass sie keinen Versuch machte, ihm ihre Hand zu entziehen. Sie errötete sogar recht lieblich unter ihrer Schicht von Rouge und Puder und fragte ganz naiv, ob Alexis finde, dass die Umgebung zu ihr passe.
»Sie sind so vielseitig – zu Ihnen passt alles! Sie würden auch in einem Dachstübchen schön sein«, antwortete er ernsthaft. »Und doch – darf ich es sagen? –, seit unserer ersten Begegnung habe ich immer das Gefühl gehabt, dass irgendetwas in Ihrem Leben fehlt. Ich glaube, Sie sind unverstanden. Äußerlich sind Sie so heiter, dass jeder sagt: ›Sie hat alles, um glücklich zu sein, die schöne Mrs. Carter – einen Gatten, eine reizende Tochter, viel Geld, viel Schönheit!‹ Vielleicht habe nur ich in diesen blitzenden Augen etwas gesehen – wie soll ich es ausdrücken? –, etwas wie Einsamkeit, die Einsamkeit einer Seele, die für alle ein Geheimnis ist, selbst für jene, die Ihnen am nächsten stehen.«
Ermyntrude seufzte leise und schenkte dem Fürsten einen vielsagenden Blick. »Ist es nicht merkwürdig?«, sagte sie. »Ich hatte von Anfang an das Gefühl, Sie seien das, was man verständnisvoll nennt.«
Er drückte ihre Hand. »Ein Band der Sympathie verbindet uns. Sie haben es auch bemerkt, denn Sie sind nicht wie Ihre anderen Landsmänninnen. Sie sind eine echte Weltbürgerin.«
Ermyntrude hätte dieses Gespräch liebend gern bis ins Unendliche fortgesetzt, aber in diesem Augenblick wurden die Koffer des Fürsten gebracht, so dass sie sich mit Bedauern zurückzog.
In gehobener Stimmung gesellte sie sich zu Wally und Mary. Ihre Haltung hatte etwas Königliches, was Wally nicht entging, der unverzüglich fragte, warum sie wie ein sterbender Schwan einhersegele. Sie beruhigte sich so weit, dass sie ihm in energischem Ton mitteilen konnte, wenn er ordinär sein wolle, so möge er es dort sein, wo er damit willkommen wäre; denn ungeachtet aller Anmut und Schönheit und Einsamkeit der Seele war sie eine mutige und tatkräftige Frau und sah keinen Grund, warum sie sich von Wally oder sonst irgendjemandem Grobheiten gefallen lassen sollte. Aber es war nur ein vorübergehendes Auftauchen aus der Entrücktheit, in der sie sich befand. Mit beachtlicher Grazie für eine Frau ihres Umfangs sank sie träumerisch in einen Armsessel.
Bald darauf trat der Fürst ein. Er setzte sich und streichelte den Spaniel, der ihn freundlich begrüßte. »Was für ein schöner Hund, Trudinka! Ja, du bist ein schönes, gutes Tier, darum geht es dir auch besser als mir, siehst du. So ein schönes Haus hast du, und die bösen Bolschewisten werden es bestimmt nicht abbrennen.«
»Hat man Ihr Haus abgebrannt?«, fragte Ermyntrude entsetzt.
Er breitete die Hände aus. »Krieg ist Krieg, Trudinka. Ich kann von Glück sagen, dass ich mein Leben gerettet habe.«
»Wie schrecklich für Sie!«, sagte Mary, denn irgendwie musste sie sich wohl dazu äußern. »Ich wusste nicht, dass die Bolschewisten in Georgien so schlimm gehaust haben.«
»Haben Sie alles verloren?«, fragte Ermyntrude.
»Alles!«, erwiderte der Fürst.
Diese lapidare Antwort, die das Bild eines unvorstellbaren Verlustes heraufbeschwor, ließ die Zuhörer verstummen. Mary schalt sich prosaisch, als sie überlegte, dass der Fürst in seiner Großzügigkeit seinen Siegelring und sein goldenes Zigarettenetui und vielleicht noch einige andere derartige Kleinigkeiten nicht berücksichtigt hatte.
Um die etwas gespannte Atmosphäre aufzulockern, wunderte Ermyntrude sich hörbar darüber, dass Vicky noch nicht da war. Der Fürst stimmte ihr bei und schüttelte seine düsteren Gedanken ab. Vicky erschien, kurz nachdem der Teetisch gedeckt worden war. Mary machten Vickys Possen immer etwas ungeduldig, andererseits hatte sie zu viel Humor, um diesen Auftritt nicht zu würdigen.
Der sportliche Aufzug war verschwunden. Vicky trug ein faltenreiches Teekleid aus Chiffon, das ihre Glieder umfloss und in einer kleinen Schleppe auslief. Lautlos trat sie herein, die Hand leicht auf den Nacken des Barsois gelegt, und blieb, sich tragisch und gedankenverloren umsehend, einen Augenblick stehen. Der Barsoi, dem es an schauspielerischem Talent mangelte, entschlüpfte dem unmerklichen Druck ihrer Hand, um den Fürsten zu beschnuppern.
Ermyntrude fand weder das Teekleid noch das exotische Air, das ihre Tochter sich gab, irgendwie lächerlich. Der gute Auftritt fand ihren Beifall. Sah Vicky nicht einfach bezaubernd aus? Sie machte sie mit dem Fürsten, der aufgesprungen war, bekannt.
Wally zog sich unter Mitnahme des Spaniels zurück, während Mary blieb, eine nicht sehr gesprächige, aber interessierte Zuhörerin bei der Komödie, die vor ihr über die Bühne ging. Sie hatte den Fürsten ziemlich bald als Mitgiftjäger klassifiziert und sich ein bisschen darüber gewundert, dass er seine Zeit an die verheiratete Ermyntrude verschwendete. Nun kam ihr der Verdacht, dass seine Pläne Vicky betrafen, denn er widmete sich ihr sehr zuvorkommend und zog Ermyntrude eigentlich nur ins Gespräch, um seine Ansichten über Vickys unergründliche Seele bekräftigen zu lassen.
Nach einiger Zeit wurde Mary es müde, sich Albernheiten anzuhören, und verließ das Zimmer. Den Fürsten sah sie erst beim Essen wieder, aber sie ging, sobald sie sich umgezogen hatte, zu Vicky, um ihr ernste Vorhaltungen zu machen.
Vicky war damit beschäftigt, ihre blonden Locken zu kunstvollen Gebilden aufzutürmen. Sie lächelte Mary fröhlich zu und sagte mit entwaffnender Offenheit: »Sieh mal, wirkt das nicht sehr erwachsen und ziemlich abstoßend? Ich fühle mich wie eine richtige femme fatale.«
»Ach, wenn du doch nicht ununterbrochen Theater spielen wolltest!«, sagte Mary. »Wirklich, du machst dich doch bloß zum Narren! Mit neunzehn kann man nicht wie eine femme fatale aussehen.«
»Doch, mit Lidschatten kann ich«, erwiderte Vicky optimistisch.
»Lass es lieber. Und wenn du’s für den Fürsten tust – ich halte ihn für einen faulen Kunden.«
»Oh, ich auch!«, pflichtete Vicky ihr bei.
»Warum in aller Welt führst du dann diese widerliche Komödie auf?«
»Es macht mir Spaß. Ich wollte, ich könnte zur Bühne gehen.«
»Hier ist dein Talent bestimmt verschwendet. Was glaubst du – warum ist der Fürst hier?«
»Nun, vermutlich, weil Mama so reich ist.«
»Ja, aber er hat doch gewusst, dass sie verheiratet ist.«
»Aber sie könnte sich von Wally scheiden lassen, nicht wahr? Ich finde das alles ganz furchtbar raffiniert von Alexis, nur ist Ermyntrude sehr ehrbar, also wird ihm vielleicht nichts übrig bleiben, als Wally zu ermorden.«
»Red doch nicht solchen Quatsch!«, sagte Mary ungeduldig.
»Doch, ich glaube wirklich, das könnte ganz leicht so kommen«, sagte Vicky, während sie großzügig Lidschatten auflegte. »Sieh mal, Liebling, sehe ich nicht großartig und gefährlich aus? Ich finde die Russen unheimlich, besonders Alexis.«
»Ich sehe nichts Unheimliches. Und du siehst scheußlich aus.«
»Hässlich scheußlich oder verworfen scheußlich? Ich traue seinem Lächeln nicht. Wie Samt, und etwas im Hintergrund seiner Augen lässt mich ein bisschen frösteln.«
»Verschwende deine Phantasie nicht an mich; du könntest kein schlechteres Publikum haben.«
»Ich habe nur geprobt«, sagte Vicky unbeirrt. »Glaubst du, dass es Spaß macht, Geheimagentin zu sein?«
»Nein. Warum?«
»Ach, ich weiß nicht. Bloß dass ich wie Sonja die Spionin aussehe, und außerdem kommt Robert Steel nach dem Essen auf einen Sprung herüber.«
»Ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat.«
»Ach, eigentlich nichts. Ich habe ihn aufgefordert, weil sich dann eine richtige Situation ergibt, und ich finde, Robert und Alexis und Wally sind ein reizendes Dreieck. Verhaltene Leidenschaften und so.«
»Vicky!«, rief Mary schockiert.
Vicky war gerade dabei, ihre Lippen nachzuziehen, und konnte nur ganz undeutlich sprechen. »Robert könnte Alexis ermorden. Und Mama wird jedenfalls merken, welcher der Solidere ist, und Alexis vielleicht nicht mehr so aufregend finden. Irgendetwas wird schon passieren.«
»Hör zu, Vicky, das ist kein Spaß!«, sagte Mary streng. »Du solltest nicht so von deiner Mutter sprechen.«
»Ach, Liebling, du bist wirklich süß!«
Diese Antwort ärgerte Mary so sehr, dass sie aus dem Zimmer und hinunter ins Wohnzimmer ging. Hier fand sie den Fürsten in hochelegantem Smoking und einer durch Perlknöpfe verschönten Pikeehemdbrust. Er warf die Zeitung, in der er gelesen hatte, beiseite. Als hätte er gemerkt, dass er bisher keinen günstigen Eindruck auf Mary gemacht hatte, gab er sich die größte Mühe, ihr zu gefallen, und hatte damit recht guten Erfolg. Doch gerade, dass er sich in Gespräch und Benehmen ihrem Geschmack anpasste, erweckte in ihrem Herzen eine gewisse Feindseligkeit, zumal ihr nicht klar war, warum er sich bei ihr beliebt machen wollte.
Das Essen verlief ohne Zwischenfall: Wally hielt den Fürsten nicht lange beim Portwein zurück, sondern führte ihn bald ins Wohnzimmer; seine Miene war schläfrig-resigniert.
Die Frage, wie der Abend weitergehen sollte, begann Ermyntrude zu beunruhigen, denn obwohl sie ein Tête-à-tête mit dem Fürsten sehr genossen hätte, war ein Abend ohne Kartenspiel oder Tanzen in ihren Augen nicht nur langweilig, sondern auch ein schlechtes Zeugnis für die Gastgeberin.
Vicky glitt, eine fünfzehn Zentimeter lange Zigarettenspitze in den Fingern, durchs Zimmer und stellte das Radio an. Ermyntrude wollte gerade um etwas Lebhafteres bitten, als sie merkte, dass der Fürst mit einem gleichsam wehmütigen Entzücken leise »Rimski-Korsakow« vor sich hin murmelte.
In diesem Augenblick wurde der von Vicky geladene Gast gemeldet, ein kräftiger, breitschultriger Mann mit krausem Haar, leicht ergrauten Schläfen und freimütig blickenden, kühlen grauen Augen unter zottigen Brauen.
Ermyntrude stand überrascht, aber nicht unangenehm berührt auf und rief: »Nanu, Bob! Wer hätte das gedacht! Also, das finde ich wirklich nett!«
Robert Steel nahm ihre Hand mit festem Druck und erklärte errötend und etwas verlegen, dass Vicky ihn eingeladen habe. Als er der jungen Dame ansichtig wurde, zwinkerte er ihr zu.
Nun musste Ermyntrude ihn dem Fürsten vorstellen. Sie waren ein sonderbarer Gegensatz – der eine schlank, hübsch und lächelnd, der andere stämmig, robust und ein bisschen düster. Mary, die Steels stille Verehrung für Ermyntrude kannte und bedauerte, fand es nicht verwunderlich, dass er heute noch zurückhaltender als sonst war, denn Ermyntrude hing förmlich an den Lippen des Fürsten. Die Situation wurde nicht besser dadurch, dass Wally zwar nicht lange beim Portwein gesessen, sich aber vor dem Essen mit einer Anzahl Drinks gestärkt hatte, so dass er jetzt etwas triefäugig aussah. Steel presste die Lippen zusammen, als er ihn sah, und beschränkte sich auf ein kurzes »Guten Abend«.
Wenn Vicky beabsichtigt hatte, eine ungemütliche Atmosphäre zu schaffen, so war ihr das auf bewundernswerte Weise gelungen, überlegte Mary. Sie machte, nachdem sie Steel in die Gesellschaft eingeführt hatte, nicht den geringsten Versuch, die Stimmung aufzulockern. Sie stand, an die bernsteinfarbenen Seidenvorhänge gelehnt, neben dem Radio, das sie so leise gestellt hatte, dass die Musik nur eine diskrete Untermalung der menschlichen Stimmen war. So blieb es dem Fürsten überlassen, Behaglichkeit zu verbreiten, was er zu Ermyntrudes Befriedigung und Steels stillem Ärger zumindest äußerlich tat.
»Nun, Bob, wie stehen die Felder und alles Übrige?«, fragte Ermyntrude freundlich. Zu dem Fürsten gewandt, setzte sie hinzu: »Mr. Steel hat nämlich eigene Landwirtschaft.«
»Ja, ich bin ein Bauer«, erklärte Steel etwas streitlustig, um von vornherein die Annahme, er arbeite vielleicht zu seinem Vergnügen, zurückzuweisen.
»Ah, phantastisch!«, lächelte der Fürst. »Leider verstehe ich gar nichts von dieser Kunst!«
»Von Kunst ist da nicht viel die Rede«, antwortete Steel. »Das ist harte Arbeit.«
Von ihrem Posten außerhalb der Sitzgruppe ließ Vicky sich gedankenvoll vernehmen: »Ich finde, die Landwirtschaft hat etwas Erschreckendes.«
»Erschreckendes?«, wiederholte Steel.
»Ja, etwas Urweltliches«, murmelte Vicky. »Der Kampf gegen die Natur, die Wildheit des Bodens.«
»Wovon reden Sie eigentlich?«, fragte Steel. »Das ist ja reiner Blödsinn.«
»Aber nein, man sieht doch genau, was sie meint!«, rief der Fürst.
»Ich leider nicht«, erwiderte Steel. »Kampf gegen die Natur! Ich versichere Ihnen, ich verstehe kein Wort, junge Dame!«
»Der Regen. Und das Unkraut«, seufzte Vicky.
»Das stimmt«, mischte Wally sich unerwartet ins Gespräch. »Schwarze Fingernägel kriegt man auch. Ja, es ist ein langer Kampf!«
»Es ist ein gutes Leben«, sagte Steel.
»Je nachdem, was Sie sich unter einem guten Leben vorstellen. Für mich wäre es jedenfalls nichts. Womöglich mitten in der Nacht aufstehen, weil ein Schaf ein Lämmchen kriegt! Nein wirklich, vielen Dank!«
»Das genügt!«, sagte Ermyntrude. »Es besteht kein Anlass, gewöhnlich zu werden.«
Das Thema Landwirtschaft schien erschöpft zu sein. Ein unbehagliches Schweigen entstand. Der Fürst begann mit Ermyntrude Erinnerungen an Antibes auszutauschen. Steel, der nicht dort gewesen war, sagte, sein eigenes Land sei gut genug für ihn, worauf der Fürst mit verbindlicher Höflichkeit erwiderte, das sei es wohl für jeden.
Es war eine willkommene Ablenkung, als man draußen auf der Terrasse Schritte hörte. Der Abend war so warm, dass die Terrassentür offen stand. Plötzlich erschien zwischen den Vorhängen ein Gesicht, und Harold White fragte mit etwas unangebrachter Scherzhaftigkeit: »Hallo! Jemand zu Hause?«
Nur Wally begrüßte den Eindringling einigermaßen freudig. Er erhob sich und forderte seinen Freund auf, näher zu treten, und als hinter White auch dessen Sohn und Tochter ins Zimmer traten, sagte er: »Immer herein! Je mehr, desto lustiger.«
White und Sohn hatten sich offensichtlich nicht umgezogen, was Ermyntrude noch in ihrem Vorurteil bestärkte. Die Tochter Janet, eine etwas unbedeutende junge Dame, trug ihr so genanntes kleines Abendkleid, das, wie alle ihre Röcke, an mehreren Stellen zipfelte. Sie wandte sich sogleich an Ermyntrude und sagte ängstlich lächelnd: »Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass wir so hereingeschneit kommen, Mrs. Carter! Vater wollte nämlich Mr. Carter sprechen, und da dachte ich, Sie werden wohl nichts dagegen haben, wenn Alan und ich mitkommen. Aber wenn es Ihnen nicht passt – ich meine, wenn es Ihnen lieber ist, wenn wir –«
Ermyntrude unterbrach das unsichere Gestammel, indem sie mit aller ihr zur Verfügung stehenden Herzlichkeit sagte: »Sie wissen doch, liebes Kind, dass ich mich immer freue, Sie und Alan zu sehen. Dies ist Fürst Alexis Warasaschwili.«