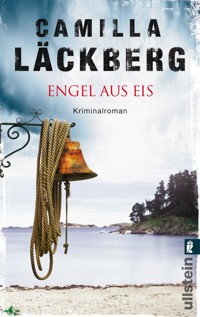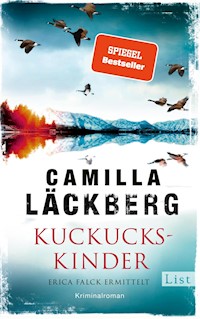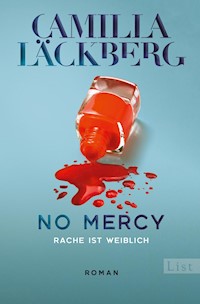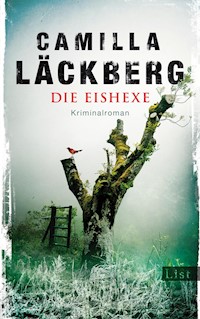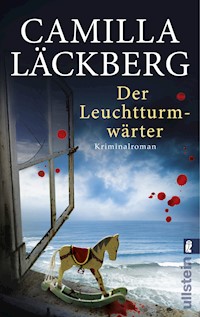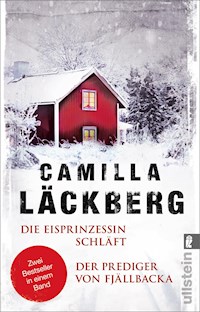0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mörderische Aussichten
- Sprache: Deutsch
Verschwörungen, Nervenkitzel, Psychoterror, knifflige Mordfälle und dunkle Geheimnisse – all das erwartet Sie in dieser Leseproben-Sammlung. Im Psychothriller »Die Komplizen« von John Katzenbach sucht College-Student Connor Mitchell im Darknet nach Spuren des Mannes, der vor Jahren den Tod seiner Eltern verursacht hat – und stößt auf den Chatroom einer Gruppe von Serienkillern, die sich »Jack's Boys« nennen und nach dem Vorbild ihres Idols Jack the Ripper morden. Als Connor in ihr Allerheiligstes eindringt, macht ihn das prompt zum nächsten Zielobjekt der perfektionistischen Psychopathen ... Folgen Sie dem Zimmermädchen Molly Gray in das altehrwürdige Londoner Regency Grand Hotel in Nita Prose' »The Maid«: Als Molly den schwerreichen Mr. Black tot in einem zerwühlten Zimmer vorfindet und sie plötzlich zur Hauptverdächtigen wird, nimmt sie die Ermittlungen selbst in die Hand, um die Ordnung in ihrem Hotel wieder herzustellen. Humorvoll geht es im Roman »Rosenkohl und tote Bete« von Mona Nikolay zu: Die Ruhe von Ex-Polizist Manne Nowak wird in der Berliner Kleingartenanlage »Harmonie« empfindlich gestört, als eine Leiche im Gemüsebeet seiner neuen Nachbarn auftaucht. Nicht nur, dass sie vom Gärtnern keine Ahnung zu haben scheinen – nun wollen sie auch noch selbst ermitteln. Na das kann ja heiter werden! Diese und weitere Geschichten von Autor*innen wie Val McDermid, Anders de la Motte, Lisa Jackson und Carine Bernard finden Sie in den Mörderischen Aussichten von Droemer Knaur. Nervenkitzel und beste Unterhaltung garantiert! Das kostenlose eBook enthält Leseproben zu: - Camilla Läckberg & Henrik Fexeus, »Schwarzlicht« - Anders de la Motte & Måns Nilsson, »Der Tod macht Urlaub in Schweden« - Chris McGeorge, »Four Walls – Nur ein einziger Ausweg« - John Katzenbach, »Die Komplizen. Fünf Männer, fünf Mörder, ein perfider Plan« - Giulia di Fano, »Vier Signoras und ein Todesfall« - Mona Nikolay, »Rosenkohl und tote Bete« - Kimberly McCreight, »Freunde. Für immer.« - Nita Prose, »The Maid« - Chang Kuo-Li, »Der grillende Killer« - Gordon Tyrie, »Schottenkomplott« - Val McDermid, »1979 – Jägerin und Gejagte« - Lisa Jackson, »Liar – Tödlicher Verrat« - Carine Bernard, »Lavendel-Grab«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Camilla Läckberg / Nita Prose / Mona Nikolay / Chang Kuo-Li / Henrik Fexeus / Anders de la Motte / Måns Nilsson / Chris McGeorge / John Katzenbach / Giulia di Fano / Kimberly McCreight / Gordon Tyrie / Val McDermid / Lisa Jackson / Carine Bernard
Mörderische Aussichten:Thriller & Krimi bei Droemer Knaur
Ausgewählte Leseproben von Camilla Läckberg, John Katzenbach, Nita Prose, Mona Nikolay, Chang Kuo-Li u.v.m.
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Camilla Läckberg & Henrik Fexeus – Schwarzlicht
John Katzenbach – Die Komplizen
Nita Prose – The Maid
Mona Nikolay – Rosenkohl und tote Bete
Chang Kuo-Li – Der grillende Killer
Anders de la Motte / Måns Nilsson – Der Tod macht Urlaub in Schweden
Chris McGeorge – Four Walls – Nur ein einziger Ausweg
Giulia di Fano – Vier Signoras und ein Todesfall
Gordon Tyrie – Schottenkomplott
Kimberly McCreight – Freunde. Für immer.
Val McDermid – 1979 – Jägerin und Gejagte
Lisa Jackson – Liar – Tödlicher Verrat
Carine Bernard – Lavendel-Grab
Liebe Leser*innen,
in spannenden Zeiten braucht es spannende Lektüren! Unsere Frühjahrstitel für 2022 versprechen Rätselspannung, Nervenkitzel und allerlei menschliche Abgründe.
Wagen Sie sich mit Camilla Läckberg und Henrik Fexeus in eine düstere Welt voll Illusion und Täuschung und jagen Sie einem erbarmungslosen Countdown hinterher. Oder checken Sie mit Nita Prose’ Debütroman The Maid ins Regency Grand Hotel ein und ermitteln Sie zusammen mit Molly, die als Zimmermädchen mehr über die Hotelgäste weiß, als gut für sie ist.
Für alle, deren Sommerurlaub zu kurz war und die es jetzt schon wieder ins Warme zieht, halten unsere Neuerscheinungen allerlei bereit: Begeben Sie sich mit dem komischsten Krimi-Leseklub aller Zeiten auf eine wilde Fahrt nach Rimini – in Giulia di Fanos Vier Signoras und ein Todesfall. Oder reisen Sie mit unserem neuen Thriller-Star Chang Kuo-Li ins ferne Taiwan und lernen Sie den »Grillenden Killer« kennen. Klassische Krimi-Reiseziele wie die Provence dürfen natürlich nicht fehlen: Für ihren vierten Fall schickt Carine Bernard ihre Heldin Lilou Braque auf die Spur einer geheimnisvollen alten Handschrift. Währenddessen nimmt Gordon Tyrie Sie mit seinem zweiten Hebridenkrimi wieder mit auf einen turbulenten Trip nach Schottland – samt sprechendem Hochlandrind Thin Lizzy.
Alle, die ihre Freizeit lieber auf der heimischen Scholle verbringen, führt Mona Nikolay mit Rosenkohl und tote Bete in den Schrebergarten Harmonie e.V., dessen Idylle von einer Leiche im Blumenbeet getrübt wird. John Katzenbach derweil lässt Sie in Die Komplizen. Fünf Männer, fünf Mörder, ein perfider Plan eintauchen in die unheimlichen Tiefen des Darknets, während Kimberly McCreight offenbart, welche düsteren Abgründe hinter sogenannten wahren Freundschaften stecken – Hauptsache »Freunde. Für immer.« Diese und weitere ausgewählte Leseerlebnisse erwarten Sie in dieser Sammlung.
Wir wünschen viel Spaß und spannende Unterhaltung mit diesen exklusiven Vorableseproben unserer Neuerscheinungen für das Frühjahr 2022. Die Aussichten bleiben mörderisch!
Ihr Team von Droemer Knaur
Camilla Läckberg & Henrik Fexeus
Schwarzlicht
Wer ermordet eine Frau, indem er sie in eine Kiste sperrt und mit mehreren Schwertern durchbohrt? Weil der Fall an einen missglückten Zaubertrick erinnert, zieht die Stockholmer Kommissarin Mina Dabiri den Profiler Vincent Walder hinzu, der selbst als Mentalist auftritt. Doch wie Mina kommt auch Vincent mit Menschen nicht sonderlich gut zurecht. Erst als eine weitere Leiche auftaucht und Vincent einen Code entschlüsselt, der auf einen Countdown hindeutet, beginnen Mina und er einander zu vertrauen – und müssen feststellen, dass ihre eigenen dunklen Geheimnisse im Zentrum des Falls stehen.
Tuva trommelt nervös mit den Fingern auf dem Tresen. Sie ist immer noch im Café am Hornstull, obwohl sie längst mit der Arbeit fertig sein müsste. Ein Kunde, der sich soeben in der Ecke niedergelassen hat, sieht genervt zu ihr herüber, und sie wirft ihm einen tödlichen Blick zu. Sie prägt sich sein Aussehen ein und nimmt sich vor, diesem Kunden beim nächsten Mal kein Herz auf den Cappuccino zu streuen. Eher einen Mittelfinger.
Wenn sie unpünktlich ist, bekommt sie schlechte Laune. Und jetzt ist sie richtig spät dran. Ohne nachzudenken, streicht sie sich das lange blonde Haar hinters Ohr. Vor einer halben Stunde hätte sie Linus vom Kindergarten abholen müssen. Gegen die finsteren Mienen des Personals ist sie mittlerweile immun, aber ihr zweijähriger Sohn wird traurig sein. Und Tuva ist niemand, der Kinder traurig macht. Vor allem Linus nicht. Sie weiß nicht, wie oft sie schon gesagt hat, dass sie für ihn sterben würde. In Wirklichkeit ist es nicht ganz so einfach. Gott weiß, wie viel Mühe sie sich gibt. Extrem viel. Sie legt die Schürze ab, öffnet die Besenkammer und wirft die Schürze auf den überquellenden Wäschekorb. Sie kann erst gehen, wenn die Ablösung kommt. Wo um alles in der Welt bleibt er?
Martin, der Vater von Linus, war an dem Tag, als sein Sohn zur Welt kam, verreist. Tuva hat ihm das nicht zum Vorwurf gemacht, schließlich war sie zwei Wochen vor dem errechneten Termin mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht worden. Seltsam fand sie jedoch, dass Martin sie auch in den darauffolgenden Tagen nicht auf der Wochenstation besuchte. Die Entbindung war nicht ohne Komplikationen verlaufen. Sie war zu erschöpft gewesen, um sich alles genau zu merken, und erinnerte sich nur vage an Ärzte, die ihr und dem Baby immer wieder Blut abnahmen und schließlich befanden, dass alles gut sei. Genau wie Martin in den kurzen Textnachrichten, die sie während des Krankenhausaufenthalts bekam. Er würde kommen, schrieb er, müsse nur vorher noch ein paar Dinge erledigen. Im Gegensatz zu den verschwommenen Tagen auf der Wochenstation blieb ihr die leere Wohnung, die sie und Linus bei ihrer Rückkehr erwartete, messerscharf im Gedächtnis. Während sie unter Schmerzen ihren gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht hatte, hatte Martin seine Sachen gepackt und die Wohnung verlassen. Das hatte er offenbar mit den »Dingen« gemeint, die er noch »zu erledigen« hatte. Seitdem hatte sich das feige Arschloch weder blicken noch von sich hören lassen. Vielleicht auch besser so, denn sie hätte ihn höchstwahrscheinlich umgebracht, wenn er wieder aufgetaucht wäre.
Stattdessen hatte sie sich ganz auf Linus konzentriert. Sie und Linus gegen den Rest der Welt, wobei diese Welt leider viel zu oft zwischen ihnen stand. Wie zum Beispiel jetzt. Daniel, der für die Nachmittagsschicht eingeteilt war, hätte schon vor einer Stunde hier sein sollen, war aber immer noch nicht da. Sie musste ihn anrufen, um ihn zu wecken. Mittags um halb zwei. War sie mit einundzwanzig auch so verantwortungslos gewesen? Vermutlich. Kein Wunder, dass es mit ihm nicht funktioniert hatte. Sie sieht auf ihre Uhr.
Verfluchte Scheiße!
Sie schlüpft in ihre Daunenjacke und setzt sich die Mütze auf, dann bereitet sie zwei doppelte Espressos zu. Einen in einer normalen Tasse und einen im Pappbecher zum Mitnehmen.
Vermutlich ist es wieder mal Matti, der im Kindergarten auf sie warten muss. Matti, der Kindergärtner, den ihr Sohn manchmal Papa nennt. Matti wirft ihr jedes Mal diesen Blick zu, der sagen will, dass sie mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen sollte, anstatt so viel zu arbeiten. Tja, vielen Dank für das schlechte Gewissen. Als ob es nicht reichen würde, sich mit Linus’ Tränen auseinandersetzen zu müssen, weil er wieder mal nicht weiß, wann seine Mama endlich kommt.
Der Espresso ist in dem Moment fertig, als Daniel verschlafen hereinspaziert. Mit ihm zieht die bittere Februarkälte herein, und einige Gäste schlottern demonstrativ, aber Daniel scheint keine Notiz davon zu nehmen. Oder es ist ihm egal. Wie ist sie bloß auf die Idee gekommen, ihn jemals auch nur ansatzweise attraktiv zu finden?
»Hier«, sagt sie so eisig, wie das mit einer einzigen Silbe möglich ist, und schiebt ihm die Espressotasse über die Theke. »Den wirst du brauchen. Ich hau ab.«
Ohne seine Antwort abzuwarten, schnappt sie sich ihren Pappbecher, rast hinaus in den Schnee, der nicht die geringsten Anstalten macht zu schmelzen, und prallt vor lauter Unaufmerksamkeit mit einem gebrechlichen Paar zusammen.
»Verzeihung, ich bin spät dran, muss mein Kind vom Kindergarten abholen«, murmelt sie, ohne die beiden anzusehen.
»Nun, Kinder versetzen einen ja immer wieder in Erstaunen. Oft wissen sie sich durchaus selbst zu helfen.«
Die Stimme klingt freundlich und nicht vorwurfsvoll.
Tuva antwortet nicht, aber sie ist erleichtert, dass ihre Ungeschicklichkeit keinen Ärger provoziert hat. Die Menschen sind so unglaublich empfindlich. Es haben schon einige Gäste nicht nur auf einer chemischen Reinigung, sondern auch auf einer saftigen Entschädigung bestanden, nachdem Tuva ihnen versehentlich Kaffee auf die Sachen geschüttet hatte. Sie lächelt dem Paar entschuldigend zu. Der Espresso in Tuvas Hand schwappt über und ruft ihr auf diese Weise ins Gedächtnis, dass sie für so was jetzt wirklich keine Zeit hat. Sie murmelt noch eine Entschuldigung und hetzt im Laufschritt weiter zur U-Bahn. Den Espresso trinkt sie unterwegs. Zuerst verbrennt sie sich die Zunge, dann spürt sie die viel zu heiße und bittere Flüssigkeit im Magen. Sie schmeckt nach Chemie, fast wie Medizin. Sie muss dringend die Maschine reinigen. In der kalten Luft wirkt der Kaffee fast noch heißer.
Wenn sie Linus abgeholt hat, will sie mit ihm zusammen ins Café zurückkehren. Dort soll er auf Daniels Rechnung so viele Zimtschnecken essen, wie er will, das geschieht Daniel recht. Zum Teufel mit Makkaroni und Fleischbällchen. Morgen wird sie verreisen, aber heute Abend geht es nur um Linus und sie.
Als sie den Treppenschacht der U-Bahn erreicht, knicken ihr ohne Vorwarnung die Beine weg. Sie schreit auf und kann sich gerade noch am Geländer festhalten. Zum Glück ist sie nicht gestürzt. Sie muss wohl gestolpert sein. So eilig hat sie es doch nun auch wieder nicht. Es ist ja nicht nötig, dass sie grün und blau beim Kindergarten ankommt.
Sie will sich wieder aufrichten, aber in ihren Beinen scheinen keine Knochen mehr zu sein. Die Füße geben einfach unter ihr nach. Ihr ist schwindelig. Und übel. Fast so, als würde sie gleich ohnmächtig werden. Es ist das gleiche Gefühl wie damals, als sie so viele Medikamente bekommen hat. Bei der Entbindung.
Linus.
Ich komme.
Sie versucht, sich am Geländer hochzuziehen, aber ihre Arme sind kilometerlang. Das Treppengeländer schwebt weit über ihrem Kopf, und sie hat sowieso keine Ahnung mehr, wozu es eigentlich da ist. An den Rändern ihres Blickfelds tanzen dunkle Flecken. Plötzlich dreht sich ihre Welt mehrmals um sich selbst, und eine leise Stimme in ihrem Innern sagt ihr, dass sie jetzt die Treppe hinunterfällt. Merken tut sie davon nichts.
Das Erste, was Tuva bemerkt, als sie wieder aufwacht, sind die Schmerzen in ihren Gliedmaßen. Sie liegt nicht bequem. Sie macht ein schmatzendes Geräusch mit den Lippen und räuspert sich. Ihr Mund ist trocken. Sie hat noch den Rest eines schalen Geschmacks auf der Zunge, den sie nicht einordnen kann. Es dauert ein paar Sekunden, bis sie wieder vollständig bei Bewusstsein ist, erst dann wird ihr klar, dass sie gar nicht liegt. Sie kniet vielmehr in einer leicht vornübergebeugten Haltung. Von allen Seiten drücken Wände gegen sie. Auch von oben, gegen ihren Nacken.
Als ob sie sich in einer Kiste befände.
Für einen bösen Traum tut es zu weh. Aber real kann es auch nicht sein. Ausgeschlossen. Oder? Das Holz riecht echt. Das Licht, das durch die Ritzen dringt, wirft ein Muster auf ihre nackten Arme und Beine. Ihre nackten …? Wo sind ihre Kleider? Nicht nur die Jacke ist weg, sondern auch der Kapuzenpullover. Und die Jeans. Jemand hat sie ausgezogen. Sie sitzt in Unterhemd und Slip da, und das darf einfach nicht wahr sein.
Wieder schmatzt sie mit den Lippen. Der chemische Geschmack ist noch da. Es muss etwas im Espresso gewesen sein. Jemand hat unbemerkt etwas hineingeschüttet. Und sie war zu gestresst, um stutzig zu werden. Und hat alles ausgetrunken.
Als das Adrenalin durch ihren Körper rauscht, spürt sie ein Stechen in der Haut. Sie muss hier raus. Sie schreit und drückt mit aller Kraft gegen die Seitenwände der Kiste. Das Holz gibt ein wenig nach, aber nicht genug. Sie schafft es weder, die Bretter durchzubrechen, noch die Kiste zu öffnen. Treten kann sie nicht, weil sie kniet, und daher muss sie sich damit begnügen, mit den Handflächen an die Wände zu schlagen, die viel zu nah sind, als dass sie Schwung holen könnte. Plötzlich scheint von der einen Seite kein Licht mehr herein. Neben der Kiste steht jemand.
»Lassen Sie mich raus!«, schreit sie. »Was soll das?«
Niemand antwortet. Aber sie spürt, dass da jemand ist. Sie hört Atemzüge. Sie schreit erneut, aber die Stille bleibt undurchdringlich und bedrohlich. Das Stechen in der Haut breitet sich über den gesamten Körper aus. Sie schlägt mit neuer Kraft gegen die Wände, aber aufgrund der Enge kann sie nur einen Bruchteil ihrer Kraft einsetzen.
»Was wollen Sie von mir?«, schreit sie. Gleichzeitig füllen sich ihre Augen mit Tränen. »Lassen Sie mich raus, bitte, dann können wir reden. Ich muss doch Linus abholen!«
Sie wirft einen Blick auf ihren Arm. Das Glas ihrer Armbanduhr ist zersplittert, und der Zeiger ist auf Punkt drei stehen geblieben. Matti muss inzwischen versucht haben, sie anzurufen. Vielleicht fragt er sich allmählich, wo sie steckt, vielleicht sucht er schon nach ihr und wird sie jeden Augenblick in dieser Kiste finden, vielleicht … ja, vielleicht holt sie Linus oft noch viel später vom Kindergarten ab.
Niemand sucht nach ihr.
Weil niemand sie vermisst.
Niemand weiß, dass sie entführt worden ist.
Entführt. Als die Bedeutung des Wortes in ihr Bewusstsein einsickert, bekommt sie kaum noch Luft. Ein Klicken in der Nähe lässt sie zusammenzucken.
»Hallo?«, ruft sie.
Durch eine der unteren Ritzen auf ihrer linken Seite wird ein spitzer Gegenstand aus silberfarbenem Metall in die Kiste gesteckt. Er sieht aus wie eine Schwertspitze. Langsam dringt die Klinge in die Kiste ein. Sie versucht, mit dem Oberschenkel auszuweichen, aber die Kiste ist zu eng. Die Schwertspitze berührt sie am Bein und drückt fest dagegen. Es tut weh, auch wenn das Schwert nicht ganz so scharf ist, wie es aussieht.
»Aua, was machen Sie da?«, schreit sie. »Hören Sie auf!«
Die Schwertspitze übt Druck auf ihren Oberschenkel aus, bis sie die Haut durchdringt und ein Tropfen Blut zum Vorschein kommt. Die Bewegung ist prüfend. Als ob die Person da draußen sich langsam herantasten würde. Tuva schreit noch einmal, kann aber ihr eigenes Wort kaum verstehen. Dann lässt der Druck plötzlich nach, und das Schwert wird etwa einen Zentimeter zurückgezogen.
Ein Motor beginnt zu brummen. Die Klinge vibriert und kommt wieder auf ihr Bein zu. Diesmal macht sie nicht halt, als sie die Haut berührt. Tuva schreit auf, als sich die Schwertspitze in ihren Oberschenkelmuskel bohrt. Während die Klinge immer tiefer in ihr Gewebe eindringt, schreit sie so laut, dass sie den Motor übertönt. Der Schmerz ist ungeheuerlich. Vor ihren Augen explodieren Farben, ihre Nervenenden stehen in Flammen. Die Welt löst sich auf, es gibt nur noch Schmerz. Das Schwert hat den Oberschenkelknochen erreicht, und die Vibrationen der Klinke versetzen ihr gesamtes Skelett in Schwingung. Tuva muss sich übergeben, das Erbrochene landet auf ihren Beinen und dem blutigen Schwert. Schließlich ist die Klinge am Knochen vorbeigeglitten und durchtrennt den Muskel dahinter. Der Anblick der Spitze, die auf der anderen Seite herauskommt, ist geradezu obszön. Aus der neuen Wunde sprudelt sofort das Blut. Es läuft über die Wölbungen ihrer Beine und sammelt sich in einer Lache unter ihr. Und das Schwert steht nicht still. Es bohrt sich weiter durch ihren Oberschenkel und steuert auf das andere Bein zu. Sie kann sich noch immer nicht bewegen.
»Aufhören, bitte, aufhören«, fleht sie unter Tränen. »Ich muss Linus abholen. Ich bin spät dran. Ich bin allein.«
Als das Schwert auch das zweite Bein durchbohrt, weiß Tuva zwar, was sie erwartet, aber auf diese Art von Schmerz kann man sich nicht vorbereiten. Sie brüllt aus Leibeskräften und hofft nur noch, bald das Bewusstsein oder gleich den Verstand zu verlieren, ganz egal, Hauptsache, nichts mehr fühlen. Es vergehen einige Sekunden. Eine halbe Ewigkeit. Sie kann nichts mehr sehen. Die Klinge hat beide Beine durchbohrt und ragt nun mit der Spitze auf der anderen Seite aus der Kiste hinaus. Endlich hört das Schwert auf zu vibrieren.
Aber der Motor verstummt nicht.
Tuva spürt einen Stich an der Rückseite ihrer Schulter, und der Teil von ihr, in dem ihr Verstand sitzt, stirbt. Sie spürt körperlich, wie ein Teil ihres Gehirns kollabiert. Denn natürlich sind auch in ihrem Rücken Schlitze in der Kiste. Sie versucht, sich noch weiter nach vorn zu beugen, um dem Schwert an ihrer Schulter auszuweichen, aber das intensiviert nur den Schmerz in ihren Oberschenkeln. Und Tuva ist nicht mehr da. Sie ist im Kreißsaal und kämpft um das Leben ihres Sohnes, sie ist in dem Café, wo sie nur durch einen glücklichen Zufall einen Job bekommen hat, sie knutscht mit Daniel, und sie ist mit Martin zusammen, der ihr sagt, dass er sie liebt. Sie hört, wie an ihrem Rücken Knorpel und Muskelgewebe durchtrennt werden, und denkt daran, dass Linus immer Papa zu Matti sagt.
Dann blickt sie an sich hinunter und sieht, wie sich die Haut unterhalb ihres Schlüsselbeins wölbt, bevor sie aufreißt und das Schwert an der Vorderseite ihres Körpers herauskommt. Es ist wie bei einem Zaubertrick. Sie ist die Assistentin des Zauberers und wird gleich Applaus bekommen. Das hat sie im Fernsehen gesehen. Während das Schwert sich auf den Schlitz an der gegenüberliegenden Kistenwand zubewegt, färbt sich das Unterhemd auf ihrer Brust rot. Der Eisengeruch ist überwältigend.
Sie sieht Linus’ blaue Augen vor sich.
Verlässt du mich auch, Mama?
Als sie versucht, etwas zu sagen, dringt nur ein Piepsen aus ihrer Kehle.
»Bitte! Ich bin spät dran.«
Draußen tut sich etwas. Einer der Schlitze vor ihrem Gesicht wird dunkel. Ein drittes Schwert. Es ist nur zehn Zentimeter von Tuvas Kopf entfernt. Die beiden Schwerter, die sie bereits durchbohrt haben, fixieren ihren Körper.
»Nicht noch mehr«, flüstert sie.
Das Schwert bewegt sich nur langsam vorwärts, aber die Entfernung ist gering. Sie sieht die Spitze kurz aufblitzen, dann ist sie ihren Augen zu nah, um sie genau zu erkennen.
Es tut mir leid, Linus. Mama hat dich lieb.
Sie zuckt zusammen, als die Spitze die weiche Haut zwischen dem inneren Augenwinkel und der Nasenwurzel berührt, sich hineinbohrt und ihr Auge punktiert. Eine Flüssigkeit läuft ihr über die Wange, und Tuva ist auf der rechten Seite blind. Aber weh tut es nicht. Wenigstens tut es nicht mehr weh.
Wieso riecht es verbrannt?, ist Tuvas letzter Gedanke.
Dann schneidet ihr das Schwert ins Hirn.
Vincent knallte mit aller Kraft die flache Hand auf die Tischplatte. Das Theaterpublikum schnappte hörbar nach Luft. Er zog die Stirn in Falten, machte eine Kunstpause und sah die Zuschauer vielsagend an, während er die Hand hob. Darunter lag eine geplatzte weiße Papiertüte. Nervöses Lachen durchzog den Saal, als er die Reste vom Tisch fegte.
»Unter der fünften Tüte auch nicht«, sagte er.
Bis auf einen schmalen Lichtstrahl lag die Bühne im Dunkeln. Der einzelne Scheinwerfer war auf ihn, den Tisch und die Frau daneben gerichtet. Die Beleuchtung unterstrich den Ernst der letzten Nummer. Es war vollkommen still. Nicht einmal Musik lief. So wirkte das Ganze noch beklemmender. Auf dem Tisch hatten anfangs fünf nummerierte Papiertüten gestanden. Zwei davon hatte er bereits zusammengeknüllt.
»Noch drei.« Er sah die Frau an. »Schauen Sie die drei Tüten nicht an, Magdalena, denn sonst kann ich Ihre Augenbewegungen verfolgen. Denken Sie nur daran, unter welcher Tüte der große Nagel ist. Sie sind die Einzige, die weiß, wo er ist. Das Publikum hat nicht gesehen, wo Sie ihn versteckt haben, und ich habe es auch nicht gesehen. Drei. Erinnern Sie sich, wie spitz sich der Nagel angefühlt hat. Denken Sie an nichts anderes.«
Die Frau schwitzte. Der Scheinwerfer war warm, aber vor allem war sie genauso nervös wie das Publikum. Vermutlich noch nervöser. Vincent musterte sie.
»Da Sie auf ›drei‹ nicht reagiert haben, obwohl ich es gerade dreimal gesagt habe«, sagte er mit nachdenklicher Miene, »ist er wahrscheinlich nicht dort.«
Bevor das Publikum wusste, wie ihm geschah, schlug er fest auf Tüte Nummer drei. Der ganze Saal schrie vor Schmerz.
Zwei Tüten waren noch übrig. Seine Chancen, sich ordentlich wehzutun, standen nun fifty-fifty. Er wusste selbst nicht, wieso er diese Nummer immer noch im Repertoire hatte. Alle, die sie aufführten, verletzten sich früher oder später. Nach einer gewissen Zeit war es einfach unvermeidlich. Das Publikum durfte jedoch nicht merken, dass er wirklich Angst hatte. Der Trick bestand zum Großteil darin, den Eindruck zu erwecken, er hätte die Situation unter Kontrolle.
»Nummer zwei und Nummer vier sind noch übrig«, sagte er zu der Frau. »Stellen Sie sich den Nagel vor. In seiner gesamten, zwanzig Zentimeter langen Pracht.«
Sie schloss die Augen und nickte unglücklich.
»Erinnern sie sich daran, wie Sie den Nagel aufrecht hingestellt haben. Unter einer dieser beiden Papiertüten. Und zwar unter der, auf die ich besser nicht schlagen sollte. Nicht wahr?«
»Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es richtig in Erinnerung habe«, jammerte die Frau.
Er zog eine Augenbraue hoch. Die Luft im Theatersaal war zum Schneiden. Zwei Tüten. Er hielt die Hand über die eine. Dann bewegte er sie zur anderen hinüber. Eine der Tüten würde die Show mit tobendem Applaus beenden. Die andere mit einem durchbohrten Körperteil und einem Krankenwagen.
»Öffnen Sie die Augen«, sagte er.
Die Frau machte widerwillig die Augen auf und blinzelte die Tüten an. Er warf ihr einen Blick zu. Dann hob er die Hand, um auf eine der beiden Tüten zu schlagen, registrierte aber, während er die Handfläche senkte, ihre vor Entsetzen geweiteten Augen. Ohne das Tempo aus der Bewegung zu nehmen, änderte er die Richtung und schlug stattdessen auf die andere Tüte. Die Frau schrie laut auf, als seine Hand auf den Tisch knallte. Mit gesenktem Kopf wartete er einige Sekunden ab. Dann fegte er triumphierend die zerfetzte Tüte vom Tisch und hob die letzte noch dastehende an. Der Nagel ragte wie ein aufgerichteter Spieß in die Höhe und blitzte tödlich im kalten Licht. Das Publikum brüllte und sprang auf, während gleichzeitig die Musik einsetzte. Er signierte den Nagel mit einem wasserfesten Filzstift, legte ihn in die letzte Papiertüte und überreichte ihn der sichtlich erleichterten Frau, die von einem Assistenten von der Bühne geführt wurde.
Vincent stellte sich ganz vorn an den Bühnenrand und breitete die Arme aus. Auch er brauchte seine Erleichterung nicht zu spielen.
Der Applaus war ohrenbetäubend. Die Vorstellung im Theater Gävle war vorbei. Er machte eine formvollendete Verbeugung und richtete den Blick anschließend ins Parkett. Die Scheinwerfer, die während des Beifallssturms hin und her bewegt wurden, blendeten ihn so stark, dass er sein Publikum nicht erkennen konnte, aber das ließ er sich nicht anmerken. Der Trick bestand darin, einfach starr geradeaus zu schauen und so zu tun, als würde man jemandem in die Augen sehen. Er lachte in die Dunkelheit, in der jetzt vierhundertfünfzehn Personen stehend Vincent Walder, dem Meistermentalisten applaudierten.
»Schön, dass Sie alle da waren«, rief er in den stürmischen Beifall.
Der Applaus und die Pfiffe wurden noch lauter. Das Theater war voll besetzt. Es war ein guter Abend gewesen. Ein sehr guter sogar. Sie war nicht da gewesen. Sie, die die ihn immer ein wenig beunruhigte. Über die Abende, an denen sie nicht kam, war er erleichterter, als er es sich selbst eingestand.
Er widerstand der Versuchung, das grelle Scheinwerferlicht mit den Händen abzuschirmen, um das applaudierende Publikum mit eigenen Augen zu sehen. Für diesen Moment hatte er hart gearbeitet, dies war seine Belohnung. Andererseits war pures Adrenalin das Einzige, was ihn noch aufrecht hielt. Vierhundertfünfzehn Sitze. Einundvierzig plus fünf ergab sechsundvierzig. Sein Alter. Jedenfalls noch für ein paar Wochen.
Hör auf.
Heute war es richtig knapp gewesen. Der verdammte Nagel. Noch dazu war es die Schlussnummer nach einer zweistündigen Show gewesen. Der Schweiß lief ihm den Rücken hinunter, und sein Gehirn schien zu kochen.
Das Geheimnis bestand, wie gesagt, nicht darin, das Verhalten der Zuschauer vorherzusagen oder den Anschein zu erwecken, er könnte ihre Gedanken lesen. Die Illusion bestand darin, es leicht aussehen zu lassen, obwohl sein Gehirn auf Hochtouren lief. Das Plakat im Foyer pries ihn als »The Master Mentalist« an. Er wünschte, er hätte sich nicht zu dieser Bezeichnung überreden lassen. Es klang so … niveaulos. Vulgär. Andererseits ein Deckmantel, unter dem man sich gut verstecken konnte. Es klang, als wäre er eine Kunstfigur und nicht jemand, der sich am liebsten in seiner Garderobe auf den Fußboden gelegt und zehn Minuten lang nur geatmet hätte. Und jetzt, nach beendeter Vorstellung, musste er seine Gedanken im Zaum halten, damit sie nicht mit ihm durchgingen. Heute brauchte er dafür noch länger als sonst.
Kontrolle. Neun Buchstaben. Genauso viele, wie es auf den oberen Rängen Sitzreihen gab.
Hör auf.
Vincent sah hinauf zur oberen Loge, wo er im ersten Akt vier Personen dazu gebracht hatte, den eigenen Namen zu vergessen. Jede Reihe hatte dreiundzwanzig Sitze. Das machte zweihundertsieben Sitze.
Vom oberen Rang pfiff jemand auf zwei Fingern.
Tief Luft holen und den Gedanken nicht zu Ende denken.
Zweihundertsieben Plätze. Am zwanzigsten Siebten fand die letzte Show dieser Tournee statt. Dreiundzwanzig Sitze pro Reihe, insgesamt neun Reihen, also drei plus zwei plus neun, das ergab vierzehn, und genau so viele Vorstellungen hatte er noch vor sich.
Hör auf, hör auf, hör auf.
Er biss sich auf die Zunge.
Vincent verbeugte sich zum letzten Mal. Dann ging er von der Bühne. Vor dem Samtvorhang, hinter dem der Nebenraum lag, blieb er stehen und zählte im Kopf. Eins. Wenn er bis zur Zehn kam, ohne dass der Beifall nachließ, würde er für ein letztes Dankeschön ans Publikum auf die Bühne rennen. Zwei. Aus dem dunklen Nebenraum näherte sich ein Schatten. Eine Frau um die dreißig. Drei. Ihm wurde eiskalt. Sie war doch gekommen. Vier. Diesmal hatte sie jedoch nicht gewartet, bis die Vorstellung vorbei war. Fünf. Wie schaffte sie es immer wieder, hinter die Bühne zu gelangen? Während seiner Auftritte durfte sich dort niemand aufhalten. Derjenige, der sie hereingelassen hatte, würde es mit ihm zu tun bekommen. Er hatte doch alle gebeten, nach dieser Frau Ausschau zu halten. Nicht, um ihr den Weg frei zu machen, sondern um sie von ihm fernzuhalten. Sechs. Wenigstens würde er nun erfahren, wie sie aussah. Dunkler Pferdeschwanz. Rollkragenpullover. Sieben. Augen, die sich für einen Moment weiteten, bevor sie Anstalten machte, etwas zu sagen. Er hatte keine Ahnung, wie gefährlich sie wirklich war. Acht. Er signalisierte ihr stumm, dass sie still sein sollte, und zeigte mit dem Daumen in Richtung Bühne, damit sie begriff, dass er noch nicht fertig war. Vielleicht gab es noch einen anderen Bühnenausgang, durch den er ihr nach dem Schlussapplaus entwischen konnte. Neun. Denk nicht an sie. Tief Luft holen und lächeln. Zehn. Er lief wieder ins Scheinwerferlicht.
»Danke, danke, Sie sind einfach zu freundlich!«, rief er. »Ich kann ja verstehen, dass Sie am liebsten sitzen bleiben würden, aber ich fürchte, draußen wartet die Wirklichkeit auf Sie. Es wird Zeit, dass Sie sich auf den Weg machen. Und falls irgendetwas, das heute Abend passiert ist, Ihnen heute Nacht den Schlaf rauben sollte, dann vergessen Sie nicht: Es war alles nur ein Scherz.«
Er legte eine Pause ein.
»Nehme ich an.«
Das Publikum lachte laut. Und ein wenig angespannt. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Es funktionierte jedes Mal. Obwohl er es überhaupt nicht eilig hatte, der Frau zu begegnen, lief Vincent von der Bühne, bevor sich die Zuschauer zum Gehen wandten. Es machte keinen guten Eindruck, wenn der Künstler noch dastand, während die Leute den Saal verließen. Und wenn sie, so wie heute, Winterjacken von der Garderobe holen mussten, dann standen sie immer noch einen Tick früher auf, in dem naiven Versuch, den unvermeidlichen Schlangen zuvorzukommen. Die Frau erwartete ihn im Nebenraum hinter dem Samtvorhang.
»Sie ist hier«, sprach er leise ins Mikrofon. »Der Wachschutz soll kommen. Sofort.«
Er war nicht sicher, ob es funktionieren würde, aber wenn er Glück hatte, hörten ihn die Tontechniker noch, obwohl der Ton im Saal schon abgeschaltet war. Die meisten Fans, die sich ihm näherten, waren nett, aber er wollte nicht während der Vorstellung überrascht werden. Vor allem nicht von einer Frau, die bekannt dafür war, die Bühne zu stürmen, sobald sein Auftritt beendet war. Sie konnte doch nicht ganz richtig im Kopf sein. Andererseits war er ihr zum Glück noch nicht persönlich begegnet. Bis jetzt.
Es fiel ihm schwer, klar zu denken. Nach der Show dauerte es immer ein wenig, bis er wieder runtergekommen war und sein Gehirn sich auf normale Betriebstemperatur abgekühlt hatte. Im Moment war er nicht in der Lage, die Situation nüchtern zu analysieren. Bis der Wachschutz auftauchte, blieb ihm jedoch nichts anderes übrig, als freundlich zu sein. Und Abstand zu halten.
Um Zeit zu gewinnen, zeigte er auf die wenigen Stufen zum Warteraum hinter der Bühne. Sie ging voraus. Die kleine Treppe hatte genau sieben Stufen. Oje. Vincent ging die letzte Stufe zweimal hinunter, um auf eine gerade Zahl zu kommen. Die Frau schien es nicht zu bemerken.
Vincent und die Frau gelangten in einen Raum, der wie ein gewöhnliches Wohnzimmer eingerichtet war. Wo blieb denn bloß der Wachschutz? Auf dem Tisch standen vier ungeöffnete Flaschen Mineralwasser der Marke Loka. Vincent zog das Jackett aus und warf es auf eins der Sofas. Er drehte eine Flasche, damit alle Etiketten in dieselbe Richtung zeigten. Die Frau behielt ihre Jacke an und öffnete nur den obersten Knopf. Er wischte sich das Gesicht mit einem Feuchttuch ab, um die Theaterschminke zu entfernen. Die Frau rümpfte fast unmerklich die Nase. Gut. Alles, was dazu führte, dass sie lieber das Weite suchte, war für ihn von Vorteil. Hoffentlich roch er auch nach Schweiß.
»Ich möchte nicht unhöflich sein«, sagte er, »aber eigentlich hat hier niemand Zutritt.«
Er öffnete eine Flasche Mineralwasser und trank einen großen Schluck.
»Sie können nicht so weitermachen«, sagte er schließlich. »Der Bühnenbereich ist dem Team vorbehalten, und …«
Die Frau unterbrach ihn, indem sie sich vorstellte.
»Mina«, sagte sie. »Mina Dabiri. Ich bin von der Polizei.«
Dann richtete sie schnell wieder die eine Flasche aus, die er versehentlich ein Stück verdreht hatte, und sorgte auf diese Weise dafür, dass alle Etiketten in genau dieselbe Richtung zeigten, bevor sie ihm die Hand gab. Vincent verstummte und erwiderte den Händedruck. Dem Meistermentalisten fehlten plötzlich die Worte.
Hat Ihnen diese Leseprobe gefallen?Schwarzlicht erscheint am 01.04.2022.
John Katzenbach
Die KomplizenFünf Männer, fünf Mörder, ein perfider Plan
Unsichtbar für den Rest der Welt planen »Jack’s Boys« im Darknet ihre Taten: perfekt ausgeführte Morde nach dem Vorbild ihres Idols Jack the Ripper. Fotos der verstümmelten Opfer landen anschließend bei willkürlich ausgewählten Polizeistationen weltweit, ohne dass auch nur die geringste Spur zu den Killern führen würde. »Jack’s Boys« fühlen sich absolut unantastbar – bis Collegestudent Connor Mitchell zufällig ihren Chatroom hackt. Und ohne es zu ahnen ganz oben auf der Abschussliste landet. Doch die Killer haben weder mit Großvater Ross gerechnet, einem Ex-Marine, noch mit Connors bester Freundin Niki …
Der junge Polizist in der französischen Kleinstadt Cressy-sur-Marne, der für die Rekonstruktion von Verkehrsunfällen zuständig war, hasste seine Arbeit mit einer Inbrunst, die man ihm bei seiner unaufgeregten Art nicht zugetraut hätte. Es war die erste Aufgabe, mit der er seit seinem Dienstantritt vor siebzehn Monaten betraut worden war. Er hatte darin ein Sprungbrett für ein anderes, interessanteres und spektakuläreres Ressort gesehen. Waffen. Verfolgungsjagden. Festnahmen und beinharte Verhöre abgebrühter Krimineller. Fehlanzeige. Der Job war ein Rohrkrepierer und bot ihm Tag für Tag nichts weiter als dieses Fahrzeug war auf der Fahrbahn in nördlicher Richtung unterwegs, als es auf dem Highway 9 ein Vorfahrtsschild missachtete und mit dem in östlicher Richtung fahrenden Lkw kollidierte. Laut Zeugenaussage – und auch die Abmessungen der Bremsspuren legen diesen Schluss nahe – fuhr das unfallverursachende Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit … und so weiter und so fort, bis zum Abwinken.
Ein Unfall wie der andere. Und wenn ein Zusammenstoß zu schweren Verletzungen oder sogar zu Toten führte, wenn es also endlich interessant wurde, übernahm jedes Mal ein dienstälterer Kollege die Nachuntersuchung.
Was ihn mächtig frustrierte.
Den ganzen Vormittag hatte er, mit einem Bandmaß bewaffnet, am letzten Unfallort zugebracht und Fotos geschossen, dabei so gut es ging die wütenden Schuldzuweisungen, das übliche Hintergrundrauschen eines jeden Unfalls ignoriert – »Das geht ja wohl eindeutig auf Ihr Konto!« »Von wegen! Hätten Sie auf die Straße geachtet …« – und sich die ganze Zeit nur gefragt, wann er endlich von der Verkehrsabteilung zu etwas Aufregenderem wechseln könne. Zum Beispiel zur Mordkommission, zum Drogen-, wenn’s sein musste, auch nur zum Einbruchsdezernat oder zur Sitte – alles, Hauptsache, er brauchte sich nicht länger die Lügen über rote und grüne Ampeln, über Stoppschilder oder darüber anzuhören, wer Vorfahrt hatte und wer zuerst im Kreisverkehr war. Wenn er dann endlich sämtliche Aussagen, Messungen und Fotos im Kasten hatte und an seinen Schreibtisch zurückkehren konnte, war der Tag schon halb vorbei. Die anderen Kollegen seiner Einheit machten Mittagspause, und so war er in dem kleinen Gehege aus Schreibtischen und Aktenschränken allein.
Er loggte sich in seinen Computer ein.
Er hatte vor, seine Fotos hochzuladen und mit seinen Grafiken anzufangen, dem ersten Teil des Berichts, der an die Versicherung weitergeleitet würde.
Stattdessen prangte in Vollbild ein Foto auf seinem Bildschirm.
Er wäre fast vom Stuhl gekippt.
Eine Leiche.
In Farbaufnahme.
Er hielt sich an der Schreibtischkante fest und beugte sich vor.
Eine junge Frau. Ungefähr in seinem Alter.
Mit aufgeschlitzter Kehle.
Die geöffneten Augen starrten in den Himmel. Mit leerem Blick. Kalt. Die Angst war in ihrem Gesicht dem gewaltsamen Tod gewichen.
Die Frau war jung.
Dunkles Haar. Schwarze Augen. Rotbraunes Blut rings um ihren Kopf, das im sandigen Boden versickerte.
Nackt. Die Kleider hatte ihr jemand vom Leib geschnitten und neben ihr auf einen Haufen geworfen.
Allem Anschein nach lag sie auf einem Feld. Er konnte nicht sagen, wo. Da gab es nichts, was ihm irgendwie bekannt vorkäme.
Am unteren Bildrand war ein Schriftzug.
Er versuchte, sich einen Reim darauf zu machen.
Arabisch. Kyrillisch. Sanskrit. Und einige japanische oder chinesische Schriftzeichen. Alles kunterbunt durcheinander, in einem nicht zu entziffernden Kauderwelsch. Kein Französisch. Nicht einmal etwas auf Deutsch oder Spanisch, das er sich mit seinen bescheidenen Fremdsprachenkenntnissen aus der Schulzeit hätte zusammenreimen können.
Der junge Verkehrspolizist starrte auf das Bild.
Sein erster Gedanke: Das muss eine Fälschung sein.
Jemand spielt dir einen Streich, nur dass es nicht 1. April ist.
Er sah sich das Foto noch genauer an.
Es wirkte real.
Sein Instinkt empfahl ihm, es in den Papierkorb zu legen. Es von seiner Festplatte zu löschen und sich wieder an die Arbeit zu machen.
Tat er aber nicht. Ohne das Bild aus den Augen zu lassen, öffnete er ein neues Fenster und ging zu einem Übersetzungsprogramm. Er wechselte auf seiner Tastatur zu Arabisch und tippte mühsam die Zeichen ein. Heraus kam:
Möchtest du nicht …
Er wechselte zu Kyrillisch, nicht ganz einfach bei seiner Tastatur, und er war sich auch nicht sicher, ob er es richtig machte. Die Übersetzung ergab:
Gerne wissen, wer …
Nun wechselte er schnell zu Sanskrit.
Die junge Frau getötet hat …
Es kostete ihn ein paar Minuten, herauszufinden, dass die letzten Worte Mandarin waren und ergaben:
Und wo sie gestorben ist?
Der junge Polizist hatte auf einmal einen trockenen Mund. Er atmete flach. Bis dato hatte er in seinem Dienst noch kein einziges Mal Angst gehabt, und streng genommen auch jetzt nicht; aufrichtig beunruhigt war er allerdings schon.
Er vertiefte sich erneut in das Bild. Auch wenn er kein IT-Experte war, kannte sich der junge Polizist mit dem Internet recht gut aus und fand daher ziemlich schnell die IP-Adresse, von der das Foto kam. Was ihn zum zweiten Mal auf den Gedanken brachte, dass ihn hier jemand zur Zielscheibe eines ziemlich raffinierten Streichs gemacht hatte. Das Foto war nämlich durch die Leserspalte einer hochleistungsfähigen italienischen PR-Firma generiert worden, die sich um die fragwürdigen Belange illustrer Klienten kümmerte, von abgesetzten afrikanischen Politikern bis zu ruchlosen Konzernen, die sich um die finanzielle Haftung für Ölkatastrophen drücken wollten.
Das ergab für ihn keinen Sinn.
Er sah sich das Foto noch einmal an.
Er war kurz davor, die ganze Sache in den Papierkorb zu verschieben, und zog schon den Cursor darüber, als er plötzlich stutzte. Langsam ließ er die Hände sinken. Spinnst du?, dachte er, irgendjemand da draußen muss von der Sache hier erfahren. Also griff er zum Telefon auf seinem Schreibtisch und rief auf der internen Leitung einen Detective im Morddezernat an. Er war dem Ermittler erst ein-, zweimal über den Weg gelaufen und konnte nur hoffen, dass er sich an ihn erinnerte.
»Sergeant«, sagte er, als der Mann sich meldete. Er gab sich Mühe, sich seine Zweifel und Nervosität nicht anmerken zu lassen. »Ich hab da etwas, was Sie, denke ich, sehen sollten.«
Delta schrieb:
Wie versprochen, Auftrag ausgeführt. Und ich hätte auch schon eine Schlagzeile für uns alle: Französische Flics flippen über fantastischem Foto aus.
Bravo und Easy würdigten den Vorschlag umgehend mit Daumen-hoch-Emojis. Flics, wussten sie, war Slang für die französische Polizei.
Delta schrieb weiter:
Hätte da mal eine Frage an alle.
Hat zufällig einer von euch Erfahrung mit den neuesten Methoden zur Erkennung von Fingerabdrücken, insbesondere mit der Musterentnahme von totem Fleisch? Ist die Gestapo dazu überhaupt in der Lage?
Nach wenigen Sekunden meldete sich Charlie:
Möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ist für die Techniker immer noch Glückssache. Selbst für die Experten beim FBI, bei Interpol oder Scotland Yard. Wenn das Opfer offensichtlich an einer Stelle angefasst wurde, an der die Identifizierung leichtfällt, ist es ihnen einen Versuch wert. Über die Jahre allerdings nur selten Treffer … Aber hin und wieder geben sie zumindest ihr Bestes. Seht euch dazu mal Festnahme und Anklage in Madrid gegen Juan Carlos Ramirez vor sechs Jahren an. Der Blödmann hat seine getrennt lebende Frau umgebracht und ihren Lover angeschwärzt, was nur leider seinen Zeigefingerabdruck an ihrer Kehle nicht erklären konnte. Ich meine, gibt es einen eindeutigeren Beweis?
Die anderen wussten Charlie als Historiker auf ihrem Interessengebiet zu schätzen.
Kurz darauf meldete sich auch Bravo:
Abend, Delta, Leute. Charlie hat absolut recht. Da zeigt sich mal wieder, wie falsch diejenigen liegen, die meinen, die Zauberkunststückchen, die sie in Fernsehserien vollführen, seien aus dem Leben gegriffen. Man denke nur an Crime Scene Investigation: den Tätern auf der Spur oder was auch immer sich so ein Schreiberling aus den Fingern gesogen hat, um die Gestapo wie Experten dastehen zu lassen. Träumt weiter! Trotzdem würde ich raten, die richtigen Handschuhe zu tragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber Vorsicht: Selbst die hochwertigsten OP-Handschuhe können schon mal Teilabdrücke hinterlassen, weil sie so dünn sind und Körperfette oder Schweiß sogar durch Latex dringen. Daher vorsichtshalber zwei Paar übereinanderziehen! Oder Latex unter einem zweiten Paar in Leder. Und nach Gebrauch fachmännisch entsorgen. Verbrennen ist immer gut. Beide, die in Latex und die in Leder. Das ist wichtig. Siehe Journal of Forensic Research, Artikel in Band 23, Nummer 8, März letztes Jahr.
Bravo war von ihnen allen der beste darin, Forschungsberichte zu lesen und zu erklären. Ihnen war nicht entgangen, dass er sich bei seinem Gruß mit »Guten Abend« gemeldet hatte, wobei es vielleicht da, wo sich Bravo gerade aufhielt, gar nicht Abend war.
Easy schrieb prompt:
Kein Problem. Mach. Dir. Keinen Kopf.
Easy war der größte Witzbold in der Gruppe.
Und Delta antwortete sofort:
LOL. Wie wahr. Dank an alle. Sehr cool. Der Artikel ist mir entgangen. So wie, zugegeben, so ziemlich jeder andere Artikel auch. Selbst schuld. Was wären wir alle ohne Bravo und seinen unersättlichen Lesehunger? Jedenfalls, wie gesagt, echt krasser Rat.
Möglicherweise war Delta jünger als der Rest – obwohl das mehrere der anderen insgeheim bezweifelten. Diesen Artikel übersehen zu haben war vielleicht auch gelogen, da Delta oft ziemlich gelehrt daherkam. Er hatte einfach eine Schwäche für einen etwas hippen, im großen Ganzen klischeehaften Umgangston, wobei mehr als ein Mitglied der Chatgruppe vermutete, dass er sich diese Sprache entweder aus dem Internet oder aus Dialogen in Jugendromanen angeeignet hatte. Ein oder zwei von ihnen spekulierten insgeheim, dass er vielleicht Lehrer an der Highschool war. Wie auch immer, sie erkannten, dass er ziemlich wahllos Teenager-Sprech einfließen ließ, um sein wahres Alter zu verbergen, und sie gingen davon aus, dass ihm seine Ausdrucksweise zur Tarnung diente. Sie alle hüteten sich, ihn darauf anzusprechen.
Es gab auch keinen triftigen Grund dafür. Abgesehen davon hatte jeder von ihnen ganz ähnliche Vorkehrungen getroffen, um ihre Identität zu schützen, was jeder vom anderen wusste – es glich sich also aus. Davon abgesehen schätzten sie Delta für das, was er beitrug, wenn er nicht gerade omg oder wtf schrieb. Er legte in ihrem gemeinsamen Betätigungsfeld die Messlatte hoch, und es bereitete allen Vergnügen, sich daran zu erproben.
Easy schrieb:
Das Wort gefällt mir: Unersättlich. Passt zu uns, oder?
Delta sendete ein Händeklatsch-Emoji.
Dann verabschiedete er sich mit dem Eintrag:
Bis demnächst, Leute. Muss dann mal. Das nächste Projekt auschecken.
Bravo riet:
Denk dran, Delta, was Leute wie uns zu Fall bringt, ist weniger die Planung und die Ausführung als das Spurenverwischen danach.
Easy bekräftigte:
Genau.
Und Alpha, der Moderator der Gruppe, sprach für alle, als er tippte:
Auf die Ergebnisse gespannt.
Das verstand sich eigentlich von selbst. Genauso wie die Tatsache, dass sie alle mit ihren eigenen Projekten beschäftigt und gleichermaßen erpicht darauf waren, sie den anderen vorzustellen.
Delta antwortete:
Gemach. Gemach. Ihr sagt mir doch immer, nur ja nichts überstürzen. Ich übe mich in Geduld.
Dem hätte keiner von ihnen widersprechen können, auch wenn sie insgeheim fanden, dass es Delta gewöhnlich ein bisschen zu eilig mit allem hatte und bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse kaum Aufschub duldete.
Alpha fuhr fort:
Gut. Ausgezeichnet. Treffen wir uns am besten alle wieder in zwei Tagen online. Selbe Uhrzeit am selben Ort. Und Delta, vielleicht kannst du dann schon ein paar Einzelheiten loswerden.
Es hagelte Okays.
Doch bevor sie sich alle von ihrem Chat abmelden konnten, hatten sie plötzlich eine neue und unerwartete Nachricht auf ihrem Bildschirm.
Socgoal02 ist dem Chatroom beigetreten.
Diese Identifizierung war ihnen allen unbekannt. Seit Bestehen war niemand in ihren geschlossenen Chatroom eingedrungen. Zu viele Verschlüsselungsebenen. Bis zu diesem Moment war ihr Austausch in diesem geschützten Raum vollkommen ungestört verlaufen. Dieser neue Auftritt war beunruhigend. Die bloße Vorstellung, entdeckt zu werden, jagte ihnen einen Schrecken ein. Sie waren zu fünft, und keiner von ihnen neigte zur Panik, aber jetzt fingen sie an, sich der Reihe nach elektronisch wegzuklicken. Doch vorher lasen sie noch:
Socgoal02schrieb:
Wer seid ihr? Seid ihr echt? Was für Spinner! Perverse. Krank, krank, krank …
Zwei Jahre zuvor hatte Alpha sich gefreut, als Bravo sich zu seiner Überraschung auf sein erstes Posting gemeldete hatte. So schnell hatte er kein Feedback erwartet, vor allem angesichts der Firewalls, die er eingerichtet hatte, um dafür zu sorgen, dass alles, was auf dem Portal besprochen wurde, streng anonym blieb. Anfänglich hatte Alpha geplant, einen persönlichen Blog zu schreiben und fortlaufend zu ergänzen. Da nun aber jeder Austausch naturgemäß geschützt verlaufen musste, hatte er es sich rasch anders überlegt. Und so hatte Alpha den privaten Chatroom erstellt und Bravo eingeladen, beizutreten. Bravo waren im Lauf der nächsten Monate Charlie, Delta und Easy gefolgt – nachdem jeder von ihnen einen Kommentar auf jenes erste Posting hinterlassen hatte, das Alpha so fasziniert hatte. Keine Gangster. Keine Schaumschläger. Klug. Gebildet. Artikuliert. Und jung – für Mörder. Alpha war in der Gruppe die graue Eminenz.
Und bei fünf war das Limit. Jeder darüber hinaus hätte nach Alphas Überzeugung den Chat erschwert und sie einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Alpha hatte darauf bestanden, außer diesen fünf keine weiteren Beitritte zuzulassen, nachdem er sich im Zuge ihrer ersten Unterhaltungen von ihrer Glaubwürdigkeit überzeugt hatte und ausschließen konnte, dass sich hinter ihren Chatnamen ein übereifriger, cleverer Ermittler irgendwo auf dem Globus verbarg oder gar bei ihm selbst um die Ecke. Die fünf Männer hatten sich schnell auf diese Obergrenze geeinigt. Fünf, eine ungerade Zahl, hatte sich irgendwie richtig angefühlt, der Teamgeist einer Basketballmannschaft – auch wenn sie sich nie persönlich begegnet waren, angesichts ihrer besonderen Leidenschaft füreinander überlebenswichtig. Wie eine Unterstützergruppe für Drogensüchtige oder Alkoholiker nach dem Entzug schien jeder von ihnen über Kernkompetenzen zu verfügen, mit denen er den anderen half. Nicht lange, und sie betrachteten sich als einen speziellen Freundeskreis, der, so wie ihre anderen sozialen Kontakte auch, besonderen Interessen und Bedürfnissen diente. Die echten Namen, ihr Alter und ihren Standort behielten sie voreinander geheim, auch wenn sie im Laufe der Zeit aus Fragen, die einer von ihnen etwa zu reißerischen Schlagzeilen oder Fernsehnachrichten aufbrachte, gewisse Rückschlüsse über ihn zogen. Dabei war keiner so unhöflich, solche Vermutungen zu äußern oder gar nachzuhaken. Darüber hinaus war Englisch die bevorzugte Sprache, und keiner stellte je die Frage, ob nicht vielleicht Schwedisch oder Finnisch oder Japanisch angenehmer wäre. Insgeheim hatten sie längst begriffen, dass sie alle Amerikaner waren. Wenn sie nämlich über ihren Alltag plauderten, kamen darin Apple Pie, der vierte Juli oder der Superbowl vor. Und natürlich Mord.
Alpha, der Umsichtigste und Intellektuellste in der Runde, bestand auf dieser Verschwiegenheit, die nicht zuletzt seinem obsessiven Bedürfnis nach Privatsphäre entsprang. Tatsächlich hatte Alpha, als in seinem Kopf Jack’s Special Place erste Gestalt annahm, eher spielerisch seine eigene Expertise in Informationstechnik austesten wollen. Abgesehen vom Nervenkitzel, den das Projekt versprach, befriedigte es sein überwältigendes Bedürfnis, auf Schritt und Tritt die Cops an der Nase herumzuführen. Um jeden Preis wollte er beweisen, dass die Schlaumeier der Polizei nichts, was er schrieb, sagte oder hochlud, zu ihm zurückverfolgen konnten. Zu viele verschachtelte falsche Identitäten. Zu viele mathematische Möglichkeiten.
Alpha liebte das Netz.
Und er liebte Jack.
Jack wie in Jack the Ripper.
Daher hatte die Gruppe ihren Namen.
Sie nannten sich Jack’s Boys. Und sie trafen sich an Jack’s Special Place.
Für Alpha war Jack immer noch das strahlende Vorbild für die Kunst, die Ordnungshüter zu täuschen und ihnen immer wieder zu entwischen. Diese beiden Fähigkeiten hatte Jack in so überragender Weise an den Tag gelegt, dass hundert Jahre später immer noch darüber gerätselt wurde, wer hinter diesem Namen steckte. London hatte eine geführte Stadttour eigens zum Ripper im Angebot. Amateurwissenschaftler und -detektive nannten sich Ripperologen und ergingen sich in endlosen Spekulationen, Theorien und Wortklaubereien zu der umfangreichen Ripper-Akte bei Scotland Yard. Eine berühmte amerikanische Krimiautorin hatte ein ganzes Buch über Jacks angeblich wahre Identität verfasst – um sie sich sogleich von eben jenen Amateurdetektiven in der Luft zerreißen zu lassen, deren Kandidaten sie vom Sockel gestoßen hatte.
Alpha wusste, dass die anderen vier Mitglieder dieses Gefühl der Seelenverwandtschaft mit Jack teilten.
Womit er richtiglag. So wie der berühmte Jack waren Bravo, Charlie, Delta und Easy in einer Arena, in der andere mit ihren besonderen Neigungen Anonymität schätzten und sich bemühten, wenig oder wenn möglich nichts dem Zufall zu überlassen, ausgesprochen risikofreudig. Alle fünf liebten den Zufall und die damit verbundene Gefahr.
Damit hoben sie sich vom klassischen Typus ihrer Sparte ab und hätten wohl die Analytiker beim FBI verwirrt.
Bei Alphas erstem Posting, das überhaupt erst den Bedarf an einem Chatroom geschaffen hatte, handelte es sich um ein bescheidenes Manifest mit dem Titel:
Warum ich tue, was ich tue.
Er hatte es kurz gehalten. Sorgfältig formuliert. Drei handgeschriebene Entwürfe, dann erst eingestellt. Keine weitschweifige Abhandlung à la Ted Kaszcynski über Gott und die Natur und die Entschlüsselung der Welt. Alpha hatte nicht vergessen, dass der Unabomber letztlich dadurch, dass er, der Killer mit Harvardabschluss, in seinen viel zu unverwechselbaren persönlichen und letztlich verräterischen schriftlichen Zeugnissen durch die korrekte Setzung seiner Semikola aufgeflogen war.
Bravo hatte die Kommentarspalte am Ende des Manifests gesehen und geantwortet:
Genauso geht es mir auch.
Dieser schlichte Austausch hatte sie zusammengebracht. Im Gefolge führte er zu einem lebhaften Hin und Her und mündete zuletzt im Chatroom.
In seiner Darlegung hatte Alpha statt töten den Euphemismus beseitigen verwendet.
Wie zum Beispiel in: Und schlussendlich akzeptierte ich, was ich tun wollte – nein, was ich absolut hundertprozentig tun musste, was meine absolute Bestimmung im Leben war, nämlich Molly zu beseitigen … oder Sally … das heißt … sie voll und ganz zu meinem Eigentum zu machen. Und erst als sie dann mir gehörten, hatte ich meine Bestimmung gefunden.
Bravo hatte dies aus eigener Erfahrung bekräftigt:
Ich weiß. Du spürst auf einmal diese totale Größe in dir. Du wartest nur darauf, dass sie sich entfalten kann. Du musst nur herausfinden, wie du sie freisetzt.
Beseitigen war der erste Euphemismus, den sie sich im Chatroom zu eigen machten. Sowie im Verlauf der nächsten Wochen Charlie, Delta und Easy sich hinzugesellten, einigten sie sich vorsichtig auf weitere. Übernehmen statt entführen. Statt foltern sprachen sie von ärgern. Und die Polizei – von den kleinsten Einheiten auf dem Lande bis zu den qualifiziertesten in New York, Rom, Tokio oder Los Angeles – firmierten als Gestapo. Über Techniken ließen sie sich in umschreibender Sprache aus und verstanden auf Anhieb, was gemeint war, weil sie bei allen individuellen Unterschieden aus demselben Holz geschnitzt waren. Dabei war keiner der fünf so naiv zu glauben, die Verhaltenspsychologen vom FBI oder bei der Special Branch des Scotland Yard oder den entsprechenden Stellen in Paris, Berlin, Madrid, Buenos Aires, Rotterdam oder Mexico City würden nicht auf Anhieb verstehen, worum es ging. Doch die Bälle, die sie sich zuwarfen, waren so geschickt abgefälscht, dass sie den meisten lasch und harmlos erscheinen mussten.
Die Fotos, die sie von Zeit zu Zeit einstellten und an denen sie sich alle weideten, waren alles andere als das. Gemeinsam machten sie sich ein Vergnügen daraus, ihre Versuche auf ihrem fotografischen Spezialgebiet auf die Webseiten ausgesuchter Polizeiwachen hochzuladen. Cop Shops nannten sie die. Ausgesucht nach dem Zufallsprinzip. Vom Polarkreis in Alaska bis zu den wilden Pampas Patagoniens. Von Christchurch bis nach Guangzhou in Südchina. So wie der Verkehrspolizist in Cressy-sur-Marne fuhr dann irgendein armer Tropf in irgendeinem Dezernat an einem stinknormalen Morgen seinen Computer hoch und hatte statt alltäglicher Schadensberichte eine blutüberströmte Leiche oder ein abgetrenntes Körperteil vor sich, mit einer Überschrift wie:
Na, erkennst du das?
Oder noch besser:
Wüsstest du nicht gerne, wer das war?
Die Überschriften brachten sie in unterschiedlichen Sprachen. Einmal auf Japanisch. Dann Swaheli. Arabisch. Englisch eher selten. Dabei achteten sie peinlich darauf, dass auf den Bildern keine verräterischen Besonderheiten zu erkennen waren. Alpha sah es gerne, wenn fünf Augenpaare ein jedes solches Foto auf derartige Merkmale untersuchten, bevor er es rausschickte. Gemeinsame Verantwortung. Fünffache Genauigkeit. Mehr als einmal hatten sie gegen ein Bild ihr Veto eingelegt, weil einer von Jack’s Boys etwas entdeckt hatte, das möglicherweise wiedererkennbar war. Zum Beispiel eine Pflanzenart im Hintergrund. Ein spezifisches Kleidungsstück. Die Körperstelle, an der sich eine Wunde befand. Außerdem wechselten sie sich beim Posten ab. Nie stellte es der Täter ein. Die Aufgabe fiel, nach reiflicher Diskussion, immer einem der anderen zu, auch wenn sie in dem Moment alle ihre Freude daran hatten und sich über den Zaubertrick, mit dem sie die Fotos hochluden, die Hände rieben. Einmal hatte sich Easy den Spaß gemacht und zu einem von Charlies Leichenfotos die GPS-Koordinaten angeführt. Das Ganze ging allerdings an einen Cop Shop auf einem anderen Kontinent, tausende Meilen entfernt und politisches Feindesland. So als würden sie Informationen über einen Toten im Umfeld von Denver an Polizisten in Teheran schicken.
Wenn sie sich dann wieder online trafen, lachten sie und malten sich den Schock und die Bestürzung in dem betreffenden Cop Shop aus, und den Ärger, wenn die dortigen Beamten versuchten, sich mit dem Cop Shop zu verständigen, der in der Nähe des Leichenfundorts lag.
Und dann lösten sich die Jack’s Boys im Internet in Luft auf und zogen sich in ihr jeweiliges eigenes geheimes Leben zurück.
Auch wenn diese Bilder auf Jack’s Special Place gelöscht wurden, nachdem sie sie miteinander geteilt und quer durch die Welt des Internets gejagt hatten, waren sie Jack’s Boys da schon unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt. Und auch hierin war keiner von ihnen naiv: Sie wussten alle sehr wohl, dass in der Welt des Internets nichts gänzlich und für immer verschwindet. Was für sie alle, weil sie die Gefahr liebten, ein Nervenkitzel, ja, geradezu berauschend war, schlug allerdings in Ernüchterung um, als sie die nächste Nachricht des Eindringlings sahen.
Socgoal02 schrieb:
Also, was seid ihr eigentlich für Leute? Ein paar alte abgetakelte Arschlöcher, die sich für besonders schlau halten? Sich als echte Killer ausgeben? Ein Klub von Perversen, die sich an kranken Mordfantasien aufgeilen?
Kaum hatte Alpha die höhnische Bemerkung gelesen, flogen seine Finger über die Tastatur. Er hatte in dem, was er sein Büro nannte, ein ehemals muffiges, nunmehr für seinen besonderen Bedarf aufgemöbeltes Kellerloch, vier Computerbildschirme vor sich. Der Rückverfolgungsalgorithmus, den er vor Jahren installiert hatte, war an Jack’s Special Place bis dahin noch nie zum Einsatz gekommen, weil es noch nie nötig gewesen war. Die Ganovenehre ließ es nicht zu, ihn gegen Bravo, Charlie, Delta oder Easy anzuwenden. Außerdem hatten sie wahrscheinlich sowieso ihrerseits entsprechende Schritte unternommen, um ihn mittels quer über den ganzen Globus verteilte Server abzuschmettern. Der Eindringling dagegen wohl eher nicht. Für einen Moment verfluchte er sich dafür, den Algorithmus nicht laufend weitergetestet zu haben.
Er wusste nur, dass er Socgoal02 ein paar Minuten lang auf ihrem Portal festhalten musste, damit das Programm, falls es denn funktionierte, seine Aufgabe erledigen konnte.
Und so tippte Alpha:
Das hier ist ein geschlossener Chatroom. Sie verletzen unsere Privatsphäre und einige US-Gesetze sowie internationale Abkommen, wenn Sie hier eindringen. Sie sollten sich auf der Stelle entschuldigen und verschwinden.
Ihm war natürlich klar, dass es keine Gesetze gab, die Socgoal02 s unerwünschte Anwesenheit betrafen, ob nun in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Westeuropa oder Lateinamerika. Und er wusste auch, dass er mit der Forderung nach einer Entschuldigung höchstwahrscheinlich eine weitere Antwort herausforderte.
Was auch die anderen sahen, die auf der Plattform ausharrten.
Und die vier begriffen sofort, dass Alpha diesen Eindringling dadurch so lange im Chat »festhalten« wollte, bis er ihn unschädlich gemacht hatte.
Bravo schrieb:
Hör mal zu, Junge, du begehst gerade einen kapitalen Fehler. Hau ab!
Wollte man jemanden in einem Fehler bestärken, so sein Kalkül, sagte man ihm am besten, er solle sich verziehen.
Das sah Delta genauso.
Er schrieb:
Du ahnst nicht, in was für Schwierigkeiten du dich gerade bringst.
Socgoal02 schnappte den Köder und schrieb:
Vielleicht ein Kaffeekränzchen alter Damen? Hab ich euch auf dem falschen Fuß erwischt? Wisst ihr was? Ihr mögt euch bei dem, was ihr da treibt, ja vielleicht für tolle Hechte halten, aber ich würde mich als Mörder jederzeit besser anstellen. Ein Haufen Amateure.
Easy reagierte prompt:
Kleiner, du klingst wie ein Zwölfjähriger. Das hier ist für Erwachsene.
Eine Antwort von Socgoal02 blieb aus.
Charlie schaltete sich ein:
Hör zu, egal, wer du bist, du legst dich besser nicht mit uns an.
Hierauf meldete sich Socgoal02 zurück:
Hab ich bereits. Man sieht sich, Loser.
Dann für alle sichtbar die Meldung:
Socgoal02 hat den Chat verlassen.
Die Männer verharrten, jeder für sich, vor ihrer Tastatur, jeder musste erst einmal mit seiner eigenen Angst und Wut fertigwerden.
Es war an Alpha, für Ordnung zu sorgen.
Bei der Erstellung von Jack’s Special Place hatte er für unvorhergesehene Ereignisse Notfallprogramme installiert. Im Lauf der Jahre, in denen das Portal nun schon existierte, war er allerdings nachlässig geworden und hatte sich in der Sicherheit gewogen, dass seine Vorkehrungen mehr als ausreichend waren.
Alpha schrieb:
Dank euch allen. Er war lange genug drin. Ich glaube, ich hab ihn.
Er ließ den Satz erst einmal so stehen, damit die gute Nachricht bei den anderen ankam.
Nach einer Weile stellte Delta die Frage, die ihnen allen unter den Nägeln brannte:
Cop?
Alpha antwortete:
Nein. Er hat sich nur den Anschein gegeben. Ein dummer kleiner Grünschnabel irgendwo in den USA, der mit seiner Zeit nichts Besseres anzufangen weiß. Ostküste. New England. Man beachte: Socgoal02. Wäre er in Europa, hätte er sich Footgoal02 genannt, oder?
Easy antwortete prompt:
Siehst du richtig. Guter Punkt.
Sie alle schalteten einen Gang herunter, beruhigten sich, bis der Puls wieder normal war
Bravo tippte:
Wie ist das passiert? Hatten wir noch nie.