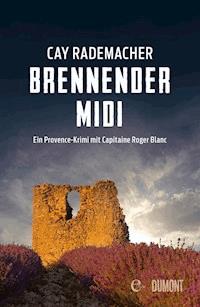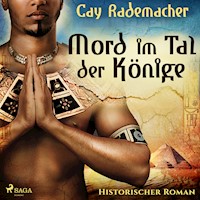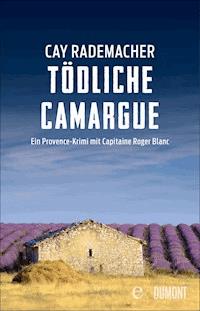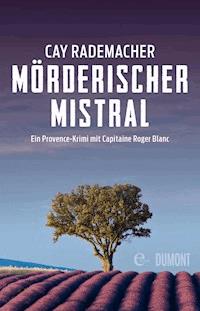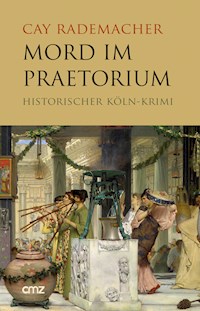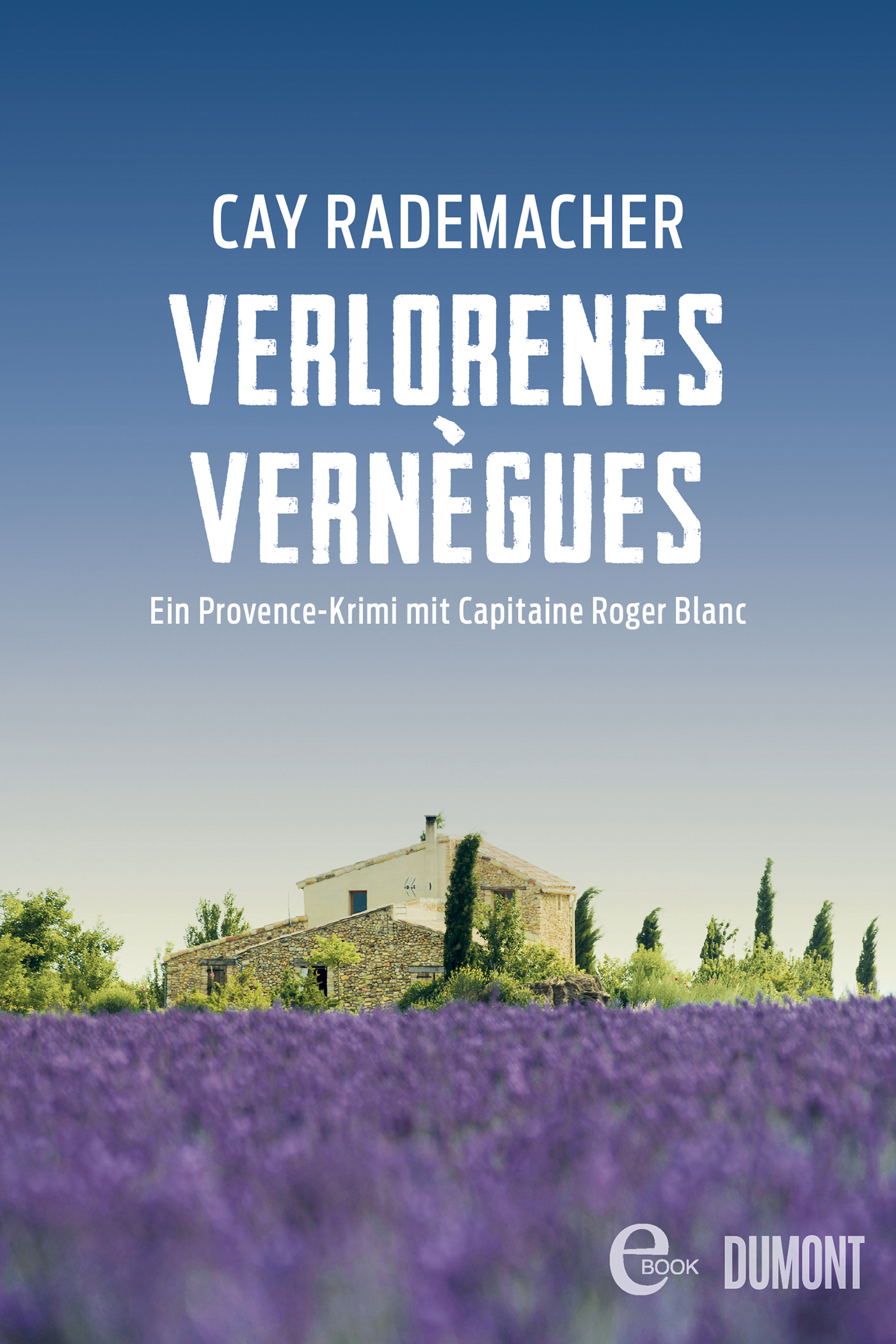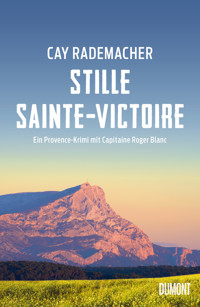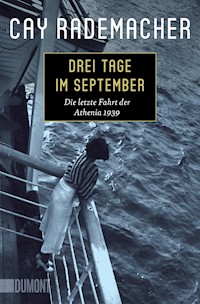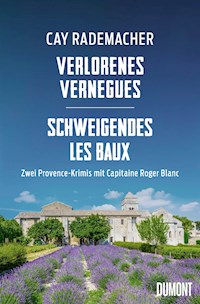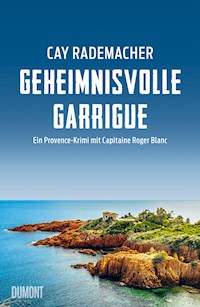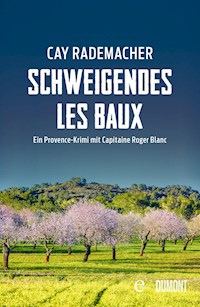14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Provence-Krimi Sammelband
- Sprache: Deutsch
Mord in der Provence - Zwei Krimis mit Capitaine Roger Blanc in einem eBook Mörderischer Mistral - Capitaine Roger Blancs erster Fall Von der Frau verlassen und in die Provinz versetzt: Bis vor kurzem war Capitaine Roger Blanc erfolgreicher Korruptionsermittler in Paris, doch dabei ist er mächtigen Leuten auf die Füße getreten. Und so findet er sich bald allein in seiner neuen Behausung in der Provence wieder, einer alten, verfallenen Ölmühle, die ihm vor Jahren ein Onkel vermacht hatte. Aber bevor Blanc sich im kleinen Ort Gadet nur ein wenig zurechtfinden kann, wird ihm ein Mordfall zugewiesen. Unversehens verfängt sich der Capitaine in einer Intrige, die ihn tiefer in die Strukturen seiner neuen Heimat führt, als ihm lieb ist. Tödliche Camargue - Capitaine Roger Blancs zweiter Fall August, die Luft über der Provence flirrt in drückender Hitze. Capitaine Roger Blanc und sein Kollege Marius Tonon werden in die Camargue gerufen: Ein schwarzer Kampfstier ist ausgebrochen und hat einen Fahrradfahrer mit den Hörnern aufgespießt. Ein bizarrer Unfall, so sieht es zunächst aus, bis Blanc ein Indiz dafür entdeckt, dass jemand das Gatter absichtlich geöffnet hat. Und schon bald stößt Blanc bei seinen Ermittlungen auf eine alte, tödliche Geschichte, die jeder, aber auch wirklich jeder vergessen will. Mord in der Provence – Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lançon Band 12: Rätselhaftes Saint-Rémy Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über die Bücher:
Mord in der Provence – Zwei Krimis mit Capitaine Roger Blanc in einem Band
Band 1: Mörderischer Mistral
Tödliche Seilschaften in der Provence – Capitaine Roger Blancs erster Fall
Von der Frau verlassen und in die Provinz versetzt: Bis vor kurzem war Capitaine Roger Blanc erfolgreicher Korruptionsermittler in Paris, doch dabei ist er mächtigen Leuten auf die Füße getreten. Und so findet er sich bald allein in seiner neuen Behausung in der Provence wieder, einer verfallenen Ölmühle, die ihm vor Jahren ein Onkel vermacht hatte. Aber bevor Blanc sich im kleinen Ort Gadet nur ein wenig zurechtfinden kann, wird ihm ein Mordfall zugewiesen. Unversehens verfängt sich der Capitaine in einer Intrige, die ihn tiefer in die Strukturen seiner neuen Heimat führt, als ihm lieb ist.
Band 2: Tödliche Camargue
Dunkle Geheimnisse in der Camargue – Capitaine Roger Blancs zweiter Fall
August, die Luft über der Provence flirrt in drückender Hitze. Capitaine Roger Blanc und sein Kollege Marius Tonon werden in die Camargue gerufen: Ein schwarzer Kampfstier ist ausgebrochen und hat einen Fahrradfahrer mit den Hörnern aufgespießt. Ein bizarrer Unfall, so sieht es zunächst aus. Bis Blanc ein Indiz dafür entdeckt, dass jemand das Gatter absichtlich geöffnet hat. Während ein fröhlicher Bautrupp das alte Dach von seiner halb verfallenen Ölmühle abträgt, aber kein neues eindeckt, stößt Blanc bei seinen Ermittlungen auf eine alte, tödliche Geschichte, die jeder, aber auch wirklich jeder vergessen will.
Über den Autor:
© Francoise Rademacher
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Krimiserie umfasst: ›Mörderischer Mistral‹ (2014), ›Tödliche Camargue‹ (2015), ›Brennender Midi‹ (2016), ›Gefährliche Côte Bleue‹ (2017), ›Dunkles Arles‹ (2018) und ›Verhängnisvolles Calès‹ (2019). Außerdem erschien 2019 der Kriminalroman ›Ein letzter Sommer in Méjean‹. Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Mehr über das Leben im Midi erfahren Sie im Blog des Autors: Briefe aus der Provence
CAY RADEMACHER
MÖRDERISCHERMISTRAL
TÖDLICHECAMARGUE
Zwei Provence-Krimis
Vollständige eBook-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Werke ›Mörderischer Mistral‹ (© 2014) und ›Tödliche Camargue‹ (© 2015) eBook 2018 © 2018 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © Christian Heeb/laif eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN eBook: 978-3-8321-8408-7
CAY RADEMACHER
MÖRDERISCHERMISTRAL
Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc
Il est midi,le jour lui-même est en balance.
Albert Camus
Ein altes Haus in der Provence
Roger Blanc trat einen Stein weg und erschreckte dadurch einen schwarzen Skorpion. Das Biest war so lang wie sein Daumen und bog den Giftstachel drohend in die Höhe. Eine Sekunde später war es im Gestrüpp verschwunden. Willkommen zu Hause, dachte Blanc.
Er war Capitaine einer Spezialeinheit der Gendarmerie in Paris, ein Mann Anfang vierzig mit blassblauen Augen, in schwarzem T-Shirt, Jeans und ausgelatschten Sportschuhen. Ein Experte, der so viele Fälle gelöst hatte, dass er seinen Kollegen unheimlich war. Bewohner eines Appartements über den Dächern des sechzehnten Arrondissements. Ehegatte einer wundervollen Frau. Zumindest war das alles so gewesen bis zum letzten Freitag um 11.30Uhr. Jetzt war es 9.00Uhr am Montag und seine Karriere lag im Altpapiercontainer, Fotos seines Appartements wurden gerade im Schaufenster eines Maklers aufgehängt und seine Frau war zu ihrem Liebhaber gezogen. Er hatte schon Wochen erlebt, die besser begonnen hatten.
Die Sonne schien gnadenlos auf eine Ruine aus braungelben Steinen, mehr als 800Kilometer südlich von Paris. Der Ort Sainte-Françoise-la-Vallée war so winzig, dass die Navigationsapp seines Nokias beinahe eine Minute gebraucht hatte, um den Weg von der Kapitale bis hierher zu berechnen. Provence. Das klang so lange gut, bis man die Karte nahe heranzoomte. Sainte-Françoise-la-Vallée lag tief im Süden, es grenzte beinahe schon an den Étang de Berre. Waren da nicht irgendwo Raffinerien und Tankerhäfen? Auf jeden Fall war Marseille nicht weit, und das bedeutete Drogen und Korruption und die Verachtung der Pariser Zentrale.
Blanc hatte das heruntergekommene Haus im Midi vor zehn Jahren von einem Onkel geerbt. Ein einziges Mal war er bis heute hier gewesen, da musste er vier oder fünf Jahre alt gewesen sein: Er hatte wenige Bilder im Kopf, ein enges Zimmer, hölzerne Fensterläden, geschlossen gegen die Sommerhitze. Sonnenstrahlen, die durch die Holzlamellen wie ein Fächer aus gelbem Licht über die Fußbodenfliesen krochen. Deutlicher war ihm ein scharfer Geschmack in Erinnerung geblieben: sein Onkel, der ihm lachend ein Glas Rosé einflößte. Er hatte es hinuntergestürzt, gierig vor Durst, und zu spät die Säure des Alkohols bemerkt.
Danach war Blanc niemals mehr zu jenem Onkel gefahren. Jahre später hatte er anstandslos die Erbschaftssteuer bezahlt, weil es ihm zu mühselig gewesen war, sich um den Verkauf eines Hauses zu kümmern, das ihm nichts bedeutete. Außerdem hatte er zu viel zu tun. Er hatte immer zu viel zu tun. Aber auch das würde sich vielleicht nun ändern. Das Anwesen war viel kleiner, als er gedacht hatte. Und viel verfallener.
Es war eine Ölmühle aus dem 18.Jahrhundert im Tal der Touloubre: ein zweigeschossiges Haus, das sich wie ein müder Wanderer an eine etwa zwanzig Meter aufragende Felswand lehnte. Wände aus grob zurechtgehauenen Steinen, so dick wie die Mauern einer Burg. Ockerrote Dachziegel, an manchen Stellen verrutscht oder gebrochen. Wilder Wein wucherte über die Mauern, das schmiedeeiserne Gitter vor den Fenstern und der Eingangstür. Deren Holz war einstmals blau gestrichen gewesen, doch die Farbe war aufgeplatzt und zu einem blassen Grau verwittert. Die Fensterläden hingen wie zerfetzte Segel in den verrosteten Angeln. Im Fluss, der um das Grundstück herumströmte, quoll flaschengrünes Wasser über bemooste Steine, Libellen huschten durch die Lichtreflexe wie winzige Hubschrauber. Vor dem Gebäude blühten Disteln und dornige Sträucher, deren Namen Blanc nicht kannte. An der hinteren Ecke wuchs ein uralter Oleander bis an die Dachkante hoch, eine betäubend duftende Wolke aus grünen Blättern und blutroten Blüten. Es war schon so heiß, dass die Zikaden in den Bäumen sägten.
Blanc fingerte einen geschmiedeten Schlüssel hervor, schwer wie ein Hammer, ein Stück, das jedes Heimatmuseum in einer Vitrine präsentiert hätte. Mit seinem Opinel-Messer kappte er die Weinranken rund um das Schloss und steckte ihn in die Öffnung. Er brauchte ein paar Minuten und all seine Kraft, bis er den verrosteten Mechanismus bezwungen hatte. Immerhin hat es niemand aufgebrochen, dachte er, atmete noch einmal die würzige Luft ein und zwängte sich danach ins dämmrige Innere.
Die Kühle eines alten Gemäuers. Der Geruch nach Staub, ein Duft wie altes Papier und Sand. Niemand hatte das Haus je leer geräumt. Blanc trat in eine Zeitkapsel ein: eine Küche mit Arbeitsplatten aus gelbem Marmor, einer uralten Keramikspüle, der Wasserhahn aus stumpf gewordenem Messing. Um einen großen Esstisch aus Holz, früher weiß lackiert, nun verwittert, standen fünf unterschiedlich geformte Stühle. Blanc betrat ein Wohnzimmer mit einem niedrigen Tisch aus den Sechzigerjahren, einem Sofa, auf dem der mumifizierte Körper einer Fledermaus lag, einem Kamin aus rußüberzogenen Steinen. Im Schlafzimmer stieß er auf einen Kleiderschrank aus Mahagoni, Empire, ein Stück, das in Paris ein Vermögen kosten würde. Daneben ein eisernes Doppelbett ohne Matratzen. (Sein Onkel war, wie sich Blanc jetzt erinnerte, dort gestorben.) Im Bad eine riesige Wanne, die auf gusseisernen Füßen in Form von grimmigen Löwen stand, dreckverkrustet, mit drei offenen Weinflaschen darin, deren Inhalt längst verdunstet war.
Blanc verzichtete darauf, die steinerne Treppe ins Obergeschoss hochzugehen. Er ging in den Flur zurück, wo auf einer kleinen Anrichte ein graues Telefon mit Wählscheibe stand. Er hob den Hörer ab. Tot. Was hatte er gehofft? Er öffnete den Sicherungskasten daneben, zögerte kurz, legte den Hauptschalter um. Er erwartete, ein Knallen der antiquierten Sicherungen zu hören, Funkenschlag zu sehen, den Gestank von durchgeschmorten Kabeln zu atmen. Stattdessen flackerte eine alte Wohnzimmerlampe auf und brannte dann gelblich unter der Staubschicht, die sich auf der Birne angesammelt hatte. Immerhin also Strom. Ihm fiel plötzlich wieder ein, dass es da seit Jahren im September eine Rechnung von EDF gab, die er nie verstanden, aber stets bezahlt hatte. Nun wusste er, wofür. Blanc zog sein Nokia hervor. Kein Empfang, das musste der Felsen sein, der die Rückwand des Hauses stützte. Hat auch seine Vorteile, dachte er.
Blanc trat wieder ins Freie, erschöpft vom letzten Streit mit Geneviève, von der langen nächtlichen Fahrt aus Paris, von der Hitze, von der Arbeit, die ihm bevorstand, um aus dieser Ruine wieder ein bewohnbares Haus zu machen. In seinem alten grünen Renault Espace befanden sich alle seine Besitztümer. Den Wagen hatten Geneviève und er angeschafft, als die Kinder noch klein gewesen waren: geräumig, aber leider so streikfreudig wie ein Gewerkschaftsfunktionär der CGT. Seine Frau – seine Exfrau – hatte ihm das Auto vorgestern überlassen. Was ihr neuer Kerl wohl für einen Wagen fuhr? Mach dich nicht zum Narren, ermahnte sich Blanc.
»He!« Eine aggressive Stimme, jenseits der Touloubre. »Diese cabane ist nicht zu verkaufen. Die gehört einem Idioten aus Paris!«
»Ich bin der Idiot aus Paris!«, schrie Blanc zurück. Er erkannte am anderen Ufer einen weißhaarigen, dabei gar nicht so alten Mann, der auf einem verbeulten grünen Traktor saß und ihn misstrauisch musterte. Hinter ihm ein weiß verputztes, schmutziges Haus undefinierbarer Form, umstellt von einem verrosteten Baugerüst ohne Holzbretter. Von irgendwoher erklang Ziegenmeckern. Muss ein Bauernhof sein, dachte Blanc. »Ich bin der neue Bewohner«, setzte er freundlicher hinzu. Das Letzte, was er jetzt brauchen konnte, war ein Nachbarschaftsstreit.
Der Mann auf dem Traktor war klein und drahtig wie ein Bantamgewichtler. »Sie dürfen bei der Renovierung das Haus nicht vergrößern«, brüllte er. »Das erlaubt die Gemeinde nicht.« Seine Stimme war von Gitanes gegerbt. Er nahm die gelbe Zigarette nicht aus dem Mund, während er redete.
»Ich baue hier kein Hotel«, versicherte Blanc. »Connard«, setzte er flüsternd hinzu, »Idiot«.
Der Nachbar rief irgendetwas Unverständliches zu seinem Haus hin, wo sich offenbar jemand verborgen hielt. Dann gab er Gas und röhrte mit seinem Traktor davon.
Blanc faltete seinen fast zwei Meter langen Körper zusammen, tauchte in den Espace und kramte im Durcheinander auf dem Beifahrersitz herum. Eine Sporttasche fiel in den Fußraum, Notizhefte und CDs quollen heraus. Er war nicht besonders geschickt, seine Arme und Beine waren zu lang und irgendwie immer im Weg. Endlich fand er seine verblichene blaue Baseballcap mit dem Aufdruck Nova Scotia. Er war geboren im Norden – dort, wo die Leute sich ungefragt bei Fremden entschuldigen, wenn es einmal zwei Tage hintereinander nicht regnet. Er hatte keine Lust, seine neuen Kollegen mit abpellendem Nasenrücken zu begrüßen.
Neue Kollegen … Es war der 1.Juli und jeder anständige Franzose faulenzte längst im endlosen Sommerurlaub. Er aber musste sich auf einer neuen Dienststelle melden. »Merde!«, fluchte Blanc und schlug auf das Lenkrad, »merde, merde, merde!«
Am Freitag um 11.30Uhr war er in die Zentrale der Gendarmerie einbestellt worden, einem kalten neuen Zweckbau in der Rue Claude Bernard in Issy-les-Moulineaux jenseits des Périphérique von Paris. Monsieur Jean-Charles Vialaron-Allègre hatte ihn herbeordert, Enarch, Abgeordneter, Staatssekretär im Innenministerium und einer jener Männer in der Regierungspartei, deren unermesslicher Ehrgeiz erst mit dem Einzug in den Élysée gesättigt wäre. Sein Büro war im gleichen abwaschbaren Luxus eingerichtet wie die Erste-Klasse-Lounge der Air France in Roissy. Der Staatssekretär war etwa fünfzig Jahre alt, dünn, die gelichteten grauen Haare klebten mit Pomade an seinem hohen Schädel, sein Maßanzug war von der Sorte, die besonders teuer und unauffällig ist. Er hatte eine de-Gaulle-Nase, und da beim Gehen sein Kopf auf dem mageren Hals stets etwas vor- und zurückzuckte, wirkte er auf den Capitaine wie ein gravitätischer Reiher.
Blanc stand in Vialaron-Allègres Büro und schwankte vor Müdigkeit. Er hatte in den letzten beiden Monaten keinen freien Tag gehabt. Die wenigen Stunden Schlaf hatte er oft genug in der Gendarmeriestation verbracht, die gummierte Schreibtischunterlage vor dem Monitor war sein Kissen gewesen. Das war der Preis, den er zahlen musste (der einzige, wie er da noch dachte), um einen ehemaligen Handelsminister zu überführen, bevor der alle belastenden Unterlagen verschwinden lassen konnte. Eine alte Geschichte, aber noch nicht verjährt: Frankreich hatte in den Neunzigerjahren Kraftwerksturbinen an die Elfenbeinküste geliefert. Die afrikanische Regierung hatte Millionen Francs dafür bezahlt – und einige dieser Millionen waren weder in der Staatskasse noch beim Kraftwerksbauer gelandet, sondern auf Konten in Liechtenstein. Mit dieser netten Summe war später der Wahlkampf eben jenes Ministers bezahlt worden, als der sich zum Bürgermeister von Bordeaux aufschwingen wollte, um sich einen gut dotierten Alterssitz zu verschaffen.
Kein Politiker liebt einen Flic, der Korruption aufdeckt, denn mit jedem Skandal hat er das Gefühl, dass die Einschläge näher kommen. Andererseits war der ehemalige Minister ein Schwergewicht der konkurrierenden Partei des Staatssekretärs und schon drohten wieder Wahlen am Horizont. Da war es doppelt ratsam, unbestechlich zu erscheinen. Blanc hoffte deshalb, dass er befördert werden würde: Commandant der Gendarmerie. In seinem Alter. Nicht schlecht.
»Gratuliere. Sie werden versetzt.« Die Stimme von Vialaron-Allègre klang wie Kreide auf einer Schultafel.
Blanc, erwartungsvoll und erschöpft, brauchte ein paar Sekunden, bis die Bedeutung dieser Worte in seinem Hirn explodierte. »Wohin?« Er bemerkte selbst, dass er keuchte, als hätte man ihm einen Leberhaken versetzt. Paris war das Zentrum der Welt – für einen Gendarmen, wenn er Karriere machen wollte. Und für einen Nordfranzosen, der nie, nie wieder an seine muffig-feuchte Herkunft erinnert werden wollte. Der bloß fortwollte von verfallenen Reihenhäusern und stillgelegten Stahlwerken. Fort von Orten, in denen die Einzigen, die noch Arbeit hatten, die Beamten des Arbeitsamtes waren. Fort von einer Welt, in der Bier und Zigaretten zum Lebensinhalt geworden waren.
»In den Süden.«
Blancs Gedanken tanzten. Der Midi. Mafia. Provinz. Arsch der Welt. Die Müllkippe jeder Karriere. »Sie stellen mich kalt?«
Der Staatssekretär hob die Hände. »Kaltstellen? In der heißesten Region Frankreichs? Ich bitte Sie!«
Was hast du zu verbergen?, dachte Blanc. Ob Vialaron-Allègre in die Durchstecherei mit den Turbinen verwickelt war? Was hatte er damals für einen Posten? Schon Abgeordneter? In welchem Ausschuss? Zu spät: Für Millionen Franzosen war der Süden ein Traum. Jeder Wähler würde, sofern er sich für ein derartiges Detail überhaupt interessierte, die Versetzung des Korruptionsermittlers Roger Blanc als Belohnung für geleistete Dienste verstehen – und nicht als Strafe. Sehr subtil. »Wann?«, fragte er und bemühte sich, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten.
»Sofort. Sie beginnen Montagmorgen. In der Gendarmerie einer Ortschaft namens Gadet. Mal was anderes als Paris, was, mon Capitaine? Sie haben da in der Nähe ja ein Häuschen.«
Blanc brauchte endlose Augenblicke, bis er überhaupt verstand, worüber der Staatssekretär sprach. Woher weiß der Kerl das? Er hatte seit Jahren nicht an die geerbte Ruine gedacht und nie einem Kollegen davon erzählt. »Dann werde ich mal meine Unterlagen im Büro zusammenpacken«, murmelte er schließlich. Es sollte eine Drohung sein, eine letzte trotzige Geste, ein Signal: Ich habe auch schon Indizien gegen dich gesammelt, warte nur ab.
Aber falls der Staatssekretär beunruhigt war, so zeigte er es nicht. Sein Mund formte ein Lächeln, während seine schmalen, grauen Augen ihn aufmerksam musterten. »Wir werden uns wahrscheinlich noch oft begegnen«, sagte er und schüttelte ihm förmlich die Hand. Es klang wie eine Kriegserklärung. Und als Blanc schon an der Tür war, rief er ihm noch nach: »Auch Ihre Gattin wird sich sicher über die Versetzung in die Provence freuen.« Das klang wie eine Beleidigung, aber Blanc brauchte noch mehr als eine Stunde, bis er den Sinn dieses Satzes begriff.
Blanc gab die Adresse der Gendarmeriestation von Gadet ins Handy ein. Die App zeigte ihm eine Landstraße an, ein paar Kurven, ein Kreisverkehr, kaum mehr als zweieinhalb Kilometer. Er drehte am Zündschlüssel und der Espace sprang wider Erwarten schon beim dritten Versuch an. Er schob die CD von Fredericks Goldman Jones, die ihm Geneviève nach ihrer ersten gemeinsamen Woche geschenkt hatte, in die Anlage und rollte zum großen, halb verfallenen Tor, das den Zugang zu seinem Grundstück begrenzte. Immerhin würde er nicht mehr wie im morgendlichen Paris im Stau stehen, dachte er – und trat nach zwanzig Metern auf die Bremse, weil er auf der schmalen Landstraße nicht weiterkam. Vor ihm standen drei weißgraue Pferde und starrten desinteressiert durch seinen Wagen hindurch.
Blanc hupte. Ein Pferd wieherte. Er hupte wieder. Die Pferde drehten ihm ihre Hinterteile zu. Blanc überlegte, ob er die Biester einfach umfahren sollte. Doch sein Renault war so klapprig, dass er vermutlich den Kürzeren ziehen würde. Er fingerte das Nokia aus der Halterung am Armaturenbrett und zoomte in die Karte hinein. Es gab keinen anderen Weg nach Gadet als diese Route départementale. Er kurbelte das Seitenfenster hinunter und rief: »Ich mache euch zu Wurst!«
»Für die Wurst nimmt man Esel, keine Camarguepferde.«
Blanc fuhr auf seinem Sitz herum. Neben seiner Beifahrerseite stand ein Pferd, das ihm noch einen halben Meter höher zu sein schien als die anderen drei. Darauf saß lässig eine Reiterin, sie musste quer über ein Feld gekommen sein. Er schätzte sie auf etwa vierzig Jahre, ihre kräftigen schwarzen Haare waren zu einem strengen Zopf zurückgebunden, ihre Haut war von endlosen Sonnenstunden so tief gebräunt, dass sie diesen Teint niemals mehr verlieren würde. Sie trug Mokassins, Jeans und ein altes weißes T-Shirt mit einem roten Herz und der Parole Don du Sang.
»Pardon. Manchmal vergessen meine Töchter, das Gatter zu schließen.« Sie deutete auf eine Wiese jenseits der Straße, die halb hinter einer Reihe hoher Zypressen verborgen lag. Daneben stand ein Haus aus rötlichen Steinen, vor dem gelber Oleander blühte. Bougainvilleen schütteten rote Kaskaden über einen schmiedeeisernen Balkon im ersten Stock.
»Dann sind wir Nachbarn.« Blanc nannte seinen Namen und schälte sich aus dem Auto, ließ den Motor jedoch laufen, aus Angst, dass der Espace auf der Landstraße nicht mehr starten würde.
Sie sprang mit der federnden Leichtigkeit einer Kunstturnerin vom Pferd. »Paulette Aybalen.«
Er schüttelte ihre Hand und deutete auf die Ruine. »Ich werde mich um diesen Steinhaufen kümmern.«
»Endlich wohnt da wieder jemand. Ihr Ferienhaus?«
Sie hat die »75« gesehen, dachte Blanc, das Pariser Nummernschild, die Idiotenplakette. Sie wird das Schlimmste denken. Besser, ihr gleich die ganze Wahrheit zu sagen. »Ich bin hierhin versetzt worden«, erklärte er. »Gendarmerie.«
Sie zögerte eine Winzigkeit, ein Augenschlag des Misstrauens, den er bei fast jedem Menschen erlebt hatte, der zum ersten Mal von seinem Beruf hörte. »Sie werden sich hier garantiert nicht langweilen!«, erwiderte sie schließlich.
»Ich werde meine Energie auf die Arbeit und auf das Renovieren verteilen. Ich habe gerade schon ein paar Hinweise zum Ausbau erhalten.«
Paulettes Lächeln verflog. »Serge«, sagte sie und nickte. »Serge Douchy.«
»Ein Freund offener Worte.«
»Serge brüllt durch die Gegend wie ein betrunkener clochard, seine Schäferhunde bellen die halbe Nacht, seine Ziegenherde stinkt zum Himmel, sein schimmeliges Haus steht da ohne Genehmigung, mit einer asthmatischen Dieselpumpe saugt er illegal Wasser aus der Touloubre und er schießt mit seiner Schrotflinte auf alles, was Fell oder Federn hat. Aber ansonsten ist er in Ordnung.«
»So ungefähr habe ich ihn eingeschätzt.«
»Sie sind ja auch ein Profi.« Paulette lachte wieder. »Ich treibe jetzt die Pferde auf die Weide, bevor sie noch beim Metzger landen.«
Blanc beobachtete sie und atmete tief durch. Es duftete herb. »Wonach riecht es hier?«, fragte er.
»Dort sah ich zum ersten Mal dunkelgrüne Büschel, die wie Zwergoliven aus dem Baoukogras auftauchten«, antwortete sie. »Ein Zitat«, setzte sie hinzu, als sie seinen verblüfften Blick bemerkte. »Marcel Pagnol. Ihm ging es so wie Ihnen, als er das erste Mal in der Provence aufs Land ging. Der Duft überwältigte ihn. Das ist der wilde Thymian. Der wächst hier überall unter den Bäumen. Sehr gesund. Sehr schmackhaft.«
Blanc, der sich in den letzten Jahren hauptsächlich von Croissants und pappigen Baguettes ernährt hatte, wusste weder, wie Thymian schmeckte, noch, wie er aussah. Er nickte unbestimmt, um nicht wie ein Trottel dazustehen.
»Ich werde vorbeikommen und Ihrer Frau ein paar Rezepte geben«, sagte Paulette, die seine Ahnungslosigkeit erraten hatte.
»Die Rezepte müssten Sie ihr mailen. Meine Frau ist in Paris.«
Paulette Aybalen schwang sich auf ihr Pferd und sagte nichts. Die anderen drei Tiere waren inzwischen freiwillig zur Weide getrabt. Blanc hatte keine Ahnung, welchem heimlichen Zeichen ihrer Herrin sie gehorchten. »Dann werde ich Ihnen die Rezepte vorbeibringen. Wir werden uns ja häufiger über den Weg laufen.«
»Ich werde nie wieder Pferdewurst erwähnen.« Blanc stieg hinter das Steuer und gab behutsam Gas, um die Tiere nicht zu erschrecken. Im Rückspiegel sah er, wie die Reiterin ihm hinterherblickte.
Über dem schmalen Asphaltstreifen der Straße flirrte die Luft. Aus dem Radio drang die Stimme eines Sprechers, der vor der Waldbrandgefahr im Midi warnte und an das Verbot erinnerte, Zigarettenkippen oder Glas in die Natur zu werfen. Es klang wie eine Verfluchung. Der Boden zu beiden Seiten war braun und krustig wie trockenes Brot. Er passierte eine aus Feldsteinen aufgeschichtete Mauer, hinter der er die grüngrauen Blätter junger Olivenbäume erkennen konnte und die Ruine eines Gebäudes, das vielleicht einmal ein Stall gewesen war oder ein winziges Gehöft. Pinien und Eichen an einem Hang. Eine Senke, in der Reihen von Weinstöcken standen.
Ein verbeulter weißer Lastwagen kam Blanc entgegen, viel zu schnell. Die Straße war so eng, dass er seinen Renault auf den sandigen Randstreifen lenken musste, um nicht gerammt zu werden. Er schimpfte, der Espace schüttelte sich, Steinchen knirschten unter dem rechten Vorderrad. Das Handschuhfach sprang auf und ein altes Modellauto flog heraus, ein grüner Opel Rekord. Blanc hatte die Majorette- und Matchboxautos seiner Kindheit nie wegwerfen können. Er präsentierte sie nicht in Vitrinen, wie nostalgische Sammler es tun, sie lagen einfach überall herum und tauchten an den überraschendsten Orten wieder auf, bevor sie erneut für lange Zeit verschwanden. Wie dieser alte Opel. Ein Geschenk seines Vaters.
Der war ein Flic gewesen wie er und schon lange tot: eine nächtliche Streifenfahrt, eine Ölspur in einer Kurve, und der alte blaue R4, den die Gendarmerie damals noch einsetzte, war an einem Baum zerknallt wie eine Konservendose. Seine Mutter hatte immer viel geraucht, und eine Woche nach ihrem vierzigsten Geburtstag hatte ein Arzt Schatten auf dem Röntgenbild ihrer Lunge entdeckt und ihr mit kaltem Bedauern die Diagnose gestellt. Zwei lächerliche Tode in Jahresfrist hatten Blanc als Teenager zum Waisen gemacht.
Blanc hatte später in Paris Jura studiert, weil er sich nach der maîtrise bei den Flics bewerben wollte, École des Officiers de la Gendarmerie Nationale in Melun. In seiner zweiten Woche an der Universität hatte er Geneviève kennengelernt, Erstsemester Kunstgeschichte. Sie war zierlich und schwarzhaarig, er groß und blond, sie kam aus dem Languedoc, er aus dem Norden, sie sprach ständig, er schwieg gerne, sie hielt die Filme von Eric Rohmer für die besten der Welt, für ihn war das Valium, sie rauchte Marlboro, er hasste Zigaretten, sie malte gerne spätabends Bilder nach, er paukte am liebsten frühmorgens Paragrafen. Sie passten in nichts zusammen. Sie waren das perfekte Paar.
Fast sofort kamen die Kinder, lange vor der Hochzeit, die sie viel später und eher als Formsache vollzogen. Und plötzlich war Eric einundzwanzig Jahre alt und studierte Biochemie in Montreal, weil die Jobaussichten in Frankreich so mies waren. Und Astrid war zwanzig, jobbte in Paris als Eventmanagerin und Blanc hatte keine Ahnung, was man bei so einem Beruf eigentlich zu tun hatte. Viel konnte es nicht sein, denn das Konto seiner Tochter war ein schwarzes Loch. Sein Leben mit Geneviève war ihm selbstverständlich gewesen wie das Atmen, sodass ausgerechnet der Bluthund, der im Job die feinste Witterung hatte, nicht einmal geahnt hatte, dass es da seit einem Jahr einen anderen gab.
Staatssekretär Vialaron-Allègre musste das aber gewusst haben, als er ihn am Freitagvormittag an den Arsch der Welt versetzt hatte. Ob er sogar vorausgesehen hatte, wie Geneviève reagieren würde? Gendarmen waren Militärs, für die die uralte Soldatenregel galt: Befehl ist Befehl! Selbst wenn es die Order war, innerhalb von ein paar Tagen aus Paris zu verschwinden. Als Blanc geschlagen aus Issy zurückgekehrt war, hatte seine Frau ihn angehört und hinterher ruhig verkündet, dass sie in der Hauptstadt bleiben würde. Dass sie schon lange mit ihm vernünftig sprechen wollte und dass dies nun der richtige Zeitpunkt sei. Und dann hatte sie ihre Koffer gepackt. Seither hatte Blanc höchstens vier Stunden geschlafen und fühlte sich wie ein Boxer in der zwölften Runde.
Zu seiner Linken leuchtete es rot und orange im Wald: Einige schwere Feuerwehrwagen parkten im Schatten von Pinien. Feuerwehrmänner in voller Montur, die bloß ihre Helme abgelegt hatten. Etliche saßen an einem hölzernen Picknicktisch und frühstückten, andere dösten auf den Autodächern. Blanc musste an die Waldbrandwarnung aus dem Radio denken. Im Midi postierten sie die pompiers nicht in ihren Wachen, sondern mitten im bedrohten Wald. Clever. Er würde ein paar Euro dafür springen lassen, wenn er jetzt auch im Pinienschatten schlafen könnte.
Er stellte den Espace ein Stück weiter mit laufendem Motor zwischen zwei Pinien ab und zog sich um. T-Shirt, Jeans und Schuhe warf er achtlos auf den Rücksitz, dann zwängte er sich in die ungewohnte Uniform und legte den Waffengurt um. Gendarmen durften sich meist aussuchen, ob sie in Zivil oder in Uniform zum Dienst erschienen. Er hatte in den letzten Jahren fast immer schwarze Klamotten getragen, sodass seine Zivilkleidung auch schon etwas von einer Uniform hatte. Für seinen ersten Tag auf der neuen Dienststelle warf er sich allerdings besser in Montur – mit der Uniform zog man sich die Autorität des Staates an und machte sich damit ein klein wenig unverwundbarer. Zuletzt setzte er die schmale, blaue Mütze auf, die Gendarmen trugen. Viele Kollegen hatten protestiert, als im Jahr 2011 das képi abgeschafft worden war, doch Blanc war sich mit der alten Kopfbedeckung immer vorgekommen wie ein Statist in einem Film von Louis de Funès. Er gab Gas.
Er bog an einer Kreuzung ab, sah eine hohe, gelb verputzte Mauer an der rechten Seite, dahinter Grabmonumente und eine Kapelle. Die Straße führte nach Gadet hinein, kleine, helle Häuser zu beiden Seiten, eine bescheidene Kirche im Zentrum, Platanen. Kühle. Vier Bars, Tische auf dem Bürgersteig, der Duft nach Kaffee und Croissants. Die frühen Gäste – Bauern, ältere Männer in Tarnanzügen, junge Typen, die mit ihren Motorrädern zwischen den Stühlen parkten – starrten seinem Wagen hinterher. Zwei Boulangerien, ein Metzger, ein winziger Casino-Markt, ein Bar-Tabac. Er würde hier nicht verhungern. Welche Zeitungen es hier wohl gab? Ein moderner Sportplatz an einem Bach – die Touloubre, wie Blanc auf einem Schild las. Zur Linken die Post, gegenüber die Mairie, ein Schlösschen in einer Aura sommerlicher Verlassenheit. Er würde bis nach dem 15.August warten müssen, um seinen Wohnsitz im Rathaus anzumelden und das Nummernschild zu tauschen.
Schließlich: die Gendarmerie. Ein Flachbau, zwei Stockwerke hoch, orangegelb verputzter Beton, dunkle Fensterbänder mit Gittern davor, eine stählerne Tür. Ein Ufo aus den Siebzigerjahren, das nicht in Würde alterte wie die traditionellen Gebäude, sondern einfach bloß verkommen aussah. Hundepisse an den Ecken. Eine Bewegung hinter dem Fenster neben dem Eingang. Blanc parkte seinen Espace an der Seite einiger Einsatzwagen und atmete tief durch.
In der Wachstube musterte ihn ein junger, übergewichtiger Gendarm, dem Schweißflecken das hellblaue Uniformhemd verdunkelten. Blanc stellte sich vor und zeigte seinen Dienstausweis.
»Ah«, grunzte der Gendarm bloß und hielt es nicht für nötig, seinen Namen zu nennen. Brigadier Barressi stand auf dem Namensschild seiner Uniform. »Der Chef ist oben.« Er deutete mit seiner fleischigen Hand auf eine Treppe vor der Rückwand der Stube. »Er ist vorgewarnt, denn er hat schon von Ihrer Versetzung zu uns gehört«, setzte Barressi hinzu, als Blanc bereits seinen Fuß auf die erste Stufe gesetzt hatte.
»Wann hat er davon gehört?«
»Donnerstagabend.«
Dann wussten die es hier vor mir, dachte Blanc wütend. Das Treppenhaus roch nach einem scharfen Reinigungsmittel, das ihm Kopfschmerzen bereitete. Oben trat er auf einen Flur mit orange gestrichenen Bürotüren aus Blech zu beiden Seiten, einige offen, andere geschlossen. Zerrissene Dienstpläne an einem schwarzen Brett, vergilbte Fahndungsplakate, Rundschreiben des Ministeriums, ein paar Polizeifotos und Plaketten. Ein Kaffeeautomat, offenbar seit Langem defekt, Staub bedeckte das Gerät. Zigarettenqualm aus einem geöffneten Zimmer. Hitze. Am Ende des Flurs eine größere Tür, geschlossen. Ein Namensschild aus Messing: Commandant Nicolas Nkoulou. »Merde alors«, flüsterte er und klopfte an.
Er trat in das ordentlichste Büro, das er je gesehen hatte: Der helle Schreibtisch mit der Lederunterlage und dem schwarzen Computermonitor sah aus wie aus einem Einrichtungskatalog. Ein Regal mit penibel beschrifteten Akten an einer Wand, der Tür gegenüber ein Fenster mit gelbweißer Sichtblende in akkuraten Falten. Eine goldgerahmte Ehrenurkunde. Kein privates Foto, kein Souvenir, kein Nippes, nicht einmal ein Kaffeebecher.
Auf einem ledernen Schreibtischstuhl thronte der jüngste Commandant, dem Blanc bislang begegnet war. Nicolas Nkoulou war höchstens Mitte dreißig, wobei sein faltenfreies Gesicht ihn noch jugendlicher wirken ließ. Seine Haut war ebenholzschwarz, seine krausen Haare waren so kurz geschnitten, dass sie sich wie ein dünner Helm um seinen Schädel schmiegten. Eine elegante, goldgefasste Brille. Ein blaues Uniformhemd, das so stark leuchtete, dass es ihm in den Augen schmerzte. Dunkelblaue Sommerhose mit linealgezogenen Bundfalten. Blanke Lederschuhe.
»Paris hat Sie also hergeschickt«, begrüßte ihn Nkoulou und hob sich so schwerfällig aus dem Stuhl, als bereitete es ihm Schmerzen.
Blanc blickte auf seinen Vorgesetzten und das Büro und wusste, dass er es kaum hätte schlechter treffen können. Brillant. Ehrgeizig. Der will nach Issy, dachte er, nach ganz oben. Der hat Angst, dass ich an seinem makellosen Ruf klebe wie Taubenscheiße. »Mon Commandant, melde mich zum Dienst«, sagte er und wusste nicht, ob er militärisch mit der Hand an der Stirn grüßen sollte oder mit Handschlag oder gar nicht. Er entschied sich dafür, die Arme hängen zu lassen.
»Sie sind also auf Korruption spezialisiert.«
Blanc nickte.
»Hier in der Provence sind alle korrupt.«
Blanc nickte.
»Sie lassen sich allerdings nicht erwischen.«
Blanc nickte nicht mehr.
Nkoulou räusperte sich. »Ich stelle Sie den Kollegen vor«, sagte er ohne Enthusiasmus.
Blanc folgte dem Commandanten von Büro zu Büro und zu einer Reihe von Gesichtern und Namen: ein kleiner Kerl mit zerschlagenem Nasenbein und gewaltigen Schultern; ein Hüne mit einer Metallbrille, wie sie in seiner Schulzeit mal modern gewesen war; eine übergewichtige Brünette mit Gauloises zwischen den zu rot angemalten Lippen. Sie schob ihm die blaue, zerknautschte Packung über den Schreibtisch. Blanc, der nicht rauchte, weil der Krebs seine Mutter zerfressen hatte, lehnte ab. Sie verzog das Gesicht, und man musste kein erfahrener Psychologe sein, um ihre Gedanken zu erraten. Zwei dunkelhaarige Männer, die wirkten, als seien sie Brüder, und sich spöttische Blicke zuwarfen, als er eintrat. Eine junge Beamtin mit langen braunen Haaren, die kaum von ihrem iPad aufsah, als er hineingeführt wurde. Schließlich das letzte Zimmer auf dem Flur, am weitesten entfernt von Nkoulous Büro: zwei Schreibtische aus nachgemachter Eiche vor einem schlierigen Fenster. Darauf zwei Computer – die ältesten, die Blanc auf dieser Gendarmeriestation gesehen hatte, graue Kästen, die einzigen, über denen noch klobige Monitore glommen und keine Flachbildschirme.
»Ihre neue Heimat«, sagte der Commandant müde. »Und Ihr Partner: Lieutenant Marius Tonon.« Er blickte missbilligend auf den Schreibtisch, der mit Croissantkrümeln bedeckt war. »Keine Ahnung, wo der Kerl steckt.«
»Hatte er bislang keinen Partner?«
Nkoulou zuckte mit den Achseln. »Lassen Sie sich nicht vom Geschwätz der Kollegen beeinflussen.«
»Noch habe ich kein Geschwätz gehört.«
»Man wird es Ihnen schon zuflüstern, glauben Sie mir. ›Der Tonon bringt Unglück.‹ Abergläubischer Unsinn, Provinzgerede. Ich bin seit einem Jahr Leiter dieser Station und nie ist irgendetwas vorgefallen. Aber ich finde niemanden, der mit Tonon Einsätze fahren will. Da kommt mir ein Beamter aus Paris gerade recht. Ein unabhängiger Geist.«
Blanc war sich nicht sicher, ob sein Commandant ihn lobte oder verhöhnte. »Wir werden zurechtkommen«, erwiderte er.
In diesem Moment kam ein Mann von Mitte fünfzig herein, der das Minimalmaß für den Eintritt in die Gendarmerie von 1,79Metern wohl nur durch Einlegesohlen erreicht hatte. Die kräftigen Hände mit einem schwarzen Haarflaum bedeckt wie Tiertatzen, der Körper in der zerknitterten Uniform aufgeschwemmt, die knollenförmige Nase rotviolett, die dünnen schwarzen Haare wirr. Mit ihm quoll ein Duft ins Zimmer, den Blanc zunächst für den eines billigen Rasierwassers hielt, bis in ihm schlagartig eine Erinnerung aus der Kindheit hochkam: Rosé. Lieutenant wurde man mit Mitte zwanzig. Wenn man dreißig Jahre später immer noch nicht weiter war, dann stimmte irgendetwas nicht. Blanc war sich ziemlich sicher, dass an dem Geschwätz über seinen neuen Partner etwas dran sein musste. Er schüttelte die behaarte Pranke und stellte sich vor.
»Ein Kollege aus dem Norden wird uns hier guttun«, erwiderte Tonon. Seine Stimme war angenehm tief. Ein Mann, der mit einem Satz einen hysterischen Zeugen beruhigen und dem Verdächtigen eine Aussage entlocken könnte, dachte Blanc überrascht.
Er lächelte. »Als Pariser wird man eher selten zum Nordländer erklärt.«
»Für uns ist alles, was nördlich von Lyon liegt, Skandinavien.« Er deutete auf den leeren Schreibtisch. »Nachmittags scheint die Sonne so durch das Fenster, dass man nichts auf dem Bildschirm erkennen kann. Dann geht man besser ins Café und denkt dort nach.« Er lachte.
Nkoulou lächelte säuerlich. »Den Cafébesuch müssen Sie verschieben, mon Lieutenant. Ich werde Ihnen und Blanc einen Routinefall übertragen, damit Sie sich kennenlernen, gewissermaßen. Liegt in der ZGN.«
»ZGN?«
»Zone de responsabilité propre de la gendarmerie nationale. Die 95Prozent des französischen Territoriums, die von uns überwacht werden und nicht von der Police nationale. Sie waren wirklich zu lange in der Hauptstadt, mon Capitaine.« Bei den Sondereinheiten in Paris war die altehrwürdige, unsinnige Trennung zwischen Gendarmerie und Police nationale in der Tat bedeutungslos geworden: Hier die Gendarmen für die ländlichen Regionen, dort die Polizisten für die Großstädte. Blanc musste sich erst daran gewöhnen, wieder im Nirgendwo zu arbeiten.
»Was bedeutet Routinefall?«, fragte er.
»Ein Toter. Auf einer Müllkippe.«
»Das nennen Sie Routine?«
»Sie sind nun ein Provinzgendarm. Nach der ersten Meldung, die bei uns eingegangen ist, gehe ich davon aus, dass wir bloß den Tatort sichern müssen. Es gibt da ein paar Indizien, die darauf hindeuten, dass danach die Kollegen aus Marseille übernehmen werden. ZPN. Zone de responsabilité propre de la police nationale.« Seine Lippen formten wieder ein freudloses Lächeln. »Aber sehen Sie selbst. Brigadier Barressi hat die notwendigen Details zusammengestellt. Sie können nicht viel falsch machen.«
Blanc nickte. »Ein Freund von Abkürzungen«, flüsterte er, als sein Vorgesetzter das Büro verlassen hatte.
»Der kann seine Untergebenen so was von abkürzen, das hat man noch nicht gesehen«, warnte ihn Tonon.
Unten reichte ihnen Barressi einen Zettel. »Ein Toter auf der Müllkippe bei Coudoux«, nuschelte er, »direkt an der A7. Ein Müllmann hat ihn gefunden und die 17 gewählt. Er glühte noch.« Der Brigadier hüstelte.
»Der Müllmann?«, fragte Tonon.
»Der Tote. Verbrannt. Aber daran ist er wahrscheinlich nicht gestorben. Die Kollegen von der Verkehrsstreife waren als Erste da, die waren gerade auf der Autobahn, als die Meldung hereinkam. Sie sagen, dort liegen überall Patronen herum. Kalaschnikow.«
»Bon«, erwiderte Tonon sachlich und griff nach dem Bericht.
Blanc starrte ihn an. »Gut? Was ist daran gut?«
»Wir werden zum Mittagessen wieder hier sein. Das kleine Restaurant in Gadet ist nicht übel.«
»Da ist jemand mit einem Schnellfeuergewehr exekutiert worden. Wir werden Stunden dort sein, auf dieser Müllkippe.«
Der Lieutenant hob die Hände. »Eine Kalaschnikow ist in Marseille so gewöhnlich wie ein Opinel. Die kriegen Sie für 1000Euro, miese Exemplare auch schon für die Hälfte. Die Dealer schießen sich damit gegenseitig in die ewigen Jagdgründe. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Die Müllkippe liegt an der A7, die direkt nach Marseille hineinführt. Commandant Nkoulou hat recht. Wir werden den Fundort der Leiche sichern und warten, bis die Kollegen aus der Stadt da sind. Das ist einer von deren Kunden, mon Capitaine. Die werden den Fall übernehmen. Wir gehen dann Mittag essen.«
Barressi warf Blanc einen Autoschlüssel zu. »Ich wollte schon immer mal eine provenzalische Müllkippe sehen«, murmelte er und drückte die Stahltür auf.
Tonon wies auf einen Streifenwagen. »Das ist unser Mégane«, sagte der Lieutenant und zwängte sich auf den Beifahrersitz des blauen Kombis. Blanc mochte die große Aufschrift Gendarmerie an den Seitentüren nicht, die weißen Streifen, die rot-weißen Reflektoren an der Motorhaube, das Blaulicht. In Paris war er immer in unauffälligen Zivilwagen unterwegs gewesen. Umständlich passte er Sitz und Rückspiegel seiner Länge an, dann startete er. »Sie kennen den Weg?«, fragte er.
»Ich bin zwar nur Lieutenant, aber der Ältere von uns. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns duzen. Ich bin Marius. Wir sehen einander sowieso häufiger als unsere Ehefrauen.«
»Das ist mal sicher«, brummte Blanc.
»Fahr bis zum Kreisverkehr und dann folgen wir den Schildern Richtung Lançon. Danach lotse ich dich weiter. In einer Viertelstunde sind wir da.«
Blanc ermittelte gerne alleine. Flics bildeten zwar bei jedem Fall ein Team, manchmal arbeiteten nur drei oder vier Beamte an einer Sache, manchmal waren es Hunderte. Das wusste und das akzeptierte er. Trotzdem suchte er sich gerne die Jobs aus, bei denen er auf sich gestellt war: Er beschattete einen Verdächtigen, über Stunden und Tage, wenn es sein musste. Er grub sich durch alte Akten und beschlagnahmte Papiere. Er hockte hinter seinem Schreibtisch, kritzelte sein Notizheft voll und dachte nach. Jetzt fühlte er sich gehemmt neben diesem fleischigen, nach Rosé riechenden Kollegen, auf dem Weg zu einer verbrannten Leiche.
»Der Commandant ist sehr jung«, sagte er unbestimmt, um kein lastendes Schweigen zwischen ihnen aufkommen zu lassen. Er fuhr vorsichtig, aber anders als in Paris wurde er nicht angehupt oder geschnitten, da jedermann das Polizeiauto erkannte.
»Nkoulou ist schon da, wenn ich morgens ankomme. Und er hockt noch in seinem aufgeräumten Büro, wenn ich abends gehe. Er liebt Vorschriften, Fleiß, Pünktlichkeit. Der würde sogar einen Deutschen in den Wahnsinn treiben. Ein paar Kollegen und ich haben eine Wette laufen. Wenn du willst, kannst du einsteigen. Wer als Erster herausfindet, ob Nkoulou eine Freundin hat, bekommt den Topf.«
»Ein Mann ohne Privatleben. Geht er bei seiner Arbeit auch mal raus, oder verschanzt er sich den ganzen Tag in seinem Zimmer?«
»Er geht auf den Schießstand. Ist der beste Pistolenschütze seines Jahrgangs gewesen, sagt man.«
Blanc spürte das Metall der Sig Sauer SP 2022, deren Holster er weit hinten am Gürtel stecken hatte. Gegen alle Vorschriften, wie die Dienstpistole zu tragen ist. Er hatte als junger Flic bei einem Raubüberfall, der aus dem Ruder gelaufen war, in Panik auf einen fliehenden Täter geschossen. Eine Woche hatte der Kerl zwischen Leben und Tod geschwebt. Am Ende war er durchgekommen, und Blanc hatte seine erste Belobigung erhalten, weil er einen seit Langem gesuchten Verbrecher unschädlich gemacht hatte. Aber so eine Woche wollte er nie wieder erleben. Seither hatte er niemals mehr in einem Einsatz eine Waffe ziehen müssen. Und auf den Schießstand ging er nur, wenn das obligatorische jährliche Training anstand.
Tonon lotste ihn durch ein Gewerbegebiet außerhalb von Gadet, vorbei an einem Händler für Schwimmbäder, der einen riesigen blauschimmernden Fertigpool lotrecht aufgestellt hatte, ein Bild wie aus einem surrealen Traum. Dann wieder Felder. Der strohgedeckte Verschlag eines Töpfers, der an einem Kreisverkehr bunt lackierte Vasen, Terrinen und Keramikzikaden anbot. Ein Dorf. Blanc bog auf die Route départementale 19 ein. Ein Friedhof mit einer uralten, schiefen Kapelle. Und plötzlich, hundert Meter unterhalb der Landstraße, ein graues Band, das Blanc im ersten Augenblick für einen großen Fluss hielt: die Autobahn. Die A7 fräste sich durch graue, felsige Hügel, die Route départementale verlief fast einen Kilometer parallel zum breiten Asphaltband. Autos und Lastwagen und Wohnmobile röhrten zu ihrer Linken, schwarze Dieselfahnen trieben in der Luft. Blanc schloss das Fenster. Trotzdem roch er nicht nur Abgase, sondern plötzlich auch etwas anderes: Fäulnis. Zerrissene Plastiktüten flatterten in den Ästen der Pinien, die zur Rechten die Straße beschatteten. Möwen kreisten über ihnen.
»Die Müllkippe«, sagte Tonon. Er fasste mit der Rechten kurz an ein goldenes Medaillon um seinen Hals. Als er Blancs erstaunten Blick bemerkte, erklärte er: »Sainte Geneviève. Unsere Schutzheilige.«
»Unsere?«
»Die Schutzheilige der Gendarmen. Du bist nicht katholisch, eh?«
»Ich habe es geschafft, zur Kommunion meiner Kinder rechtzeitig in der Kirche zu sein«, erwiderte Blanc. Geneviève, die Heilige der Flics. Seine Frau würde darüber lachen. Seine Exfrau. »Hast du Angst?«, fragte er seinen Kollegen.
»Angst, zu kotzen. Ich habe noch nie einen verbrannten Kerl gesehen. Vielleicht sieht der aus wie ein Hammel beim méchoui. Könnte mir den Appetit verderben.«
»Du denkst immer ans Essen.«
»Man muss Prioritäten setzen.«
Blanc bog durch ein Tor in einem drei Meter hohen Drahtzaun auf eine ungepflegte Zufahrt. Er fluchte leise, als ihn ein entgegenkommender grüner Müllwagen an den Rand drängte und in eine Wolke aus Diesel, Dreck und Staub einhüllte. Wahrscheinlich hatte hier einst ein weites Tal zwischen zwei schroffen Klippen gelegen. Doch nun war die Senke fast ganz aufgefüllt mit Müll. Bagger schoben Unrathaufen zusammen, umtanzt von wütenden Möwen, am Rande der Senke wölbten sich dicke, schwarze Plastikwülste hoch – der Rand riesiger Kunststoffbahnen, die den Boden des Tals auskleideten und das Grundwasser vor hineinsickerndem Schmutz schützen sollten. Es stank nach fauligem Gemüse und verwestem Fleisch.
»Im Sommer ist es immer am schlimmsten«, entschuldigte sich Tonon. »Hier laden sie den Dreck der halben Provence ab.« Er deutete auf einen Streifenwagen und ein Motorrad der Autobahnpolizei, die neben zwei unauffälligen weißen Lieferwagen parkten, in deren Windschutzscheiben Plastikschilder mit der Aufschrift Techniciens d’investigation criminelle klebten.
»Die Spurensicherung ist aus Marseille?«
»Nein. Die nächste Einheit ist in Salon stationiert. Gute Leute. Nehmen sich Zeit. Haben ja auch weniger zu tun als die Kollegen aus Marseille.«
Blanc stieg aus und schüttelte einem Brigadier die Hand, danach einem jungen Staatsanwalt mit Sonnenbrand im Gesicht. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als in Gestank und Hitze zu warten und den Spezialisten der Spurensicherung bei der Arbeit zuzusehen. Weiße Ganzkörperschutzanzüge mit der Aufschrift NTECH auf dem Rücken, Überschuhe, Handschuhe, Masken – er fragte sich, wie sie das in der Hitze aushielten. Der Fundort der Leiche lag am Rand des Parkplatzes, hinter einem großen offenen Container, in dem man Metallschrott abladen konnte. Er erkannte die verrosteten Skelette eines Matratzenrostes und eines Fahrradrahmens, die über den Rand ragten. Die Spurensicherer gingen nicht auf direktem Weg zum Fundort der Leiche, sondern näherten sich in einem halbkreisförmigen Umweg von der Rückseite. Jemand schoss Fotos. Zwei Weißkittel knieten neben etwas, das auf die Entfernung aussah wie ein verkohlter Baumstamm. Blanc stieg ein neuer Geruch in die Nase: angebranntes Fleisch, verdampftes Fett.
»Wer hat ihn gefunden?«, fragte er den Brigadier.
Der Flic deutete auf einen Mann in grünem Overall, der im Schatten einer verkrüppelten Pinie saß und von einer sehr jungen Beamtin gerade eine Flasche Wasser gereicht bekam. »Ein Müllwagenfahrer. Der hat immer noch Schnappatmung.« Er lachte höhnisch.
Blanc erwiderte nichts und ging zu dem Zeugen. Tonon folgte ihm. Beide knieten sich vor den Mann und Blanc holte einen Notizblock und einen angekauten Bleistift hervor. »Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oder sollen wir noch etwas warten?«, wollte der Capitaine wissen.
Der Müllwagenfahrer, ein junger Araber, schüttelte den Kopf. »Bringen wir es hinter uns«, sagte er und versuchte sich an einem Lächeln.
»Ihr Name?«
»Mourad Ghoul.«
»Wann und wie haben Sie den Toten gefunden?«
»Ich fahre den Lastwagen da.« Er deutete auf einen schweren Wagen mit Kran und leerer Ladefläche. »Einmal in der Woche lade ich den Container mit dem Alteisen auf und fahre ihn zum Metallhändler. Ich wollte gerade die Ketten vom Kran an dem Container befestigen, als ich …«, er rang um die richtigen Worte, »diesen … Körper sah. Oder: Ich hab ihn zuerst gerochen. Er hat noch gequalmt.«
»Komplett verbrannt?«
»Ich hab nicht länger hingesehen. Bin davongerannt bis zum Führerhaus des Lastwagens, hab mein Handy geschnappt und die Flics gerufen. Dann hab ich gekotzt.«
»Sie waren allein?«
»Meine Kollegen fahren seit heute Morgen mit ihren Müllwagen rein und raus. Aber die nehmen die Rampe weiter hinten. Hier dürfen Privatpersonen ihren Schutt abladen. Aber so früh ist noch keiner hier.«
»Erholen Sie sich.« Blanc stand auf. Ihn schwindelte. Die Hitze, der Gestank, die Müdigkeit.
»Manchmal treffen sich einige Idioten am Wochenende heimlich auf der Müllkippe«, sagte Tonon, der seinen massigen Körper mit erstaunlicher Leichtigkeit aufrichtete. »Sie verabreden sich zu illegalen Paintballduellen.«
»Paintball auf einer Müllkippe?«
»Scheint manchen Kerlen einen Kick zu geben. Ab und zu verhaften wir mal einen. Hausfriedensbruch.«
»Das muss ein ziemlich heißer Paintball gewesen sein.«
»Vielleicht gab es Zeugen?«
»Bien. Klapper später diejenigen ab, die du schon mal bei derartigen Spielchen verhaftet hast. Wenn wir Glück haben, dann war jemand da.«
Ein zerkratzter weißer Jeep Cherokee hielt neben ihnen, in dessen Auspuff irgendwo ein Loch klaffen musste. Als der asthmatische Motor abgestellt wurde, schüttelte sich das Gefährt. Eine Frau sprang heraus, Mitte dreißig, lange brünette Haare, das Gesicht halb verborgen hinter einer übergroßen Sonnenbrille aus den Siebzigerjahren.
Tonon nickte ihr zu und stellte sie vor: »Doktor Fontaine Thezan. Médecin légiste im Hospital von Salon.«
Blanc schüttelte ihre Hand. Ihr T-Shirt und ihre Haare verströmten leicht den Geruch nach Marihuana. Er warf seinem Kollegen einen raschen Blick zu, doch der schien nichts zu bemerken. »Wir müssen uns noch etwas gedulden«, erklärte er.
»Sieht so aus, als käme ich genau rechtzeitig«, erwiderte die Ärztin leichthin und deutete auf einen Techniker, der die Maske von seinem verschwitzten Gesicht geschoben hatte und auf sie zukam.
»Der Tote gehört Ihnen, Madame«, keuchte er. Blanc würdigte er kaum eines Blickes.
»Fechterstellung«, murmelte Doktor Thezan. »Beugung der Arme durch hitzebedingte Schrumpfung der Muskulatur. Verkohlte Haut, im Gesicht aufgesprungen durch die extreme Temperatur.«
Blanc, der sich in den letzten Dienstjahren vor allem durch Kontoauszüge, Akten und Briefe gegraben hatte, versuchte möglichst flach zu atmen. Der Gestank nach verbranntem Fleisch, vermischt mit den Ausdünstungen der Müllkippe. Diese verdammte Hitze. Vor ihm lag ein Körper, die Haut wie Kohle, die Arme parallel angewinkelt, die Beine parallel, das zerstörte Gesicht eine Grimasse – der Körper hatte wenig von einer Leiche, eher etwas von einer Schaufensterpuppe nach einem Brandanschlag. Keine Haare, keine Ohren, keine Kleidung, bis auf eine Gürtelschnalle, die noch auf dem Rumpf lag. Unkenntliche Gesichtszüge. Kein Blut.
»Sie müssen mir nicht über die Schulter sehen«, murmelte Doktor Thezan, die bemerkt hatte, dass er schwankte.
»Das ist nur die Hitze«, erwiderte der Capitaine.
»Sie sind nicht von hier.«
Blanc beschloss, darauf nicht einzugehen. »Ist das Opfer lebendig verbrannt worden?«
Die Gerichtsmedizinerin schüttelte den Kopf und deutete auf Einkerbungen in dem verkohlten Rumpf. »Wahrscheinlich Einschusslöcher«, konstatierte sie. »Der Tote ist männlich. Ich werde im Institut seine Lunge untersuchen. Das, was davon noch übrig ist. Aber es würde mich wundern, wenn ich da Ruß in den Bronchien entdecken sollte. Der hat nicht mehr geatmet, als er brannte.«
Tonon deutete auf die staubige Fläche ringsum, die von den Spezialisten mit kleinen Zahlentafeln gespickt worden war. »Patronenhülsen. Kalaschnikow. Mindestens zehn Hülsen. Und wir dürfen nicht mehr zum Schießstand, weil wir Geld sparen müssen.« Er schüttelte den Kopf. »Farid Berrhama war ein Schläger und Dealer aus Salon, der einer der ganz Großen in der Unterwelt von Marseille werden wollte. Sie nannten ihn ›Le Barbecue‹, weil er die Typen, die er aus dem Weg räumte, auch noch anzündete, um Spuren zu verwischen. Wir haben ihn auch nie gekriegt. Aber ein korsischer Clan hat ihn dann in einer Brasserie erwischt, acht Killer auf einmal, zwölf Kugeln im Körper. Sieht so aus, als wolle jemand Berrhamas Nachfolger werden.«
»Eine Abrechnung unter Drogendealern?«, wollte Blanc wissen.
Der Lieutenant deutete mit dem Zeigefinger auf den verkohlten Leichnam. »Der Kerl hat Koks oder Heroin unterschlagen. Oder er hat seine Schulden nicht bezahlt. Oder er hat jemanden verpfiffen. Oder jemand wollte sein Revier übernehmen. Im Durchschnitt wird in Marseille alle zwei Wochen jemand mit einer Kalaschnikow erledigt.«
Blanc erinnerte sich an den Skandal vor einiger Zeit, als eine Bezirksbürgermeisterin aus der Stadt den Einsatz des Militärs forderte, um die Banlieus zu befrieden. Die Empörung überall. Die Hohnworte in Paris. Truppen nach Marseille! Sarkozy hatte zuvor den Etat gekürzt, allein in Marseille waren 350Polizistenstellen gestrichen worden. Das hatte niemanden aufgeregt.
»Es ist immer noch genug übrig, um seine DNA zu gewinnen«, versicherte Doktor Thezan. »Und sein Gebiss ist intakt. Mit seinen Knochen werde ich die Größe bestimmen und das Alter. Und vielleicht kriege ich noch Haar- und Augenfarbe heraus. Und was er zuletzt gegessen hat. Wir identifizieren ihn.«
»Und dann kümmern sich die Jungs aus Marseille um den Fall. Ich melde mich bei der Zentrale.« Tonon wandte sich gerade in Richtung Renault, als er innehielt. Die Gerichtsmedizinerin hatte die Leiche mit ihren behandschuhten Händen vorsichtig angefasst. Behutsam drehte sie das Opfer um. Da leuchtete etwas unter der Stelle, wo der Nacken auf dem Boden gelegen hatte. Gold. Die Reste einer Halskette. Ein Medaillon. Blanc und der Lieutenant beugten sich darüber, ohne etwas zu berühren. Auf das Schmuckstück war eine Kobra graviert, die sich drohend aufgerichtet hatte. Zwei winzige Rubine waren als rote Augen in das Gold gesetzt.
»Putain!«, fluchte Tonon. »Diese Kobra kenne ich. Die Meldung nach Marseille können wir uns sparen. Das ist jemand von hier.«
Anzeige gegen einen Toten
Blanc winkte die Spurensicherer heran und deutete auf das Schmuckstück. Dann zog er sich zurück und ließ die Spezialisten ihre Arbeit machen. »Scheint ein ziemlich seltenes Stück zu sein, wenn du den Toten damit identifizieren kannst«, flüsterte er Tonon zu.
Sein Kollege nickte zerstreut und blickte sich auf dem Parkplatz um. »Wenn er der ist, von dem ich glaube, dass er es ist, steht hier ein Motorrad. Er war immer mit seiner Enduro unterwegs.« Tonon rief einige Brigadiers zusammen. Es dauerte weniger als eine Minute, bis ein Uniformierter den Arm hob und sie heranwinkte. Am Rande eines anderen Containers stand halb versteckt eine alte Yamaha, die Blanc für Schrott gehalten hätte: abgerissenes Rücklicht, Beule im Tank, verbogene Lenkstange, zersplitterter Frontscheinwerfer, der linke Rückspiegel fehlte, nur noch die Stange ragte nutzlos vom Lenker.
Der Lieutenant deutete auf das halb nach oben gebogene Nummernschild mit der »13«: »Seine Karre. Die Nummer kenne ich auswendig.« Er gab einem Mann der Spurensicherung ein Zeichen, der sich seufzend wieder seine Maske vors Gesicht schob und anfing, das Motorrad auf Fingerabdrücke zu untersuchen.
»Wer ist es?«, fragte Blanc.
»Charles Moréas. Die Provence ist ein schönerer Ort ohne ihn.«
»Ein Kunde von dir?«
»Ich wünschte, es wäre so gewesen.« Tonon seufzte. »Ich habe Jahre drangegeben, um den Kerl zu erwischen. Ein einziges Mal hatten wir etwas gegen ihn in der Hand, er ist mit seiner Yamaha viel zu schnell an einem Blitzgerät vorbeigerast. Aber nicht einmal diese Strafe hat er bezahlt. Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Das Verfahren schmort wahrscheinlich noch immer in irgendeinem Gerichtsschrank.«
»Aber du wolltest ihn nicht fassen, weil er über Landstraßen raste.«
»Nein.« Der Lieutenant schloss die Augen. »Wegen Mord. Oder zumindest Totschlag.« Er schwieg lange. »Moréas war ein Einzelgänger. Und jeder, der ihn kannte, wünschte sich, es wäre nicht so. Lebte in einem heruntergekommenen Haus auf dem Land, das zur Gemeinde Caillouteaux gehört.«
»Unser Gebiet?«
»ZGN. Moréas ist 38Jahre alt, wenn ich mich recht erinnere. War es. Keiner weiß genau, wovon er lebt.«
»Hat er eine Frau? Kinder? Angehörige?«
Tonon lachte bloß. »Er hat ein paar Grundstücke. Hier und da in der Region, Felder, Waldstücke, eine cabane für die Jagd. Seine Eltern waren Bauern, aber die sind längst tot.«
»Das Land hier soll teuer sein, habe ich gehört. Vielleicht hat er es verkauft und lebt seit Jahren vom Geld?«
»Moréas? Niemals. Der ist manchmal mit seiner Yamaha auf seine Grundstücke gefahren und hat dort im Freien übernachtet. Und Wanderer, die sich dorthin verirrten, hat er so verscheucht, dass sie nie wieder diese Wege gingen.«
»Mit Waffen?«
»Jagdgewehre.«
»Reicht, um ihn vorzuladen.«
»Das habe ich getan. Mehr war nicht drin.« Tonon deutete mit verächtlicher Geste auf den verkohlten Körper, der gerade von zwei Leichenträgern, die mit ihrem grauen Kombi angekommen waren, auf eine Bahre gebettet wurde. »Vor zwanzig Jahren, als ich noch ein guter Flic war, gehörte Moréas zu einer Clique, die sich auf Straßenraub spezialisiert hatte: zwei frisierte Autos, nachts, eine wenig befahrene Route départementale. Die Kerle warteten auf Wagen mit ausländischen Kennzeichen. Entdeckten sie Touristen, überholte das erste Auto deren Wagen, bremste ihn brutal aus und zwang ihn zum Stopp. Oft gab es einen Blechschaden. Die Touristen waren empört, verwirrt, verängstigt. Doch bevor sie richtig reagieren konnten, kam das zweite Auto heran, diesmal von hinten. Die Kerle liefen von beiden Seiten auf ihre Opfer zu, zerrten sie aus dem Auto, räumten alles aus – und fort waren sie. Lief über Wochen so ab. Nie haben wir sie geschnappt. Dann ging einmal etwas schief: Bei der Flucht erwischten sie eine ausländische Touristin, die in Panik auf die Straße gelaufen war. Sie schleiften die Frau einige Meter mit. Sie war sofort tot. Ich habe die Blutspur auf dem Asphalt gesehen. Die Kerle bekamen einen Schock und setzten das Auto ein paar Kurven weiter gegen eine Pinie. Einige sind mit dem zweiten Wagen davon, ein paar mussten zurückbleiben. Die haben wir sofort gekriegt. Und diesmal hatten wir das Nummernschild des Autowracks. So haben wir die meisten anderen auch überführt. Bis auf einen.«
»Charles Moréas?«
»Einer seiner Kumpane hat damals ausgesagt, dass Moréas dabei war. Er soll sogar der Kopf der Bande gewesen sein. Und er soll am Steuer des Unfallwagens gesessen haben. Einige Kollegen sind ein paar Stunden später in seiner cabane aufgekreuzt und haben ihn festgenommen. Moréas leugnete alles. Und die anderen Kerle, die wir geschnappt hatten, sagten aus, sie hätten Moréas noch nie gesehen.«
»Klingt nach einer abgesprochenen Sache.«
»Tja. Der Typ, der gegen Moréas ausgesagt hatte, ist nur wenig später in der Haft gestorben. Hofgang, Messer zwischen den Rippen, Durcheinander, Täter nie gefasst. Wir hatten sonst nichts gegen Moréas in der Hand. Keine Fingerabdrücke in einem der beiden Autos. Und es war noch vor der Zeit der DNA-Spuren. Wir mussten ihn laufen lassen. Seither habe ich versucht, ihn zu schnappen. Mir geht die Blutspur der Touristin auf dem Asphalt nicht aus dem Kopf.«
»Jemand ist dir zuvorgekommen.«
»Ein Kerl wie Moréas wird viele Feinde haben. Eigentlich schade, dass wir seinen Mörder fangen müssen.«
Als sie endlich zur Gendarmeriestation zurückfuhren, war es schon später Vormittag. Blanc fingerte am Radio herum. Alles, was ihn länger wach halten würde, war gut. Er erwischte Radio Nostalgie. Bevor er erneut die Tasten drücken konnte, sang Tonon den Refrain mit: »Les amants de Paris«. Blanc starrte durch die Windschutzscheibe. Er hatte eine verbrannte Leiche an den Hacken und einen Edith-Piaf-Chansons singenden Kollegen neben sich. Er hoffte, irgendwann aufzuwachen, in seinem Bett in Paris, Geneviève an seiner Seite. Das kann nur ein verrückter Traum sein, sagte er sich, bloß ein Traum, ein Traum, ein Traum, merde. Doch er fuhr die Route départementale entlang und kam in Gadet vor der Station an und er wusste, dass er nicht träumte.
Nkoulou sah aus, als hätte er Magenkoliken. »Ich habe die Funkmeldungen gehört. Das sollte ein Routinefall werden«, eröffnete er ihnen, als hätten sie die Sache schon verbockt.
»Es hat Moréas erwischt«, erwiderte Tonon, in der Hoffnung, seinen Chef aufzumuntern.
Blanc schwieg. Der Commandant hatte die Beamten, denen er am wenigsten zutraute, auf die spektakulärste Ermittlung der letzten Wochen angesetzt. Dumm gelaufen. Nkoulou konnte sie jetzt schlecht wieder abziehen, nachdem er sie gerade erst höchstpersönlich mit dem Fall betraut hatte.
»Sie waren schon jahrelang vergebens hinter diesem Moréas her«, zischte der Commandant. »Ich hoffe, Sie werden die nächsten zwanzig Jahre nicht vergebens seinen Mörder jagen.«
»Moréas war ein Dreckskerl«, warf Blanc ein, um seinem Kollegen beizuspringen. »Wenigstens wird uns die Presse nicht die Hölle heiß machen, wenn wir den Täter nicht nach vierundzwanzig Stunden in Handschellen präsentieren.«
»Ihr Pariser seid vielleicht dicke mit den Journalisten, aber mich interessiert das nicht.«
»Politiker interessiert das«, erwiderte der Capitaine sanft.
Nkoulou lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er hatte verstanden: Wenn die Presse und somit die Politiker dieser Fall nicht interessierte, dann bedeutete das, dass keine Gefahr herrschte. Keine Gefahr für die Karriere. Kein Staatssekretär, schon gar kein Minister, der Mails schrieb oder zum Hörer griff und irgendwann fragte, was zum Teufel denn da im Midi los sei und wer dafür die Verantwortung trage. »Kümmern Sie sich darum«, sagte er und entließ sie mit einem Kopfnicken.
»Danke, dass du das Feuer ausgetreten hast, bevor es mir den Arsch verbrannt hat«, flüsterte Tonon, als sie den Gang hinuntergingen.
»Stehen bleiben oder ich schieße!«, rief jemand hinter ihnen. Die junge Braunhaarige mit dem iPad. Blanc hatte ihren Namen vergessen.
»Ma chérie«, sagte der Lieutenant, »seit wann sprichst du Männer an? Sous-Lieutenant Fabienne Souillard«, stellte er sie Blanc vor, ganz so, als habe Nkoulou das nicht schon vor einigen Stunden getan. »Wir rufen sie immer, wenn unsere Computer abstürzen.«
»Marius schaltet den Drucker ein, bevor sein antiker Rechner hochgefahren ist. Crasht jedes Mal. Er kapiert es nicht.« Fabienne Souillard war etwa Ende zwanzig, sportlich, elegant. Sie trug zwar Uniform, doch umwehte sie der Hauch eines teuren Parfums. Sie reichte Blanc die Hand.
»In Paris tragen die Computerspezialisten Brillen, die aussehen, als habe sie jemand mit einer Axt aus einem Kunststoffklumpen gehauen.«
»Das sind ja auch Männer.« Fabienne deutete auf ihr Büro. »Ich habe etwas für euch.«
»Du hast schon von unserem Fall gehört?«, fragte Tonon.
»Alle Kollegen sind ja so froh, dass ihr euch um die Sache kümmert.«
»Hängen Sie sich freiwillig mit rein?«
»Du. Nicht einmal der Polizeihund siezt mich hier.«
»Sie ist eine von den Guten«, erklärte der Lieutenant und setzte sich ächzend auf einen Stuhl vor Souillards Schreibtisch. »Also?«
»Da ist noch ein Fall für euch Helden: ein Einbruch«, sagte sie und deutete auf ein ausgefülltes Anzeigenformular, das neben ihrem Computer lag.
»Nkoulou hat uns für die andere Sache freie Hand gegeben. Der Einbruch ist nicht unser Fall«, erwiderte Tonon.
»Ein Architekt aus Caillouteaux, bei dem am Samstag jemand eingestiegen sein soll, als er bei der Arbeit war.«
»Pech für ihn. Das ist immer noch nicht unser Fall.« Der Lieutenant blieb ganz gelassen.
Fabienne klopfte auf das Formular. »Dieser Architekt beschuldigt in seiner Anzeige einen Verdächtigen: Charles Moréas. Sein Nachbar.«
»Das ist unser Fall«, sagte Blanc und stand auf. »Gehen wir.«
Tonon hob beschwichtigend die Hand. »Wir sind hier nicht in Paris.«
»Ich will mir das Haus von diesem Moréas ansehen. Und danach will ich mit dem Architekten reden.«
»Das Haus nimmt sich die Spurensicherung gerade vor. Da kommen wir in ein paar Stunden herein, frühestens. Und der Architekt wird uns nicht weglaufen. Wir gehen erst einmal essen.«
»Essen?«
»Hier in Gadet. Ich habe dir doch gesagt, das ist gar nicht so schlecht.«
Bevor Blanc noch etwas darauf sagen konnte, drehte Fabienne Souillard ihren Computerbildschirm zu ihnen um. »Ich gebe dir an Informationen, was wir schon haben. Dann kannst du besser verdauen. Voilà.« Sie deutete auf zwei Polizeifotos eines jungen Mannes, frontal und im Profil. »Das ist Moréas vor fast zwanzig Jahren. Als er wegen dieser Sache mit den Autoräubern vorgeladen wurde. Ein neueres Bild gibt es nicht, wir haben ihn nie wieder erwischt.«
»Das habe ich schon gehört.«
»Einen Meter achtzig groß, muskulös. Seine Haare trug er immer so lang wie auf dem Foto.«
»Sind allerdings ergraut«, ergänzte Tonon.
»Später hat er sich am linken Unterarm tätowieren lassen. Verschlungene Buchstaben, deren Bedeutung niemand kennt«, fuhr Souillard fort.
»Connerie«, zischte Tonon. »Ein ›G‹, ein ›T‹ und ein ›I‹. Die Kerle hatten einen BMW und einen VWGTI, beide gestohlen. Moréas fuhr den GTI. Damit hat er die Touristin zu Tode geschleift. Er hat sich das an dem Tag in die Haut stechen lassen, als das Verfahren gegen ihn aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde. Der hat uns verarscht.« Der Lieutenant sprach immer lauter.
»Die Tätowierung ist jetzt Asche«, warf Blanc ein, um seinen Kollegen zu beruhigen.
»Ein Verfahren, weil er ein Bußgeld wegen Geschwindigkeitsüberschreitung nicht gezahlt hat«, las Fabienne vor. »In Aix beim Gericht anhängig, wird aber nie aufgerufen, weil die Richter keine Zeit haben. In Aix, in Salon und bei unseren Freunden in Marseille taucht sein Name öfter in Ermittlungsunterlagen auf, als Verdächtiger im Drogenhandel. Vielleicht ein Kurier, vielleicht jemand, der Stoff versteckt hat, auf jeden Fall eine kleine Nummer, wenn überhaupt. Keine Anklagen in dieser Hinsicht. Keine weiteren Auffälligkeiten. Keine Verwandten.« Fabienne Souillard drehte den Monitor wieder in seine ursprüngliche Position zurück. »Nehmt ihr mich mit, Jungs? Ich habe Hunger.«