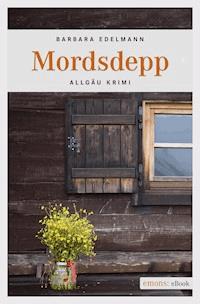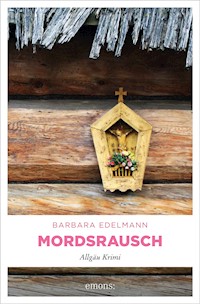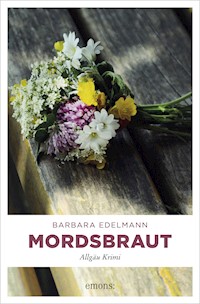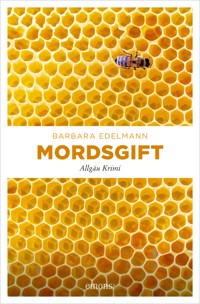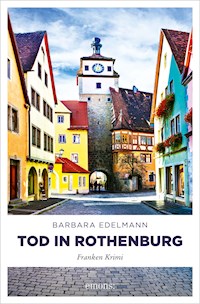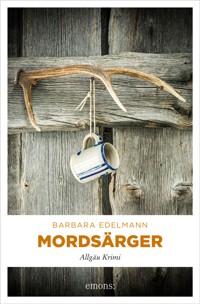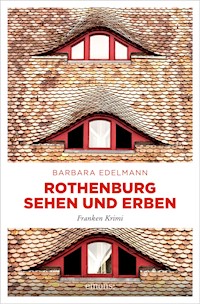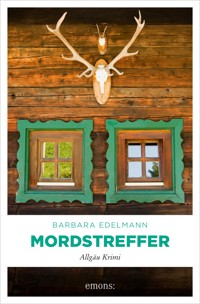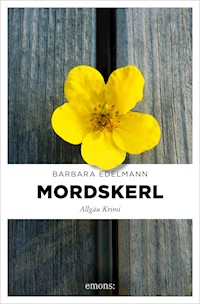
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sissi Sommer, Klaus Vollmer
- Sprache: Deutsch
Ein urkomischer, hundsgemeiner Allgäu Krimi. Gestern war Norbert, der wohlhabende ehemalige Alleinunterhalter, noch quietschfidel. Heute treibt er, bis in die Haarspitzen voll mit Alkohol, Beruhigungsmitteln und Potenzpillen, tot im Pool einer luxuriösen Senioren-WG in Legau. Sissi Sommer und Klaus Vollmer merken schnell, dass auf dem Altersruhesitz alles ein wenig anders ist als erwartet: Es wird gezockt und getrunken, alle haben Dreck am Stecken, jeder verdächtigt jeden. Und offenbar gab es für Norberts Mitbewohner mehr als einen Grund, den lebenslustigen Rentner um die Ecke zu bringen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Edelmann ist in Mindelheim geboren und aufgewachsen. Seit Jahrzehnten lebt sie glücklich und zufrieden im Allgäu und möchte nirgendwo anders sein. Ihre Erfahrungen und Beobachtungen verarbeitet sie in ihren Allgäu Krimis.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2020 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Malin Levay/Pixabay.com Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Christine Derrer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-625-8 Allgäu Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de
Dieses Buch widme ich »dem unbekannten Hausarzt«– nämlich meinem eigenen.
Danke, Herr Dr.Pütz, dass Sie sich so engagiert und unermüdlich in den Dienst des Patienten stellen und sogar am Wochenende für uns alle da sind, auch wenn es Ihnen selbst nicht gut geht. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und zuhören, danke, dass Sie auch mal ein Rezept persönlich vorbeibringen oder einen Kaffee bei mir trinken.
Samstagnacht, Unterallgäu
Ein prächtiger Vollmond verwandelte das Unterallgäu mit seinem kalten Glanz in jener samtigen, lindwarmen Juninacht in eine anmutige Landschaft voller flüsternder Geheimnisse und tauchte akkurat gepflegte Vorgärten, spärlich beleuchtete Gassen und den liebevoll ausgestalteten Marienbrunnen am Legauer Marktplatz in geheimnisvolles Licht.
Kein Laut war aus den verschatteten, mit blühender Klematis und dichtem Liguster umwachsenen Gärten zu vernehmen. Fauchend jagten sich zwei liebeshungrige Katzen, ungeachtet des schallenden Gelächters aus dem »Mohren«, über den Asphalt und verschwanden kreischend hinter der Kirche, während sich das amüsierte Kichern der Damen vom Kegelclub aus dem Biergarten der Pizzeria in der warmen Sommerluft verlor. Am Illerufer in Richtung Kaltbronn hüpften neun unbekleidete Damen in den allerbesten Jahren, die sich »Hexenzirkel« nannten, rhythmisch um ein großes Feuer und beschworen, mit welken Margeriten bekränzt, enthusiastisch die Erdgöttin. Sehr zur Freude von Schucki Hermann aus Lautrach übrigens, der während der Heimfahrt auf seinem bevorzugten Schleichweg zufällig auf das Getrommel aufmerksam geworden war und nun aus einem dichten Gebüsch heraus die ausgelassene Festivität beobachtete. Während er sich kindlich an den ums Feuer hüpfenden Hexen erfreute, wurde überall im Landkreis gegrillt, gefeiert, gelacht und getanzt bis in den frühen Sonntagmorgen hinein. Immerhin war heute eine Sonnwend und damit auch die kürzeste Nacht des Jahres.
Der Rest von Legau schlummerte derweilen hinter zugezogenen Gardinen den Schlaf der Gerechten– und Pfarrer Sommers Sonntagspredigt entgegen, die sich nur durch einen anschließenden deftigen Frühschoppen im Gasthaus »Mohren« verdrängen lassen würde. Alles war irgendwie in allerbester Ordnung.
Eingebettet zwischen sanft gewölbten, dicht bewachsenen Hügeln wie ein halb versunkenes architektonisches Kleinod, einige Kilometer vom Flusslauf der Iller entfernt, beschien der Mond mit seinem mysteriösen Licht auch den Moserhof, ein stattliches Anwesen, das sich wie gemalt in die Landschaft schmiegte.
Ein frisch gepflasterter, von hohen Birken gesäumter Zufahrtsweg führte geradewegs zu dem geräumigen dreihundert Quadratmeter großen Wohngebäude, von dem eine Hälfte in strahlendem Weiß leuchtete, während die andere mit Baugerüsten versehen und mit Planen abgedeckt war. Durch einige Fenster im bewohnten Trakt drang helles Licht. Weinseliges Gelächter hallte aus dem Gebäude in die warme Juninacht, untermalt von psychedelischen Klängen einiger Bands, deren Mitglieder schon vor vielen Jahren, vorwiegend aufgrund von Drogenmissbrauch oder anderen Unbotmäßigkeiten des Schicksals, das Zeitliche gesegnet hatten.
Umgeben war das Gehöft von einer gekalkten hohen Mauer, um die Bewohner vor neugierigen Blicken zu schützen. Diese hatte anfangs für einigen Gesprächsstoff im Dorf gesorgt, aber mittlerweile waren die Legauer daran gewöhnt, dass die Bewohner des Anwesens es vorzogen, unter sich zu bleiben. An dem schmiedeeisernen elektrischen Gittertor, das um diese Uhrzeit stets verschlossen war, prangte ein großes weißes Metallschild mit der Aufschrift: »Senioren-Wohngemeinschaft Moserhof«. Gekrönt wurde das »i« in »Senioren« von einem kreisrunden, gezackten Loch. Bis zum heutigen Tage wusste niemand um seine Entstehung außer dem Sepp vom Bichlerhof, der seinerzeit, als er im Vollrausch nach einer Halloweenparty von historischen Ausmaßen mit seinem alten Diesel in Schlangenlinien am Moserhof vorbeigeschlingert war, die alte Wehrmachtspistole seines Opas ausprobiert hatte. Von den abgegebenen fünf Schuss traf nur einer, und am nächsten Morgen versenkte Sepp die angerostete Waffe wortlos, von angemessenem Schädelweh geplagt, an einer unzugänglichen Stelle an der Iller im Wasser. Einen Tag später hatte er die ganze Geschichte komplett vergessen und wunderte sich seither täglich auf dem Weg zur Arbeit über das kaputte Schild.
Der ehemalige, nach und nach zu einem Apartmentkomplex umgebaute Moserhof war jetzt, kurz vor seiner Fertigstellung, eines der schönsten Anwesen im ganzen Gäu. Über viele Generationen hatte das lang gestreckte, mehrstöckige Bauernhaus samt den ausladenden Stallungen der Familie Moser als Heimat gedient. Doch nichts ist so beständig wie der Wandel, das musste auch Albert Moser erfahren, als sein Sohn Martin sich vor zwanzig Jahren vor ihm aufgebaut und angekündigt hatte, er würde ab sofort sein Geld anderweitig verdienen, weil er es satthatte, sich die Finger schmutzig zu machen. Immerhin hatte Martin trotz der offensichtlichen Missbilligung seines Vaters vor Kurzem ein mit Betriebswirtschaft kombiniertes Informatikstudium absolviert und wollte vom Heurechen und Mistschaufeln nichts mehr wissen, denn da musste man rund um die Uhr ackern ohne Aussicht auf ein freies Wochenende. Martin schwebte etwas anderes vor, was er seinem Vater unverblümt mitteilte.
»Papa, ich mach des nimmer, sorry. Musst dir wen suchen, der meine Arbeit in Zukunft erledigt, ich hab gestern den Mietvertrag unterschrieben für ein Büro in der Zimmergasse in Memmingen und werd ab sofort des tun, was ich am besten kann. Des Büro ist erst der Anfang. Ich will’s weit bringen.«
Was Martin Moser, der hoffnungsvolle einzige Sprössling einer Landwirtsfamilie, nach Meinung seines Vaters am besten konnte, verkniff dieser sich auszusprechen. EDV war es definitiv nicht. Martin hatte nämlich einen latenten Hang zu Glücksspiel, seichten Vergnügungen, schweren Autos sowie leichten Damen. Ohnehin hatte er in letzter Zeit viel zu oft auf dem Feld oder im Stall gefehlt, weil er sich so schlecht von seinen zweibeinigen Hobbys loszureißen vermochte.
»Bub, und wie sollen mir dann weitermachen?«, hatte Albert desillusioniert gefragt. »Seitdem die Mama tot ist, hab ich doch außer dir keinen mehr, der mir hilft.«
Aber Martin, ein schmucker Bursche mit dichtem schwarzen Haar und einem stattlichen Vollbart, hatte sich wortlos umgedreht, seinen Vater im Stall stehen gelassen, den silbernen Designerkoffer gepackt und war bei Nacht und Nebel zu seiner derzeitigen Freundin Julia Häring, einer klapperdürren Platinblonden mit ausladendem Schmollmund, verschwunden, die ihn mit offenen Armen empfing. Immerhin verfügte Martin, dieser energische, energiegeladene und äußerst attraktive Mann, zusätzlich zu seinem athletischen Körperbau und dem gefährlichen Charme eines nimmersatten Ladykillers außerdem über ein paar andere, hier nicht zitierfähige Eigenschaften, und Julia war gierig auf ein Leben, das ihr mehr zu bieten hatte als Memmingens Nachtleben, Textildiscounter oder Pauschalurlaube.
Albert Moser, der damals den Hof zusammen mit seiner umtriebigen Mutter Gerlinde und, bis zum jetzigen Zeitpunkt, mit Martin bewirtschaftete, hatte geschluckt. Dann war er ins Haus gegangen, hatte sich zu seiner achtzigjährigen Mutter in die Stube gesetzt, wo diese gerade seine Socken stopfte, und lange geredet.
»Ohne den Buben kann ich net weitermachen, Mama. Dann müssen mir mit der Landwirtschaft aufhören. Du gehst ins Seniorenstift, und ich nehm mir a Wohnung in Legau. Den Hof verkaufen mir.« Hastig wischte er bei dieser Eröffnung eine vorwitzige Träne diskret mit dem Handrücken ab. Seine Mutter duldete nämlich keine Sentimentalitäten.
»Des schaffen mir auch zu zweit, mir brauchen den nixigen Bazi net«, hatte Gerlinde damals resolut beschlossen und mit ihrer verarbeiteten Hand auf den Tisch gehauen, dass die Blumenvase mit den Freesien schepperte.
Leider erwies sich ihre euphemistische Aussage als fataler Trugschluss, denn keine sechs Wochen nach Martins Auszug wurde Albert Moser, der vor lauter Arbeit nicht mehr aus noch ein wusste, von seinem erst seit vier Monaten abbezahlten Traktor zerquetscht, als dieser samt Anhänger umkippte und ihn unter sich begrub. Albert hatte sich total übermüdet in einer tiefen Furche im Acker festgefahren, was sein Gespann in gefährliche Schieflage brachte, und war dann verärgert ausgestiegen, um zu prüfen, wie er die Zugmaschine aus dem Schlamm befreien könnte, als das Fahrzeug endgültig der Krängung nachgab und Alberts arbeitsreichem Leben ein jähes Ende setzte.
Gefunden wurde er von seiner entsetzten Mutter Gerlinde, die ihm mit der Brotzeit hinterhergeradelt war. Trotzdem Gerlinde eine tatkräftige, immer noch recht fitte Person war, schaffte sie es nicht, ihren Sohn unter dem zweihundertPS starken Ungetüm herauszuziehen. Also strampelte sie tränenüberströmt zurück zum Hof und alarmierte die Legauer Feuerwehr.
Nie mehr würde Albert die Stubentür aufreißen und fragen: »Was gibt’s zum Essen?« Für diese grausame Erkenntnis benötigte Gerlinde genau vierundzwanzig Stunden, denn sie hatte den Zweiten Weltkrieg überlebt, alle sinnvollen oder sinnlosen Steuererhöhungen seit Adenauer, jede Regierung nach 1945 und war deshalb hart im Nehmen. Ihren missratenen Enkel Martin wies sie an der Türschwelle ab, als dieser am nächsten Tag anklopfte, um sie zu trösten, und warf ihm unter wüsten Beschimpfungen einen halb vollen Putzeimer nach, der ihn nur um Haaresbreite verfehlte. Dann drehte sie sich um, marschierte in die Stube, heulte zwei Stunden und trug ab diesem Zeitpunkt die Angelegenheit mit bemerkenswerter Fassung. Dabei half ihr eine größere Menge Johannisbeerlikör in für andere Menschen vermutlich toxischer Dosierung, den sie jährlich– nur für den eigenen Hausgebrauch– ansetzte. Es handelte sich um ein Gebräu mit hoher Klopfzahl, das sie grundsätzlich keinem Besuch anbot und wie einen herbsüßen Schatz hütete. Nicht einmal Erna Dobler, die öfter bei ihr vorbeischaute, bekam ein Stamperl angeboten, doch die besaß ohnehin ihren mit Melissengeist gefüllten Flachmann und braute ihren eigenen Likör, der um einiges besser war als der von Gerlinde, wie sie selbst behauptete.
Dieses gehaltvolle Getränk half Gerlinde durch die nachfolgende schwere Zeit: die Beerdigung ihres einzigen Sohnes, das Getuschel im Dorf, sie hätte den Traktor gefahren (was nicht stimmte), die scheinheiligen Krokodilstränen ihres einzigen Enkels Martin, der mit gespielt betrübter Miene am Grab stand, und den ganzen Behördenkram, denn einfach nur zu sterben und anschließend tot zu sein war in Deutschland nicht möglich, wie Gerlinde leidgeprüft feststellen sollte.
Schon Wilhelm Busch schrieb seinerzeit: »Es ist ein Brauch von alters her– wer Sorgen hat, hat auch Likör.« Und so gönnte sich Gerlinde täglich ihre Ration, wenn sie aus dem Stall müde in die Küche schlurfte, während sie angestrengt darüber grübelte, wie der Betrieb aufrechterhalten werden könnte. Ohne mindestens eine männliche Kraft musste sie den Hof aufgeben.
Das Schicksal, in manchen Fällen ein mieser Verräter, nahm ihr diese Entscheidung ab, denn als sie zwei Wochen nach Alberts Beerdigung, mitten in der Nacht und wohltuend angeschickert, die unebene hölzerne Treppe ins Erdgeschoss im Dunkeln hinuntertapste, um dort auf die Toilette zu gehen, erlitt sie einen Schwindelanfall, kugelte alle dreizehn Stufen abwärts und brach sich am Fuße der Treppe das Genick, wo sie am nächsten Morgen vom Häfele Hans, dem erschreckten Postboten, entdeckt wurde.
Endlich hatten die Legauer wieder etwas zu schwätzen, zumal Gerlinde laut Aussage vom Häfele Hans stark nach Alkohol gerochen haben sollte. Zwei tragische Todesfälle innerhalb kürzester Zeit– das war seit dem Fall mit dem Florian Schütz und dem Mord auf der Hochzeit nicht mehr vorgekommen. Es wurde nochmals eine– nicht mehr ganz so rauschende– Beerdigung für die arme Gerlinde ausgerichtet, denn Martin Moser wollte dem Bestattungsunternehmen nicht allzu viel Geld in den Rachen werfen. Immerhin hegte er hochfahrende Pläne, seitdem er vor Kurzem in der Zeitung gelesen hatte, dass Deutschland zu vergreisen drohte. Gerade einmal dreiunddreißig Jahre alt, gedachte er das Pflegegeschäft vom Kopf auf die Beine zu stellen, und zwar mit so wenig Arbeit und so viel Ertrag wie möglich. Es herrschte eine wachsende Nachfrage nach Wohngelegenheiten mit Betreuung für Senioren, und er besaß seit Neuestem eine Menge Grundbesitz, mit dem sich einiges anstellen ließe. Immerhin war er der einzige Erbe und musste sich nicht mehr mit seiner Oma darüber streiten, dass er ein Verräter sei und seine Notdurft ihren Worten zufolge dort verrichtete, wo er aß. Im Grunde genommen hatte seine Großmutter es wesentlich drastischer ausgedrückt.
Einen Tag nach der Beerdigung seiner Oma, die unschön geendet hatte, weil er von mehreren Leuten am Grab teils handgreiflich beleidigt worden war, stand Martin Moser im zugigen Gang des uralten Bauernhauses und betrachtete nachdenklich den steinernen, von unzähligen Schuhen, Putzlappen und Bohnerbürsten abgewetzten Boden. An seinem Arm hing wie eine luxuriöse Handtasche seine Freundin Julia und sah sich naserümpfend um. Sie stammte ursprünglich aus Memmingen und hatte mit Blut und Boden nicht allzu viel am Hut.
»Schnucki, komm endlich. Du hast nachher einen Kunden.« Ungeduldig zupfte sie an seinem Ärmel und wollte ihn zum Ausgang ziehen. »Das alte Gemäuer verkaufen wir, und dann können wir selber bauen.«
»Na.« Martin kratzte sich gedankenverloren am Kinn. »Des Vieh lass ich vom Königsperger abholen, der hat mir ein Angebot gemacht, dann ist des Nötigste erledigt. Mir zwei bleiben fürs Erste in Memmingen. Mit dem alten Bunker vom Papa machen mir später was, des uns richtig Kohle bringt, Schatzi, weil ich eine saugute Idee hab.«
»Schatzi.« Die Frau Mitte zwanzig mit vollen Lippen und harten braunen Augen, in einem giftgrünen Kleid, das keine Fragen offenließ, schaute ihn erwartungsvoll an, denn »Kohle« war ihr Lieblingsthema. »Nix mehrIT oder was meinst du?«
Mit einem letzten Blick auf die hölzernen Dielen, die abgewetzte Kommode und den weitläufigen Flur schlug Martin die Tür hinter sich zu. Es klang endgültig. »Nix mehrIT. Mir verkaufen den Grund am Rand von Memmingen«, klärte er Julia auf, während beide in seinem neuen roten BMW Platz nahmen. »Des wird als Bauland ausgewiesen, hab ich gehört. Dann ham mir einen Haufen Geld. Mit dem übernehmen mir die alte Käserei vor Kempten, die ich neulich angeschaut hab, bauen die um und setzen ein paar zahlungskräftige Rentner rein, weißt. Und wenn des lauft, wie ich mir des durchgerechnet hab, schaffen mir uns die nächste alte Hütte an und machen so weiter. Wirst sehen, des klappt.«
»Aber hier hast du doch ein Haus?« Julia zeigte auf den Moserhof.
Martin schüttelte den Kopf. »Legau ist grad net so klug, Schnuckele. Da schwätzt ein Haufen Leut momentan saublöd rum, dass ich an allem schuld sei, hast ja gestern beim Leichenschmaus mitgekriegt, als mir der Korbinian eine schmieren wollte. Den Moserhof vermiet ich an diese Öko-Fritzen aus Hannover, die mir neulich auf der Party beim Bürgermeister kennengelernt ham. Die wollen da eine natürliche Landwirtschaft aufbauen oder was weiß ich, die lass ich anständig zahlen. Und wenn Gras über alles gewachsen ist, schmeiß ich sie raus und mach draus, was mir vorschwebt.«
»Find ich blöd, dass du vermieten möchtest, hier müssten wir nichts kaufen, es ist ja schon da«, murmelte Julia skeptisch.
»Weiß schon, was ich tu.« Martin blieb von ihrem Einwand unbeeindruckt. »Denk nach, je älter die Leut werden, umso reicher werden mir zwei. Mir sind jung, des mit dem Hof vom Papa pressiert net.« Mit einem bösen Grinsen startete er den Wagen. Seine Frau grinste mittlerweile auch.
So kam es, dass fünfzehn Jahre nach den beiden unglücklichen Todesfällen, und vierzehneinhalb Jahre nach der Umwidmung des Moserhofs in eine Art neuzeitliche gemeinwirtschaftliche Kolchose, das alte Bauernhaus zwischenzeitlich beinahe vollständig in neuem Glanz erstrahlte, denn die Öko-Community hatte sich vor Jahren in alle Winde zerstreut, hauptsächlich aufgrund fehlender betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, mangelnder Beherrschung der Grundrechenarten und tagesformabhängiger Selbstdisziplin. Das Öko-Geschäft war nicht so gut gelaufen. Es hatte sich gezeigt, dass es beim Betreiben einer Landwirtschaft von Vorteil war, mindestens rudimentäre Kenntnisse über Ackerbau und Viehzucht zu besitzen. Das in den ersten Monaten euphorisch propagierte Konzept »Wir lassen alles einfach wachsen, danach verkaufen wir es zu guten Preisen« hatte sich bereits nach einem Jahr mit nur erbsengroßen Radieschen, erdbeergroßen Kohlrabi und streichholzdicken Möhren als Milchmädchenrechnung herausgestellt. Genau wie die Schafzucht, denn die Herde wurde, so wie das Getreide, ums Verrecken nicht größer, im Gegensatz zur Katzen- und Mäusepopulation, bei der allerdings die Mäuse das Rennen machten.
Martin ließ nach dem Auszug der ambitionierten, aber gescheiterten Kommune unter Zuhilfenahme der Baufirma von Jürgen Reichelt, dem größten Unternehmer vor Ort, das gesamte Gebäude entkernen, von Grund auf sanieren und sparte dabei an nichts. Albert Moser, sein verstorbener Vater, hätte sich vermutlich im Grabe herumgedreht. Vielleicht tat er das auch, wenn man Erna Dobler, der rüstigen Witwe, glauben konnte, die sich ständig auf dem Friedhof herumtrieb.
Der vordere Teil des Moserhofs war binnen kürzester Zeit vollständig umgebaut worden, und seit neun Monaten wohnten dort die ersten Senioren. Die Bauarbeiten an dem angrenzenden Wirtschaftstrakt sollten demnächst abgeschlossen sein, dann würden acht Apartments Geld in die Kasse spülen. Innerhalb weniger Wochen waren die von Martin angebotenen Studios seiner Luxusresidenz in Legau vermietet gewesen. Sechs waren seitdem belegt, und die restlichen Gäste, die es trotz der ellenlangen Warteliste, länger als das Memminger Telefonverzeichnis, geschafft hatten, sich einen Platz zu sichern, planten zum Jahresende den Bezug ihrer Altersruhesitze im Voralpenland mit ländlichem Charme zu Großstadtpreisen. Martin bevorzugte seit Jahren Senioren ohne Anhang, denn er hatte die Erfahrung gemacht, dass sich Kinder oder Enkel als außerordentlich lästig erwiesen. Er ging gern jedem Ärger aus dem Weg.
Den Gästen stand jede erdenkliche Annehmlichkeit zur Verfügung, die einen schönen Lebensabend garantierte, und trotz der horrenden Preise brachte Moser seine komfortablen Räumlichkeiten problemlos an den Mann oder die Frau. Neben einer Sonnenterrasse mit beheiztem Pool, luxuriös ausgestatteten Single-Apartments mit Flachbildfernsehern und barrierefreien Sanitäranlagen gab es zusätzlich noch Sauna und Fitnessraum im Gewölbekeller. Es war also für alles gesorgt.
Wer einkaufen oder zum Essen oder Tanzen gehen wollte, dem stand ein Wagen mit einem mehr oder weniger willigen Betreuer am Steuer zur Verfügung, denn Kurzausflüge mit Senioren rangierten in der Beliebtheitsliste des Aufsichtspersonals ganz weit unten– als zu anspruchsvoll erwiesen sich einige Gäste, die das Personal als Privatkulis zu betrachten schienen. In der ehemaligen Bauernküche mit den Ausmaßen eines Apple-Stores schuf Moser einen Gemeinschaftsraum mit speziell auf ältere Personen zugeschnittener Einrichtung wie zum Beispiel versenkbaren Hängeschränken, Induktionskochinsel und Dampfgarer, alles gehalten in Lindgrün und Schleimgelb, denn er wollte den Herrschaften das Umfeld bieten, in dem sie seiner Meinung nach aufgewachsen waren. Anschließend heuerte er zwei Betreuerinnen an, in deren Zuständigkeitsbereich auch die Erfüllung kleinerer und größerer Bedürfnisse seiner Gäste fiel, sowie jemanden für die Hauswirtschaft. Immerhin bot er in seinem Hochglanzprospekt auf Wunsch täglich warme Mahlzeiten an. Im Grunde genommen war das Ganze die Lightversion eines Vier-Sterne-Hotels mit Lokalkolorit, die sich vor allem im hohen Norden gut verkaufte, und das nützte Moser weidlich aus.
Von seinen anderen vier Liegenschaften hatte er gelernt, dass ihm vor allem die Auswahl seiner Betreuerinnen Anfragen vitaler männlicher Senioren nach einem freien Platz in seiner Anlage verschaffte. Unangenehmerweise hatte seine Gattin Julia nach mehreren unschönen Vorfällen in Besenkammern und Poolhäuschen, bei denen Martin sich als Beteiligter der horizontalen Völkerverständigung gewidmet hatte, der Angelegenheit einen Riegel vorgeschoben und wählte nun selbst das Personal aus. Martin durfte nur noch Prospekte gestalten und neue Kunden begutachten, das tat er mit sehr viel Kreativität.
Vor einem Dreivierteljahr war Martin allerdings bei der Erstvermietung seiner Apartments auf dem frisch eröffneten Moserhof ein Irrtum unterlaufen, wie er seufzend beklagte, denn diese mehr als renitenten Neubewohner erwiesen sich als echte Sorgenbringer. Sie benahmen sich nämlich so gar nicht, wie sie es Martins Meinung nach tun sollten. Von den insgesamt sechs neuen Gästen verhielten sich nur zwei seiner Ansicht nach »altersgemäß«, verbrachten ihre Zeit also lesend oder beim Spazierengehen. Der rebellische Rest hatte sich innerhalb kürzester Zeit angefreundet, zu einem aufmüpfigen Freizeitclub verbündet und tyrannisierte nicht nur die Betreuerinnen– hübsche junge Damen aus diversen Ostblockstaaten, die entnervt nach kurzer Zeit das Handtuch warfen–, sondern auch das Dorf. Mehr als einmal saßen die vier am Sonntagvormittag in Legau, belagerten den Marienbrunnen mit einer Flasche Bier in der Hand, bezeichneten die braven Kirchgänger beim Verlassen des Gotteshauses als »folkloristische Klerikalfaschisten« und lachten dazu abfällig.
So etwas hatte es in Legau noch nie gegeben, und schnell wurden Ressentiments gegen die »zugezogenen Preußen« laut, die es sich nicht nehmen ließen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit über das Allgäu und die Eigenschaften seiner liebenswerten, fleißigen Einwohner zu lästern.
Martin Moser, der gern mal eine Halbe im »Mohren« am Stammtisch trank, mied deshalb bei seinen Inspektionsbesuchen das Gasthaus wie der Teufel das Weihwasser, um sich nicht noch mehr Beschwerden über seine »Preißn« anhören zu müssen, für die er im Grunde genommen gar nichts konnte. Seine Frau Julia, die sich im Alleingang um die Buchhaltung kümmerte, hatte mit Legau ohnehin nicht viel am Hut und verreiste höchstens einmal jährlich für vier Wochen in eine Klinik am Bodensee, von wo sie mit frisch gefüllten Falten und geleertem Geldbeutel zurückkehrte. Bis auf gelegentliche Stippvisiten bekam man sie nie zu Gesicht, sie zog ihr Penthouse in Memmingen der Landluft bei Weitem vor. Beide lebten, wenn sie sich nicht die Zeit in der Karibik auf einer kleinen exklusiven Insel vertrieben, in einem luxuriösen Penthouse mit Sauna, Fitnessraum und Portier inmitten von Versace-Fliesen, Colani-Armaturen und Benz-Möbeln und verbrachten ihre Freizeit in Oberstaufen mit den »richtigen« Leuten, denn Armut war ihrer Meinung nach ansteckend, damit wollten sie nicht kontaminiert werden.
Es wurde seit der Eröffnung des Moserhofs einiges gemunkelt im Dorf. Zwar glaubte niemand wirklich, dass Martin selbst den Traktor auf seinen Vater gekippt oder seine Oma die Treppe hinuntergeschubst hatte, allerdings waren in letzter Zeit Gerüchte laut geworden, dass es angeblich auf dem Anwesen spukte.
Renate Reismann, seit dem Tag der Eröffnung vor neun Monaten Bewohnerin des Moserhofs, eine extrem schlanke, schwerreiche Intendantenwitwe Anfang siebzig mit feuerrot gefärbtem Haar, das sich über ihrem käseweißen, faltigen Gesicht bauschte wie ein brennender Helm, hatte es vor Kurzem schockiert dem Friseur Hermann Reisacher erzählt.
»Da war neulich etwas am Pool«, vertraute sie ihm flüsternd hinter vorgehaltener Hand an, als er an ihr vorbeihuschte. »Eine dunkle Gestalt mit Kapuze. Unter der konnte ich ein Gesicht erkennen, mit riesigen Zähnen und Glupschaugen!«
Reisacher, seines Zeichens bodenständiger Pragmatiker, ein smarter Mann um die sechzig mit auf Abruf verfügbarem verschmitzten Lächeln, hatte die Geschichte keine Sekunde lang geglaubt, denn auch über die Bewohner der Wohngemeinschaft existierten Gerüchte, was zum Teil daran lag, wie sie sich in der Öffentlichkeit benahmen. Zumindest erweckte Renate Reismann den Eindruck, als wäre sie in jungen Jahren täglich mit Keith Richards von den Rolling Stones bekifft um die Häuser gezogen, denn so ein Gesicht bekam man nicht von einem anständigen Lebenswandel, wie Erna Dobler regelmäßig behauptete. Und die musste es wissen.
Renate war übernervös bis hysterisch, leicht reizbar, über alle Maßen eitel und führte gelegentlich unter der Trockenhaube lange Selbstgespräche, während sie mit spitzen Fingern in der »Gala« blätterte. Außerdem hatte sie sich beim Bäcker beschwert, weil er keine »Berliner«, sondern »Krapfen« anbot, und den Metzgermeister Korbinian Altmeier in seinem eigenen Laden des Sexismus beschuldigt, weil der bei dem Wort »Putenbrust« angeblich spöttisch auf ihren Busen geschielt hatte. Sie war je nach Tagesform militante Feministin oder kränkelnde Kameliendame und beklagte sich bei jedem, sogar bei Pfarrer Sommer, der ihr beim Edeka zufällig in die dürren Finger gelaufen war, dass sie es hier furchtbar fände, das Alpenpanorama überbewertet und überbezahlt wurde und dass sie nur schnellstens wegwollte zu kultivierten Menschen ihres eigenen intellektuellen Niveaus. Ihr Make-up erweckte den Eindruck, als wäre sie für Gewinnzusätze diverser Parfümerieketten ganz allein verantwortlich, denn ihre um die Mundwinkel tief eingegrabenen Falten waren mit so viel Puder zugespachtelt, dass Jürgen Reichelts Maurergesellen bei ihr etwas hätten lernen können. Einst war sie eine Schönheit gewesen, und es fiel ihr nicht ein, zuzugeben, dass diese Zeiten eventuell vorbei sein könnten. Sie bevorzugte es, nicht alles ganz so scharf zu sehen, trug deshalb niemals eine Brille und grüßte gelegentlich den Kleiderständer in Reisachers Friseursalon mit einem unfreundlichen »Moin«. Eine Antwort bekam sie von dem Holzgestell nie, aber von den »Eingeborenen« in »diesem Kuhkaff« erwartete sie ohnehin nicht mehr allzu viel.
»Preiß halt«, hatte sich Hermann Reisacher damals gedacht und Renates Erzählungen keine größere Bedeutung zugemessen. Als Friseur benahm er sich wie ein zweibeiniger Anrufbeantworter, denn sobald der Kunde seinen Laden verließ, löschte er in seinem Kurzzeitgedächtnis alles, was er gehört hatte. Damit war er bisher gut gefahren.
Allerdings hatte ihn einige Tage danach Dieter Brumbach, ein weiterer Bewohner der Seniorenresidenz, aufgesucht, um sich einen frischen Messerschnitt verpassen zu lassen. Dieter, ein ausgesprochen attraktiver Mann um die siebzig, ließ sich im Salon Reisacher diskret seine grauen Schläfen färben. Er fühlte sich keinen Tag älter als fünfundzwanzig und wollte, dass andere das genauso sahen. In jungen Jahren war er ein Bild von einem Mann gewesen, Chef einer mittelständischen Baumaschinenfirma im Württembergischen, mit hohen Umsätzen und niedrigen Personalkosten, der nie ohne Maßanzug und zehn verschiedene Platin-Kreditkarten seine schmucke Villa verlassen hatte. Er fuhr damals die teuersten Autos, übernachtete in den teuersten Hotels und hatte Affären mit den teuersten Frauen, was seiner Gattin so gar nicht passte, die ihm nach fünfunddreißig Jahren Ehe davonlief, aus Rache die Hälfte seines Vermögens kassierte, es schlau anlegte und ihm dann eine lange Nase drehte.
Für Dieter war diese Scheidung nur eine Bodenschwelle in seiner emotional verkehrsberuhigten Zone gewesen, denn er lebte danach sein glitzerndes, in absehbarer Zukunft nicht mehr bezahlbares Leben ungeniert weiter und warf noch mehr Geld zum Fenster hinaus als zuvor. Bis zu seinem sechzigsten Lebensjahr wirkte er fünfzehn Jahre jünger und schaffte es mit seiner dichten Haarpracht, dem gebräunten Teint und seinem charismatischen Wesen, die Damen reihenweise flachzulegen. Leider vergaß er darüber gelegentlich, dass er eine Firma zu leiten hatte, die allmählich den Bach runterging. Bei der letzten Bilanzbesprechung erlitt sein Steuerberater eine Panikattacke und legte anschließend sein Mandat nieder. Damals wurde sogar dem Lebemann Dieter klar, dass das Finanzamt niemals scherzte und Insolvenzverschleppung eventuell doch härter als Falschparken sanktioniert wurde, weshalb er zerknirscht seine beiden erwachsenen Kinder um Hilfe bat. Diese verfrachteten ihn kurz nach seinem siebzigsten Geburtstag und einem ernsten Gespräch auf den Moserhof, von dem bei jener Unterredung »rein zufällig« ein Hochglanzprospekt auf dem Schreibtisch gelegen hatte. Sie versprachen, ihn großzügig zu versorgen, wenn er nur künftig die Finger von der Firma ließe.
Dieter akzeptierte das angebotene monatliche Taschengeld in Höhe des Bruttoinlandsproduktes eines kleinen lateinamerikanischen Landes murrend und fühlte sich nach einiger Zeit auf dem Moserhof pudelwohl, denn auch hier gab es Personal, das man herumkommandieren konnte. Die lachten sogar über seine frauenfeindlichen Witze oder seine Scherze über Bayern, denn immerhin war er Württemberger und behauptete regelmäßig, er sei nur hier, um Entwicklungshilfe zu leisten. Manche Dinge ändern sich eben nie.
An diesem sonnigen Maitag im Friseursalon baumelte Dieter ungeduldig auf dem großen ledernen Friseurstuhl mit den Beinen. Warten war er nicht gewöhnt. »Dieses Allgäu wäre so schön, wenn nur die Leute nicht wären«, beklagte er sich. »Hier wird man beschummelt.«
Grund seiner Enttäuschung war ausgerechnet jener Hochglanzprospekt, mit dem Dieters Kinder seinerzeit herumgewedelt hatten, um ihn ins bayerische Feindesland zu locken, denn auf dem Titelbild prangte Mosers neueste Errungenschaft, Natalja Petrovna, eine wunderschöne Russin mit hohen Wangenknochen und laszivem Schmollmund, die alle Interessenten verführerisch anzulächeln schien.
Moser hatte der bildschönen Siebenundzwanzigjährigen für den Fototermin ein nicht jugendfreies Dirndl verpasst und ließ sie strahlend in die Kamera lächeln, während sie, um wirklich jedem Klischee übers Allgäu zu entsprechen, in einer Hand eine blecherne Milchkanne schwenkte und mit der anderen eine mürrische Kuh streichelte.
Dieter gedachte beim Anblick des Fotos seinerzeit, den Platz dieser Kuh schnellstmöglich einzunehmen, denn Natalja aus den Tiefen der sibirischen Steppe war ein Traum mit ihren taillenlangen dunklen Haaren und den funkelnden grünen Augen. Leider hatte sie kurz vor seiner Ankunft gekündigt, doch ihre Nachfolgerin, eine Bulgarin namens »Mladenka«, war auch nicht ohne gewesen und hatte Dieter halbwegs getröstet, denn sie kochte nicht nur ausgesprochen gut, sondern ließ sich von ihm öfter mal in ihren ausladenden Hintern zwicken, was sie immer mit einem schelmischen Kichern quittierte.
»Bei uns spukt es«, vertraute Dieter nun Hermann Reisacher an diesem schönen Maitag an, der krampfhaft überlegte, wie er es vermeiden könnte, ein nichtssagendes Gespräch mit einem Preußen führen zu müssen. »Ich habe einen Geist gesehen. Ist das vielleicht ein Gespenst aus den Kreuzzügen?«
Reisacher stutzte, denn er hatte während seiner Schulzeit in Geschichte nicht aufgepasst. »Weiß net so genau«, antwortete er daher beflissen. »Kann schon sein. Hat er was Lateinisches gesagt, der Geist?«
»Sie glauben mir wohl nicht?«, hatte Dieter sich aufgeregt. »Eine Figur in Kapuze, mit kalkweißem Gesicht, beinahe wie in dem Film ›Nosferatu‹ mit Max Schreck. Den kennen Sie hoffentlich? So jung sind Sie ja auch nicht mehr.«
Hermann Reisacher kramte in seinem durch unzählige Kundengespräche abgenutzten Gedächtnis und schüttelte betreten den Kopf.
»Wo bin ich hier nur gelandet?«, hatte Dieter sich mürrisch bei seinem Spiegelbild beklagt. »Ich hätte auf meinen Bauch hören und nach Thailand gehen sollen. Na ja, wenigstens hübsche Frauen habt ihr. Obwohl die ja alle aus dem Ausland kommen.«
»Wieder eine Neue?«, hatte sich Reisacher mit vorgetäuschtem Interesse erkundigt.
»Eine Bulgarin diesmal.« Dieter hatte mit der Zunge geschnalzt. »Da kann Jane Russell einpacken.«
»Hat sie schon lang.« Reisacher arbeitete sich am linken Ohr vorbei. »Bulgarin also?«
»Rattenscharfes Gerät«, bejahte Dieter. »Ein Fahrgestell, dass sie dafür TÜV bräuchte. Aber die hat auch gekündigt. Nächste Woche kriegen wir eine aus Köln. Also machen Sie mich schön.«
»Ich tu, was ich kann«, versicherte Reisacher beflissen und arbeitete wortlos weiter. Er war schließlich nicht der liebe Gott.
Seit dieser Unterhaltung im Salon Reisacher waren einige Wochen vergangen, die üppige Mladenka war in ihre geliebte Heimat zurückgekehrt und Dieter überwältigt von der neuesten Betreuerin, die alles in den Schatten stellte. Diese schien über ein unerschöpfliches Reservoir an knapp geschnittenen Arbeitskitteln zu verfügen und Büstenhalter zu hassen. Jeder war zufrieden. Beinahe jeder.
Heute nun, in dieser samtweichen, lauen Sommernacht, als am Illerufer lautstark gegrillt und gefeiert wurde, während sich die Biergärten allmählich leerten, herrschte auf dem Moserhof am gefliesten Pool betroffenes Schweigen. Das einzige vernehmbare Geräusch kam von der tropfenden Dusche neben dem Schwimmbecken.
»Muss ich richten lassen.« Martin Moser wischte sich nervös mit dem Unterarm eine Schweißperle von der Stirn. Neben ihm starrten zwei Personen wie hypnotisiert auf die glänzende dunkle Wasseroberfläche. Etwas weiter entfernt war fröhliches Gelächter zu vernehmen, dann drehte jemand die Musik voll auf. Alle zuckten zusammen. »Break On Through«, schallte es durch die lauwarme Nacht, als wäre Jim Morrison wiederauferstanden.
»Deppen.« Moser warf einen irritierten Blick auf das hell erleuchtete Fenster im Wohntrakt.
»Und? Soll ich reinhüpfen und ihm den Blutdruck messen?« Dr.Butz, ein hochgewachsener Mann Mitte sechzig mit einer im Mondlicht kalkweiß leuchtenden Glatze und runder, stets ein wenig dreckiger Nickelbrille, deutete fragend auf den großen Pool, auf dessen sich geheimnisvoll kräuselnder Oberfläche eine männliche Gestalt mit dem Gesicht nach unten trieb. Bekleidet war sie mit einem grellroten Bademantel, der sich im Wasser bewegte, als wäre er lebendig. Von einer länglichen Wunde an der Schläfe verteilte sich ein dünner Blutfaden im Wasser.
Missmutig reckte Butz sich zu seiner vollen Größe von einem Meter fünfundneunzig auf. »Schöne Sauerei«, konstatierte er. »Warum sollte ich kommen, Martin?« Sein ehemals weißes kurzärmeliges Leinenhemd spannte bis zum Zerreißen über dem stattlichen Kugelbauch, und er schien stinksauer zu sein, was der Tatsache geschuldet war, dass Mosers verzweifelter Anruf ihn bei einem vorgezogenen Frühstück gestört hatte, denn die Uhr am Kirchturm mitten in Legau hatte vorhin bereits ein Uhr geschlagen. Soeben hatte Butz sich noch an einem Schinkenbrot mit Gurke gütlich getan und dabei eine Folge »Medical Detectives« verfolgt, seine heimliche Leidenschaft, von der nicht einmal seine Frau etwas ahnte. Nun stand er am Rande eines Swimmingpools und beobachtete, wie der Bademantel einer Leiche vom sich kräuselnden Wasser aufgefächert wurde.
»Nicht mein Tisch«, sagte er ruppig und wünschte sich nichts sehnlicher, als sich aus dem Staub machen zu können, denn seine Zeit war immer knapp. Täglich fuhr er übers Land, besuchte bettlägerige Landwirte und verpasste störrischen Bäuerinnen Spritzen– die zwar ohne Zögern einem Hasen das Fell über die Ohren ziehen konnten, aber bei einer Antibiotika-Injektion Herzrasen bekamen– und hörte sich geduldig traurige Geschichten an, wenn seine Diagnose »Einsamkeit« lautete. Auf seinem unordentlichen Schreibtisch türmten sich Berge von unbearbeiteten Formularen, und neulich hatte er unter dem Wust von Papieren das Lesegerät für die Chipkarten der Krankenkasse nicht mehr gefunden. Butz war ein Mediziner alten Schlages, bei dem der Kranke an erster Stelle stand, geradlinig, engagiert und allzeit hilfsbereit, was seine Patienten sehr zu schätzen wussten, die genau wie er nie lange um den heißen Brei redeten. Er konnte einen Simulanten von einem echten Kranken unterscheiden, war verlässlich durchgehend schlecht gelaunt und brummig-kompetent. Für einen Landarzt die besten Voraussetzungen.
Jetzt verschränkte er ablehnend die Arme vor der Brust, während er die Leiche beobachtete, die stumm im geheimnisvollen Mondlicht auf der Wasseroberfläche trieb. »Was hast dir dabei gedacht?«, wiederholte er.
Moser warf ihm einen mürrischen Blick zu. Auch heute noch war er ein ausgesprochen schöner Mann mit seinem dichten schwarzen Haar, dem stattlichen Vollbart und deutlich definierten Muskeln, die sich unter seinem teuren Poloshirt abzeichneten. Er wog kein Gramm zu viel, hatte nicht eine Falte mehr als mit dreißig und die besten Keramikkronen im Landkreis.
»Schau ich aus wie ein Rettungsschwimmer?« Butz klopfte sich auf seinen ansehnlichen Bauch, an dem seine Frau seit Jahren herumnörgelte. Und hätte er Zeit für den Besuch bei einem Internisten gehabt, hätte der vermutlich auch genörgelt, aber Butz konsultierte aufgrund einer Ärztephobie nie einen Kollegen. Der würde ihm höchstens seine geliebte Hausmacher-Leberwurst verbieten, die ihm gelegentlich von Patientinnen zugesteckt wurde. Kam nicht in die Dose.
»Wieso hat den keiner rausgeholt?«, raunzte er Moser an. »Glaubst, der hält sich da drin länger? Ruf die Polizei, pronto.« Dr.Butz’ Frau war Italienerin, deswegen hatte er sich im Laufe der Jahrzehnte ein paar Brocken angeeignet, auch wenn die meisten davon nicht salonfähig waren, zumindest behauptete das seine Gattin.
»Des sieht man doch, dass der hinüber ist«, rechtfertigte sich Moser kreidebleich. »Sollst mir bloß den Tod aufgrund von Herzversagen bescheinigen, dann föhnen mir ihn trocken, legen ihn ins Bett und lassen ihn vom Bestattungsinstitut abholen. Herrgott, Nicole, ziehen Sie sich endlich was anderes an!«
Das galt einer bildschönen blonden Frau Ende dreißig, die patschnass neben ihm stand, während ihr dünnes Sommerkleid eng am Körper klebte und sie wie Espenlaub zitterte. Sie hatte ihr Gesicht in den Händen verborgen und heulte ohne Unterlass.
»HörenS’ gefälligst mit dem Geflenne auf!«, befahl Moser barsch. »Da kann man nix mehr machen, des is schon rum ums Eck.«
»Oh mein Gott!«, schluchzte die Blondine immer wieder, während es sie schüttelte.
»Ihre erste Leiche?«, wollte Butz wissen und betrachtete sie wohlwollend. Die Frau bejahte stumm. »Na, dann sind Sie in einer Senioren-WG definitiv falsch.«
»Ich wollte ihn herausholen. Aber er war so schwer. Als ich ihn gefunden habe, lag er schon im Wasser.«
»Hat doch keiner behauptet, dass Sie was damit zu tun haben«, meinte Butz väterlich. »Sie sind so ein Leichtgewicht, das hätten Sie ohnehin nicht geschafft.«
»Rein ins Haus, zefix!«, herrschte Moser Nicole an. »Des hilft dem net, wenn Sie rumplärren. Der hört nix mehr. Und ham Sie eigentlich eine Ahnung, wie des ausschaut, wenn Sie mit Ihren nassen Sachen rumstehen? Am Schluss ham Sie den noch selber ersäuft.«
»Warst schon dein Lebtag lang eine mitfühlende Seele, Martin.« Butz schaute diskret Nicole hinterher, die in ihrem pitschnassen Kleid barfuß über die Terrasse zum Hintereingang wankte, der direkt in die große Gemeinschaftsküche führte.
»Was geht ab? Ist des etwa…?« Ein untersetzter junger Mann Anfang dreißig, dessen weit aufgerissene Augen unter einem rotblonden Haarschopf erschrocken funkelten, stolperte über den gepflasterten Weg auf den Pool zu. Offensichtlich kam er vom Parkplatz vor dem Haus. Seine Jeans hing auf Halbmast, er zog sie hastig hoch und warf einen scheuen Seitenblick auf die Leiche. »Herr Moser, was…?« Unmittelbar begann er zu zittern, sein Gesicht verzog sich, als würde er gleich weinen.
»Da schau her, der Engels«, sagte Moser barsch. »Wo kommst du her, Christian?«
»Ich hab heut freigehabt«, stotterte der junge Mann und schnaufte schwer. »War in Memmingen. Was ist denn passiert?«
»Nix.« Moser verschränkte die Arme vor der Brust. »Die Nicole hat ihn gefunden. Er ist wohl gestolpert und reingefallen.«
»Ist er wirklich tot?« Christian schnappte panisch nach Luft.
»Viel toter geht’s net«, bestätigte ihm Butz anstelle von Moser. »Sagen Sie mal, ham Sie Rouge im Gesicht?« Misstrauisch musterte er den jungen Mann mit medizinischem Interesse. »Ihre Backen sind viel zu rot. Und Sie hyperventilieren ja. Ganz ruhig, tief einatmen. KommenS’ nächste Woch zu mir in die Praxis, dann nehmen mir Ihre Leberwerte. Wie viel trinkenS’ denn so am Tag?«
»Mir ham grad andere Probleme als die Leber von dem da«, fuhr Moser ihn an.
»Ich net«, erklärte ihm Butz süffisant. »Hab übrigens gehört, die Bank macht nimmer mit wegen dem Stallausbau?«
»Die Leut reden immer«, grollte Moser. »Was machen mir jetzt mit dem Toten?«
»Ich werd ihn net rausholen«, stammelte Christian, der am ganzen Körper zitterte. »Weil ich net schwimmen kann.«
»Du kannst net schwimmen?«, raunzte Moser ihn an. »Und des erfahr ich erst heut? Jemand muss nämlich auf die Gäst aufpassen, wenn die rumplanschen, als wären sie erst siebzehn. Außerdem ist des Wasser grad amal hundertzwanzig Zentimeter tief. Aber du hockst ja bloß vor deiner Scheiß-Playstation oder dem Computer, drum bist auch so fett. Vor vier Wochen hab ich dir schon angeschafft, du sollst des Häusle am Pool streichen. Nix ist passiert.« Er zeigte vorwurfsvoll auf eine kleine Holzhütte neben dem Becken, die wie eine Bushaltestelle am Ende der Welt nur mit einem schmalen Bänkchen bestückt war und zum Umziehen diente.
»Mir reicht’s.« Dr.Butz zückte sein Handy. »Den kann untersuchen, wer will. Wie kommst auf des schmale Brett, dass ich da reinhupf und dir seinen Tod bestätige. Wenn den jemand vielleicht rausgeholt hätt, könnt sein, der wär noch am Leben. Des ist unterlassene Hilfeleistung, nur damit mir uns verstehen.«
»Michi, dass du so unloyal bist und mir net amal einen kleinen Gefallen tust, fass ich net«, empörte sich Moser. »Meine Gäste sind alle Privatpatienten, da verdienst du auch ganz gut dran.«
»An dem Freischwimmer nimmer. Übrigens hab ich den erst vor zwei Wochen untersucht. Der hat Magenweh gehabt wegen dem Saufraß, den deine neue tolle Hauswirtschafterin den Leuten vorsetzt.«
»Saufraß?«, entrüstete sich Moser.
»Der war fit wie a Turnschuh«, fuhr Butz ungerührt fort. »Leberwerte wie a Dreißigjähriger, net so wie deine, Martin.«
»Michi, mach schon«, bettelte Moser. »Schreib auf, dass der an Herzschlag gestorben ist. Ich zahl dir auch was.«
»Ich kann des net«, hauchte Christian, dessen Gesicht mittlerweile eine fahlgrüne Farbe angenommen hatte. »Der ist tot.«
»Und der nächste zum Altenbetreuer Berufene«, brummte Butz sarkastisch.
»Jammer net rum, Christian«, schnauzte Moser den schlotternden Betreuer an. »Die Nicole kauf ich mir auch noch. Da brauch ich euch kein Schweinegeld zahlen, wenn ihr eure Arbeit net machts.«
»Hallo?« Butz hatte eine Nummer gewählt. »Dr.Butz hier. Wir haben einen ungeklärten Todesfall. Bringen Sie eine Badehose mit. Nein, ich mach keine Witze. Wenn Sie mich kennen würden, wüssten Sie des. Ach, Sie kennen mich? Sind Sie deshalb so patzig? Moserhof, Richtung Altusried. Da steht ein Schild, des könnts net amal ihr übersehen. Pfiagott.«
»Ich geh dann besser«, flüsterte Christian, der sich kaum noch unter Kontrolle hatte. Seine Hände flatterten, und er atmete nach wie vor viel zu schnell.
»Gar nix machst du«, befahl Moser ruppig. »Mir warten auf die Bullen, wie der Herr Doktor es ja unbedingt will. Du bringst mich in Teufels Küch, Michi, werd mir wohl an anderen Arzt suchen müssen für meine Gäst.«
»Mir schlackern schon die Knie«, entgegnete Butz. Er war müde, hungrig und hatte schlechte Laune. Und er wollte zurück zu »Medical Detectives« und seinem Wurstbrot, denn normalerweise forderten die Lebenden unter seinen Patienten vierundzwanzig Stunden am Tag seine Aufmerksamkeit, weswegen er sich über jede Sekunde Freizeit freute. »Des berechne ich dir übrigens. Mit Nachtzuschlag.«
»Was machen die überhaupt?« Moser blinzelte verdrossen zum Wohngebäude, wo aus dem hell erleuchteten Fenster nach wie vor laute Musik und Gelächter schallten. »Da geht’s zu wie in Woodstock. Na ja, besser, als dass die hier rumlungern und hysterisch werden.«
»Ist wer in der Küche?« Butz setzte sich ächzend auf einen der hölzernen Liegestühle. Ein Scharnier knirschte bedenklich. »Ich könnt ein Salamibrot vertragen.«
»Du spinnst komplett«, fauchte Martin. »Mei Geschäft geht den Bach runter, wenn ich Pech hab, und du willst rumfressen. In acht Wochen sollen die nächsten Gäste einziehen, weil dann der Umbau fertig ist. Christian, setz dich auch hin.«
»Also stimmt’s, Martin, dass die Bank dir den Hahn abgedreht hat?«, erkundigte sich Butz.
Samstagnacht, Legau
»Schatzi!«, versuchte Peter Sommer, seine Frau zu wecken. »Dein Telefon. Das Revier!« Vorsichtig tätschelte er Sissis nackte Schulter, woraufhin sie verwirrt in das leuchtende Handydisplay blinzelte und mühsam die Augen öffnete.
»Diese Straßenfeste haben es in sich.« Sissi, eine üppige, attraktive Frau Ende dreißig, quälte sich im Halbschlaf aus dem Bett und gähnte. »Wenn sich nur nicht Erna Dobler selbst eingeladen und mir ihren Zwetschgenlikör angeboten hätte, den ich dumme Nuss auch noch getrunken habe, dann wäre ich beim ersten Summen aufgewacht. Hab’s nicht gehört, tut mir leid, Peter.«
Das Telefon klingelte immer noch. »Sommer?« Ruhig lauschte sie eine Weile. »Oh, die Seniorenresidenz? In Ordnung, Boss. Klaus holt mich ab, oder? Danke.« Dann beendete sie das Gespräch und drehte sich zu ihrem Mann um. »Ist erst halb zwei, könnte dauern, bis ich zurück bin, Süßer.« Aber Peter war schon wieder eingeschlafen und schnarchte selig vor sich hin. »Wäre ich nur gestern Abend verschwunden, als Erna aufgetaucht ist, die und ihr Likör.«
Sissi schwang sich anmutig aus dem Bett und schlüpfte im Dunkeln in eine Jeans. Dann schlich sie, ohne Licht anzumachen, in die blinkende Küche ihres schmucken Einfamilienhauses in Legau. Schon nach drei Schritten stolperte sie und stieß sich den großen Zeh.
»Autsch! Hoffentlich hört das bald auf.« Mit grimmiger Miene tastete sie nach dem Lichtschalter. »Nun bin ich tatsächlich an diesen Presslufthammer gelaufen. Mein Mann betritt einen Baumarkt und kommt zwei Stunden und hundert Euro später mit so einem Krempel nach Hause. Der macht mich wahnsinnig.« Fluchend humpelte sie in die Küche und schaltete schlaftrunken den Kaffeeautomaten ein. Die Zeit genügte für genau eine halbe Tasse Espresso, als es auch schon an der Tür klingelte.
Hastig fuhr sie sich mit zehn Fingern durch das gelockte dunkle Haar, ehe sie öffnete. »Morgen, Klaus, na, anscheinend hat dich der Boss gerade gestört?« Verschmitzt grinste sie ihren Kollegen an, der attraktiv wie eh und je mit missmutigem Gesichtsausdruck vor ihr stand und einen unausgeschlafenen Eindruck machte. »Du hast Lippenstift auf der Backe. Um die Uhrzeit bist du normalerweise schon südlicher bei den Damen.« Nach einem letzten wehmütigen Blick in den aufgeräumten Flur mit dem frischen Strauß Blumen auf der Anrichte verließ Sissi zusammen mit ihrem Kollegen das Haus.
»Ich hätte den Schlaf gut gebrauchen können«, beklagte sie sich, während sie auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Ausgestorben lag die hübsche Siedlung am Rande von Legau im kalten Mondlicht. Nur eine einsame Katze streunte durch die Gärten und schreckte dabei eine brütende Amsel auf, die kreischend schimpfte. »So eine unchristliche Zeit.«
»Ich könnte mir auch was Schöneres vorstellen«, pflichtete Klaus ihr bei, der trotz seines zerknitterten Gesichtsausdrucks immer noch besser aussah als neunzig Prozent seiner Kollegen auf dem Revier und das auch wusste. Mit seiner sportlichen Figur, dem kantigen Kinn und den funkelnden Augen, die unter einem dunklen Haarschopf herausfordernd blitzten, hatte er bei der Memminger Damenwelt freie Auswahl und nützte das weidlich aus. Vor einigen Jahren war er auf eigenen Wunsch, während einer heißen Affäre mit einer hübschen Allgäuer Blondine, von Berlin nach Memmingen versetzt worden. Diese ließ ihn kurz darauf wegen eines reichen Russen sitzen, was Klaus’ Einstellung Frauen gegenüber nachhaltig beeinflusste. Seitdem machte er das Memminger Nachtleben unsicher und kümmerte sich in seiner Freizeit um alleinstehende oder -liegende Damen sowie seinen Hund Harro, eine treue Seele, die er während seines ersten Mordfalls im Allgäu auf dem Schützhof vor einem Dasein als Kettenhund gerettet hatte.
»Bin voll aus dem Schlaf gerissen worden«, stöhnte Klaus. »Ich hatte mich schon hingelegt.«
»Glaub ich sofort.« Sissi lachte. »Was weißt du von dem Fall?« Verwirrt zupfte sie an ihrem T-Shirt herum und schaltete dann die Deckenbeleuchtung ein. »Mist, ich hab tatsächlich versehentlich Peters Polohemd angezogen. Und auch noch verkehrt herum.«
Klaus warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. »Steht dir gut, trotzdem es irgendwie staubig wirkt. Wir müssen zum Moserhof, Leiche im Pool.«
»Moserhof?«, wiederholte Sissi. »Da waren wir letztes Jahr am Tag der offenen Tür. Barrierefreie Luxus-Apartments, Schwimmbad, Sauna, auf Wunsch voll möbliert. Moser hat die Kosten für den Umbau sicher bald schon locker reingeholt. Und da wird ein Tötungsdelikt vermutet?«
»Werden wir gleich sehen. Ein Dr.Butz hat angerufen und es gemeldet.«
»Ach, der Butz.« Sissi musste schmunzeln. »Mit dem hatten wir schon mal zu tun. Der ist recht geradeheraus. Um wen geht es?«
»Männlich, zweiundsiebzig Jahre alt. Ein Norbert Heiler, ursprünglich aus Bad Wörishofen, Hochschuldozent mit Nebenberuf. Mehr weiß ich auch nicht, und das auch nur, weil jemand auf dem Revier ihn kannte.«
»Den kennt hier jeder, sogar ich. Hier bitte geradeaus in Richtung Altusried, Klaus. Wurde der Tote geborgen?«
»Keine Ahnung.« Klaus gähnte nochmals ausgiebig. »Vermutlich wollte keiner von denen nass werden, die ihn gefunden haben. Vielleicht hätte das Chlorwasser ihre Klamotten versaut, die Geld gekostet haben. Sparsamkeit ist ja hier erste Bürgerpflicht zwischen Misthaufen und Maibaum, habe ich gelernt.«
»Ach, du Preuße, hör auf, über uns zu lästern, dir gefällt’s doch bei uns«, tadelte Sissi. »Rechts abbiegen bitte.« Sie zeigte auf ein großes weißes Schild mit der Aufschrift »Moserhof«. Ein großes Stück der Zufahrtsstraße wurde soeben von Kollegen der Spurensicherung abgesperrt. Mehrere Männer schleppten schwere Scheinwerfer und verteilten diese auf dem Grundstück.
»UnserK7– zuverlässig und schnell wie immer.« Klaus nickte anerkennend, als er Seibolds Wagen erkannte. »Da haben die Kollegen zu tun, immerhin ist das abzusuchende Areal recht groß.«
»Komisch, Martin Moser hab ich neulich in Memmingen getroffen, der meinte, alle seine Gäste seien topfit«, sagte Sissi gedankenverloren. »Merkwürdigerweise klang er nicht glücklich darüber. Ich muss mich wirklich mehr um den Dorfklatsch kümmern.«
»Einen Gast kannst du ab sofort ausschließen von wegen ›topfit‹.« Klaus stoppte vor einem großen weißen Gebäude mit aufwendiger Lüftlmalerei und dicht bepflanzten Balkonkästen. In der Mitte des gepflasterten Hofes stand eine mit Lichterketten behangene Platane, um die sich eine hölzerne Bank zog. Der gesamte Parkplatz war voll besetzt mit Streifenwägen und Fahrzeugen der Spurensicherung.
»Nett hier.« Klaus sah sich um. Von irgendwoher waberten Geräuschfetzen durch die Dunkelheit: laute Stimmen, gelegentliches schallendes Gelächter und Musik. »Hörst du das auch?«, fragte er Sissi irritiert.
»Erst zum Pool«, schlug sie vor. »Darum kümmern wir uns später. Liegt ja recht abgeschieden hier, zumindest nerven die niemanden, wenn sie Lärm machen. Vom Tag der offenen Tür weiß ich noch, dass wir über die Sonnenterrasse auch hinkommen, der Weg führt ums Gebäude herum.« Sie zog Klaus mit sich zur Rückseite des Hauses, wo eine hohe Ligusterhecke die mit Granitfliesen gepflasterte Terrasse vor neugierigen Spaziergängern abschirmte. Auch diese war mit Lichterketten behangen.
Klaus schaute sich auf dem Weg zum Pool aufmerksam um. »Charmant, aber Bauernhof bleibt trotzdem Bauernhof.«
»Von wegen. Tiefgarage, Sauna und jede erdenkliche Annehmlichkeit. Den Leuten hier geht es nicht übel. Martin hat sogar einen Shuttleservice eingerichtet, habe ich von Erna Dobler gehört.«
»Oh Gott.« Klaus erschrak. »Lass das bitte, ich zucke schon bei der Nennung dieses Namens zusammen und bin froh, seit der Geschichte mit der Toten im Beichtstuhl nichts mehr von ihr gehört zu haben. Sucht sie dich immer noch regelmäßig heim?«
»Es ist eher mein lieber Mann, den sie besucht«, antwortete Sissi. »Der kommt gut mit ihr klar. Unser Kamin steht für Ernas Landeanflug durchgehend offen.«
Schon von Weitem konnte man die Gruppe von Kollegen erkennen, die in weißen Anzügen ihre Arbeit taten. »Auch schon da?«, grüßte Seibold von der Spurensicherung mürrisch. »Frau Sommer, Sie wohnen in Legau, da hättenS’ ja mit dem Radl kommen können.«