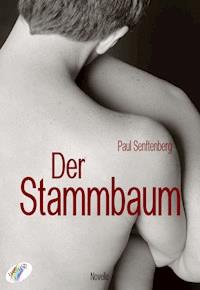Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verbotene Beziehungen und Erpressung in der Weimarer Republik und dem England der Sechzigerjahre, der Kampf gegen unterdrückte Sehnsüchte auf einer Farm im ländlichen Montana von 1925, dramatische Liebesgeschichten in der flirrenden Atmosphäre eines Sommers im nördlichen Italien und einem Badeort in der Normandie der Achtziger; erste Sehnsucht auf der thailändischen Insel Phuket und das Aufbegehren gegen die Engstirnigkeit einer homophoben Gesellschaft im Georgien unserer Tage ...
Paul Senftenbergs neue Essays zu Gänsehautmomenten in schwulen Filmen und Serien erstrecken sich nicht nur von der Zeit, als die Bilder gerade erst laufen lernten, bis zu jüngsten Produktionen, sie behandeln auch eine weite Bandbreite an Motiven und Themen, die mit schwulen Charakteren und ihrem Streben zu tun haben, einen ihnen entsprechenden Platz im Leben zu finden.
Ob liebevolle Reminiszenz oder aufregende Neuentdeckung: Paul Senftenberg hat Filme und Serien aus der ganzen Welt zusammengetragen und beschäftigt sich mit bekannten Streifen wie Call Me By Your Name und The Power of the Dog, aber auch mit historischen Streifen wie dem ersten Film, der Homosexualität ins Zentrum einer Handlung stellte (Anders als die Anderen). Zudem hat er wahre Kleinode wie die südostasiatische Serie I Told Sunset About You entdeckt.
Als "Plädoyer für die Kraft des Kinos" und "wahre Liebeserklärung ans schwule Kino" wurde Gay Movie Moments, der 2017 erschienene erste Band mit den stärksten Szenen aus diesem Genre, in Rezensionen bezeichnet. Mit dem gleichen Feuer brennt Paul Senftenberg auch bei seinen neuen scharfsichtigen Analysen von magischen Momenten. Durch seinen ganz persönlichen, von Enthusiasmus und Ironie getragenen Zugang präsentiert der Autor in More Gay Movie Moments erneut Texte, die unbedingte Lust auf schwule Filme und Serien machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Senftenberg
More Gay Movie Moments
Inhaltsverzeichnis
More Gay Movie Moments
More Gay Movie Moments
Impressum
Autorenvita
More Gay Movie Moments
Aufblende
Verleugnung
Der abwesende Schwule
Beach Rats
Bent
Caracas, eine Liebe
Parasiten der Seele
Closet Monster
Aufbruch
Departure
Blicke ohne Worte
Herzstein
Die Fesseln der Stigmata
Luca
Das Haus unter den rauschenden Bäumen
Man in an Orange Shirt
Es war einmal im Westen …
The Power of the Dog
Von der Schönheit und den Schmerzen der Liebe
Dieses unerreichbare Objekt der Begierde
The Blossoming of Maximo Oliveras
Herzensbrecher
Total Eclipse
Ein Film, ein Liebesgedicht
The Cakemaker
Die Vielgestaltigkeit der Liebe
Call Me By Your Name
Arkadien in Yorkshire
God’s Own Country
Die Schönheit und die Hässlichkeit
Die Hütte am See
Der ruhende Punkt im Drehen der Welt
I Told Sunset About You
I Promised You the Moon
Vertreibung aus dem Paradies
Kater
Vom Flüstern, vom Schreien und vom Schweigen
Loev
Der Kuss der Küsse
Matthias & Maxime
Die Starken
Tatsächlich Liebe
Please Like Me
Sie schlugen und sie küssten sich
Shameless
Vom Festhalten des Augenblicks
Sommer 85
Eine Reise durch die Nacht
Théo & Hugo
Die Zeit des Kämpfens, die Zeit der Niederlage
Stille bedeutet Tod
120 BPM
An den Rand gedrängt und darüber hinaus
01:54
Marilyn
Tom Ripleys Wiederkehr
The Assassination of Gianni Versace
The Price You Pay
Anders als die Anderen
Große Freiheit
Weiße Elche
Don’t Ever Wipe Tears Without Gloves
Von der Schwere der Wiederkehr des Gleichen
For My Brother
Liebe ohne Namen
The Happy Prince
Oscar Wilde
Der Tag und die Stunde
Jonathan
Die Dunkelheit um uns, die Dunkelheit in uns
Lawrence von Arabien
Der Löwe im Winter
Liebesverbot
Mario
Berührungen
Moonlight
Die Verstrickungen der Identität
Sag nicht, wer du bist
Verdächtige
Der Teufelskreis
Die Schmerzen des Übergangs
Die Wunde
Vom Aufheben der Grenzen
Die neuen alten Leiden der jungen Männer
Alles wegen Benjamin
Circus of Books
Giant Little Ones
Handsome Devil
Mit siebzehn
Sprache, die aus dem Innersten kommt
Als wir tanzten
Aussicht auf Stille
A Bigger Splash
Der Blick durch den Riss
Flesh
Des Menschen Würde
Four Moons
Lieb und Leid und Welt und Traum
Leid und Herrlichkeit
Das Kind im Spiegel
Marvin
Von Liebe und Freundschaft
Mein bester Freund
Der Lover im Sarg
Sterben für Anfänger
Irrfahrt
Xenia – Eine neue griechische Odyssee
Abblende: Stolz
Register
Programm
Gay Movie Moments
Hände
Der Stammbaum
Paul Senftenberg
More Gay Movie Moments
Neue schwule Gänsehautmomente in Filmen und Serien
1. Auflage
© 2023 HOMO Littera Romy Leyendecker e. U.,
Am Rinnergrund 14/5, 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
Email: [email protected]
© Paul Senftenberg, More Gay Movie Moments
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
ISBN Print: 978-3-99144-004-8
ISBN PDF: 978-3-99144-005-5
ISBN EPUB: 978-3-99144-006-2
ISBN PRC: 978-3-99144-007-9
Über den Autor
Paul Senftenberg ist ein niederösterreichischer Autor. In seinen Büchern beschäftigt er sich mit der Selbstfindung von schwulen Jugendlichen und Männern, die sich gefangen fühlen zwischen bürgerlichem Leben und ihren wahren Neigungen. Immer wieder spielen in den Geschichten auch Referenzen zu Filmen eine wichtige Rolle.
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Der Stammbaum (Novelle, 2014)
Hände (Roman, 2015)
Gay Movie Moments (Sachbuch, 2017)
Informationen sowie Texte und Rezensionen zu weiteren Filmtiteln auf: www.paulsenftenberg.at
„We as gay people find ourselves enmeshed in a culture that studiously ignores us or radically misrepresents us; thus, in order to compensate for what the culture withholds from us, we appropriate it (in fantasy, in subculture) and make it say what we need it to say.“
Patrick E. Horrigan, Widescreen Dreams
Aufblende: Blicke
Diesmal begann alles mit einem Blick. Nicht mit einem aus Bette Davis’ von Kim Carnes so poetisch besungenen Augen, sondern mit dem des von Timothée Chalamet verkörperten Elio, der, selbstvergessen und mit dem Schicksal der unglücklichen Liebe hadernd, ins flackernde Licht eines Kaminfeuers starrt.
Meine Anspielung auf die herzzerreißende Schlussszene von Call Me By Your Name ist wohl offensichtlich. Was sich in diesen über vier ungeschnittenen Minuten im Gesicht und darin primär in den von Tränen glänzenden Augen des ungemein talentierten jungen Schauspielers abspielt, sucht in Bezug auf die Tiefe von ganz widersprüchlichen Gefühlen seinesgleichen – dem Glück, echte Liebe gefunden, und der Traurigkeit, diese Liebe wieder verloren zu haben. Auch in meiner Brust wohnten zwei Seelen. Ich verspürte Freude, an dieser grandiosen Szene in Luca Guadagninos wunderbarer Verfilmung von André Acimans nicht minder gelungenem gleichnamigem Roman teilhaben zu dürfen, auf der anderen Seite Unzufriedenheit, nicht in der Lage gewesen zu sein, sie in die Reihe der Gänsehautmomente in Gay Movie Moments aufgenommen zu haben – schlichtweg aus dem Grund, dass der Reaktionsschluss für das Buch in seiner ersten Auflage lang vor dem Erscheinungstermin des Films lag.
„…With one look/I put words to shame/Just one look/Sets the screen aflame …“ In ihrer großen Arie beschwört Norma Desmond, der ehemalige Stummfilmstar in Andrew Lloyd Webbers Musicaladaption von Billy Wilders Boulevard der Dämmerung (Sunset Boulevard, 1950) ein letztes Mal ihre große Zeit herauf, als es nicht Worte, sondern Augen und Blicke waren, die Filmszenen zum Leben erweckten. Sie weiß um die damalige Wirkung ihrer Ausstrahlung: „One tear from my eye/Makes the whole world cry.“ Im Fall von Elios Blicken ins Feuer war mir gleich bewusst, dass ich über diese Szene und den Film schreiben würde, und wäre es auch nur für mich selbst. Dieser erste Filmtext gab den nächsten, und ohne zu diesem Zeitpunkt an die Möglichkeit eines zweiten Bandes mit meinen Essays über schwule Streifen auch nur zu denken, geriet ich abermals in den Bann großer filmischer Momente aus neuen Produktionen und älteren, die ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt hatte. Dass daraus eine solche Vielzahl an Texten würde, die dieses vorliegende Buch mit dem Titel More Gay Movie Moments füllen, hätte ich am Startpunkt meiner neuerlichen Expedition in die Schätze des schwulen Films nicht gedacht.
Das Resultat von drei Jahren Arbeit liegt nun in Form von Essays zu rund fünfzig Filmen und Serien vor; sie verdienen hoffentlich mehr als einen flüchtigen Blick, so wie die Szenen, die sie analysieren, es definitiv wert sind, mit all der Lust und Hingabe betrachtet zu werden, die diese Themen, diese Geschichten und ganz besonders natürlich die Charaktere verdienen, die zu jenem filmischen Leben erweckt werden, zu dem wir im besten Fall so etwas wie einen persönlichen Bezug finden.
Im Nachwort zu der unter dem Titel How to Write an Autobiographical Novel (2018; Wie man einen autobiografischen Roman schreibt) veröffentlichten Sammlung von Essays des amerikanischen Autors mit koreanischen Wurzeln Alexander Chee interpretiert Daniel Schreiber dessen Texte als „safe space“, als sicheren Raum für den Autor und seine queeren Leser:innen, der ihnen die Gelegenheit schenke, ihren vielen möglichen Ichs nachzuspüren und herauszufinden, wie es sich anfühlen könnte, die Masken zu tragen, die das Leben ihnen bietet – mit ihnen zurechtzukommen und vielleicht die richtige für sich selbst zu finden.
Chees beste Essays, so Schreiber, würden „die queeren Heranwachsenden in uns ansprechen, die sich in der Bibliothek verstecken und in Büchern Antworten auf die Fragen suchen, wie sich dieses schwierige Leben gestalten lässt.“ Oder – gespiegelt auf das Thema von schwulen Filmen – eben in einem dunklen Kinosaal, auf dessen hell erleuchteter Leinwand wir in die Seele von Protagonisten blicken, die der unseren ähnelt.
Ums Leben und Überleben inmitten von Gesellschaften, die dafür keine Vorbilder geben können, dreht sich auch der – thematisch nicht queere – Film All Day and a Night (2020), eine düstere Milieustudie von Joe Robert Cole, dem Co-Autor von Black Panther. Anhand der Geschichte eines jungen Schwarzen namens Jahkor, dargestellt von Ashton Sanders, den wir aus dem Oscar-Gewinner Moonlight kennen, befasst sich die Handlung mit Themen wie alltägliche Gewalt und soziale Verwahrlosung. Jahkor gerät in einen Bandenkrieg und wird wegen Doppelmordes zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Seine zynisch anmutende Selbstreflexion lässt uns aufhorchen: „Die Sklaverei hat Schwarzen Überleben beigebracht, aber nicht, wie man lebt – und das geben wir einander weiter.“ Dieses Narrativ, das Rassismus verhandelt, kann auf Homophobie umgelegt werden, ecken die Lebensentwürfe so mancher Betroffener doch oftmals an der Engstirnigkeit dessen an, was sich als Mainstream im alleinigen Besitz von Regeln und Wahrheiten wähnt.
In der Erfahrung von Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber dem Weg jenseits heteronormativen Verhaltens, so desgleichen Alexander Chees Schlussfolgerung, werde man vielleicht auch „menschlicher“ gegenüber sich selbst. Von der Gefahr des Selbsthasses zur Akzeptanz des eigenen Ichs: In der Entdeckung unseres Selbst waren es vor anderen Menschen für viele von uns Bücher, Filme und Serien, die uns diese ganz spezielle Form von Liebe entgegenbrachten, die das Ich im Wir zu stärken vermag.
„Die einzige Freude auf der Welt ist das Anfangen. Es ist schön zu leben, weil Leben Anfangen ist, immer, in jedem Augenblick“, hat der italienische Schriftsteller Cesare Pavese einmal gesagt. Bezugnehmend auf die Arbeit an More Gay Movie Moments traf für mich die Freude zu, wieder mit dem Schreiben über Gänsehautmomente in schwulen Filmen und Serien begonnen zu haben; am Anfang jedes Textes stand ein Film, stand das Staunen über die so unterschiedlichen Herangehensweisen an eine Figur und ihre Geschichte, die die Kreativität der Beteiligten an jenen Streifen auszeichnen, die Eingang in diese Sammlung gefunden haben. Die Freude zu Beginn, aber auch die Freude, beim näheren Betrachten Neues, Fesselndes, Faszinierendes zu entdecken – diese Entdeckungen dann in die Sprache meiner Essays zu fassen, hat mich durch die gesamte Arbeit an dem Buch begleitet.
Noch ein Wort zu Zitaten und der Art und Weise, wie wir sie in diesem Buch anführen. Es steht außer Frage, dass allein die Originalversion eines Films dessen Atmosphäre authentisch zu vermitteln weiß. Man muss ja nicht so weit gehen wie beim Beispiel der Verstümmelung von Hitchcocks berühmtem Thriller Notorious (1946) mit Ingrid Bergmann und Cary Grant, der 1951 unter dem Titel Weißes Gift (später: Berüchtigt) in einer deutschsprachigen Kinofassung herauskam. Da man so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dem Publikum keine Nazigeschichte zumuten wollte, wurden sämtliche diesbezügliche Referenzen entfernt und durch den Handlungsfaden einer Drogenstory ersetzt. Doch auch schlechte Synchronisation und – im Fall von schwulen Filmen wird oftmals in keine deutsche Fassung investiert – gar nicht so selten unkorrekte Untertitel vermitteln die Gewissheit, in der jeweiligen Originalversion besser aufgehoben zu sein. Für zusätzliche Verwirrung mögen zuweilen beträchtliche Diskrepanzen zwischen Untertiteln und Auszügen aus Drehbüchern oder Zitierungen sorgen, die im Internet allenthalben aufzuspüren sind. Aus diesen Gründen haben wir uns wie im ersten Band dazu entschlossen, wörtliche Zitate, wann immer möglich, im Original zu belassen – dies scheint uns in erster Linie, weil wohl weitgehend verständlich, in Bezug auf die englische Sprache zielführend und möglich zu sein. Da diese Annahme aber natürlich nicht auf weitere Sprachen ausgedehnt werden kann, haben wir Zitate aus anderssprachigen Büchern in der deutschen Übersetzung und aus Filmen, deren Originalversion abseits von Deutsch oder Englisch gedreht wurde, mangels praktikabler Alternativen in der deutschen Version der Untertitel verwendet.
Doch genug der Theorie. Löschen wir wie schon beim ersten Mal die Lampen im Saal und folgen wir mit unseren Augen voller Spannung dem Lichtstrahl, der auf die Leinwand fällt und sie mit dem Leben magischer schwuler Filmmomente erfüllt. Denn jede neue Geschichte beginnt mit einem Blick.
Paul Senftenberg, im März 2022
Verleugnung
Der abwesende Schwule
Beach Rats (2017)
Bent (1997)
Caracas, eine Liebe (2015)
Die amerikanische Schriftstellerin Lorrie Moore hat den von ihr so bezeichneten „Trost der Masken“ wie folgt definiert: „Wenn man sich einen Raum außerhalb des eigenen Lebens schafft, für das Leben, das im eigenen Leben keinen Platz hat, für alles aus dem Gedächtnis Verbannte.“ Es scheint, als würden die Charaktere des bedeutenden Theaterautors Tennessee Williams solche Masken tragen und ins weite Land ihrer zerrissenen Seelenlandschaften dahinter verbannen, was zu akzeptieren sie nicht über sich bringen. Messerscharfe Dialoge zerschneiden in diesen psychoanalytischen Achterbahnfahrten durch die Hölle von Hoffnungslosigkeit und leeren Existenzen die Seelen jener Figuren, denen sie Williams in den Mund legt, ebenso wie jener anderen, an die sie gerichtet sind. Viel deutlicher, als in ihren mit Stars wie Liz Taylor, Katharine Hepburn, Paul Newman und Marlon Brando prominent besetzten filmischen Adaptationen, die sich aufgrund der Angst vor der Zensur des „Hay’s Code“ seltsam zahnlos gerieren, wird in den Bühnenfassungen das zur Zeit ihrer Entstehung noch absolute Tabuthema der Homosexualität deutlicher, wenngleich immer noch nicht dezidiert fokussiert. Vergewaltigung und Mord, Alkoholismus und Drogensucht, Kastration und sogar Kannibalismus sind nur einige der Themen in Williams’ Stücken – doch mit der zentralen Darstellung schwuler Charaktere, zumal in positiver Konnotation, hätte sich der Pulitzerpreisträger und Meister im Sezieren von hinter Masken verborgener Wahrheiten wohl eine Blöße gegeben, die in den Vierziger- und Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wohl zum Entzug der Gunst eines breiten Publikums geführt hätte.
In diesem Sinne beschreibt der Literaturwissenschaftler William Mark Poteet in seiner Analyse Gay Men in Modern Southern Literature (2006) als Konstante in Williams’ dramatischem Personal die sogenannten „absent gay men“. Diese abwesenden, meist toten Schwulen stehen nicht als Personen auf der Bühne – und bestimmen den Verlauf der Handlung und die Befindlichkeit und Entwicklung der Figuren doch entscheidend. Die Charakterdreiecke dieser Stücke sind um diese abwesenden Schwulen gewoben, und ihre Geister suchen die Lebenden geradezu heim. So nimmt Allan, der sich in A Streetcar Named Desire (Endstation Sehnsucht, 1947) erschießt, nachdem seine Frau Blanche seine Homosexualität entdeckt, in der Rekonstruktion durch diese und ihrer Schwester Stella teil am Verlauf des Stücks. In vergleichbarer Hinsicht erfahren wir vom brutalen Lynchmord an Sebastian in Suddenly, Last Summer (Plötzlich letzten Sommer, 1958) durch die Erinnerungen seiner Cousine Catherine und Mutter Violet. Und Skipper in Cat on a Hot Tin Roof (Die Katze auf dem heißen Blechdach, 1955) stirbt durch seine Alkoholsucht, nachdem ihm die Wahrheit seiner Gefühle für seinen Jugendfreund Brick klar wird.
Wirklich offen gesprochen wird über diese Männer, die noch aus der Vergangenheit die Gegenwart im Griff haben, nicht; hingegen umkreisen sie die Gedanken der anderen gepeinigten Figuren in geradezu magnetischer Anziehung. So ist es das ungeschriebene Gesetz, Stillschweigen über Bereiche zu bewahren, in denen gefährliche Untiefen des Uneingestandenen und Verleugneten lauern. Die Angst vor Heimsuchungen aus diesem Bereich des von Sigmund Freud bis Stephen King immer wieder verhandelten „Es“ ist es etwa auch, die offene Worte in der Ehe von Brick und seiner Frau abwürgen – Verletzlichkeit, unerfüllte und unerfüllbare Begierden und die Angst vor der Realität haben aus Brick einen Alkoholiker und aus der doch eigentlich verführerischen Maggie jemanden gemacht, der sich wie die im Titel des Stücks angesprochene Katze fühlt, die in der Beziehung zu ihrem Mann jede Selbstachtung verloren hat: „What is the victory of a cat on a hot tin roof? Just staying on it. […] I guess, as long as she can.“
Skipper lauert als unausgesprochene Heimsuchung zwischen den Eheleuten – der Fluch einer Enthüllung, die die Lebenslügen in dem kaum noch aufrechten Gebäude ihrer Ehe zum Einsturz bringen könnte. „Brick’s homosexuality must remain clouded in secrecy“, drückt es Poteet aus, „but it must still be expressed.“ Williams’ textimmanente Symbolik ist aus einer Zeit ihrer Entstehung zu verstehen, in der ein deutlicheres Ansprechen der Thematik eben selbst für einen so berühmten Autor nicht möglich war. Der Anglistikprofessor Thomas P. Adler fasst ihren Kontext denn auch kurz und bündig zusammen: „Williams encodes his own same-sex desire.“
Vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem abwesenden Schwulen und dem literarischen und filmischen Charakter einer Geschichte auch um ein und denselben Menschen handeln kann, möchte ich drei Filme betrachten. Sie zeichnen jeweils ein Dreiecksverhältnis und den Aufruhr, den die Verleugnung des schwulen Selbst darin verursacht – wenn nämlich die verstörte Psyche das Andocken der Gefühle verhindert. Die gedankliche Materialisierung des „absent gay guy“ mag in einer Umarmung dieser Seite der eigenen Existenz oder in ihrer Zurückweisung, in Selbsterkenntnis oder Selbstverleugnung münden, in jedem Fall jedoch steht die Frage im Vordergrund, inwiefern sich der Protagonist auf die Schattierungen der eigenen Persönlichkeit einzulassen wagt. „Man hasst das, was man fürchtet, das also, was man sein kann, was man, wenn man fühlt, ein wenig ist“, hat der italienische Schriftsteller Cesare Pavese einmal formuliert und zieht die Schlussfolgerung: „Man hasst sich selbst.“ Versiegelte Gefühle und wie sie losbrechen – eine filmische Erkundungsreise.
Der erste dieser drei Männer in der Verleugnung ihrer schwulen Identität ist der Teenager Frankie in Eliza Hittmans Beach Rats. Er verbringt den Sommer, in dem sein Vater an einer schweren Krankheit stirbt, zwischen dem Familienleben am Stadtrand von Brooklyn und den Stränden und dem Vergnügungspark auf Coney Island, wo er mit seinen Kumpels abhängt und vordergründig auf der Suche nach einer Freundin, in Wahrheit aber nach sich selbst ist. Der Darsteller von Frankie, Harris Dickinson, ist fast zu schön, um wahr zu sein, und macht doch mit seiner großen physischen und psychischen Präsenz die Unsicherheit und Verunsicherung seines Charakters als in seinem unausgesprochenen Gefühlsleben verlorener Junge nachvollziehbar.
Frankie und seine Gang, allesamt solch ziellos treibende, verlorene Jungen – das ist vergleichbar mit J. M. Barries Bühnenstück Peter Pan (1906) und dessen Romanversion sowie der Adaptation durch Disney und andere Filmemacher wie zum Beispiel auch Steven Spielberg (Hook, 1991). Peter und die „Lost Boys“ leben in völliger Freiheit ohne die Aufsicht durch ihre Eltern oder andere Erwachsene auf ihrer Insel in Neverland; echte Ziele gibt es in ihrem Leben scheinbar nicht. Frankies Neverland ist der Pier von Coney Island; das Feuerwerk, das es dort an jedem Wochenende zu bestaunen gibt, kann ihn aber nicht begeistern, es scheint immer gleich abzulaufen und wirkt für ihn so schal wie seine ganze Existenz. Frankie vermittelt nicht den Eindruck, als würde er sich selbst und seine Umgebung intensiv spüren. Er zieht mit anderen Burschen herum, die sich im Umgang miteinander gegenseitig ständig ihrer Coolness und Stärke versichern müssen und die alles, aber nur nicht ehrlich zueinander sind. Sie rauchen, konsumieren Alkohol und Drogen – eine Taktik, so hat es den Anschein, um die Zeit totzuschlagen, das Jetzt zu vernebeln und die Leere und Langeweile ihrer Lebensrealität auszublenden. Was zumindest in Frankies Fall wohl auch mit seiner Selbstverleugnung zu tun hat. „I don’t think of myself as gay“, versichert er noch im fortgeschrittenen Handlungsverlauf der zweiten Hälfte des Films einem älteren Mann – nachdem sie gerade Sex hatten. Nächtens flirtet Frankie online mit Männern und trifft sich ab und zu mit einem von ihnen in einem Cruisinggebiet an der Autobahn. Dabei fallen auch schon mal Dialoge wie „Do you like what you see?“ – „I don’t really know what I like.“ Es ist offensichtlich: Da gibt sich jemand große Mühe, die Fassade des heterosexuellen Jungen aufrechtzuerhalten, und wird doch gleichzeitig von Versagensängsten beim Sex mit einem Mädchen geplagt, das er als seine Freundin ausgibt.
Wenn Frankie zusammen mit seinen Kumpels einen Schwulen überfällt, um an Drogen zu kommen, handelt er im Grunde genommen gegen sein eigenes Ich, und im Verlauf der Handlung fällt es ihm immer schwerer, sein Doppelleben geheim zu halten. Er weiß nicht genau, wonach er sich eigentlich sehnt, es gelingt ihm nicht, die unbestimmten und widersprüchlichen Gefühle in seinem Herzen festzumachen. Was ihn davor wohl hindert, ist die geradezu panische Angst vor der Einsicht in sein wahres Selbst.
Wie mit Beiläufigkeit erzählt Regisseurin Hittman von Frankies Orientierungslosigkeit, sie ist jedoch ganz genau im Hinschauen und in der Analyse der inneren Zerrissenheit des jungen Mannes und der Anstrengungen, die es ihn kostet, sie nach außen hin zu verdecken. Mit seinen traurigen blauen Augen, dem verschlossenen Gesichtsausdruck und den zusammengepressten Lippen versucht Frankie, sich seine unterdrückten Emotionen, die Verwirrtheit, die Wut, die Angst, nicht anmerken zu lassen; doch sie drohen hochzukochen und auszubrechen.
Wie es für sie sei, wenn zwei Frauen miteinander rummachen, tastet er sich einigen Mädchen gegenüber vor. Die Antwort: Das sei heiß. Und, setzt er nach, wie es sich bei zwei Jungen verhalten würde? „It’s not hot“, meinen die Mädchen, „it’s just gay.“
Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, bekannt für seine Affinität zu kreativer kinematografischer Analyse, vergleicht in seinem dokumentarischen, mit unzähligen Beispielen gespickten Filmessay The Pervert’s Guide to Cinema (2006) den dreigeschoßigen Aufbau des düster-gotischen Hauses aus Alfred Hitchcocks Klassiker Psycho (1960) und damit verbunden auch die gespaltene Persönlichkeit des Serienmörders Norman Bates mit Freuds bereits angesprochener Theorie von „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“. Der Ebene des „Ich“ entspricht darin Normans alltägliches Leben im Parterre des Hauses, aus dem ersten Stock kommen die imaginierten Kommentare der eigentlich längst toten Mutter, der übergeordneten Instanz des „Über-Ichs“ mit ihren Regulativen und gesellschaftlichen Vorgaben, gegen die Norman in den Disputen, die ebenfalls nur in seiner Vorstellung ablaufen, nur den Kürzeren ziehen kann. Im Keller aber lauern seine geheimen Wünsche, die verdrängten Sehnsüchte und auch Ängste, die er in den Bereich des „Es“ verbannt zu haben glaubt, seines Unbewussten also, aus dem sie immer wieder unvermittelt und mit drastischen Folgen – der legendäre Mord in der Dusche lässt grüßen – hervorzubrechen pflegen. Nicht zuletzt verwendet die imaginierte Stimme der toten Mutter, als Norman den Leichnam von ihrem Schlafzimmer in den Keller trägt, das Vokabel „fruity“ – früher ein abwertender Ausdruck für homosexuell.
Die Komponenten dieses Gedankengangs lassen sich auch in Beach Rats festmachen. Zu ebener Erde und erster Stock lautet der Titel einer als solche bezeichneten „Localposse“ von Johann Nestroy aus dem Jahr 1835. Die Trennung funktioniert auch in Frankies Elternhaus: Das „normale Leben“ mit seiner Mutter und der Schwester läuft hier ab, hier stellt ihnen Frankie auch ein Mädchen, das er in Coney Island kennengelernt und bei ihm die Nacht verbracht hat, als seine Freundin vor. Zu dieser Ebene steigt die Mutter als übergeordnete Instanz aus ihrem Schlafzimmer im ersten Stock herab, die sie als Oberhaupt der kleinen Familie darstellt. Wir wollen nicht übersehen, dass der heterosexuelle Geschlechtsverkehr, durch den nicht zuletzt Frankie entstand, wohl dort oben stattfand. Aufgrund seiner Krebserkrankung wurde der im späteren Verlauf des Films verstorbene Vater aus diesem dezidiert heterosexuell und regulativ konnotierten Lebensraum verbannt und sein Krankenbett mit den medizinischen Geräten im Erdgeschoß in einem Zimmer aufgestellt, das zu betreten Frankie sich zu Beginn von Beach Rats überwinden muss. Als dritte Ebene dient auch hier der Keller, Frankies Reich in diesem Haus. Hier erlebt er die Versagensängste beim Sex mit seiner vorgeblichen Freundin. So viel Mühe sich Frankie auch gibt, im Bereich seines ins Unterbewusste verdrängten Selbst scheint eine weibliche Sexpartnerin keinen Platz zu haben. Hier im Keller kommt er per Videochat – anfangs noch schüchtern, dann aber immer selbstsicherer – auch Männern näher: Sein Herantasten an den schwulen Mann, der in ihm lebt, findet demnach eindeutig im Keller des Gebäudes, Žižeks Interpretation von Psycho folgend also in seinem „Es“, statt. Wenn in einer späteren Szene des Films Gefahr droht, dass sein Doppelleben nicht mehr geheim gehalten und sein wahres Ich entdeckt werden könnte, löscht er panisch alle Computerdaten, die auf seine Homosexualität hindeuten könnten – es ist, als würde ein Verbrecher einen Tatort reinigen.
In seinem Erfolgsroman Swimming in the Dark (2020) beschreibt Tomasz Jędrowski in einer stimmungsvollen Szene, wie sich Ludwik und Janusz, die beiden Protagonisten, im konservativen Polen zur Zeit des Kriegsrechts auf einer abgeschiedenen Lichtung an einem Waldsee zum ersten Mal näherkommen. „I looked at the water, I couldn’t see through its body, couldn’t assess its contents. But I stepped in. And the water embraced me completely, softly and coolly. I felt myself anew, as if something in me had been switched on after a long time. It was a sensation of lightness and power and total inconsequence.“ Auch diesen beiden Burschen fällt es offensichtlich nicht leicht, den schwulen Mann in sich selbst zu akzeptieren. Ins dunkle Wasser zu steigen, dessen Grund nicht auszumachen ist, also sich der Umarmung der Sehnsüchte aus ihrem Unterbewussten preiszugeben, ohne die Folgen abschätzen zu können, macht ihnen Angst. Doch die Vorstellung in die Tat umzusetzen, zahlt sich aus: Das Gefühl im Wasser des Sees, das fast einer Wiedergeburt gleichkommt, erleichtert ihnen, den für sie vorbestimmten Weg zu gehen. Es kommt zur ersten Umarmung und zum ersten Kuss und ist der Beginn einer dramatischen Liebesbeziehung. Der bereits im Vorwort angeführte Autor Alexander Chee beschreibt die Problematik für viele junge Schwule, ihren Platz im Leben zu finden, in seiner Sammlung von Essays Wie man einen autobiografischen Roman schreibt sehr treffend: „Es ist nicht einfach, sich selbst und sein Leben in einer durch und durch heterosexualisierten Welt neu zu erfinden. Vor allem, wenn man, wie es lange der Fall war, keine Vorbilder hat, niemanden, der einem vorlebt, wie man ein queeres Leben in einer Welt führt, die dafür keinen Platz vorgesehen hat.“
Beach Rats entwickelt für diesen mitunter schwierigen Prozess eine unmittelbare, sehr direkte Herangehensweise. Düster, verträumt, poetisch, sinnlich, zärtlich ist der Ton der Erzählung, wenn wir Frankie auf seiner Suche nach sich selbst begleiten. Es gibt kein klares Happy End in diesem Film, doch in den letzten Einstellungen scheint mir, als wäre Frankie fast an diesem Punkt angekommen. Er befindet sich wieder auf dem Pier, im nächtlichen Himmel über ihm explodiert das Feuerwerk. Um ihn herum sind viele Menschen, die Lichter und der Lärm des Vergnügungsparks, und doch ist Frankie wie herausgeschält aus dieser Umgebung. Er starrt in den Himmel, als ob er das Feuerwerk zum ersten Mal sehen würde, er erblickt es mit anderen Augen, weil er nur noch um Haaresbreite davon entfernt ist, ein neuer Mensch zu sein – jemand, der den schwulen Mann in sich nicht tot sehen will, der die Chance hat, sich mit ihm und dadurch mit sich selbst zu versöhnen.
Ein Charakteristikum von Beach Rats ist der respektvolle Abstand, den die Augen der Kamera mit großer Stringenz halten, sie scheinen Frankie nie zu nahe treten zu wollen, sie beobachten nur und zeichnen auf, was sie sehen.
Auf eine sehr vergleichbare Weise arbeitet der venezolanische Regisseur Lorenzo Vigas in seinem mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichneten Spielfilmdebüt Caracas, eine Liebe – und stellt wie auch Eliza Hittman in Beach Rats den Beweis an, dass mit Behutsamkeit eine große Nähe zu den Figuren und eine ebensolche Tiefe zu ihrem Innenleben herzustellen möglich ist. Wir müssen bei einem Film wie Desde allá (Von fern, von Weitem), wie Caracas, eine Liebe weitaus treffender im Original heißt, eben vieles zwischen den Zeilen lesen. Der Streifen basiert auf einer Geschichte des mexikanischen Autors Guillermo Arriaga, der durch seine Drehbuchvorlagen zu Amores Perros (2000) und Babel (2006) internationale Wertschätzung errang, und zerlegt wie sie die Handlung in ein Puzzle aus einer Vielzahl von Steinchen, die zusammenzusetzen an uns liegt – der Film selbst gibt uns dazu bloß einige Hinweise.
Wir begleiten den einzelgängerischen Zahntechniker Armando auf seinen Streifzügen durch verarmte Viertel von Caracas. Seine Suche nach Straßenjungen hat fast den Charakter einer Jagd, er befindet sich sozusagen auf der Pirsch nach „frischem Fleisch“; und wenn sich Armando für einen der Burschen entschieden hat, geht er durchaus forsch zur Sache. Gegen Entgelt müssen sie ihn in seine gediegene Wohnung begleiten, die ganz im Gegensatz zu den ärmlichen Lebensverhältnissen dieser Burschen steht. Sie müssen sich halb oder ganz ausziehen und ihm den Rücken zukehren, während er sich selbst befriedigt. Dabei hält er zu ihnen jene Distanz, die offenbar sein gesamtes Leben kennzeichnet – er scheint zu allem und jedem auf eine sichere Entfernung bedacht. Armando tritt zu Beginn des Films aus der Unschärfe ins Bild und bewegt sich wie ein Gespenst durch die Straßen der Stadt, die so wie die Menschen um ihn herum in Unschärfe zerfließen. Wie einer der Figuren in Gus Van Sants Elephant folgen wir Armando und erleben die soziale Distanz zwischen ihm und seiner Umwelt mit. Er fühlt sich offenbar nirgendwo und niemandem zugehörig, und dieses Verhalten prägt sein Leben und die spärlichen sozialen Kontakte darin. Schweigen durchzieht den Film wie ein roter Faden, lange Blicke ersetzen viele Dialoge. In Armandos Augen liegen tiefe Verletztheit und große Vorsicht, Alfredo Castros minimalistisches Spiel setzt nur ab und zu Akzente in dieses unergründliche Gesicht; für kurze Momente fällt dann die Maske der äußersten Zurückhaltung.
Bei seiner beruflichen Tätigkeit muss Armando ganz genau hinschauen, er trägt dabei eine Brille, vor deren Gläsern eine Lupe hängt. Die Welt um sich nimmt er aber nur verschwommen wahr, und so verhält es sich wohl auch in Bezug auf ihn selbst. Wie Frankie in Beach Rats ist er der abwesende Schwule in seinem eigenen Leben und hat noch keinen Zugang zu diesem Teil seines Ich gefunden. Als er den siebzehnjährigen Elder (Luis Silva) kennenlernt, bricht die Chance auf etwas ganz anderes auf: auf Offenheit, auf Intimität, auf eine echte zwischenmenschliche Beziehung. „Was willst du von mir, alte Schachtel?“, herrscht Elder Armando anfangs an. Zwischen ihnen wird sich ein seltsames Verhältnis zwischen Anziehung und Verachtung, Begierde und Abscheu entwickeln, dessen Ausmaß und Intensität uns bis zum bitteren Ende ein Rätsel bleiben wird.
Kommen wir zum oben zitierten Text von Alexander Chee über die Schwierigkeiten schwuler Selbstfindung inmitten einer heterosexualisierten Welt und die Rolle von positiven queeren Vorbildern zurück. Darin zieht der Autor den folgenden Schluss: „Erst heute, fünfzig Jahre nach den Stonewall-Aufständen und dreißig Jahre nach dem Höhepunkt der Aids-Krise, gibt es eine Generation schwuler Männer, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen offen und frei an die nächste Generation weitergeben kann.“ Mit seinem Alter um die fünfzig wäre Armando einer dieser Männer, doch mit dem Weitergeben läuft bei ihm nichts. Im Gegenteil, Armando sucht zwar immer wieder Elders Nähe, verweigert sich aber jeder emotionalen Tiefe und liefert Elder schließlich ans Messer. Bei ihrem ersten Treffen beschimpft Elder Armando noch als „Schwuchtel“, schlägt ihn bewusstlos und raubt ihn aus. Doch Armando lässt nicht locker, er lädt den jungen Mann zum Essen ein und unterstützt ihn finanziell. Als Elder von den Brüdern seiner schwangeren Freundin krankenhausreif geprügelt wird, kümmert sich Armando um seine medizinische Versorgung. Was folgt, ist ein Lernprozess, durch den die beiden so unterschiedlichen Männer im Kampf um das Ausreizen ihres gegenseitigen Vertrauensverhältnisses und um das fragile Gleichgewicht gegenseitiger Würde gehen: ob sie voneinander lassen oder einander doch annehmen können, wie sie sind. Elder bricht Armandos Safe auf und wirft ihm, als er von ihm überrascht wird, den Schmuck vor die Füße: „Ich bin vielleicht eine Ratte, aber keine Schwuchtel wie du!“ Nach einer neuerlichen Beschimpfung durch den Jüngeren rammt sich Armando als Männlichkeitsbeweis ein Messer in den Oberschenkel. Doch zusehends wird offensichtlich, dass das, was Elder für Armando empfindet, Liebe ist; und jetzt kommt Armandos Vater ins Spiel. „Dein Vater ist tot?“, will Elder von Armando wissen. Die Antwort: „Nein, aber ich wünschte mir, er wäre es.“
Wir erfahren bis zum Schluss des Films nicht, welche traumatischen Erlebnisse aus seiner Kindheit Armando immer noch heimsuchen und welche Rolle dabei sein Vater gespielt hat. Es braucht eine Weile, bis wir die Mosaiksteinchen, die uns der Film vorgibt, zu dem Fokus zusammenzusetzen vermögen, der uns den Weg zu den sperrigen Charakteren und ihrem zuweilen rätselhaften Verhalten weist. Dabei bleiben Armandos Gefühle bis zuletzt so rätselhaft, wie sie zu Beginn des Films schon waren. Doch die Dramaturgie des Streifens leidet nicht unter diesen Leerstellen, sie setzen die Charakterstudien von Armando und Elder unter geradezu elektrische Spannung. Als Elder Armando auf einer Hochzeit, zu der er ihn eingeladen und bei der er ihn seiner Mutter als Geschäftspartner vorgestellt hat, auf der Herrentoilette leidenschaftlich küsst, wird er von diesem geohrfeigt und brüsk zurückgewiesen. „Was machst du da? Komm mir nicht zu nahe!“ Elders Mutter, durch Tratsch mit der Realität konfrontiert, setzt ihren Sohn angewidert vor die Tür. Abermals zieht Elder bei Armando ein und verspricht ihm den Mord am verhassten Vater als ultimativen Liebesbeweis.
Diesen scheint Armando dann auch als solchen anzunehmen. Als Elder mit drei leeren Patronenhülsen in die Wohnung zurückkehrt und angibt, Armandos Vater getötet zu haben, haben die beiden zum ersten Mal Sex und verbringen die Nacht miteinander; sie vermitteln den Eindruck eines Liebespaares. Doch der Einsturz der Distanz in diesen innigen Momenten vermag in Armandos Verhalten keine Änderung herbeizuführen; der verleugnete Schwule, so lange Zeit eingesperrt, bleibt ein Gefangener seiner selbst. Elder verlässt die Wohnung, um für ein gemeinsames Frühstück einzukaufen, während Armando die Behörden über dessen Rolle bei dem Mord informiert. Wir sehen ihm zu, wie er aus der Entfernung die Verhaftung des jungen Mannes beobachtet, der Farbe in sein graues Leben hätte bringen können. Die Erschütterung der eigenen Lebenslüge ist offenbar etwas, das Armando trotz der Möglichkeiten, die ihm Elder eröffnet hätte, nicht zuzulassen vermag.
Es ist die grausamste und ganz und gar menschenverachtendste dieser drei Filmgeschichten um den abwesenden Schwulen, die mit der deutlichsten Akzeptanz des wahren Ich endet. Bent, von Sean Mathias nach dem gleichnamigen Theaterstück von Martin Sherman adaptiert, mutet wie ein bitterer Kommentar zu Bob Fosses Cabaret (1972) nach dem Roman von Christopher Isherwood an. Funktioniert letzterer Stoff als Vorahnung der kommenden Gräuel und Schrecken des Naziterrors, sind diese für die Figuren in Bent bereits brutale Realität geworden. Max (Clive Owen), offen schwuler Lebemann im Berlin der Zwischenkriegszeit, wohnt mit seinem Freund Rudi (Brian Webber) in einem Abbruchhaus und verdingt sich mit dem Verkauf von Drogen. Es herrscht eine Atmosphäre zwischen Dekadenz und Weltuntergangsstimmung, die Regisseur Mathias mit großer Theatralik fernab jedes Anspruches auf historisch korrekte Rekonstruktion inszeniert. Mick Jaggers Auftritt als Travestiekünstler schwelgt noch einmal in einer lyrischen Ode an die „Streets of Berlin“, dann kommt es auch schon zu den ersten Verhaftungen im Rahmen des Röhmputsches und kippt die Szenerie in einen Kampf ums reine Überleben.
Max glaubt, sich durch Verleugnung seines Selbst vor dem Schlimmsten bewahren zu können. Auf dem Transport nach Dachau macht er alles, um an Stelle eines Rosa Winkels, dem Zeichen für Homosexuelle, einen gelben Judenstern an die Jacke geheftet zu bekommen – selbst unter den Gefangenen scheint es noch Hierarchien zu geben. Zum Beweis, nicht schwul zu sein, geht er zum Äußersten und erschlägt im Waggon auf Befehl eines Offiziers seinen Freund. Eine interessante Variante zu den Überlegungen über den verleugneten schwulen Mann im Homosexuellen: Gerade derjenige, der eigentlich mit sich selbst im Reinen gewesen zu sein schien und offen schwul gelebt hat, sucht nun Rettung durch die völlige Selbstverleugnung. Erst am Ende seines Lebens wird Max sein verlorenes Ich wiederfinden.
Die Szenen im Lager sind in extremer Abstraktion dargestellt, es ähnelt einem großen Industriegelände, und es gibt kaum Gemeinsamkeiten mit der Zeichnung von Konzentrationslagern in Produktionen wie Schindler’s List (Schindlers Liste, 1993) oder La vita è bella (Das Leben ist schön, 1997). Max macht Bekanntschaft mit dem Mithäftling Horst (Lothaire Bluteau), der im Gegensatz zu ihm den Rosa Winkel trägt. Die beiden sind zu einer Art von Sisyphos-Tortur eingeteilt. Sie bewegen sich durch surreal ausgebleichte Szenerien von staubigem Geröll und haben Felsstücke und Steinbrocken von einer Seite einer freien Fläche oder einer Lagerhalle zur anderen zu schleppen – eine Schikane ohne jeden Sinn und allein zum Zweck der Demütigung der beiden Männer. Sie dürfen einander nicht berühren, noch miteinander sprechen und doch entwickelt sich zwischen ihnen ein Kammerspiel des Begehrens.
Horst erweist sich von Anfang an als der Stärkere; er ist eins mit sich selbst und bewahrt die Reinheit seines Innersten vor dem Schmutz der äußeren Gewalt, die mit aller Vehemenz auf ihn eindringt und ihn dennoch nicht zu korrumpieren vermag. In drei Szenen, die einander spiegeln und weiterführen, kommen die beiden Männer einander so nahe, wie es eigentlich nur Liebenden gelingt. Mit ihren kahl geschorenen Köpfen und ihren ausgemergelten Körpern stehen sie stramm nebeneinander in der grellen Sonne und brechen das Redeverbot. Wie schön er Max’ Körper finde, beginnt Horst, wie gut sich seine Haut in seiner Vorstellung anfühle. Max steigt auf das Gedankenspiel ein. Anfangs ist es nur die aufgestaute Begierde, die sich ein Ventil sucht, später sind es auch die aufgestauten Gefühle. Max und Horst stehen getrennt voneinander und haben imaginierten Sex miteinander. Ihre Blicke sind nach vorn gerichtet, nur hin und wieder wandern ihre Augen, um einen kurzen Impuls vom anderen zu erhaschen. Ohne körperliche Berührungen tauschen sie Zärtlichkeiten aus und spüren den Körper und die Geschlechtsteile des anderen. Sie schlafen miteinander und sinken einander erschöpft in die Arme, ohne sich auch nur zu bewegen – der Triumph der Vorstellung gegenüber der Wirklichkeit, die nichts Lebenswertes mehr an sich hat.
In einer weiteren Szene werden Max und Horst durch die Brutalitäten, denen sie sich ohne Unterlass ausgesetzt sehen, und durch die Hoffnungslosigkeit, die sie längst fast aufgefressen hat, eigentlich schon ganz weit von einer menschenwürdigen Existenz fort- und hinein in die totale Verzweiflung getrieben. Doch abermals sprechen sie Worte der gegenseitigen Berührung aus: „gently, softly“. Erneut haben sie Sex miteinander, der vielleicht intensiver ist als jeder reale Sex, den sie bisher in ihrem Leben hatten; und diesmal berühren sich dabei sogar ihre Seelen: „You are safe with me.“
Und doch ist ihr Ende vorgezeichnet. Ein vor Sadismus triefender Offizier nimmt Horst kurze Zeit später die Kappe ab und wirft sie auf den elektrisch geladenen Zaun. Er befiehlt ihm, sie sich zurückzuholen, und schießt Horst, als dieser stattdessen brüllend auf ihn zuläuft, einfach nieder. Max bleibt mit dem Toten in den Armen zurück. Er bettet ihn in die Grube, aus der sie kurze Zeit zuvor noch Steine gehoben haben, macht sich daran, die sinnlose Tätigkeit wieder aufzunehmen, hält dann jedoch inne. In ihm, das ist zu erkennen, hat sich ein Prozess abgespielt, der zu einem Ende gekommen ist, einem Entschluss. Er zieht sich Horsts Jacke mit dem Rosa Winkel an, er knöpft sie sorgfältig zu und überprüft, ob sie denn auch gut sitzt. Dann schreitet er auf den elektrischen Zaun zu, man kann es nicht anders ausdrücken: nicht ohne Angst vor dem, was jetzt kommen wird, doch würdevoll und mit erhobenem Haupt. Max ist wieder eins geworden mit dem Schwulen, der er einmal war und den er für seine vermeintliche Rettung weggesperrt hat. Er holt ihn zu sich und in sich zurück, er umarmt ihn wie vorhin den niedergeschossenen Horst und schließt Frieden mit ihm. Er legt die Hände an den Zaun und der Strom fährt in seinen Körper. Der tote Max hängt an dem Gitter wie ein Christus am Kreuz. Er hat seine Passion überstanden; er hat wieder zu sich zurückgefunden.
Beach Rats (USA 2017, Drama)
Regie: Eliza Hittman
Darsteller: Harris Dickinson, Kate Hodge, Madeline Weinstein, Neal Huff, Nicole Flyus, Frank Hakaj, David Ivanov, Anton Selyaninov, Harrison Sheehan, Douglas Everett Davis, Erik Potempa
Bent (GB 1997, Drama)
Regie: Sean Mathias
Darsteller: Clive Owen, Lothaire Bluteau, Ian McKellen, Nikolaj Coster-Waldau, Mick Jagger, Jude Law, Rupert Graves
Caracas, eine Liebe(Desde allá, Venezuela/Mexiko 2015, Drama/Liebesfilm)
Regie: Lorenzo Vigas
Darsteller: Alfredo Castro, Luis Silva, Jericó Montilla, Catherine Cardozo, Marcos Moreno, Jorge Luis Bosque
Parasiten der Seele
Closet Monster (2015)
Zum Thema von Parasiten, die in menschliche Körper eindringen, sich darin ausbreiten und die Kontrolle über ihren Wirt übernehmen, gibt es im Kanon der Filmgeschichte unzählige Einträge. Im Streifen Parasiten-Mörder (Shivers, 1975) des kanadischen Horrorspezialisten David Cronenberg etwa steigern im Labor gezüchtete Würmer zum Zweck der rascheren Vermehrung den Sexualtrieb der Befallenen ins Extreme, in Philip Kaufmans Die Körperfresser kommen (Invasion of the Body Snatchers, 1978) bemächtigt sich ein außerirdischer Mikroorganismus schlafender Menschen und ersetzt sie in der Folge durch gefühllose, äußerlich aber völlig identische Doppelgänger. Wir alle haben auch noch die Bilder des vor Schmerzen schreienden John Hurt in Ridley Scotts Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (Alien, 1979) vor Augen, als die durch einen Facehugger eingepflanzte todbringende Brut durch seinen berstenden Brustkorb den Weg ins Freie erzwingt.
Wie ein solcher Parasit lebt auch etwas in Oscar, dem jugendlichen Protagonisten in Stephen Dunns Film Closet Monster. Es ist Angst, die genährt wird durch ein Erlebnis aus seiner Kindheit, durch Bilder, die ihm längst ins Hirn gewachsen sind und in die Seele; und durch die Gewissheit, durch das, was er ist, mit diesen Bildern in direkter Verbindung zu stehen. Als Achtjähriger muss Oscar (Jack Fulton) im konservativen Neufundland mitansehen, wie ein Junge von Mitschülern auf einem Friedhof geschlagen und getreten und mit einer Eisenstange vergewaltigt wird. Einen spitzen Pflock in den Händen versucht Oscar einzuschreiten – er fühlt sich wie der Vampirjäger aus einer der Geschichten, die ihm sein Vater vor dem Einschlafen erzählt, ist aber zu jung, um die Natur und das Ausmaß der Geschehnisse ermessen zu können, die sich vor seinen Augen abspielen. Die Jungen werden aufgeschreckt und suchen das Weite, der Misshandelte, so erfährt Oscar später aus den Fernsehnachrichten, wird Zeit seines Lebens querschnittsgelähmt sein. Kein Wunder, meint sein Vater Peter (Aaron Abrams) achselzuckend: Er sei eben ein Schwuler. Er rät seinem kleinen Sohn, sich die Haare schneiden zu lassen, um nicht auch wie ein solcher auszusehen.
Worte, die Oscar nicht vergisst. Immer wenn er sich zehn Jahre darauf mit seiner Homosexualität konfrontiert sieht, spürt er schreckliche Schmerzen im Bauch. Das Monster namens Furcht hat sich in ihm eingenistet, Unsicherheit und Selbstzweifel sind seine Tentakel, die Oscars Innerstes ausfüllen. Connor Jessup gibt dem Teenager ein Gesicht, das dem Kindlichen noch nicht ganz entflohen ist, Züge zwischen Naivität und Versuchen des trotzigen Aufbegehrens. Dabei vermischen sich für Oscar die Ebenen von Realität und Imagination. Wie als Kind führt er Gespräche mit seinem Hamster Buffy, der von Isabella Rossellini gesprochen wird. Vor dem „imaginary friend“ kann er ganz er selbst sein – ebenso wie wenn er seine Freundin Gemma (Sofia Banzhaf) zur Figur aus Horrorfilmen schminkt. Dabei fühlt er sich seinem Ziel, auf einer Schule für Maskenbildner in New York aufgenommen zu werden und auf diese Weise der Beengtheit seiner Heimatstadt zu entkommen, zum Greifen nah.
Oscars Eltern sind seit seiner Kindheit getrennt, richtig entspannt ist Oscar weder, wenn er mit seinem Vater zusammen ist, noch bei der Mutter und ihrer neuen Familie. Während der Arbeit am Baumarkt treffen ihn die Stiche im Bauch unvermutet, als er einen neuen Kollegen, den coolen Wilder (Aliocha Schneider), kennenlernt – man beachte den Zusammenklang ihrer beider Vornamen, den Hinweis auf Oscar Wilde. Jedenfalls hat Wilder sein Shirt vergessen und bittet Oscar, der sich gerade umzieht, um das seine. Als Oscar am nächsten Tag mit Gedanken an den anderen Jungen onaniert, hat er auf einmal wieder die alten Bilder vom Friedhof vor Augen – und ihm ist, als hätte er selbst die blutige Eisenstange im Bauch.
Es kommt, wie es kommen muss. Oscar himmelt Wilder aus der Ferne an, die beiden freunden sich miteinander an und verbringen schließlich Zeit zusammen. Oscar ist sich sicher, dass auch Wilder schwul ist. Eines Abends lädt er ihn zu einer Kostümparty ein. Oscar probiert gerade eine Nietenjacke und die Pelzmütze an, die seine Mutter im Schrank des Vaters zurückgelassen hat, da wird er von ebendiesem überrascht. Der Vater hat mittlerweile erkannt, dass sein Sohn mit Gemma nicht auf eine Weise zusammen ist, die ihm als natürlich erscheint. Wütend verbietet er seinem Sohn, zu der Party zu gehen. Da wehrt sich Oscar zum ersten Mal auf körperliche Art. Er stößt den Vater zurück, dieser stolpert in den Wandschrank, also genau dorthin, woraus Oscar soeben dabei ist, zu entfliehen: coming out of the closet. In der hereinbrechenden Nacht wird Oscar den Entschluss fassen, aus seiner Einsamkeit zu entfliehen und auszuprobieren, was ihm und für ihn möglich ist, wenn er ganz einfach nur er selbst ist. Indem er sich erstmals dem Vater entschieden entgegengestellt hat, hat er einen Prozess in Gang gesetzt, in dem es für ihn noch lang keine Sicherheit über sich selbst geben, in dessen Verlauf er aber gezwungen sein wird, sich seiner Angst zu stellen.
Auf der Party gestalten Mädchen zuerst einmal Oscars Kostüm in Richtung Coolness um und schminken ihm ein Brillenmuster um die Augen – er sieht klarer, realisiert, dass Wilder gar nicht schwul ist, nimmt eine Tablette und wird so high, dass er sich auf Sex mit einem Partygast einlässt. Doch die Szene gerät außer Kontrolle. Aus Oscars Bauch stülpt sich ein Wulst, als versuchte ein Alien aus ihm herauszukommen, er krümmt sich vor Schmerzen, er kotzt blutige Schrauben und Muttern in ein Waschbecken. Dann verliert er das Bewusstsein und bricht zusammen.
Wilder liest ihn auf. Er gibt ihm zu trinken und begleitet ihn dann durch die Regennacht nach Hause. Völlig durchnässt, klettern sie in Oscars Baumhaus. Sie ziehen die nassen Sachen aus und liegen beisammen. Oscars Herzklopfen ist fast spürbar. Er missversteht eine Geste Wilders und glaubt, er wolle ihn küssen. Die Peinlichkeit der Situation wird in einem sehr zarten, ganz leise gesprochenen Dialog aufgelöst. „Since when have you known?”, fragt Wilder, und beiden ist klar, worüber hier gesprochen wird. „I don’t“, wehrt Oscar vorerst noch ab. „Have you ever kissed a guy?”, insistiert Wilder. Er habe mit Jungen rumgemacht, meint Oscar zögernd, aber noch nie jemanden geküsst. „Do you want to?“, will Wilder wissen. – „What?“, ist Oscars Gegenfrage. Und Wilder: „Do you want to know?” Da setzen wieder Oscars Bauchschmerzen ein: „My stomach feels like it’s on fire.” Wilder nimmt einen Schluck aus einer Wasserflasche und beugt sich über Oscars Lippen. Er lässt Tropfen in seinen Mund fallen – und es kommt zu einem langen zärtlichen Kuss. Zum Einschlafen nimmt er seine Hand.
Die sanfte Stimmung dieser Szene stellt Regisseur Dunn den erschreckenden Vorkommnissen des nächsten Tages gegenüber. Oscar bricht ins Haus der Mutter ein und wird von ihr überrascht. Endlich kommt es zu einer ehrlichen Aussprache. Oscar wirft ihr vor, damals nicht nur den Vater, sondern auch ihn verlassen zu haben. „I was dying in that house“, ist ihre Rechtfertigung. Sie gibt ihm den Ratschlag: „If you’re forced to walk through shit, then you might as well grow a thick skin”, und äußert die Vermutung, dass es Oscar in seinem Leben nie leicht haben werde.
In Heinrich von Kleists Novelle Die Marquise von O…. (1808) stellt sich die Titelfigur mit ungewohnter Heftigkeit dem Tötungsakt durch ihren Vater und seinem Ansinnen entgegen, ihr die eigenen Kinder wegzunehmen. „Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötzlich, wie an ihrer eigenen Hand, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgestürzt hatte, empor.“ In diesem Sinne reagiert auch Oscar, als er, getrieben von einem schrecklichen Gedanken, zum Haus seines Vaters läuft. Er steigt über eine Leiter in sein Zimmer ein und findet es völlig verwüstet vor. Viele seiner Sachen, darunter die Schminkutensilien und Buffys Käfig, hat der Vater vors Haus geworfen. Oscar findet den toten Hamster und daneben seinen zugespitzten Vampirjägerstock. Die Mutter ist ihm nachgefahren, er hört sie mit dem Vater streiten. Da krümmt sich Oscar unter Schmerzen so stark wie nie zuvor. Die Erinnerungen, die ihm zeitlebens zu Albträumen wurden, wallen auf: Wie er damals auf dem Friedhof mit dem Stock nichts mehr ausrichten, nicht mehr helfen konnte. Nun stürmt er statt auf die Vergewaltiger auf den Vater zu. Er halluziniert die Woge der Gefühle, die über ihm zusammenbricht, zur momentanen Wirklichkeit, er sieht die Spitze der Eisenstange seine Bauchdecke durchstoßen und zieht sie sich aus dem blutenden Leib. In zeitlupenverzerrtem Brüllen geht er damit auf den Vater los. Dieser flüchtet sich ins Haus, das Oscar mithilfe der Stange, die er biegt, als hätte er alle Kräfte dieser Welt, verriegelt. Dort, im Haus des Vaters, bleibt seine Angst zurück, der Parasitenwurm, der dem Kind einst durch die dummen Sätze eingepflanzt wurde.
Closet Monster (Kanada 2015, psychologisches Drama/Coming-of-Age)
Regie: Stephen Dunn
Darsteller: Connor Jessup, Aaron Abrams, Joanne Kelly, Aliocha Schneider, Jack Fulton, Sofia Banzhaf, Mary Walsh, Isabella Rossellini
Aufbruch
Departure (2015)
Es muss geradezu ein Crescendo an Tabubrüchen gewesen sein, als Frank Wedekinds gesellschaftskritisches Drama Frühlings Erwachen, das den Untertitel Eine Kindertragödie trägt, im Jahr 1891 erschien. Eine Gruppe Jugendlicher, die an der Enge und der Intoleranz der Wilhelminischen Zeit zu zerbrechen droht, der konsequente Blickwinkel aus der Sicht der Charaktere, der ihre psychische Instabilität und Gefühlswallungen der Pubertät, aber auch ihre Neugier und Unsicherheit hinsichtlich ihrer aufkeimenden Sexualität ernst nimmt und dabei auch vor Anspielungen auf Onanie und Homoerotik nicht zurückscheut – nicht von ungefähr kam es bei der Uraufführung 1906 an den Berliner Kammerspielen unter der Regie von Max Reinhardt zu einem handfesten Theaterskandal. In der letzten Szene des Stücks hält ein als solcher apostrophierter vermummter Herr Zwiesprache mit dem Protagonisten Melchior, einem verwirrten jungen Mann, der sich das Leben nehmen will, und weist ihm einen gangbaren Weg in die Zukunft.
In einer ähnlichen Situation befindet sich Elliot in Andrew Steggalls Coming-of-Age-Drama Departure – Alex Lawther spielt sein Erwachen aus dem Schlaf seines bisherigen Erlebens mit noch ein wenig kindlichem, altklugem Blick aus großen Augen und berührender Intensität. Im Grunde genommen ergeht es den Charakteren um ihn herum ähnlich wie ihm. Auch sie stehen an einem Punkt des Aufbruchs aus ihrem alten in ein neues Leben.
Sie würde sich fühlen, als müsste sie ertrinken, meint Elliots Mutter Beatrice (Juliet Stevenson) in einer Szene angesichts des Lügengebildes, das ihre Ehe ausmachte und nun zusammenstürzt. Elliot und sie sind mit dem Auto von England nach Südfrankreich gekommen, um ihr Ferienhaus zu räumen und letztlich zu verkaufen. Elliots Vater Philip (Finbar Lynch) hat nach Jahrzehnten des Versteckspiels mit sich selbst und seiner Familie einen Schlussstrich gezogen und endlich den Mut gefunden, zu seiner Homosexualität zu stehen – eine Tatsache, um die Elliots Eltern aber in der direkten Auseinandersetzung nur herumreden. Elliot selbst, eine poetische Seele voller Selbstzweifel und unausgesprochener Sehnsüchte, ringt in einem Gespräch mit dem Besitzer eines Cafés nach den richtigen Worten, wenn er über seine „Sehnsucht nach dem Menschsein“ spricht.
Was er damit wirklich meint, wird bald offensichtlich. Er streift in seiner seltsamen Uniformjacke durch die Gegend, während seine Mutter die Erinnerungsstücke an ihr früheres Leben in Kartons packt. Bei einem dieser Spaziergänge durch den herbstlichen Wald beobachtet er einen französischen Jungen, Clément (Phénix Brossard), als dieser von einer Mauer ins Wasser springt. Ein verbotener Akt, denn in dem Staubecken zu baden, ist nicht erlaubt. Clément setzt sich einfach über die Regeln hinweg – ein Verhalten, das Elliot und seiner Mutter fremd ist. Bald ist Clément ihr Mittelpunkt, den sie umkreisen, fast möchte man sagen, umwerben, die Mutter als eine Art Ersatz für den verlorenen Ehemann, Elliot als Objekt seiner versteckten Begierde. Er führt Clément zum von Pflanzen überwucherten Wrack eines Lkw, seinem geheimen Zufluchtsort. Dort bricht es aus Clément heraus: Der Krebs im Kopf seiner Mutter habe sie verändert, er kenne sie nicht mehr wieder, sie sei wie ausgewechselt. Clément schlägt plötzlich in einem Anfall von Wut und Verzweiflung um sich und – als ihn Elliot tröstend berührt – auch nach ihm. Auf dem Heimweg offenbart sich ihm Elliot: „Je t’aime.“ Doch Clément gibt vor, ihn misszuverstehen und berichtigt ihn, es würde „Je t’aime bien“ heißen: Ich mag dich, ich kann dich gut leiden. Natürlich hat Elliot das Gesagte durchaus als echte Liebesbezeugung gemeint.
In einer abendlichen Szene ist es Elliots Vater Philip, der nach den richtigen Worten sucht. Dass man im Leben nicht verdrängen dürfe, was einem wichtig sei, meint er, denn dann könne man kein Glück finden. Man könne so leicht vergessen, was man wirklich wolle, fügt er hinzu. „Certain things you put away don’t really go away.“ Dabei betrachtet er Elliots Pinnwand mit Fotos von nackten Männern und daneben das Segelschiff und den Globus.
„Do you think you could know things before you know them?”, fragt Elliot später Clément. All diese umständlichen Andeutungen und Umschreibungen – das, was sie tatsächlich sagen wollen, scheint den Figuren nicht über die Lippen zu kommen. Stattdessen kommt es zu Taten, die für sich sprechen. Eine idyllische Bootsfahrt, das Sonnenlicht bricht sich im Wasser, heimliche schmachtende Blicke auf Clément, der sich so selbstsicher gibt, wie Elliot gern sein würde. Clément zieht sich aus und springt ins Wasser. Elliot kriegt es mit der Angst zu tun, weil er so lang nicht auftaucht. Befreiendes Lachen, als er doch wieder an die Oberfläche kommt und ins Boot klettert. Clément legt sich auf der Ruderbank zurück, sein Brustkorb hebt und senkt sich, er zittert vor Kälte. Elliots Augen verschlingen ihn, und doch traut er sich kaum, ihn anzusehen. Er zögert noch, dann beginnt er ihn mit einem Tuch abzutrocknen. Clément nimmt es ihm aus der Hand, die nun über seine Gänsehaut streicht, ganz vorsichtig, ganz sanft. Die vibrierende sensuelle Spannung zwischen den beiden ist fast greifbar, und als er beginnt, Clément zum Höhepunkt zu streicheln, wird Elliots Gesicht ganz weich. Auf dem Heimweg jedoch stößt ihn Clément von sich; an Stelle der ersehnten Zuneigung stehen Aggression und Gewalt. Elliot irrt im Wald herum, ein Gefängnis wie das Labyrinth seiner Gefühle. Beim Abendessen eskaliert auch die Situation zwischen seinen Eltern, die in dem ihren gefangen sind. Als Elliot vom Tisch aufgesprungen ist und in seinem dunklen Zimmer sitzt, fallen herbstliche Blätter in Zeitlupe um ihn herum zu Boden: „les feuilles mortes“ – tote Blätter, entrücktes Entsetzen.
Wie Elliot stehen auch seine Eltern am Abgrund ihrer Existenz. „It’s not a marriage”, meint Philip zu seiner Frau. „It’s all I’ve got”, erwidert diese. Aber auch sie hält ihr Zusammenleben, wie es war und ist, nicht länger aus. „I saw you eyeing the waiters”, spricht sie davon, dass ihr die Begierden ihres Mannes nicht entgangen sind: „The looks, the longing.”
Derweil nimmt Elliot die Fotos der nackten Männer von der Wand seines Zimmers.
Später macht sich Beatrice daran, die Möbel aus dem Haus zu verbrennen. Elliot findet sie danach zusammengekrümmt in seinem Bett liegend vor. Dass sie seinem Vater nichts über ihn und Clément erzählt habe, wehrt sich die Mutter, als Elliot ihr Vorwürfe macht, sie habe auch Dinge verbrannt, die ihm gehörten. Und er nicht von ihrem von Clément gestohlenen Kuss unter einer Brücke, den er zufällig mitangesehen hat, entgegnet er ihr.
Bei der Fahrt zum Ferienhaus in der Nacht ihrer Ankunft hat sich Elliot eingebildet, sie hätten einen Hirsch angefahren. Nun läuft er über ein Feld in der Nähe der vermeintlichen Unfallstelle. In seiner Vorstellung lebt das Tier noch und leidet. Clément rennt hinter Elliot her, die beiden geraten in Streit. Elliot wirft sich auf ihn, sie prügeln immer heftiger aufeinander ein. Es ist keine Rauferei unter Freunden, es ist bitterer Ernst. Schließlich kommt Elliot auf Clément zu knien. In seiner erhobenen Hand ist ein Steinbrocken, mit dem er zuzuschlagen droht. Ein Moment, in dem alles in Schwebe ist, doch dann die Entscheidung: Elliot wirft die Arme hoch und umarmt Clément, dieser zieht ihn an sich und es kommt zu dem Kuss, den sie in Gedanken schon so lange Zeit ausgetauscht haben.
Schwer atmend liegen sie nebeneinander im Feld, dann bleibt Elliot allein zurück. Es ist Nacht, ein Gewitter zieht herauf. Die Mutter ist allein im Haus, während Elliot zur Staumauer geht, auf der er Clément zum ersten Mal gesehen hat. Über ihm der Vollmond. „Silberner Mond du am Himmelszelt“, lautet der erste Vers aus Antonín Dvoráks „Lied an den Mond“ aus Rusalka, das nun zu hören ist. Und weiter: „Oh Mond, verweile, bleibe,/sage mir doch, wo mein Schatz weile./Sage ihm, Wandrer im Himmelsraum,/ich würde seiner gedenken: mög’ er,/verzaubert vom Morgentraum, seine Gedanken mir schenken.“ Elliot zieht sich nackt aus und springt von der Mauer aus in die Tiefe. Wir sehen ihn durchs Wasser brechen und unter einem Schwall aus aufsteigenden Luftblasen zu Boden sinken. Elliot ist ganz ruhig. Er blickt sich im Wasser um, als gäbe es darin Klarheit und Antworten zu entdecken. Still schaut er den letzten Luftblasen nach.
In der Zwischenzeit sitzt seine Mutter vor dem Haus, das bald nicht mehr das ihre sein wird. Im Wind und dem Regen und in der klaren Luft um sie herum taucht Elliot aus dem Wald auf und setzt sich neben sie. Sie sind zu erschöpft, um noch miteinander zu streiten. Sie haben Frieden geschlossen, mit sich selbst und miteinander, und legen ihre Hände aufeinander. Wir sehen, wie sich Elliot kurz zuvor im Wasser abgestoßen hat, wie er begonnen hat, aus der todbringenden Tiefe wieder nach oben zu schwimmen. Und die Arie vom Mond spricht vom Geliebten, wo immer er auch sei, seinem Traumgesicht und seinen Gedanken an den Liebsten. Die Zwiesprache mit dem vermummten Mann, hier in Gestalt des vollen Mondes, hat Elliot im Chaos seiner Gefühle Atem schöpfen lassen.
Departure (GB/Frankreich 2015, Drama/Liebesfilm)
Regie: Andrew Steggall
Darsteller: Alex Lawther, Phénix Brossard, Juliet Stevenson, Niamh Cusack, Patrice Juiff, Finbar Lynch
Blicke ohne Worte
Herzstein (2016)
Es beginnt mit Blicken ohne viele Worte. Drei Burschen, alle um die dreizehn oder vierzehn Jahre alt, genießen auf einem Pier die seltenen Sonnenstrahlen im isländischen Sommer. Thór drückt sich neben ihnen herum. Er trägt als einziger ein Shirt und betrachtet verstohlen die nackten Oberkörper. Dabei sucht er nach Anzeichen der aufkeimenden Männlichkeit, die er an sich selbst noch schmerzhaft vermisst. Seine Augen bleiben an Kristján hängen, seinem besten Freund, dessen Finger mit den ersten Achselhaaren spielen. Später wird Thór vor dem Spiegel im Badezimmer stehen und seine Muskeln anspannen, er wird sich mit einem Büschel aus der Bürste seiner Schwestern ein Schamhaartoupet basteln. Der liebevolle Spott der Kameraden tut weh und macht wütend, und als Thór unter dem Pier einen Fischschwarm entdeckt, ergibt sich die Gelegenheit, diese Wut, die aus Unsicherheit resultiert, an den geangelten Tieren auszulassen. Die Jungen zertrümmern und zertreten den Fischen die Köpfe. Den Stolz, den größten Fang aufweisen zu können, vermag Thór nicht auszukosten. Er solle die Fische vor dem Haus stehen lassen, meint die Mutter. Sie werden dort vergammeln.
Borgarfjörður eystri, ein kleines Fischerdörfchen irgendwo in Island, gibt den Schauplatz für Guðmundur Arnar Guðmundssons Langfilmdebüt Herzstein. Die Natur in ihrer wilden Schönheit ist viel mehr als reine Kulisse: Die karge Landschaft des Hinterlandes, die sturmzerzausten Weiden und eiskalten Seen, die steilen Klippen am Meer, das unablässige Brausen der Brandung – die Menschen, die hier leben, sind ständig Wind und Wetter ausgesetzt. Kaum ein Tag dieses Sommers, an dem sie der Regen nicht durchnässt, einmal schneit es sogar. In den kleinen, schachtelartigen Häusern finden sie nur scheinbar Zuflucht – die Familien, die darin leben, sind dysfunktional und zerrissen. Thórs Vater hat sich aus dem Staub gemacht, seine Mutter gibt sich Mühe, die Familie zusammenzuhalten, doch ihr macht die Sehnsucht nach einem Partner sehr zu schaffen. Kristjáns Vater ist ein brutaler Säufer, seine Mutter ist zu schwach, um sich ihm gegenüber zu behaupten. Mit den älteren Jungen gibt es bei jedem Aufeinandertreffen im und um den kleinen Dorfladen aggressive Auseinandersetzungen. Wann immer diese Figuren ihre Emotionen, die sie schier zu zerreißen drohen, nicht mehr zurückzuhalten vermögen, sucht sich die Gewalt ihren Weg und ihren Fokus. Dies trifft nicht nur auf Kristjáns Vater zu, der, wenn ihm etwas gegen den Strich geht, einfach zuschlägt. Als Thórs Mutter am Esstisch ihr Bedürfnis artikuliert, nicht länger allein bleiben zu wollen, während ihr Mann eine jüngere Freundin hat, kommt es zum heftigen Wortwechsel mit ihren Töchtern. Es fallen Sätze, die man innerhalb dieser Familie nicht für möglich gehalten hätte, und es bleibt nicht beim verbalen Streit.
In diesem klar und realistisch gezeichneten, zuweilen bedrohlichen Umfeld entwirft Guðmundsson sein vielschichtiges Bild der Freundschaft zwischen Thór und Kristján, ihrer Blicke und Berührungen und, wie sich bald zeigen wird, der ganz unterschiedlichen Bedeutung, die diese für die beiden Jungen haben. Guðmundssons Erzählduktus ist von einer bewundernswert natürlichen Geradlinigkeit; die Selbstverständlichkeit, mit der er den Schauplatz und die wichtigen Charaktere seines Films darlegt und in diese Informationen, die nie nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen gegeben scheinen, die Einschreibung seiner zentralen Themen und Motive vornimmt, bestimmt den Ton und die Stimmung des Streifens, den ruhigen Fluss seiner Geschichte. Wenn darin zwischen Thór und Kristján Worte fallen, sind diese nicht immer dazu da, um ihre wahren Gefühle darzulegen, sondern eher, um sie zu verbergen. Die Zeichnung der Charaktere konzentriert sich auf die Ambivalenz in der Beziehung zwischen Thór und Kristján – Thórs Selbstzweifel, was seinen noch kindlichen Körper und seine aufkeimende Sexualität betrifft, ebenso wie Kristjáns zärtliche Zuneigung dem Freund gegenüber. Sie wollen ihre Unsicherheit dem anderen gegenüber nicht eingestehen, obwohl es doch sonst niemanden gäbe, dem sie solch intime Gefühle anvertrauen könnten. Wenn Thór wieder einmal von seinen Schwestern aufgezogen wird, legt Kristján seinen Arm beschützend um ihn. Doch meist wehren die Jungen, auch Kristján, die Berührungen des anderen als „schwul“ und reines Spiel ab.
Der französische Soziologe und Philosoph Didier Eribon reflektiert in seiner autobiografischen Studie Rückkehr nach Reims