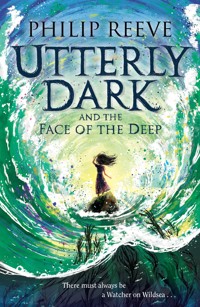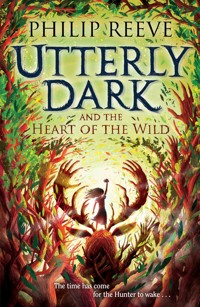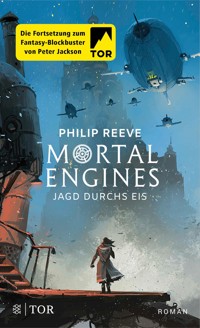12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mortal Engines
- Sprache: Deutsch
»Mortal Engines – Die verlorene Stadt« ist der vierte Band in Philip Reeves monumentaler Fantasy-Saga voller Luftschiffe und Piraten, Kopfgeldjäger und fahrender Städte. Ein neues Zeitalter des Friedens und des Wohlstands ist zum Greifen nah. General Naga, der Anführer des Grünen Sturms, ist fest entschlossen, den Krieg gegen die fahrenden Städte zu beenden und die Welt zur Ruhe kommen zu lassen. Doch als auf seine Frau bei einem Staatsbesuch in Zagwa ein Attentat verübt wird, flammt der alte Hass wieder auf, und die Welt läuft einmal mehr Gefahr, in einen alles vernichtenden Schlagabtausch zu geraten … Mortal Engines – Die verlorene Stadt ist der furiose Abschlussband des »Mortal Engines«-Quartetts, in dem die Geschichten von Tom, Hester, Wren, Theo Ngoni, Anna Fang und Shrike zu Ende erzählt werden. Das spektakuläre Finale einer großen Fantasy-Saga. Für Leser von Philip Pullman und J. R. R. Tolkien sowie Fans von Peter Jackson. Das »Mortal Engines«-Quartett besteht aus: Band 1: Mortal Engines – Krieg der Städte Band 2: Mortal Engines – Jagd durchs Eis Band 3: Mortal Engines – Der Grüne Sturm Band 4: Mortal Engines – Die verlorene Stadt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Philip Reeve
Mortal Engines - Die verlorene Stadt
Roman
Über dieses Buch
Ein neues Zeitalter des Friedens und des Wohlstands ist zum Greifen nah. General Naga, der Führer des Grünen Sturms, ist fest entschlossen, den Krieg gegen die fahrenden Städte zu beenden und die Welt zur Ruhe kommen zu lassen. Doch als auf seine Frau auf einem Staatsbesuch in Zagwa ein Attentat verübt wird, flammt der alte Hass wieder auf, und die Welt läuft einmal mehr Gefahr, in einen alles vernichtenden Schlagabtausch zu geraten …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philip Reeve ist seit vielen Jahren erfolgreicher Autor und Illustrator. Zusammen mit seiner Frau Sarah und seinem Sohn wohnt er im Dartmoor National Park, Südengland. Die insgesamt acht Mortal-Engines-Bücher (das Mortal-Engines-Quartett, drei Prequels und ein Band mit Erzählungen) stellen sein vielfach ausgezeichnetes Hauptwerk dar.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »A Darkling Plain« bei Scholastic Ltd.
© Philip Reeve
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverabbildung: © Ian McQue, 2018. Reproduced by permission of Scholastic Ltd.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490657-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Sarah, wie immer
Für meine Lektorinnen, Kirsty und Holly (sowieso)
Und für Sam, Tom und Edward (irgendwann)
Ach, Liebste, lass uns treu
und wahrhaftig sein! Denn die Welt, die dort
verlockend vor uns liegt, ein Zauberort,
so vielgestaltig, schön und neu,
kennt weder Freude noch die sanfte Macht
der Liebe und des Friedens, Schmerzen nur;
und wir stehen wie auf dunkler Flur
umtost von Hilferufen und der Schlacht
von blinden Heeren in der Nacht.
Matthew Arnold, Am Strand von Dover
Teil 1
1Tigermücken über Zagwa
Im Morgengrauen hatte Theo den Aufstieg begonnen. Zunächst erklomm er die steilen Straßen, Fußpfade und Schafwege hinter der Stadt, überquerte dann rutschige Geröllhalden und kletterte schließlich an der nackten Gebirgswand empor, wo immer er eine Mulde oder Kerbe fand, in der sich die blauen Schatten sammelten. Als er den höchsten Punkt erreichte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Er legte eine kurze Rast ein, um zu verschnaufen und etwas zu trinken. Ringsum waberten die Berge hinter den Hitzeschleiern, die sich von den warmen Felsen erhoben.
Sachte, sachte rückte Theo auf eine schmale Felsnase vor, die aus dem Gipfel ragte. Zu beiden Seiten ging es senkrecht tausend Meter weit in die Tiefe, hinunter zu schroffen Felsspitzen, Bäumen, weißen Flüssen. Ein Stein löste sich, fiel geräuschlos, kreiselnd, ins Nichts. Vor sich sah Theo nur den endlosen Himmel. Er richtete sich kerzengerade auf, holte tief Luft, sprintete die letzten Meter bis zur Felskante und sprang.
Weit und weiter ging es hinaus, tiefer und tiefer, in einem schwindelerregenden Gleitflug zwischen Berg und Himmel. Die Echos seines Schreis verhallten in der Stille, und Theo hörte nichts als sein trommelndes Herz und das Rauschen der Luft in seinen Ohren. Vom Wind hin und her geworfen, stieß er aus dem Schatten der Felswand ins Sonnenlicht hinaus und erblickte unter sich – weit unten – seine Heimatstadt, das statische Zagwa. Von hier oben sahen die kupfernen Kuppeln und buntgestrichenen Häuser wie Spielzeug aus; die am Hafen an- und ablegenden Luftschiffe waren Blütenblätter im Wind, der sich durch die Schlucht schlängelnde Fluss ein silbernes Band.
Theo betrachtete das alles liebevoll, bis es hinter einer Bergschulter verschwand. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte er geglaubt, er würde niemals nach Zagwa zurückkehren. Im Ausbildungslager des Grünen Sturms hatte man ihm beigebracht, dass die Liebe zu Heimat und Familie eitler Luxus sei, den er vergessen müsse, wenn er seinen Beitrag im Kampf für eine grüne Erde leisten wollte. Später, als gefangener Sklave an Bord der Floßstadt Brighton, hatte er von zu Hause geträumt, war aber überzeugt gewesen, dass seine Familie ihn nicht wiedersehen wollte, denn seine Eltern waren altmodische Antitraktionisten und hatten ihn, so glaubte er, für immer verstoßen, weil er weggelaufen war und sich dem Grünen Sturm angeschlossen hatte. Und doch war er nun zurück in den heimischen Hügeln von Afrika, und jetzt war es seine Zeit im Norden, die ihm wie ein Traum vorkam.
Das alles hatte er nur Wren zu verdanken, dachte er im Fallen. Wren – dieses sonderbare, mutige, witzige Sklavenmädchen, das er in Brighton kennengelernt hatte. »Fahr nach Hause zu deinen Eltern«, hatte sie zu ihm gesagt, nachdem sie zusammen geflohen waren. »Sie lieben dich noch immer, und sie werden dich bestimmt mit offenen Armen empfangen.« Und sie hatte recht behalten.
Links von ihm schoss ein aufgeschreckter Vogel vorbei, was Theo daran erinnerte, dass er sich im freien Fall befand und auf eine Menge unfreundlich aussehender Felsen zuraste. Er öffnete den großen Drachen, den er sich auf den Rücken geschnallt hatte, und stieß ein Triumphgeheul aus, als die Tragfläche ihn ruckartig nach oben zog und sein betäubender Sturz in einen anmutigen Segelflug überging. Das Brüllen des vorbeirauschenden Windes wich sanfteren Geräuschen: dem Wispern der Silikonseide und dem Knarzen der Taue und Bambusstreben.
Früher hatte sich Theo oft mit seinem Drachen vom Berg gestürzt, um im Spiel mit Wind und Thermik seinen Mut zu beweisen. Viele junge Zagwaner gingen Drachenfliegen. Seit seiner Rückkehr aus dem Norden vor sechs Monaten hatte er so manches Mal neiderfüllt zu den bunten Flügeln aufgeschaut, jedoch nie gewagt, sich ihnen anzuschließen. Während seiner Abwesenheit hatte er sich zu sehr verändert. Er fühlte sich älter als die anderen Jungen in seinem Alter, war ihnen gegenüber aber schüchtern und schämte sich dessen, was er gewesen war – Tumblerbombenpilot, Kriegsgefangener und Sklave. An diesem Morgen jedoch waren die anderen Wolkenflieger alle in der Zitadelle, um die fremden Besucher zu bestaunen. Theo hatte gewusst, dass er den Himmel für sich allein haben würde, und es schon beim Aufwachen kaum erwarten können, sich wieder in die Lüfte zu schwingen.
Wie ein Falke glitt er im Wind dahin und schaute zu, wie sein Schatten über die sonnenbeschienenen Ausläufer des Berges schoss. Echte Falken, die unter ihm in der glasklaren Luft schwebten, wichen ihm vor Schreck und Empörung keckernd aus, als er vorbeisauste, ein schlanker schwarzer Junge mit himmelblauem Flügel. Ein Eindringling.
Theo vollführte einen Looping und wünschte, Wren könnte ihn sehen. Aber Wren war weit weg, irgendwo auf den Vogelpfaden, die sie im Luftschiff ihres Vaters bereiste. Nach ihrer Flucht von Wolke Sieben, dem schwebenden Palast von Brightons Bürgermeister, hatten sie die Traktionsstadt Kom Ombo angesteuert, wo Wren Theo geholfen hatte, eine Koje an Bord eines nach Süden fahrenden Frachters zu finden. Auf dem Kai, während das Luftschiff sich zum Ablegen bereitmachte, hatten sie sich voneinander verabschiedet, und er hatte sie geküsst. Und obwohl Theo schon andere Mädchen geküsst hatte, darunter viel hübschere als Wren, konnte er Wrens Kuss nicht vergessen. In den unerwartetsten Momenten – so wie jetzt – kehrten seine Gedanken wieder dorthin zurück. Als er sie küsste, waren all ihr Lachen und ihr sarkastischer Humor verschwunden, und sie war zittrig und ernst geworden und so still, als lausche sie angestrengt auf etwas, das er nicht hören konnte. Einen Augenblick war er drauf und dran gewesen, ihr zu sagen, dass er sie liebe und dass sie mit ihm kommen solle, oder zu fragen, ob er bei ihr bleiben könne – doch Wren war so besorgt um ihren Vater, der eine Art Herzanfall erlitten hatte, und so wütend auf ihre Mutter, die sie im Stich gelassen hatte und mit Wolke Sieben in der Wüste abgestürzt war, dass er das Gefühl gehabt hätte, ihre Situation auszunutzen. Seine letzte Erinnerung an sie war, wie er zu ihr hinunterschaute, als das Luftschiff in den Himmel aufstieg, und sie ihm nachwinkte und dabei kleiner und kleiner wurde, bis sie ganz verschwand.
Sechs Monate war das her! Schon ein halbes Jahr … Es wurde höchste Zeit, dass er aufhörte, ständig an sie zu denken.
Also dachte er eine Weile an gar nichts, sondern kurvte und segelte im übermütigen Wind nach Westen, mit einem grünen Berg zwischen sich und Zagwa, an dem über den Kronen des Nebelwalds Fetzen und Fahnen aus weißem Dunst wehten.
Ein halbes Jahr. Die Welt hatte sich in dieser Zeit sehr verändert. Es hatte jähe Erschütterungen gegeben wie von einem Zusammenstoß tektonischer Platten, bei dem sich die Spannungen aus den langen Jahren des vom Grünen Sturm entfesselten Krieges schlagartig entluden. Begonnen hatte es mit dem Tod von Stalker Fang. Jetzt gab es einen neuen Herrn in der Jadepagode, General Naga, der in dem Ruf stand, hart und unnachgiebig zu sein. Kaum war er zum Anführer ernannt worden, hatte er den Vormarsch der Pangermanischen Traktionsstadtgesellschaft in den Rostigen Marschen gestoppt und die slawischen Städte zerstört, die den Grünen Sturm seit Jahren an der Nordgrenze seines Hoheitsgebiets gepiesackt hatten. Doch dann hatte er zum Erstaunen der ganzen Welt seine Luftflotten zurückbeordert und einen Waffenstillstand mit den Traktionsstädten geschlossen. Es kursierten Gerüchte, dass der Grüne Sturm politische Gefangene freiließ und besonders strenge Gesetze wieder aufhob; es wurde sogar gemunkelt, dass Naga vorhabe, den Grünen Sturm aufzulösen und die alte antitraktionistische Liga wiederzubeleben. Nun hatte er eine Delegation geschickt, um mit der Königin und dem Stadtrat von Zagwa zu verhandeln – eine Delegation unter der Leitung seiner eigenen Ehefrau, Lady Naga.
Sie war der Grund, weshalb Theo im Morgengrauen losgezogen war, um seinen alten Drachen in die luftigen Höhen über der Stadt aufsteigen zu lassen. Heute sollten die Gespräche beginnen, und sein Vater, seine Mutter und seine Schwestern hatten sich in die Zitadelle begeben, um einen Blick auf die Fremden zu erhaschen. Sie waren aufgeregt und hoffnungsvoll. Aus Abscheu vor der Doktrin des totalen Krieges und den Armeen aus wiedererweckten Leichen hatte Zagwa nach der Machtübernahme des Grünen Sturms die antitraktionistische Liga verlassen. Aber jetzt (so war es Theos Vater zu Ohren gekommen) schlug General Naga einen offiziellen Frieden mit den Barbarenstädten vor, und es gab sogar Hinweise, dass er bereit war, die Stalker zu verschrotten. Wenn er das wirklich tat, würden sich Zagwa und die anderen afrikanischen Statikstädte vielleicht wieder an der Verteidigung der letzten grünen Gegenden der Erde beteiligen. Theos Vater legte Wert darauf, dass seine Frau und seine Kinder diesen historischen Augenblick in der Zitadelle miterlebten, und noch dazu war er neugierig auf Lady Naga, die, wie er gehört hatte, recht jung und überaus schön war.
Theo hingegen hatte vom Grünen Sturm mehr als genug gesehen und glaubte kein Wort von dem, was Naga oder dessen Gesandte behaupteten. Während sich also ganz Zagwa in den Gärten der Zitadelle drängte, stieg er in der goldenen Luft auf und ab und dachte an Wren.
Da bewegte sich etwas unter ihm, wo sich nichts hätte bewegen dürfen, nichts außer Vögeln jedenfalls, und diese Dinger waren zu groß, um Vögel zu sein. Sie stiegen aus dem weißen Nebel über dem Wald auf, zwei winzige Luftschiffe, die Hüllen mit schwarz-gelben Wespenstreifen bemalt. Die kleinen Gondeln und stromlinienförmigen Triebwerksgehäuse waren Theo, der während seiner Ausbildung beim Grünen Sturm die Erkennungsmerkmale sämtlicher feindlicher Schiffe hatte auswendig lernen müssen, auf Anhieb vertraut. Es waren Cosgrove Tigermücken, die von Mitgliedern der Traktionsstadtgesellschaft als Kampfbomber eingesetzt wurden.
Aber was machten sie hier? Dass die deutschen Traktionsstädte Schiffe nach Afrika schickten, geschweige denn so weit in den Süden, hatte Theo noch nie gehört.
Und dann dachte er: Sie sind wegen der Verhandlungen hier. Die Raketen, die er wie Messer in den Halterungen unter den Gondeln aufblitzen sah, würden schon bald auf die Zitadelle zurasen, in der sich Nagas Ehefrau befand. Und die Königin von Zagwa. Und Theos Familie.
Er musste sie aufhalten.
Es war seltsam, wie ruhig er blieb, als er das dachte. Gerade eben noch hatte er die Sonne und die klare Luft genossen und dabei tiefen Frieden empfunden, und jetzt sah er seinem Tod entgegen – und trotzdem kam ihm das ganz natürlich vor, als gehörte es zu diesem Morgen wie der Wind und der Sonnenschein. Er ließ den Drachen nach vorn kippen und tauchte im Sinkflug zu der hinteren Tigermücke hinunter. Die Aeronauten hatten ihn noch nicht gesehen. Die Tigermücken waren Zwei-Mann-Schiffe, und er bezweifelte, dass die Besatzung mit Gefahr von oben rechnete. Der Drachen trug ihn immer näher heran, bis er erkennen konnte, wie die Farbe von den Triebwerksgehäusen abblätterte. Auf den großen Steuerrudern prangte das Symbol der Traktionsstadtgesellschaft, eine gepanzerte Faust auf Rädern. Unwillkürlich empfand Theo so etwas wie Bewunderung für diese tollkühnen Piloten, die sich in ihren Schiffen so weit in antitraktionistisches Gebiet hineinwagten.
Er stemmte sich zurück und bremste den Drachen ab, wie er es vor Jahren gelernt hatte, als er mit seinen Schulkameraden in den Aufwinden über dem Liemba-See geflogen war. Diesmal jedoch landete er nicht im Wasser, sondern auf der harten, abgerundeten Oberseite des Luftschiffrumpfes. Der Aufprall kam ihm furchtbar laut vor, aber er beruhigte sich damit, dass die Männer in der Gondel über dem Dröhnen ihrer großen Triebwerke ganz sicher nichts gehört hatten. Er befreite sich aus dem Gurtzeug und versuchte, seinen Drachen unter den Leinen zu verstauen, die quer über die Hülle gespannt waren, aber der Wind riss ihn ihm aus den Händen, und er musste loslassen, um nicht mitgezogen zu werden. An die Leinen geklammert, sah er hilflos zu, wie der Drachen davontrudelte.
Theo hatte sein einziges Fluchtmittel verloren, doch noch bevor er sich darüber Gedanken machen konnte, klappte neben ihm eine Luke auf, und ein lederbehelmter Kopf ploppte hervor und starrte ihn durch eine getönte Fliegerbrille an. Also hatten sie ihn doch gehört. Er warf sich nach vorn, und er und der Aeronaut kippten zusammen durch die Luke, stürzten einen kurzen Aufstieg hinunter und krachten mit voller Wucht auf einen metallenen Laufsteg zwischen zwei Gaszellen. Theo rappelte sich schnell auf, aber der Aeronaut blieb benommen liegen. Es war eine Frau, dem Aussehen nach eine Thai oder Laotin. Asiaten, die für die deutschen Traktionsstädte kämpften? Das war Theo neu. Aber hier hatte er eindeutig eine vor sich, in der Uniform der Traktionsstadtgesellschaft und in einem ihrer Schiffe, das mit vollen Raketenhaltern auf Zagwa zuhielt.
Das war alles höchst rätselhaft, aber Theo hatte keine Zeit, sich darüber zu wundern. Er knebelte die Aeronautin mit ihrem eigenen Schal, zog dann das Messer aus ihrem Gürtel und schnitt ein Stück Seil aus dem Netz um die Gaszellen, um ihre Hände am Geländer des Laufstegs festzubinden. Gerade als er die letzten Knoten festzurrte, kam sie zu sich, wand sich in den Fesseln und funkelte ihn durch ihre gesprungenen Brillengläser wütend an.
Er ließ sie weiterzappeln, rannte den Steg entlang zu einer weiteren Leiter und kletterte im Schatten der Gaszellen in die Tiefe. Das Geräusch der Motoren wurde immer lauter, bis es die erstickten Flüche von oben übertönte. Als er sich in die Gondel fallen ließ, blendete ihn das Licht von den Fenstern. Er blinzelte und sah den Piloten mit dem Rücken zu ihm an den Steuerhebeln stehen.
»Was war das?«, fragte der Mann auf Airsperanto. Airsperanto? Das war die Verkehrssprache der Luftschiffer, aber Theo hatte immer gedacht, in der Traktionsstadtgesellschaft würde Neudeutsch gesprochen …
»Ein Vogel?«, fragte der Mann, betätigte einen seiner Hebel und drehte sich um. Er war ebenfalls asiatischer Herkunft. Theo stieß ihn gegen die Wand und drohte ihm mit dem Messer.
Draußen kam hinter einem Bergsporn die Stadt in Sicht. Die Besatzung der Tigermücke vor ihnen, nicht ahnend, was an Bord ihres Schwesterschiffs vor sich ging, legte die Steuerruder um und nahm Kurs auf die Zitadelle.
Theo zwang den Aeronauten auf den Pilotensitz und tastete nach den Schaltern der Funkanlage. Genau so ein Gerät hatte er in seiner Zeit beim Grünen Sturm in der Führerzelle seiner Tumblerbombe gehabt. Er schrie ins Mikrophon: »Zagwa! Zagwa! Ihr werdet angegriffen! Zwei Luftschiffe! – Ich bin in dem hinteren!«, fügte er hastig hinzu, als neben ihm die ersten Feuerbälle zerbarsten und Granatsplitter so heftig gegen die gepanzerte Gondel prasselten, dass die Scheiben Risse bekamen.
Der Aeronaut nutzte diesen Augenblick, um zur Gegenwehr überzugehen. Er stemmte sich aus dem Sitz hoch und rammte den Kopf gegen Theos Brust. Theo ließ das Mikrophon fallen, und der Pilot packte seine Messerhand. Sie rangen um die Waffe, bis plötzlich überall Blut war, und als Theo genauer hinsah, stellte er fest, dass es von ihm kam. Der Pilot stach noch einmal zu, und Theo brüllte vor Zorn, Angst und Schmerz laut auf und versuchte, die Klinge zu fassen zu bekommen. Das wutverzerrte Gesicht seines Gegners nahm ihn so in Beschlag, dass er nicht einmal bemerkte, wie das Luftschiff vor ihnen in einem gelben Feuerblitz explodierte. Die Druckwelle erwischte ihn völlig unerwartet; alle Fenster der Gondel zersprangen, und im nächsten Moment krachten und klirrten Trümmer gegen das Schiff. Ein abgerissenes Propellerblatt sauste wie eine Sense durch die Gondel. Der Pilot wurde durch das klaffende Loch gesogen, wo eben noch die Seitenwand gewesen war, und hinterließ Theo nur das Nachbild seiner ungläubig aufgerissenen Augen.
Theo kämpfte sich zur Funkanlage vor und griff nach dem herabbaumelnden Mikrophon. Er wusste nicht, ob es noch funktionierte, aber er brüllte trotzdem hinein, bis der Blutverlust, die Erschöpfung und die nackte Angst ihn übermannten. Das Letzte, was er im Fallen wahrnahm, waren Stimmen, die ihm sagten, dass Hilfe unterwegs sei. Von der Zitadelle stiegen zwei parallele Kondensstreifen auf. Darüber erhoben sich, blau wie Prachtlibellen, die Luftschiffe des Zagwanischen Fliegerkorps in den goldenen Himmel.
2Herzensangelegenheiten
Absender: Wren Natsworthy
LMS Jenny Haniver
Peripatetiapolis
24. April 1026 TZ
Lieber Theo,
ich hoffe, das Leben in Zagwa ist nicht zu öde? Falls doch, dachte ich, vielleicht könnte ich Dir mal einen richtigen Brief schreiben und erzählen, was ich alles so gemacht habe. Kaum zu glauben, dass es schon so lange her ist … Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen – Brighton und Wolke Sieben und das mit Mum …
Kurz nachdem Du nach Zagwa abgereist bist, hat uns auch Professor Pennyroyal verlassen. Er hat Freunde in anderen Städten, bei denen er sich einnisten wollte. Aus dem Wrack von Wolke Sieben hat er nichts retten können, nur seine Klamotten, und die waren zu extravagant, um auf dem Basar von Kom Ombo viel einzubringen. Ich hatte fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Er war uns ja durchaus eine Hilfe, auf dem Weg nach Kom Ombo und später im Krankenhaus, wo er den Ärzten so lange gedroht hat, bis sie Dad umsonst behandelt haben. Aber er wird schon durchkommen, denke ich (Pennyroyal, meine ich). Außerdem will er ein neues Buch schreiben, das von der Schlacht in Brighton handelt. Er hat mir versprochen, dass er nicht lügen wird, vor allem nicht über Dich oder mich, aber das war wohl eins dieser Versprechen, die er vergessen wird, sobald er sich an seine Schreibmaschine setzt.
Dad geht es so weit gut. Die Ärzte in Kom Ombo haben ihm grüne Tabletten gegeben, die er gegen die Schmerzen nehmen kann, und seit dieser schrecklichen Nacht auf Wolke Sieben hat er keine Anfälle mehr gehabt. Aber er wirkt irgendwie furchtbar alt – und furchtbar traurig. Wegen Mum natürlich. Er hat sie wirklich geliebt, trotz ihrer Art. Dass sie nicht mehr bei ihm ist und er nicht mal weiß, ob sie überhaupt noch lebt, macht ihn todunglücklich, obwohl er versucht, tapfer zu sein.
Ich dachte ja, er würde sofort mit mir nach Anchorage-in-Vineland heimkehren wollen, sobald er wieder auf den Beinen ist, aber bislang hat er das mit keinem Wort erwähnt. Also reisen wir seitdem auf den Vogelpfaden umher, sehen ein bisschen von der Welt und treiben Handel – vor allem mit Antiquitäten und Old-Tech, aber harmlose Sachen, nicht so was wie dieses grässliche Zinnbuch! Wir verdienen ganz gut damit, jedenfalls gut genug, dass wir das Schiff neu streichen und die Triebwerke überholen lassen konnten. Wir haben es wieder in Jenny Haniver umbenannt. So hieß es nämlich, bevor Professor Pennyroyal es vor vielen Jahren von Mum und Dad geklaut hat. Zuerst waren wir nicht sicher, ob es gefährlich sein könnte, aber ich glaube nicht, dass sich noch irgendjemand an den Namen von Stalker Fangs erstem Schiff erinnert, und selbst wenn, interessiert es wohl keinen.
Hast Du von dem Waffenstillstand gehört? (Ich fand ja gleich, dass General Naga ein anständiger Mensch ist. Als die Soldaten des Grünen Sturms uns auf Wolke Sieben gefangen genommen haben, waren sie ziemlich brutal, und Naga hat sie davon abgehalten, uns zu misshandeln. Es ist gut zu wissen, dass der neue Anführer des Grünen Sturms sich klar gegen solche rüden Methoden ausspricht.) Also jedenfalls sind hier alle ganz begeistert wegen des Waffenstillstands und hoffen, dass der Krieg damit vorbei ist, und das hoffe ich auch.
An das Leben als Lufthändlerin habe ich mich inzwischen ganz gut gewöhnt. Du würdest staunen, wie sehr ich mich verändert habe. Ich habe mir die Haare nach der neuesten Mode schneiden lassen, so ein schiefer Schnitt, bei dem die Haare auf der einen Seite bis zum Kinn gehen und auf der anderen nur bis zum Ohr. Ich will ja nicht eitel klingen, aber es sieht extrem schick aus, auch wenn ich mit der Frisur manchmal das Gefühl habe, als würde ich auf einem Hang stehen. Außerdem habe ich neue, hohe Stiefel und eine Lederjacke, nicht so einen langen Mantel, wie Daddy und die anderen Oldschool-Aeronauten ihn tragen, sondern so tunikamäßig, mit rotem Seidenfutter und einer Art Zipfeln unten am Saum, die Schluppen oder Flappen oder so ähnlich heißen. Und während ich das schreibe, sitze ich in einem Café hinter dem Lufthafen von Peripatetiapolis, fühle mich durch und durch wie eine Aeronautin und genieße es einfach, an Bord einer Stadt zu sein. Früher konnte ich mir nie vorstellen, wie es sich in richtigen Städten lebt, wo ich doch nur mein verschlafenes Kaff kannte. Aber seit ich so viel Zeit auf Städten verbringe, habe ich sie lieben gelernt – so viele Menschen, so viel Leben, und wie die Motoren die Gehwege wummern lassen, als wäre ganz Peripatetiapolis ein gewaltiges, lebendiges Tier. Ich warte auf Dad, der auf die oberen Decks gefahren ist, um nachzufragen, ob die Ärzte hier vielleicht bessere Pillen auf Lager haben als die, die man ihm in Kom Ombo verschrieben hat. (Er wollte natürlich nicht gehen, aber ich habe ihn irgendwann dann doch dazu überredet!) Und wie ich hier so saß, musste ich an Dich denken, wie so oft, und ich dachte …
So war das nichts, beschloss Wren. Sie knüllte das Blatt zusammen und pfefferte es in einen Abfalleimer in der Nähe. Mittlerweile war sie ziemlich treffsicher. Sie hatte Theo schon an die zwanzig Briefe geschrieben, und bislang hatte sie keinen einzigen in die Post gegeben. Zu Weihnachten hatte sie eine Karte geschickt, denn obwohl Theo nicht sonderlich religiös war, lebte er doch in einer christlichen Stadt und feierte wahrscheinlich deren seltsame alte Feste alle mit. Aber außer »Frohe Weihnachten« und ein paar Zeilen, wie es ihr und ihrem Dad ging, hatte sie nichts geschrieben.
Das Problem war, dass Theo sie wahrscheinlich längst vergessen hatte. Selbst wenn er sich an sie erinnerte, interessierte er sich bestimmt nicht für ihre Kleidung oder ihre Frisur. Und wie sie vom Stadtleben geschwärmt hatte, würde ihn wohl eher schockieren, denn er war überzeugter Antitraktionist.
Aber sie konnte ihn nicht vergessen. Wie tapfer er auf Wolke Sieben gewesen war. Und dieser Abschiedskuss auf dem Luftkai in Kom Ombo, zwischen all dem ölverschmierten Tauwerk, Bergen von Lastzug-Kupplungen, den brüllenden Hafenarbeitern und dröhnenden Motoren. Es war Wrens erster Kuss gewesen. Sie hatte nicht genau gewusst, wie das ging; sie war nicht sicher, was sie mit ihrer Nase anfangen sollte; als ihre Zähne aneinanderstießen, bekam sie Angst, dass sie alles falsch machte. Theo hatte gelacht und gesagt, diese Küsserei sei schon eine komische Angelegenheit, und sie hatte gesagt, mit ein bisschen Übung hätte sie den Dreh vielleicht bald raus, doch da rief der Kapitän seines Luftschiffs schon: »Alle an Bord!«, und begann seine Ankerklemmen zu lösen, und sie hatten keine Zeit mehr gehabt …
Das war vor sechs Monaten gewesen. Theo hatte einmal geschrieben – der Brief hatte Wren im Januar in einer schäbigen Luftkarawanserei in den Tannhäuser-Bergen erreicht –, dass er es wohlbehalten zurück nach Hause geschafft habe und von seiner Familie willkommen geheißen worden sei »wie der verlorene Sohn« (was offenbar auch etwas Christliches war). Aber Wren hatte es nie fertiggebracht zu antworten.
»So ein Mist!«, sagte sie und bestellte einen weiteren Kaffee.
Tom Natsworthy, Wrens Vater, hatte schon oft dem Tod ins Auge geblickt und viele furchteinflößende Situationen erlebt, aber nie hatte ihn eine so kalte Angst gepackt wie jetzt.
Er lag mit nacktem Oberkörper auf einem kühlen Stahltisch in der Praxis eines Herzspezialisten auf Deck zwei von Peripatetiapolis. Über ihm drehte eine Maschine mit einem langen, mehrgliedrigen hydraulischen Hals ihren metallischen Kopf hin und her und untersuchte ihn mit wissender Miene. Tom war ziemlich sicher, dass die grün leuchtenden Linsen an ihrem beweglichen Ende von einem Stalker stammten. Er vermutete, dass Stalker-Bauteile heutzutage leicht zu bekommen waren. Eigentlich sollte er froh sein, dass all die Kriegsjahre auch etwas Gutes hervorgebracht hatten, neue medizinische Verfahren und Diagnoseapparate wie diesen hier. Doch als der Kopf aus mattem Stahl zu seinem Torso hinabsank und er die Maschinerie hinter den glänzenden Augen klicken und surren hörte, dachte er unweigerlich an den alten Stalker Shrike, der ihn und Hester in den Außenlanden gejagt hatte, damals kurz vor Londons Untergang.
Als es vorbei war und Dr. Chernowyth seine Maschine abschaltete und aus seiner kleinen, mit Blei verkleideten Kabine kam, konnte er Tom nichts sagen, was dieser nicht bereits geahnt hatte. Infolge der Kugel, mit der Pennyroyal ihn vor vielen Jahren in Anchorage verwundet hatte, leide er an Herzschwäche. Es werde sich stetig verschlimmern, und irgendwann werde er daran sterben. Er habe noch ein, zwei Jahre zu leben, vielleicht fünf, nicht mehr.
Der Arzt schürzte die Lippen, schüttelte den Kopf und riet ihm, es ruhiger angehen zu lassen, aber Tom lachte nur. Wie konnte man im Lufthandel die Dinge ruhiger angehen lassen? Das ginge höchstens, wenn er nach Anchorage-in-Vineland heimkehrte, aber nach dem, was er über Hester erfahren hatte, konnte er sich dort nie wieder blicken lassen. Tom selbst war schuldlos, schließlich hatte nicht er die Eisstadt an die Kaperjäger von Arkangel verraten oder war mordend durch ihre verschneiten Straßen gezogen, aber er schämte sich für seine Frau und kam sich dumm vor, dass er so lange mit ihr zusammengelebt hatte, ohne ihre Lügen zu durchschauen.
Davon abgesehen würde Wren es ihm nie verzeihen, wenn er jetzt mit ihr nach Hause fuhr. Sie war genauso abenteuerlustig wie er in ihrem Alter. Sie genoss das Leben auf den Vogelpfaden, und sie zeigte Talent als Aeronautin. Er würde bei ihr bleiben und weiter Handel treiben, sie mit allen Tücken und Freuden der Luftfahrt vertraut machen und sein Bestes tun, um sie vor Schwierigkeiten zu bewahren. Und wenn die Todesgöttin kam, um ihn ins Sonnenlose Land zu holen, würde er Wren die Jenny Haniver vermachen, so dass sie selbst entscheiden konnte, welches Leben sie wollte, den Frieden von Vineland oder die Freiheit über den Wolken. Die Neuigkeiten aus dem Osten waren vielversprechend. Wenn der Waffenstillstand hielt, würde es bald reichlich Gelegenheit zum Handeln geben.
Kaum hatte er die Praxis von Dr. Chernowyth verlassen, fühlte Tom sich schon besser. Hier draußen, unter dem Abendhimmel, schien es ihm undenkbar, dass er sterben würde. Die Stadt schaukelte sanft, während sie an der felsigen Westküste der Großen Jagdgründe entlang nach Norden rumpelte. Draußen auf dem im Licht des Sonnenuntergangs silbern schimmernden Meer tuckerte auf gleicher Höhe ein Fischerstädtchen unter einer Wolke von Möwen dahin. Tom blieb eine Weile an der Reling stehen und bewunderte den Ausblick, dann nahm er einen Aufzug hinunter zum Hauptdeck, schlenderte über den Markt hinter dem Lufthafen und erinnerte sich an seinen ersten Besuch in Peripatetiapolis vor zwanzig Jahren, mit Hester und Anna Fang. An einem dieser Stände hatte er Hester einen roten Schal gekauft, damit sie ihr vernarbtes Gesicht nicht immer hinter der Hand verstecken musste …
Aber er wollte nicht an Hester denken. Immer wenn seine Gedanken zu ihr wanderten, erinnerte er sich unweigerlich daran, wie sie auseinandergegangen waren, und das, was sie getan hatte, machte ihn so wütend, dass sein Herz hämmerte und sich zusammenkrampfte. Er konnte es sich nicht mehr leisten, an Hester zu denken.
Er ging Richtung Hafen und überlegte sich, was er Wren über seinen Arztbesuch erzählen würde. (»Alles ganz unbedenklich. Eine Operation ist nicht nötig.«) Als er Pondicherry’s Old-Tech Auction Rooms passierte, blieb er stehen, um einige Händler vorbeizulassen, die aus den Auktionssälen strömten. Ein Gesicht kam ihm bekannt vor – eine recht hübsche Frau, etwa so alt wie er. Offenbar war sie bei der Auktion erfolgreich gewesen, denn sie trug ein großes, schweres Paket. Sie sah Tom nicht, und er grübelte im Weitergehen, wie sie hieß und wo er ihr schon einmal begegnet war. Katie vielleicht? Nein, Clytie. Das war es. Clytie Potts.
Er hielt an und drehte sich ungläubig um. Es konnte unmöglich Clytie gewesen sein. Clytie war in der Historikergilde im Jahrgang über ihm gewesen, als London zerstört wurde. Wie alle anderen in der Stadt war sie bei der Explosion von MEDUSA umgekommen. Sie konnte einfach nicht in Peripatetiapolis herumspazieren. Sein Gedächtnis spielte ihm einen Streich.
Aber sie hatte haargenau so ausgesehen wie Clytie!
Er machte kehrt und ging ein paar Schritte zurück. Die Frau stieg eilig eine Treppe zu der Ebene hinauf, wo die Luftschiffe vor Anker hingen. »Clytie!«, brüllte Tom, und sie wandte ihm den Kopf zu. Doch, sie war es, da war er sich auf einmal ganz sicher, und er lachte vor Glück und Überraschung laut auf und rief noch einmal: »Clytie! Ich bin’s! Tom Natsworthy!«
Eine Gruppe Händler drängte an ihm vorbei und versperrte ihm die Sicht. Als sie vorüber waren, war Clytie verschwunden. Er rannte auf die Treppe zu und ignorierte das warnende Stechen in seiner Brust. Fieberhaft überlegte er, wie Clytie MEDUSA überlebt haben konnte. War sie damals gerade außerhalb der Stadt gewesen? Er hatte von anderen Londonern gehört, die der Katastrophe entronnen waren, aber das waren alles Mitglieder der Händlergilde, die sich zum Zeitpunkt der Explosion weit weg auf anderen Städten aufgehalten hatten. Auf dem Korsarenkliff war Hester diesem widerwärtigen Ingenieur Popjoy begegnet, aber der war im Bauchraum gewesen, als MEDUSA die Stadt zerstört hatte …
Er zwängte sich durch die vielen Menschen auf der Treppe und sah Clytie zwischen den Anlegeplätzen für Langzeitbesucher vor ihm weglaufen. So wie er ihr nachgebrüllt hatte, konnte er ihr das auch nicht verübeln. Wahrscheinlich hatte sie ihn aus der Entfernung nicht wiedererkannt und ihn für einen Spinner gehalten oder für einen Konkurrenten, der wütend war, dass sie ihn bei der Auktion überboten hatte. Er trabte ihr nach, um das Missverständnis aufzuklären, und sah sie hastig eine weitere Treppe zu Anlegeplatz sieben hinauflaufen, wo ein kleines, windschnittiges Luftschiff ankerte. Am Fuß der Treppe hielt er kurz inne, um zu lesen, was dort mit Kreide auf die Anzeigetafel geschrieben war: Das Schiff hieß Archaeopteryx, war in Airhaven registriert und wurde von Cruwys Morchard geführt. Daraufhin stieg er beherrscht, ohne zu rennen oder zu brüllen oder sonst irgendetwas zu tun, was eine Dame erschrecken könnte, hinter ihr her. Als ausgebildete Historikerin hatte Clytie Potts natürlich keine Schwierigkeiten gehabt, auf einem Old-Tech-Handelsschiff anzuheuern. Bestimmt hatte Cruwys Morchard sie als fachkundige Einkäuferin angestellt, und aus diesem Grund war sie auch im Auktionshaus gewesen.
Oben angelangt, blieb er kurz stehen, um zu verschnaufen. Sein Herz pochte wie wild. Über ihm ragte die Archaeopteryx in der Dämmerung auf. Sie war in Tarnfarben gestrichen: die Gondel und die Unterseiten von Rumpf und Triebwerken himmelblau, die Oberseiten in verwirrenden, grün-braun-grauen geometrischen Mustern. Am Fuß der Laufplanke warteten zwei Besatzungsmitglieder in einem fahlen Lichtkreis. Sie wirkten grobschlächtig und waren schäbig gekleidet, wie Plunderer aus den Außenlanden. Als Clytie auf sie zuging, hörte Tom einen der Männer rufen: »Hast du sie gekriegt?«
»Hab sie«, bestätigte Clytie und deutete mit dem Kopf auf das Paket, das sie trug. Der andere Mann trat vor, um ihr damit zu helfen, und entdeckte dabei Tom hinter ihr. Clytie sah ihm die Überraschung wohl an und drehte sich um.
»Clytie?«, sagte Tom. »Ich bin’s, Tom Natsworthy. Gehilfe dritter Klasse, von der Historikergilde. Aus London. Ich weiß, du erkennst mich wahrscheinlich nicht wieder. Es ist … mal überlegen … fast zwanzig Jahre her! Und du musst mich für tot gehalten haben …«
Im ersten Moment war er sicher, dass sie ihn sehr wohl erkannt hatte und dass sie sich freute, ihn zu sehen, doch dann veränderte sich ihre Miene. Sie wich einen Schritt zurück und warf den Männern an der Planke einen Blick zu. Einer von ihnen – ein hochgewachsener, hagerer Mann mit kahlgeschorenem Schädel – legte die Hand an sein Schwert, und Tom hörte ihn fragen: »Belästigt Sie der Kerl, Ms Morchard?«
»Ist schon gut, Lurpak«, sagte Clytie und bedeutete ihm zu bleiben, wo er war. Sie kam wieder ein Stück auf Tom zu und meinte freundlich: »Es tut mir leid, Sir. Ich fürchte, da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin Cruwys Morchard, Kommandantin dieses Schiffs. Ich kenne niemanden aus London.«
»Aber …«, begann Tom. Peinlich berührt und verwirrt, musterte er ihr Gesicht. Er war sicher, dass sie Clytie Potts war. Sie hatte etwas zugenommen, genau wie er, und ihr ehemals dunkles Haar war inzwischen von silbernen Strähnen durchzogen, als hingen Spinnweben darin, aber ihr Gesicht war noch dasselbe … bis auf die Stelle zwischen ihren Augenbrauen, wo Clytie Potts mit einigem Stolz das tätowierte blaue Auge der Historikergilde getragen hatte. Dort war nichts mehr.
Tom kamen Zweifel. Immerhin war es zwanzig Jahre her. Vielleicht täuschte er sich. Er sagte: »Verzeihen Sie, aber Sie sehen ihr wirklich ähnlich …«
»Keine Ursache«, sagte sie mit einem liebenswürdigen Lächeln. »Ich habe eben ein Allerweltsgesicht. Ich werde ständig verwechselt.«
»Sie sehen ihr wirklich ähnlich«, sagte Tom noch einmal vage hoffnungsvoll, als könnte sie sich plötzlich darauf besinnen, dass sie doch Clytie Potts war.
Sie verbeugte sich und wandte sich ab. Ihre Männer behielten Tom im Auge, während sie ihr mit dem Paket die Laufplanke hinaufhalfen. Es gab nichts mehr zu sagen, also wiederholte er noch einmal: »Verzeihung«, wandte sich seinerseits ab und ging mit hochrotem Kopf davon. Er wollte sich zu seinem eigenen Schiff begeben, war aber noch keine zwanzig Schritte weit gekommen, als er hinter sich die Motoren der Archaeopteryx aufheulen hörte. Er sah dem Luftschiff nach, wie es sich in den Abendhimmel erhob, rasch Fahrt aufnahm und den Luftraum der Stadt in östlicher Richtung verließ.
Was merkwürdig war, denn Tom war sicher, auf der Tafel am Anlegeplatz gelesen zu haben, dass es noch zwei Tage in Peripatetiapolis bleiben würde.
3Die geheimnisvolle Ms Morchard
»Ich bin sicher, dass sie es war!«, sagte Tom wenig später, als sie im Jolly Dirigible zu Abend aßen. »Sie war natürlich älter, und das Gildenzeichen auf ihrer Stirn fehlte, was mich ein bisschen irritiert hat. Aber Tätowierungen kann man doch entfernen, oder?«
Wren sagte: »Reg dich nicht so auf, Dad …«
»Ich rege mich nicht auf, ich bin nur neugierig! Wenn es Clytie war, wie kann es sein, dass sie noch lebt? Und warum hat sie sich als jemand anderes ausgegeben?«
In dieser Nacht bekam er kaum ein Auge zu, und auch Wren lag in ihrer kleinen Kabine oben im Rumpf der Jenny lange wach und hörte, wie er durch die Gondel tappte und so leise wie möglich in der Kombüse herumhantierte, um sich einen seiner Drei-Uhr-morgens-Tees zu machen.
Zunächst machte sie sich Sorgen um ihn. Sie hatte ihm seine Version der Diagnose des Herzspezialisten nicht so recht abgenommen und war ziemlich sicher, dass er nicht die ganze Nacht aufbleiben und sich über geheimnisvolle Aeronautinnen den Kopf zerbrechen sollte. Aber nach einer Weile begann sie zu überlegen, ob seine Begegnung mit der Frau nicht vielleicht auch ihr Gutes hatte. So lebendig wie vorhin beim Abendessen, als er von ihr erzählt hatte, war er Wren seit Monaten nicht mehr vorgekommen. Die Teilnahmslosigkeit, die er an den Tag legte, seit Mum sie verlassen hatte, war wie weggefegt, und er war wieder ganz der Alte gewesen, voller Fragen und Theorien. Wren konnte nicht sagen, woran das lag: ob es das Rätsel war, das ihn so reizte, oder die Verbindung zu seiner untergegangenen Heimatstadt oder ob Clytie Potts eine alte Flamme von ihm war. Aber was es auch sein mochte – es konnte ihm eigentlich nur guttun, zur Abwechslung mal über etwas anderes nachzugrübeln als über Mum.
Beim Frühstück am nächsten Morgen sagte sie: »Wir sollten der Sache nachgehen. Mehr über diese vermeintliche Cruwys Morchard in Erfahrung bringen.«
»Wie denn?«, fragte ihr Vater. »Die Archaeopteryx ist bestimmt schon hundert Meilen weit weg.«
»Du hast gesagt, dass sie im Auktionshaus was ersteigert hat«, sagte Wren. »Da könnten wir anfangen.«
Mr Pondicherry, ein Gentleman der korpulenten, aalglatten Sorte, schien noch korpulenter und aalglatter zu werden, als er von seinen Geschäftsbüchern aufblickte und Tom Natsworthy mit Tochter sein kleines Kontor betreten sah. Die Jenny Haniver hatte in dieser Saison schon mehrere wertvolle Stücke über ihn verkauft. »Mr Natsworthy!«, schnarrte er. »Miss Natsworthy! Wie schön, Sie zu sehen!« Er erhob sich, um sie zu begrüßen, und schob einen großen Wulst silbern bestickten Ärmelstoffs in die Höhe. Darunter kam eine dickliche braune Hand zum Vorschein, die Tom schüttelte. »Wie ist Ihr wertes Befinden? Ich hoffe, die Götter des Himmels waren Ihnen gewogen? Was haben Sie denn heute Schönes für mich?«
»Leider nur ein paar Fragen«, gestand Tom. »Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht etwas über eine freie Archäologin namens Cruwys Morchard sagen. Sie hat hier gestern etwas erworben …«
»Die Dame von der Archaeopteryx?«, überlegte Mr Pondicherry. »Ja, ja, die kenne ich gut. Aber ich kann Ihnen bedauerlicherweise keine Auskunft geben.«
»Natürlich«, sagte Tom, und: »Verzeihen Sie vielmals.«
Wren, die schon damit gerechnet hatte, holte ein kleines Stoffbündel aus ihrer Jackentasche und legte es auf Mr Pondicherrys Schreibtischunterlage. Der Auktionator schnurrte wie ein Kater, als er es auswickelte. In dem Schutzumschlag lag ein kompaktes, flaches Gehäuse aus silbrigem Metall, in das winzige rechteckige Felder mit nur noch schwach lesbaren Ziffern eingelassen waren.
»Ein Mobiltelefon der Damaligen«, sagte Wren. »Wir haben es letzten Monat einem Plunderer abgekauft, der nicht mal wusste, was das ist. Dad wollte es eigentlich privat verkaufen, aber er wäre sicher gern bereit, es bei Ihnen versteigern zu lassen, wenn …«
»Wren!«, sagte ihr Vater verblüfft.
Mr Pondicherry hatte den Kopf dicht über das Relikt gebeugt und klemmte sich eine Juwelierlupe ans Auge. »Oh, wie hübsch!«, sagte er. »So wunderbar erhalten! Jetzt, wo der Frieden vor der Tür steht, kommt der Handel mit solchen Liebhaberstücken so richtig in Schwung. Es heißt, General Naga habe keine Zeit mehr zum Kämpfen, seit er sich eine reizende junge Frau zugelegt hat. Fast so reizend wie Cruwys Morchard …« Er schaute zu Tom auf und zwinkerte. Das Auge hinter der Lupe wirkte riesenhaft vergrößert. »Nun gut. Nur unter uns: Ms Morchard war in der Tat gestern hier. Sie hat einen Restposten Kliest-Spulen erstanden.«
»Was um alles in der Welt will sie denn damit?«, wunderte sich Tom.
»Wer weiß?« Mr Pondicherry spreizte strahlend beide Hände, wie um zu sagen: Was kümmert es mich, was meine Kunden mit dem Krempel machen, den sie kaufen, solange ich meine Provision in der Tasche habe? »Praktischen Nutzen haben sie keinen mehr. Nur als Handelsware vermutlich. In der Branche ist Ms Morchard ja auch tätig. Sie handelt mit Old-Tech, und zwar recht erfolgreich, glaube ich. War schon als ganz junges Ding auf den Vogelpfaden unterwegs.«
»Hat sie irgendwann mal erwähnt, woher sie kommt?«, fragte Wren eifrig.
Mr Pondicherry dachte kurz nach. »Ihr Schiff ist in Airhaven registriert«, sagte er.
»Ja, das wissen wir. Ich meine, wissen Sie, wo sie aufgewachsen ist? Wo sie ausgebildet wurde? Wir glauben nämlich, dass sie aus London kommt.«
Der Auktionator schenkte ihr ein nachsichtiges Lächeln und zwinkerte Tom noch einmal zu, bevor er das antike Telefon in eine Seitenschublade seines Schreibtisches legte. »Ach, Mr N., was für romantische Ideen sich diese jungen Damen in den Kopf setzen! Also bitte, Ms Wren! Niemand kommt aus London!«
Danach tranken sie Kaffee auf der Dachterrasse eines Cafés und blickten über die endlose Ebene der Großen Jagdgründe hinweg nach Osten. Es war ein warmer, goldener Frühlingstag. Ein grüner Flor überzog die gewaltigen Fahrrillen und Kettenspuren, die andere Städte in der Erde hinterlassen hatten, und über ihnen sausten Mauersegler durch die Luft. Weit im Osten knabberte eine Schürferstadt an einer Hügelkette, die bis dahin wie durch ein Wunder verschont geblieben war.
»Das Verrückte ist«, sagte Tom nachdenklich, »ich bin mir sicher, dass ich diesen Namen schon mal gehört habe. Wenn ich nur wüsste, wo! Cruwys Morchard. Wahrscheinlich irgendwo auf den Vogelpfaden, damals …« Er schenkte Wren Kaffee nach. »Du hältst mich bestimmt für verrückt, dass ich mich so daran aufhänge. Aber der Gedanke, dass eine Historikerkollegin nach all den Jahren noch am Leben ist …«
Er konnte es nicht erklären. Seit einiger Zeit dachte er immer öfter an seine Jugendjahre im London Museum zurück. Die Vorstellung, dass die Erinnerung an diesen Ort mit ihm sterben würde, stimmte ihn traurig. Wenn tatsächlich noch ein weiterer Historiker überlebt hatte, jemand, der in denselben staubigen Ausstellungsräumen und nach Bienenwachs riechenden Fluren groß geworden war, der wie er in den Vorlesungen des alten Arkengarth gedöst und sich Chudleigh Pomeroys Klagen über die schlechten Stoßdämpfer des Gebäudes angehört hatte, dann wäre er von der Verantwortung befreit, der alleinige Träger dieser Erinnerungen zu sein. Das Echo der Dinge würde im Gedächtnis anderer Menschen bewahrt bleiben, wenn er einmal nicht mehr war.
»Eins verstehe ich nicht«, sagte Wren. »Warum gibt sie es nicht zu? Als Old-Tech-Händlerin könnte sie doch damit Eindruck schinden, dass sie aus London kommt und von der Historikergilde ausgebildet wurde.«
Tom zuckte mit den Schultern. »Ich habe es auch immer verschwiegen, wenn deine Mutter und ich gehandelt haben. London hatte damals keinen guten Ruf. Was die Ingenieursgilde getan hat, hat das Gleichgewicht der Welt erschüttert, vielen Städten Angst eingejagt und den Grünen Sturm an die Macht gebracht. Vermutlich hat sich Clytie deshalb einen anderen Namen zugelegt. Die Potts sind eine berühmte Londoner Familie, aus der seit Quirkes Zeiten Stadträte und Gildenoberste hervorgegangen sind. Clyties Großvater, der alte Pisistratus Potts, war viele Jahre lang Oberbürgermeister. Wenn man seine Londoner Herkunft verheimlichen will, wäre es keine gute Idee, mit einem Namen wie Clytie Potts aufzutreten.«
»Und was sind das für Dinger, die sie bei Pondicherry ersteigert hat?«, fragte Wren.
»Die Kliest-Spulen?«
»Davon hab ich noch nie gehört.«
»Aus gutem Grund«, sagte ihr Vater. »Sie stammen aus dem Elektrischen Weltreich, das um 10000 v.T. hier in diesen Breiten florierte, bevor es von der Blaumetall-Kultur verdrängt wurde.«
»Wozu sind sie denn gut?«
»Das weiß niemand«, sagte Tom. »Zanussi Kliest, der Londoner Historiker, der sie als Erster erforscht hat, behauptete, sie hätten dazu gedient, elektromagnetische Energie zu bündeln oder so etwas. Aber wie das praktisch funktioniert haben soll, hat man nie herausgefunden. Das Elektrische Weltreich war wohl eine technologische Sackgasse.«
»Also haben diese Spulen gar keinen Wert?«
»Nur als Sammlerstücke. Sie sind recht hübsch.«
»Was will Clytie Potts dann damit?«
Tom hob wieder die Schultern. »Ich nehme an, sie hat einen Abnehmer dafür. Vielleicht kennt sie einen Sammler.«
»Wir sollten ihr hinterherfahren«, sagte Wren.
»Aber wie? Ich habe mich gestern im Hafenamt erkundigt. Die Archaeopteryx hat keine Angaben zu ihrem Fahrziel gemacht.«
»Sie fährt bestimmt nach Osten«, sagte Wren mit der Zuversicht einer Amateurin, die schon ein halbes Jahr lang im Geschäft war und nun zu wissen glaubte, wie der Hase läuft. »Jetzt, wo der Waffenstillstand zu halten scheint, macht sich jeder auf den Weg nach Osten, und das sollten wir auch tun. Wenn wir Clytie Potts nicht finden, können wir immerhin dort handeln, und ich würde gern mal die Inneren Jagdgründe sehen. Wir könnten nach Airhaven fahren. Die Registrierbehörde dort müsste doch mehr Informationen über die vermeintliche Cruwys Morchard und ihr Schiff haben.«
Tom trank seinen Kaffee aus und sagte: »Ich dachte, dass du dieses Frühjahr vielleicht eher nach Süden willst. Dein Freund Theo ist doch noch in Zagwa, oder? Ich kann mir vorstellen, dass wir dort eine Landegenehmigung erhalten …«
»Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht«, sagte Wren beiläufig und lief rot an.
»Ich fand Theo sehr nett«, fuhr Tom fort. »Er ist ein guter Junge. Freundlich und wohlerzogen. Und gutaussehend …«
»Daddy!«, sagte Wren streng, weil sie sich nicht aufziehen lassen wollte. Dann gab sie nach und nahm seufzend seine Hand. »Hör zu. Er hatte nur deswegen so gute Manieren, weil er aus einer piekfeinen Familie kommt. Seine Eltern sind reich, und sie leben in einer Stadt, die zu einer großen Zivilisation gehörte, als unsere Vorfahren noch Tierfelle getragen und sich in den Ruinen Europas um die letzten Abfälle gezankt haben. Warum sollte sich Theo für mich interessieren?«
»Er wäre dumm, wenn er es nicht täte«, sagte ihr Vater, »und ich hatte nicht den Eindruck, dass er auf den Kopf gefallen ist.«
Wren stöhnte entnervt auf. Warum war Dad nur so schwer von Begriff? Theo war wieder in seiner Heimatstadt, umgeben von Mädchen, die viel hübscher waren als sie. Vielleicht hatte seine Familie ihn schon verheiratet, und wenn nicht, hatte er sie bestimmt längst vergessen. Jener Kuss, der ihr so viel bedeutet hatte, war für Theo wahrscheinlich nicht weiter von Belang gewesen. Sie würde sich nur zum Narren machen, wenn sie ihm bis nach Zagwa folgte, bei ihm anklopfte und erwartete, dass sie da weitermachten, wo sie aufgehört hatten.
»Lass uns nach Osten fahren, Dad. Und Clytie Potts suchen.«
4Lady Naga
Nachdem er tagelang auf den sanften Wellen von Schmerz und Betäubungsmitteln dahingetrieben war, kam Theo schließlich in einem sauberen weißen Raum des Krankenhauses von Zagwa zu sich. Durch die Schleier von Moskitonetzen und verschwommenen Erinnerungen sah er ein offenes Fenster und das Licht der Abendsonne auf den Bergen. Seine Mutter, sein Vater und seine Schwestern Miriam und Kaelo saßen um sein Bett, und als seine Gedanken klarer wurden, begriff Theo, dass er wirklich sehr schwer verletzt gewesen sein musste, denn anstatt ihn damit zu necken, wie komisch er mit seinen vielen Wundverbänden und Bandagen aussah, schienen seine Schwestern drauf und dran zu sein, in Tränen auszubrechen und ihn zu küssen. »Gott sei Dank, Gott sei Dank«, wiederholte seine Mutter immer wieder, und sein Vater beugte sich über ihn und sagte: »Du wirst wieder gesund, Theo. Aber eine Weile sah es gar nicht gut aus.«
»Das Messer«, fiel Theo ein, und er berührte seinen Bauch, der frisch bandagiert war. »Die Raketen … Sie haben die Zitadelle getroffen!«
»Sie sind in den Gärten explodiert und haben kaum Schaden angerichtet«, beruhigte ihn sein Vater. »Niemand wurde verletzt. Niemand außer dir. Du hast viel Blut verloren. Als unsere Aeronauten dich hierhergebracht haben, wollten die Ärzte dich eigentlich schon aufgeben. Aber die Botschafterin – die Gesandte des Grünen Sturms, Lady Naga – hat von deinem Zustand erfahren und bestand darauf, dich höchstpersönlich zu behandeln. Vor ihrer Heirat hat sie als eine Art Chirurgin gearbeitet. Jedenfalls kennt sie sich mit den inneren Organen des Menschen ziemlich gut aus. Du bist von General Nagas Frau geheilt worden! Damit kann man sich rühmen, was?«
»Also hast du ihr das Leben gerettet und sie dir«, sagte Miriam.
»Sie wird sich freuen zu hören, dass du auf dem Weg der Besserung bist!«, sagte Mrs Ngoni. »Sie war sehr beeindruckt von deiner Tapferkeit und nimmt großen Anteil.« Sie zeigte stolz auf einen riesigen Blumenstrauß in einer Ecke des Zimmers, den Lady Naga geschickt hatte. »Sie kam mich persönlich besuchen, um mir zu sagen, dass die Operation gut verlaufen ist.« Sie strahlte. Der Gast aus Shan Guo hatte sie sichtlich für sich eingenommen. »Lady Naga ist ein wunderbarer Mensch, Theo.«
»Und was hat sie dann beim Grünen Sturm verloren?«, fragte Theo.
»Eine unglückliche Fügung«, mutmaßte sein Vater. »Wirklich, Theo, du würdest sie mögen. Soll ich ihr eine Nachricht in die Zitadelle schicken, dass es dir bessergeht? Sie würde sicher gern kommen und mit dir sprechen …«
Theo schüttelte den Kopf und sagte, er fühle sich noch zu schwach. Er war froh, dass er die Barbaren hatte aufhalten können, und dankbar, dass Lady Naga ihm das Leben gerettet hatte, aber es behagte ihm nicht, in der Schuld des Grünen Sturms zu stehen.
Am nächsten Tag durfte er nach Hause. In den folgenden Wochen, während er allmählich wieder zu Kräften kam, versuchte er, nicht an Lady Naga zu denken, obwohl seine Eltern oft von ihr sprachen. Ganz Zagwa sprach von ihr. Jeder hatte davon gehört, wie sie ihre edlen Gewänder abgelegt und einen Arztkittel übergezogen hatte, um dem jungen Theo Ngoni das Leben zu retten, und im Lauf der Zeit kamen immer neue Geschichten hinzu: wie sie die antike Kathedrale besucht hatte, die im Dunklen Zeitalter aus den Felsen des Bergs Zagwa herausgemeißelt worden war, und wie sie zusammen mit dem Bischof dort gebetet hatte. Offenbar hielt das jeder für ein gutes Zeichen, bis auf Theo, der dahinter nur ein weiteres Manöver des Grünen Sturms witterte.
Zwei Berater der Königin suchten ihn auf und befragten ihn zu dem Luftschiff, das er geentert hatte. Die Aeronautin, die sie gefangen genommen hatten, werde zwar verhört, verweigere aber jede Aussage, erklärten sie und beglückwünschten ihn zu seiner mutigen Tat.
»Ich war nicht mutig. Ich hatte keine andere Wahl«, sagte Theo. Aber insgeheim war er stolz, und er freute sich, dass ihn nun alle in Zagwa als Held betrachteten. »Ich bin froh, dass ich diesen Traktionisten in die Quere gekommen bin, bevor sie jemanden verletzen konnten«, antwortete er den Beratern. Daraufhin wechselten die beiden einen merkwürdigen, nachdenklichen Blick, und der Jüngere der beiden schien etwas sagen zu wollen. Doch der Ältere bedeutete ihm, zu schweigen, und kurz danach verabschiedeten sie sich.
Draußen vor seinem Elternhaus brütete Zagwa unter einer Hitzeglocke. Von unten sah die Stadt nicht ganz so prachtvoll aus: Die Gebäude waren heruntergekommen, von den Mauern blätterte die bunte Farbe ab, und hie und da waren die Dächer eingesackt. In den Ritzen zwischen den Pflastersteinen wucherte Unkraut. Sogar die Kuppeln der Zitadelle waren von einem grünen Belag überzogen. Zagwas Blütezeit lag tausend Jahre zurück; das mächtige Reich, über das es geherrscht hatte, war von hungrigen Städten verwüstet worden. Im Schatten des Regenschirmbaums auf der gegenüberliegenden Straßenseite versammelten sich jeden Nachmittag Männer, die aufgebracht über die neuesten Gräueltaten der Traktionisten aus dem Norden debattierten. Vielleicht würden einige der Jüngeren irgendwann so zornig werden, dass sie loszogen und sich dem Grünen Sturm anschlossen, wie Theo es getan hatte. Theo beobachtete sie manchmal vom Fenster aus und versuchte, sich daran zu erinnern, wie es gewesen war, sich seiner Überzeugungen so sicher zu sein, aber es gelang ihm nicht.
Eines Nachmittags, fast einen Monat nach dem Luftangriff, saß er gerade lesend im Gartenzimmer, als seine Eltern Besuch für ihn hereinführten. Theo sah kaum von seinem Buch auf, als sie durch die Tür kamen, denn er hatte die Besuche seiner vielen Tanten und Onkel satt, die alle unangenehm begierig darauf waren, seine Narben zu sehen, darüber zu sinnieren, was für ein Rabauke er mit drei doch gewesen sei, oder ihn mit den hübschen Töchtern ihrer Freunde bekannt zu machen. Erst als seine Mutter sagte: »Theo, mein Schatz, erinnerst du dich an Generalleutnant Khora?«, wurde ihm klar, dass es diesmal anders war.
Khora war einer der besten Aeronauten Afrikas und Kommandant des Zagwanischen Fliegerkorps. Er war ein hochgewachsener, immer noch sehr ansehnlicher Mann, obwohl er auf die fünfzig zuging und sein Haar sich schon weiß färbte. Er trug eine Paraderüstung, und um seine Schultern war der traditionelle Umhang der Leibwache der Königin drapiert: gelb mit schwarzen Punkten. Er war dem Fell eines Fabeltiers namens Leopard nachempfunden. Khora verbeugte sich tief vor Theo und grüßte ihn respektvoll. Dann folgten einige Floskeln, an die Theo sich später nicht mehr erinnern konnte, so überwältigt war er. Von klein auf war Khora sein Held gewesen. Mit neun Jahren hatte Theo eine ganze Regenzeit damit herumgebracht, ein Modell von Khoras Kampfschiff zu bauen, den Zerstörer Mwene Mutapa, mit einem daumengroßen Mini-Khora auf der Heckgalerie. Vor lauter Verblüffung, Khora in Lebensgröße vor sich zu sehen, in der vertrauten Umgebung seines eigenen Zuhauses, bemerkte Theo erst nach einigen Augenblicken, dass er nicht allein gekommen war. Hinter Khora standen zwei junge Dienerinnen, Fremde in fließenden Roben aus regengrauer Seide, und hinter ihnen, in schlichterer Kleidung, eine weitere, sehr kleine und schmale Frau, die Theo von Fotografien in den zagwanischen Nachrichtenblättern kannte.
»Theo«, sagte Generalleutnant Khora, »ich habe Lady Naga mitgebracht. Sie möchte dich kennenlernen.«
Theo wusste, was er sagen sollte: Ich will das nicht; ich will nichts mit ihr und ihren Leuten zu tun haben. Aber in Khoras Gegenwart brachte er immer noch kein Wort über die Lippen, und dann kam die Botschafterin ein Stück näher, so dass er ihr zartes Gesicht und die schwere schwarze Brille sah (die sie auf den Zeitungsfotos nicht getragen hatte) und feststellte, dass er sie kannte.
»Sie waren auf Wolke Sieben!«, platzte er heraus und verblüffte damit Khora und die Dienstmädchen, die eine etwas förmlichere Begrüßung erwartet hatten. »An dem Abend, als der Grüne Sturm angegriffen hat! Sie sind Dr. Zero! Sie waren bei Naga und …«
»Und ich bin bei Naga geblieben«, erwiderte die Frau mit einem leisen, etwas verdutzten Lächeln. Sie war jung und auf burschikose Art hübsch. Ihr Haar, das kurz und grün gefärbt gewesen war, als Theo sie zum ersten Mal gesehen hatte, war nun länger und schwarz. Ihr Leinenhemd war oben aufgeknöpft, und in der Grube an ihrem Hals hing ein billiges Zinnkreuz, das sie von einem der Stände vor der Kathedrale gekauft haben musste. Sie berührte es nun leicht, als sie fragte: »Also waren Sie letztes Jahr mit uns auf Wolke Sieben, Mr Ngoni? Ich muss gestehen, dass ich mich nicht daran erinnere …«
Theo nickte eifrig. »Ich war mit Wren dort. Sie haben uns von Stalker Fang weggebracht und Wren nach dem Zinnbuch gefragt …« Er verstummte. Ihm war die Uniform eingefallen, die sie an jenem Abend getragen hatte. Sie habe »als eine Art Chirurgin gearbeitet«, hatte sein Vater gesagt, doch das war nur die halbe Wahrheit: Sie war Elektrochirurgin gewesen und hatte für das gefürchtete Wiedererweckungskorps des Grünen Sturms Stalker gebaut.
»Das waren Sie?«, fragte sie immer noch lächelnd. »Bitte verzeihen Sie. In jener Nacht ist so viel passiert, und seither auch … Wie steht es um Ihre Wunde? Verheilt sie?«
»Es geht schon besser«, sagte Theo tapfer.
Khora lachte und sagte: »Ihr Jungen erholt euch schnell! Ich bin auch einmal so schwer verletzt worden, in Batmunkh Gompa, damals im Jahr 07. Ein verfluchter Londoner hat mir sein Schwert in die Lunge gerammt. Manchmal habe ich immer noch Schmerzen.«
»Theo, mein Junge«, sagte sein Vater, »willst du Lady Naga nicht unsere Gärten zeigen?«
Verlegen wies Theo auf die offene Tür, und Lady Naga folgte ihm nach draußen. Ihre Dienstmädchen kamen in respektvollem Abstand nach. Als Theo einen Blick über die Schulter warf, sah er Khora in ein Gespräch mit seinen Eltern vertieft, während seine Schwestern ihm kichernd hinterherschauten. Wahrscheinlich, begriff Theo, überlegten sie schon, in welches der Dienstmädchen er sich verknallen würde. Beide Mädchen waren bildschön. Die eine stammte wohl aus dem Volk der Han oder aus Shan Guo, die andere schien südindischer Herkunft zu sein: Ihre Haut war so dunkel wie Theos, und ihre Augen, die seinem Blick begegneten, als er sie betrachtete, waren pechschwarz.
Er sah schnell weg und versuchte, seine Verwirrung zu kaschieren, indem er auf den Pfad zu seinem Lieblingsort in den Gärten zeigte, eine Terrasse, von der aus man die Schlucht überblickte. Der schattige Weg führte unter Bäumen in orangefarbener Blütenpracht hindurch, und Lady Naga bückte sich, um eine zu Boden gefallene Blüte aufzuheben, die sie im Weitergehen zwischen den Fingern drehte. Als er hinschaute, bemerkte Theo, dass ihre kleinen Finger mit ausgebleichten Hautstellen und braunen Flecken übersät waren. »Chemikalien«, erklärte sie, als sie seinen Blick bemerkte. »Ich habe lange für das Wiedererweckungskorps gearbeitet. Die Chemikalien, die wir benutzt haben …«
Theo fragte sich, wie viele tote Soldaten sie stalkerisiert hatte und wie eine schüchterne junge Offizierin des Wiedererweckungskorps in nur sechs Monaten zur Frau des Anführers des Grünen Sturms hatte aufsteigen können. Als hätte sie seine Gedanken erraten, sah Lady Naga zu ihm hoch und sagte: »Ich war es, die Stalker Fang in jener Nacht getötet hat. Ich habe einen alten Stalker rekonstruiert, Mr Shrike, und ihn darauf programmiert, sie anzugreifen. General Naga war beeindruckt. Offenbar hielt er das für sehr mutig. Und er hatte wohl das Gefühl, dass ich Schutz brauche, denn es gibt viele im Grünen Sturm, die Fang verehrt haben und mir nach dem Leben trachten. Und – nun ja, Sie wissen, wie sentimental Soldaten sein können. Jedenfalls hat er sich auf dem Heimweg nach Tienjing sehr gut um mich gekümmert, und als wir dort ankamen und er sich seiner Position als neuer Anführer sicher sein konnte, hielt er um meine Hand an.«
Theo nickte. Es war ihm unangenehm, mit ihr über solche privaten Dinge zu reden. Er hatte Naga gesehen: ein grimmiger Krieger, der in einem motorisierten Exoskelett aus Stahl herumstapfte, weil er den rechten Arm verloren hatte und beide Beine verkrüppelt waren. Theo konnte sich nicht vorstellen, dass sich Dr. Zero in ihn verliebt hatte. Sie musste seinen Antrag aus Angst oder Machtgier angenommen haben.
»Der General vermisst Sie sicher sehr«, war alles, was ihm als Antwort einfiel.
»Ich denke schon«, sagte Lady Naga. »Aber er ist ein guter Mensch, und der Frieden liegt ihm wirklich am Herzen. Er will die Freundschaft zwischen Zagwa und dem Grünen Sturm wiederaufleben lassen. Ich habe ihn überzeugt, dass ich mit Ihrer Regierung reden sollte, und er dachte, ich wäre hier in Sicherheit. Es gibt immer noch Elemente im Grünen Sturm, die Naga dafür hassen, dass er ihren Krieg zu beenden versucht, und die mich dafür hassen, dass ich ihre alte Anführerin zerstört und Naga damit an die Macht gebracht habe. Er dachte, wenn ich um die halbe Welt fahre, entkomme ich ihnen vielleicht eine Zeitlang. Offenbar hat er sich getäuscht …«
Theo fragte sich, was sie meinte. Doch in diesem Moment traten sie aus dem Schatten der Bäume hervor, die sonnenbeschienene Terrasse erstreckte sich vor ihnen, und eine Weile verharrte Lady Naga andächtig.
Der Blick war wirklich wunderschön. Selbst Theo, der ihn von klein auf kannte, stand manchmal ehrfürchtig staunend an der Brüstung. Die steilen Felswände der Schlucht von Zagwa fielen senkrecht zu der türkis schimmernden Flussschleife in der Tiefe ab, und darüber erhob sich das Gebirge mit seinem grünen Nebelwald unter den mit Schnee bedeckten Gipfeln, die hoch und immer höher in den gleißenden Himmel ragten: riesige Gewitterwolken, die im Sonnenlicht weiß und eisblau leuchteten. In den Aufwinden über der Schlucht schwebten einige Windreiter, was Theo an seinen eigenen Flug erinnerte und an den Drachen, den er verloren hatte. Ihm fiel auf, dass Lady Naga ihm noch nicht für die Rettung vor dem Luftangriff der Städter gedankt hatte. Dafür, hatte er geglaubt, war sie doch gekommen.
»Was hat Sie dazu gebracht, all das hier zurückzulassen und sich dem Grünen Sturm anzuschließen?«, fragte sie.
Theo zuckte unbehaglich mit den Schultern. An seine Zeit als fliegende Bombe wollte er lieber nicht zurückdenken. »Das alles ist gefährdet«, sagte er. »Das Fliegerkorps gibt sein Bestes, unsere Grenzen zu verteidigen, aber mit jedem Jahr werden mehr Acker- und Waldflächen auf unserem Gebiet vernichtet. Die mobilen Wüstenstädte wandern nach Süden und bringen die Wüste mit. Ich habe meinen Vater und meine Freunde so lange darüber reden hören, dass ich irgendwann einfach etwas tun wollte. Ich dachte, der Grüne Sturm hätte die Lösung. Ich war eben jung. Wenn man jung ist, glaubt man, dass es für alles eine einfache Lösung gibt.«