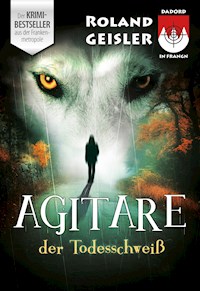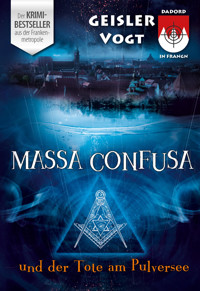9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Nürnberger Frankenstadion wird Schauplatz eines heimtückischen Giftanschlags. Kommissar Schorsch Bachmeyer, ein alter „Glubberer“, der just an diesem Tag seine Mannschaft anfeuert, wittert sofort ein Verbrechen größeren Ausmaßes. Und tatsächlich – das Ehepaar, das dabei ums Leben kommt, ist keinesfalls unschuldig gestorben. Die Ermittlungen führen die Nürnberger Kripo in eine ihnen bis dato völlig unbekannte Szene, die „Schwarze Szene“, in der Teufelsanbetung genauso präsent zu sein scheint wie die unverhohlene Auslebung von Sex und Gewalt. Das Durchdringen der satanistischen Strukturen aber erweist sich als äußerst schwierig bis fast unmöglich. Ein verdeckter Ermittler muss her. Doch ob dieser dem kriminellen Treiben im Frankenland Einhalt gebieten kann? >>Sowohl die authentische Schilderung des Büro- und Ermittlungsalltags von Kommissar „Schorsch“ Bachmeyer und seinem Team wie auch die Krimi-Handlung als solche überzeugen durch realitätsnahe Bezüge und äußerst authentisch wirkende Dialoge. Es ist den Verfassern gelungen, über dem großen Spannungsbogen des zugrundeliegenden kriminalistischen Sachverhalts mehrere kleinere, in sich abgeschlossene Spannungsfelder einzubauen, die es dem Leser schwer machen, das Buch vorzeitig aus der Hand zu legen. << Der Polizeipräsident von Mittelfranken, Johann Rast
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Es gibt sie wirklich, und sie sind mitten unter uns!
Dieser Kriminalroman beruht auf Fiktion und wahrer Begebenheit, beides verschmilzt ineinander und führt so den Leser durch die Geschichte.
Alle Figuren, bis auf Ausnahme der zeitgeschichtlichen Personen, sind frei erfunden. Sofern Personen der Zeitgeschichte in unserem Buch handeln oder denken wie Romanfiguren, ist auch dies frei erfunden. Fiktiv sind ebenso einige der Handlungsorte in der Gegenwart.
Die Autoren möchten dem Leser eine Handlung vermitteln, die eine gewisse Authentizität beinhaltet. Deshalb muss dem Geschichtenerzähler erlaubt sein zu sagen: Es ist zwar nur eine Geschichte, die durch den Erfahrungsbericht eines okkulten Aussteigers, einer evangelischen Pfarrerin sowie zweier Zeitzeugen angeregt wurde, aber vielleicht steckt ja doch ein kleines Fünkchen Wahrheit darin!?
Lediglich manch taktische und kriminalistische Handlungsabläufe der Gegenwart könnten im wahren Leben tatsächlich so erfolgt sein.
Alle Informationen über polizeiliche und strafprozessuale Ermittlungshandlungen sind als „offen“ einzustufen, da diese für die Öffentlichkeit frei zugänglich sind z.B. BGBL I, 2005, 3136. Alle diese Maßnahmen werden zudem im Internet von verschiedenen deutschen und ausländischen Strafverfolgungsbehörden ausführlich beschrieben.
Im Anhang finden Sie ein Glossar zu fränkischen und kriminalistischen Begriffen und Redewendungen.
Roland Geisler und Julia Seuser
Dadord in Frangn
Band 3
Mortificantur
und der 13. Apostel
Ein Kriminalroman
aus der Schorsch-Bachmeyer-Reihe
Dadord in Frangn 2016 © by Roland Geisler
Veröffentlicht im Dadord in Frangn-Verlag Roland Geisler, Josef-Bauer-Str.18, 90584 Allersberg.
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autoren reproduziert, unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder vervielfältigt werden.
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Umschlagsmotive: © Thinkstock
Abbildungen: © Thinkstock/Kati1313/Mak_Art/simbolocoma/VeraPetruk und Roland Geisler
Redaktion: Julia Seuser
E-Book Konvertierung: Roland Geisler
Made in Germany
Erstausgabe 2016
ISBN 978-3-73-935956-4 EPUB
Das Unrecht ist nicht an sich ein Übel, sondern nur insofern ihm die Angst vor der Entdeckung innewohnt, es könnte den für solche Fälle aufgestellten Zuchtmeistern nicht verborgen bleiben.
Epikur
Der Giftmord
Die Giftbeibringung durch fremde Hand stellt einen besonders schweren Fall der vorsätzlichen Körperverletzung dar, da das Opfer in besonderem Maße ahnungslos und wehrlos ist, und weil der Täter in hohem Maße heimtückisch handelt und die Vertrauenssituation zwischen Täter und Opfer für seine Tat missbraucht.
Quelle: Deutsche Polizeiausbildung 2008
Prolog 1
Sommer 1994,FreizeitparkDe Vossemeren, Lommel/Belgien
Sie saßen in der „Sahara von Lommel“, einem der schönsten Naturschutzgebiete Flanderns, und blickten starr in die Abendsonne, die langsam am Horizont versank. Ihre nackten Füße hatten sie im weißen Quarzsand vergraben, dem dieser Landstrich seinen Namen verdankte, und ein warmer Wind strich angenehm um ihre Knöchel. Aus der Ferne klang aus einem Lautsprecher leise, aber noch hörbar das Lied „Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück“, ein Evergreen aus den frühen 1930er-Jahren.
Ja, irgendwo auf dieser Welt … Aber nicht hier und heute! Hier und heute fühlten sie nur eine entsetzliche Leere.
Irgendwo auf dieser Welt musste sie sein. Seit vier Tagen suchten sie nach ihr – vergebens.
Nicole, ihre einzige Tochter, war verschwunden. Wie konnte ein fünfjähriges Mädchen wie vom Erdboden verschluckt werden und nicht mehr auffindbar sein? Vor der Kulisse der wüstenartigen Landschaft waren Trauer, Schmerz und Hoffnungslosigkeit allgegenwärtig.
Nicole blieb für immer verschwunden. Die Ermittlungsbehörden tappten im Dunkeln, und auch die zu Beginn verheißungsvollen Spuren einer privat beauftragten Detektei verliefen schlussendlich im Sande.
Als dann am 13. August 1996 europaweit bekannt wurde, dass das belgische Ehepaar Marc Dutroux und Michelle Martin mehrere Kinder entführt hatte und diese in ihrem Keller in einer Zelle hielt und sexuell missbrauchte, war dies trotz allen Übels ein Hoffnungsschimmer. Waren sie die Täter, die auch Nicole entführt hatten? Interpol Lyon steuerte diesbezüglich eine „Gelbe Ausschreibung“, also einen Hilfeaufruf an alle Strafverfolgungsbehörden, die mit der Ortung vermisster Personen betraut waren. Denn der Ort, an dem Nicole vor zwei Jahren verschwunden war, lag vom Tatort der Dutroux-Verbrechen gerade mal hundertzwanzig Kilometer entfernt.
Der Entführungsfall wurde von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden neu aufgerollt. Gemeinsam mit den belgischen Behörden ging man jeder Spur im Fall „Nicole“ nach. Vergebens. Es ergaben sich keine neuen Hinweise oder aktive Spuren zu den Verbrechenstatbeständen in Belgien.
Doch wenn sie keines der Opfer des belgischen Ehepaars war, lebte Nicole dann vielleicht noch? Diese Antwort blieb ihnen die Polizei jedoch weiterhin schuldig. Und so warteten sie. Warteten und hofften. Und beteten jeden Tag für das Leben ihrer Tochter.
Als dann am 3. Mai 2007 auf allen Sendern über die Entführung von „Maddie“ berichtet wurde – die fünfjährige Madeleine Beth McCann verschwand ebenso während eines Familienurlaubs –, glimmte erneut Hoffnung auf. Hinweise auf einen Mädchenhändlerring gingen durch die Presse. Wieder versuchte man akribisch, Parallelen zwischen den Verbrechen in Belgien und Maddies vermeintlicher Entführung in Portugal herzustellen. Aber auch hier waren alle Mühen umsonst, es ergaben sich keine weiteren Erkenntnisse.
Ein Schleier des Versagens, ja der Hilflosigkeit machte sich breit. Die Hoffnung erlosch. Nicole blieb verschwunden.
Prolog 2
Freitag, 2. Mai 2014, 09.55 Uhr, Einsteinring, Nürnberg, Dr. Siegfried Helm, Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie
Dr. Helm legte die Akte zur Seite. Der Gutachterauftrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth war einer von vielen, die der Doktor in den letzten Jahren erhalten hatte. Der Nervenarzt verstand seinen Beruf, er war eine Koryphäe auf seinem Gebiet, wenn es um die Aufarbeitung von traumatischen Ereignissen ging.
Nach vorliegender Aktenlage handelte es sich um eine weibliche Patientin, die vor knapp zwei Monaten in einer kalten und regnerischen Märznacht hilflos auf dem Kundenparkplatz eines großen Möbelhauses in der Schmalau, nahe der A 73, von Angehörigen eines Sicherheitsdienstes entdeckt worden war. Die Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei Fürth brachten keine näheren Anhaltspunkte zur besagten Auffindesituation.
Das junge Mädchen war mit einem schwarzen langen Ledermantel bekleidet gewesen. Unter dem Mantel trug sie eine schwarze Ledercorsage, beide Arm- und Fußgelenke wiesen Ledermanschetten mit Metallringen auf. Sie besaß keine Schuhe, auch der Slip fehlte.
Dr. Helm betrachtete das erkennungsdienstliche Foto, das von der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion aufgenommen worden war, genauer. Ihr Gesicht war sonderbar stark geschminkt. Das Kalkweiß der Haut bildete einen scharfen Kontrast zu der dunklen Schminke rund um ihre Augen, die durch den Regen bizarr verwischt worden war. Aus dieser schwarzen Ummalung starrten ihn zwei unnatürlich helle Augen an, deren Pupillen viel zu klein erschienen. Der Blick gläsern und ausdruckslos, was jedoch zweifelsohne den schauderhaften Kontaktlinsen geschuldet war.
Ausweispapiere trug sie keine bei sich. Laut Gutachten der Rechtsmedizin Erlangen, die die Blutwerte der hilflosen und sichtlich verwirrten Person im Rahmen ihres Aufgabenbereichs analysierte, stand fest, dass eine Blutalkoholkonzentration von eins Komma zwei Promille vorlag. Zudem hatte der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Nebel festgestellt, dass die hochleistungsflüssigkeitschromatographischen Untersuchungen ihrer Blutprobe einen Nachweis von Kokainkonsum erbrachten. Und nicht nur die Bekleidung der Person wies unterschiedliche Ejakulationsspuren auf, auch ein gynäkologischer Abstrich legte die Vermutung nahe, dass die Person in den letzten Stunden massiv sexuell missbraucht worden war.
Das Alter der Unbekannten wurde zwischen dreiundzwanzig und sechsundzwanzig Jahre geschätzt. Eigene Aussagen bezüglich ihrer Herkunft und Identität konnte sie nicht machen, bei der erkennungsdienstlichen Behandlung stammelte sie lediglich einen einzigen Satz vor sich hin: „Ich bin Mania, mein Herr!“
Dr. Helm stand auf und begab sich ins Wartezimmer. Er ging auf die wartende Person zu, begrüßte sie, indem er ihr seine Hand ausstreckte. Er bat sie mitzukommen. Die junge Frau im beigen Jogginganzug reagierte abwesend, folgte ihm aber widerstandslos in das Therapiezimmer.
Dr. Helm nahm Platz und stellte sich kurz vor. Sie ließ sich auf dem Sessel ihm gegenüber nieder, aber gab keinen Laut von sich. Er versuchte, ihr Vertrauen zu gewinnen, indem er ihr ein Glas Saft anbot, doch sie starrte nur weiter teilnahmslos auf den Schreibtisch. Mit der Absicht, sie wachzurütteln, schob er das Glas direkt an den Punkt, auf dem ihr Blick ruhte. Da schnellte ihr Kopf nach oben und blieb genauso starr an der Wand hinter dem Schreibtisch haften, die mit Zeugnissen, Urkunden und ein paar persönlichen Bildern dekoriert war.
Diese abwehrende Haltung sowie ihre Unfähigkeit, ihm in die Augen zu blicken, überraschten den Nervenarzt nicht. Es war die natürliche Reaktion eines traumatisierten Patienten. Womit er jedoch nicht gerechnet hatte, war Manias anschließendes Verhalten. Das Mädchen begann plötzlich sehr stark zu zittern, und Tränen schossen ihr in die Augen. Sie zog ihre Beine zu sich auf den Sessel und wimmerte, zusammengekauert wie ein Fötus, als ob er ihr Unheil angedroht hätte. Dabei war er ihr doch keinen Schritt näher gekommen, sondern hatte bewusst Abstand gehalten.
Während sie dasaß und weinte, beobachtete er, wie ihr Blick immer wieder für einen kurzen Augenblick seltsam nach oben ging, so als ob sie vor irgendetwas in dem Raum Angst hätte. Doch Dr. Helm konnte nicht ausmachen, wer oder was auf sie so bedrohlich wirkte. Sein Anblick konnte es nicht sein, schließlich wäre sie ihm dann gar nicht erst ins Patientenzimmer gefolgt.
Herrje, dachte er, da hatte ihm die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth diesmal aber einen richtigen Härtefall vorbeigeschickt. Das Vertrauen dieses Mädchens zu gewinnen und das von ihr Erlebte zu entschlüsseln, würde sicherlich unzählige Sitzungen in Anspruch nehmen. Dennoch, er wäre kein guter Psychiater, wenn diese Herausforderung nicht auch einen Reiz auf ihn ausüben würde.
1. Kapitel
Samstag, 23. August 2014, 09.25 Uhr, Kleingartenverein Zeppelinfeld e.V., Nürnberg – nahe dem Frankenstadion
Vorsichtig nahm sie mit den Latexhandschuhen die zwei Pflanzenbündel aus der Flüssigkeit. Das Wassergemisch mit den zerdrückten Vanilleschoten und dem Zucker zeigte seine Wirkung, der arttypische Geruch von Mäuse-Urin war neutralisiert. Langsam schüttelte sie das zusammengebundene Doldengewächs. Die noch anhaftende Flüssigkeit tropfte in den Eimer zurück.
Die elektrische Saftpresse beendete die Prozedur der Stoffgewinnung, genau so, wie sie es so oft in den letzten Jahren praktiziert hatte. Die tödliche Essenz, das gelb-gräuliche AlkaloidConiin, lief in den bereitgestellten Destillierkolben. Sodann folgte der Verschlussstopfen mit dem Glasröhrchen, das in den Liebigkühler geleitet wurde. Dieser chemische Prozess war notwendig, um nach der erfolgten Abkühlung das tödliche Destillat zu erhalten.
Svetlana stellte den Bunsenbrenner an, um den Destillationsprozess einzuleiten. Nach circa fünfundvierzig Minuten zog sie vorsichtig mit der Kanüle das Konzentrat aus der Petrischale in die Spritze auf und spritzte das gewonnene Sekret in eine kleine grüne Medikamentenflasche, deren Verschluss mit einer Pipette versehen war.
Samstag, 23. August 2014, 12.47 Uhr, Frankenstadion, Nürnberg
Gisela und Adalbert Giegelhundt waren bereit. Wie bei jedem Heimspiel des 1. FC Nürnbergs standen beide in der Nordkurve des Frankenstadions und warteten auf das Einlaufen ihrer Fußballmannschaft. Das Spiel gegen den FSV Frankfurt würde in wenigen Minuten beginnen.
Auch Schorsch Bachmeyer stand in der Nordkurve und hatte sein Vereinstrikot angelegt. Er freute sich auf sein langes freies Wochenende. Sein Beruf bei der Nürnberger Mordkommission forderte ihn jeden Tag aufs Neue, aber heute rückte der Polizeiberuf in weite Ferne. Er war eins mit den anderen Club-Anhängern. Sein Bürokollege, Kriminaloberkommissar Horst Meier, hatte ihm eine Freikarte geschenkt. Als Dauerkartenbesitzer ließ Horst kein Heimspiel aus, und wenn er Lust darauf hatte, kaufte er manchmal auch noch eine zweite reguläre Karte für einen guten Freund oder Kollegen.
Sie alle hofften, der Club würde die Hessen heute schlagen, für alle Franken ginge dann nach neun Jahren ein Traum in Erfüllung: „de hessische Mescherstecher“ endlich mal wieder die Leviten zu lesen. Denn seit knapp zehn Jahren kämpfte der „Glubb“ vergebens gegen die Frankfurter Elf.
Gespannt blickten die Giegelhundts auf das Spielfeld. Beide hatten ihren schwarz-roten Club-Schal umgelegt. Dieser war zwar eigentlich für diese Jahreszeit ein wenig zu warm, aber alle Fans in der Nordkurve trugen die Vereinssymbole ihres Lieblingsclubs am Leib, egal ob Schal, Trikot oder Fan-Mütze. Und durch welche Höhen und Tiefen ihr Verein auch immer gehen musste, die fränkischen Fans standen treu zu ihrem Glubb.
Wie immer floss das Bier in Strömen. Auch Gisela und Adalbert Giegelhundt hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, sich das Spiel mit einem kühlen Blonden zu versüßen, es war ja auch fast so etwas wie eine Tradition im Bierbrauerland Franken. Heute jedoch mussten die beiden Glubberer keine Halbe beim mobilen Bierverkäufer ordern, denn ein weiblicher Fan überreichte ihnen einen gefüllten Bierbecher mit den Worten: „Prosit, meine Lieben! Heute wird es endlich passieren!“
Etwas verdutzt betrachteten sie die Unbekannte, die nun den mitgeführten Bierkranz einer bekannten Nürnberger Brauerei kurz abstellte und dann mit ihnen anstieß.
„Ah, ein Freibier vom Puscher-Bräu, danke schön! Wir wollten uns grade a Seidla kaufen.“ Adalbert grinste, nahm einen großen Schluck und reichte das Bier an seine Frau weiter. Auch sie langte kräftig zu, sodass sie in nur zwei Zügen den halben Becher geleert hatten. Um im Fall der Fälle mit beiden Händen jubeln zu können, stellte Gisela das Getränk zu ihren Füßen auf den Boden ab.
Der Anpfiff erfolgte, und sofort wurde ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Spielfeld gelenkt. Die edle Spenderin hingegen war mit einem Mal verschwunden. Vielleicht musste sie ja noch einmal schnell zur Toilette oder spendierte den Rest aus ihrem Bierkranz den Fans aus einem anderen Block. Egal, die Giegelhundts versanken ganz in das Spielgeschehen. Es war der dritte Spieltag, und ihr Glubb hatte bislang nur ein mageres 1:0 am ersten Spieltag erzielt. Es wurde also Zeit, wieder ein paar Punkte zu sammeln, die für den Klassenerhalt oder vielleicht sogar den Aufstieg nützlich sein konnten.
Es waren noch keine zwanzig Minuten gespielt, als Schorsch zwei Reihen vor sich eine männliche Person wahrnahm, die bei vollem Bewusstsein ein äußerst ungewöhnliches Verhalten an den Tag legte. Der Mann machte keineswegs einen betrunkenen Eindruck, doch er japste nach Luft, krallte sich am Geländer, das die Stehplatzreihen voneinander trennte, fest und erbrach sich schließlich auf den Boden. Sogleich ging in der Reihe vor ihm ein Gerangel und Geschrei los, jeder wollte außer Reichweite sein, sollte es ihn noch einmal überkommen.
Was folgte, war jedoch bei Weitem noch unappetitlicher als ein zweiter Würgereiz. An beiden Beinen seiner kurzen beigen Bermudashorts ergoss sich eine braune glitschige Masse. In Medizinerkreisen hätte man dazu gesagt: „Er kotet sich ein“, ein danebenstehender Fan schrie dagegen völlig unverblümt: „Allmächd, ich glaub's ja net! Der scheißt sich grad die Hosen voll!“
Im selben Augenblick fing auch die Begleiterin des Mannes an, sich anormal zu verhalten. Sie drehte sich im Kreis wie ein Derwisch, dann brach sie augenblicklich zusammen, wurde aber von ein paar Schlachtenbummlern gestützt, die direkt hinter ihr standen. Schorsch konnte klar erkennen, dass auch bei ihr eine gelb-bräunliche Flüssigkeit unter dem knielangen Rock hervorquoll und in einem kleinen Rinnsal zuerst ihre Beine und dann die Stufen der Zuschauertribüne hinunterfloss.
Der Mann war inzwischen klitschnass, denn er hatte einen Schweißausbruch erlitten. Er keuchte und hing über dem Geländer wie ein nasser Sack, die Füße bedeckt von seinen eigenen Exkrementen.
Viele der umliegenden Fans bekamen zwar mit, dass hier etwas nicht stimmen konnte, die meisten jedoch drehten sich nur angewidert weg und suchten sich einen Platz weit weg von dem üblen Geschehen. Vielleicht hatten die beiden ja nur etwas Falsches gegessen.
Schorsch Bachmeyer vom Nürnberger K11 jedoch wäre ein schlechter Polizeibeamter gewesen, hätte er nicht sofort reagiert und zusammen mit Horst den Rettungsdienst alarmiert.
Bis dieser eintraf, hatten sie sich zu den beiden Leidenden hindurchgeboxt, um sich an Erste-Hilfe-Maßnahmen zu versuchen. Viel war da jedoch nicht auszurichten. Beide Betroffenen konnten sich kaum mehr artikulieren. Es schien, als ob ihre Zungen am Gaumen festgeklebt wären. Die weibliche Person lag mittlerweile auf dem harten Steinboden und blickte aschfahl und mit glasigen Augen hoch zu ihrem Begleiter, den sie noch wahrzunehmen schien. Kurze Zeit später brach auch er zusammen.
Zwei Rettungssanitäter trafen ein. Selbst sie schienen angesichts der sonderbaren Situation und des beißenden Gestanks für einen Moment lang überfordert. Der eine brabbelte irgendetwas von „Könnte eine Nahrungsmittelvergiftung sein, die eine nicht kontrollierbare Diarrhö ausgelöst hat“, während der andere nach dem Puls der Frau und dann des Mannes fühlte.
Schorsch outete sich. „Bachmeyer und Meier von der Kripo Nürnberg. Mit den beiden hier stimmt was nicht. Da sollte schleunigst ein Arzt gerufen werden.“
Sofort verständigte einer der Sanitäter über Funk einen Notarzt, während sich der andere über die am Boden Liegenden beugte und beruhigend auf sie einredete.
Es war kein schöner Anblick. Die Augen der beiden Rettungsopfer waren zu Froschaugen mutiert, sie waren weit geöffnet und beide röchelten und schnappten nach Luft. Es schien, als ob sie ihren Helfern irgendetwas sagen wollten, aber beide konnten ihre Zunge nicht mehr bewegen. Auf der Stirn hatten sich große Schweißperlen gebildet, die langsam abwärts wanderten und sich unterhalb ihres Kehlkopfes in einem Hauttrichter sammelten. Die Frau übergab sich wiederholt. Ihr türkisfarbener Rock war von Exkrementen durchdrungen. Bei dem männlichen Opfer zeigten sich ebenso weitere Einnässungen, immer wieder lief Urin von der Schamgegend abwärts. Die Hitze des Sommertages tat ihr Übriges, sodass sich der unangenehme Geruch schnell und weit verbreitete und so mancher Fan den Block verließ oder sogar eiligst in Richtung Toilette flüchtete. Nur so konnte wohl ein weiteres Unglück verhindert werden.
Es war bereits kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als der herbeigerufene Arzt zuerst den Tod von Gisela und kurze Zeit später auch den von Adalbert Giegelhundt feststellte.
„Meine Herren, ich bin Dr. Neumann. Ich habe gehört, Sie beide sind von der Kripo?“ Während er die Totenscheine aus seiner Tasche kramte, wandte sich der Notarzt an Schorsch. Der nickte. „Also, was ich Ihnen jetzt schon sagen kann: Das war kein natürlicher Tod. Beide Opfer müssen obduziert werden, das werde ich schon mal auf den Totenscheinen ankreuzen. Mein erster Befund deutet auf eine Nahrungsmittelvergiftung, vielleicht eine Pilzvergiftung. Derzeit ist ja wieder Pilzsaison, und unsere Giftnotrufzentrale hatte im August schon vier Fälle einer Knollenblätterpilzvergiftung. Aber Einzelheiten darüber erfahren wir erst von der Rechtsmedizin.“ Dr. Neumann holte einen kleinen Block hervor, zückte einen Stift und sah Schorsch erwartungsvoll an. „Dazu bräuchte ich aber noch die Personalien.“
„Ja, das haben wir uns auch gedacht. Wir übernehmen vor Ort.“ Schorsch holte sein Mobiltelefon hervor und wählte die Telefonnummer des zuständigen Bereitschaftsstaatsanwaltes. Das Opfer sollte in die Gerichtsmedizin gebracht werden.
„Dr. Menzel, Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.“
„Hallo, Dr. Menzel, Bachmeyer, K11.“ Schorsch erklärte seinem Staatsanwalt das Geschehen vor Ort.
Obwohl nach der ersten Einschätzung des Notarztes womöglich „nur“ eine Nahrungsmittelvergiftung zum Tod der beiden Fans geführt hatte, mussten sie alle, solange dies nicht bestätigt war, von einem worst case ausgehen. Die vorliegenden Todesumstände konnten theoretisch ja auch ein Verbrechen beinhalten. Beide Leichname wurden demnach auf Dr. Menzels Weisung hin in die Rechtsmedizin Erlangen überstellt. Rechtsmediziner Professor Dr. Nebel, von ihnen allen nur „Doc Fog“ genannt, sollte die genaue Todesursache feststellen.
Schorsch und Horst baten den Notarzt Dr. Neumann um Gummihandschuhe. Dann durchsuchten sie die beiden Toten nach Ausweispapieren. Sie wurden fündig. Es handelte sich allem Anschein nach um Gisela Giegelhundt, geboren am 2. Mai 1970, und Adalbert Giegelhundt, geboren am 16. September 1965, beide wohnhaft in der Merowinger Straße 2 in Nürnberg.
Neben den beiden Identitätspapieren der Opfer fand Schorsch noch etwas Merkwürdiges, was seine Neugier entfachte. Es war eine schwarz-rote Mitgliedskarte aus Plastik, die in der Mitte ein Hologramm aufwies, in dem bei Bewegung der Karte zuerst ein Teufelskopf und dann ein ihm nicht bekanntes Zeichen erschien. Ausgestellt war die Mitgliedskarte auf Gisela und Adalbert Giegelhundt. Der Aussteller war ein Gothic-Club namens „Sadoso“ in Nürnberg-Muggenhof. Die Karte trug zudem die Aufschrift: „Zum Fürst der Finsternis – der Club für die Schwarze Szene“. Und dazu den nachfolgenden Satz: „Better to reign in hell than to serve in heaven.“
Sonderbar, dachte Schorsch. Er hatte noch nie etwas von diesem Club gehört.
Er und Horst asservierten ebenso die vorgefundenen Wertgegenstände der Opfer, und da zwischenzeitlich Halbzeitpause war, machte sich allem Gestank zum Trotz nun auch eine Vielzahl von Gaffern bemerkbar. Horst zog seinen Dienstausweis aus der Tasche und hastete in Richtung der für das Fußballspiel eingesetzten Polizeikräfte, die ebenso auf die vorliegende Situation aufmerksam geworden waren. Der zuständige Einsatzabschnittsleiter reagierte umgehend und zog fünfzehn Polizeibeamte vom unteren Tribünenrand ab, die nun auf Weisung die Stehtribüne mit einem Absperrband weiträumig absicherten. Denn solange die Kollegen der Spurensicherung den Tatort nicht akribisch abgesucht hatten, durften keine möglichen Spuren beseitigt oder verändert werden – nicht einmal die mittlerweile bestialisch stinkenden Körperausscheidungen der beiden Toten. Aber auch die herumliegenden Bierbecher, Zigarettenkippen, Taschentücher sowie das Verpackungsmaterial von verkauften Lebensmitteln mussten sichergestellt werden.
Die angeforderten Kollegen der Bereitschaftspolizei waren fix und sperrten mit einem Abstand von fünfzehn Metern den Tatort weiträumig ab. Auch Dr. Neumann übernahm seine letzte Handlung. Nachdem er den Totenschein ausgestellt hatte, deckte er die beiden Leichen bis zur Freigabe zum möglichen Transport durch die Bestatter mit zwei Stanniol-Rettungsdecken ab.
Die Halbzeit war vorbei, aber das Geschehen auf der Tribüne, im inneren der Absperrung, zog weiter die Blicke von Gaffern auf sich. Der Verlauf des Fußballspiels war zumindest für die umliegenden Zuschauer zweitrangig geworden. Dem Club beim Verlieren zusehen mussten sie schließlich oft genug – wann aber hatte man schon einmal die Chance, die Inspektion eines möglichen Tat- oder Unglücksorts zu beobachten?
Gegen Viertel nach zwei traf auch Robert Schenk, der Leiter der Spurensicherung, mit seinem Bereitschaftsteam ein. Wieder einmal hatte ihn die Einteilung zur Wochenendbereitschaft getroffen.
„Servus, Robbi! Wir haben schon mal die Identität der Opfer festgestellt. Sonst haben wir aber nichts verändert am Tatort“, begrüßte Schorsch seinen Kollegen.
„Servus, Schorsch! Servus, Horst! Sieht ja ziemlich scheiße aus hier! Da kommt wohl heute noch mit Hochdruck der Herr Kärcher zum Einsatz!“, entgegnete Robert, grinste und rümpfte die Nase.
Einige von Roberts Team verzogen ebenso ihre Nasen und schüttelten beim Anblick der Toten angewidert den Kopf. Doch dann schlüpften sie in ihre grauen Overalls, legten einen parfümierten Mundschutz an und begannen mit der Tatortsicherung so, als ob man sie gebeten hätte, auf einer Blumenwiese nach einem vierblättrigen Kleeblatt zu suchen. Statt Bienen schwirrten jedoch Schmeißfliegen um sie herum, die sich mittlerweile schwarmhaft am Tatort tummelten.
Samstag, 23. August 2014, 13.52 Uhr, Merowinger Straße, Nürnberg-Boxdorf
Svetlana parkte ihren silbernen Golf in der Steinacher Straße ab. Bis zur Merowinger Straße war es von hier aus ein Katzensprung. Das Anwesen der Giegelhundts, ein freistehendes Gebäude vermutlich aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts, stand etwas abseits der übrigen Anwesen in dieser Siedlung.
Sie öffnete das Gartentürchen und ging um das Haus herum, denn die Balkontür lag im rückwärtigen Bereich und war für die Nachbarschaft nicht einsehbar. Trotzdem blickte sich Svetlana vorsichtig nach allen Seiten um, bevor sie mit dem mitgeführten Geißfuß in Sekundenschnelle die Terrassentür aufhebelte.
Drinnen war ihr Auftrag schnell erledigt. Einen Laptop, ein Tablet, den DSL-Router mit Telefon und den Micro-Server packte sie in ihre mitgeführte Sporttasche, dann legte sie zwei identische Tarotkarten auf den Schreibtisch, genau an die Stelle, wo vorher der Laptop und der Micro-Server gestanden hatten.
Abschließend ging sie die Kellertreppe hinab, durchsuchte noch kurz die dortigen Räumlichkeiten, griff in die Sporttasche und holte zwei Nebelgranaten hervor. Wie es ihr Auftraggeber von ihr verlangt hatte, zündete sie diese und floh in das Obergeschoss des Hauses. Dort schloss sie alle gekippten Fenster und betätigte den Reibzünder eines weiteren Nebelwurfkörpers, den sie mit Bedacht im Flur des Obergeschosses ablegte. Wieder stieg sie schnellen Schrittes die Stufen hinab ins Erdgeschoss, um dort den letzten Nebelwurfkörper zu zünden.
Die chemische Mischung aus Hexachlorethan, Aluminiumpulver und Zinkoxid bildete mit der Luftfeuchtigkeit einen starken Tarnrauch, der alle daktyloskopischen Spuren im Haus beseitigen sollte.
Sie verließ die Wohnung, schlich über die Terrasse wieder zurück zu ihrem Auto und verstaute die Sporttasche im Kofferraum. Alles lief perfekt. Als sie eine Minute später nach links in die Gründlacher Straße einbog, war der heutige Auftrag für sie erledigt.
Sie fuhr zurück in die Gartenlaube, in der sie seit drei Tagen lebte. Es war keine luxuriöse Bleibe, aber das Häuschen war gemütlich eingerichtet, sie hatte ein Dach über dem Kopf und es fehlte ihr an nichts. Die junge Russin aus der Moskauer Vorstadt war zufrieden. Und Aufträge wie diesen erledigte sie so routiniert wie andere ihre Lebensmitteleinkäufe.
Neben ihrer militärischen Ausbildung beim KGB war sie jahrelang im Westen als Kundschafterin tätig gewesen. Sie hatte Erfahrung im lautlosen Töten und bei der Anwendung von toxischen Opferfallen. Sie verstand ihren Job und machte ihn gut. Richtig gut.
Samstag, 23. August 2014, 15.22 Uhr, Frankenstadion, Nürnberg
Das Fußballspiel war zu Ende. Der Club hatte sein Heimspiel mit 0:1 verloren. Wieder einmal mussten sie sich den Frankfurtern geschlagen geben.
Auch Robert und sein Team hatten bereits alle wichtigen Spuren am Tatort gesichert. Für Schorsch und Horst war hier nichts mehr zu tun.
„Du, Robbi“, sagte Schorsch, „Horst und ich, wir fahren mal zur Wohnanschrift der beiden. Vielleicht treffen wir dort ja Angehörige, und die Todesnachricht muss ja eh irgendjemand überbringen, da kommen wir nicht drum herum. Ich gebe mal dem Kriminaldauerdienst Bescheid, dass wir diese unangenehme Arbeit übernehmen. Wir sehen uns ja dann am Montag.“
Die Fahrt in die Merowinger Straße dauerte wegen des regen Verkehrs rund um das Stadion etwas mehr als eine Dreiviertelstunde. Doch das Haus der Giegelhundts war nicht schwer zu finden. Es war mit wildem Wein bewachsen und machte einen gepflegten Eindruck. Das Carport, das direkt an das Haus angrenzte, war leer.
Die beiden Kommissare betraten das Anwesen durch das Gartentürchen, das sperrangelweit geöffnet war, und klingelten. Niemand öffnete.
„Die zwa sind heid beim Glubb, dou mejns nu a weng waddn“, schallte ihnen stattdessen eine Stimme aus ihrem Rücken entgegen. Horst und Schorsch drehten sich um und sahen eine ältere Frau mit einem Hund am Gartentürchen stehen. Offensichtlich eine Nachbarin.
„Obber Sie hom ja ah a Drikko oa, is des Spiel denn scho vorbei?“, quasselte die Frau fröhlich weiter.
Horst räusperte sich. „Guten Tag! Wohnt hier außer Frau und Herrn Giegelhundt noch jemand anderes?“ Er ignorierte die Frage der Hundebesitzerin und verzichtete auch darauf, sie beide als Kriminalkommissare vorzustellen. In ihrem Aufzug hätte sie sie womöglich eh nicht für voll genommen.
Die Nachbarin verneinte, verriet ihnen aber, dass die Giegelhundts keine Kinder hatten, aber immer nett und hilfsbereit waren. Dann zog sie ihren Hund beiseite, der gerade versuchte, den Pfeiler des Gartentürchens anzupinkeln, verabschiedete sich und ging schnellen Schrittes weiter.
Horst sah Schorsch an. „Mist, da hätten wir vielleicht gleich eine EMA-Abfrage starten sollen, dann hätten wir uns den Weg sparen können. Heute, an einem Samstag, nach weiteren Angehörigen zu forschen, ist fast unmöglich. Oder wollen wir die übrigen Nachbarn befragen – so in unseren Glubb-Outfits?“
Schorsch musste schmunzeln. „Wir können es ihnen ja als Symbol für mehr Bürgernähe verkaufen. Ab heute trägt die fränkische Polizei nur noch rot-weiß anstatt grün!“
Horst lachte aus vollem Halse, Schorsch jedoch wurde schnell wieder ernst. „So ein gepflegtes Anwesen … Aber warum steht die Gartentür sperrangelweit offen? Das stört mich irgendwie. Gehen wir mal ums Haus herum!“
Als sie die Terrasse betraten, erkannten beide sofort, dass Schorschs Instinkt wieder einmal richtig gewesen war. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen, wenn auch nur ein kleines Stück.
Mit den Worten „Hallo, ist hier jemand?“ betraten sie das Haus, dessen Boden, Mobiliar und Wände mit einem grauen Nebel belegt waren. Es glich einer dicken Staubschicht, doch Horst und Schorsch bemerkten sofort den abgebrannten Nebelkörper, der am Boden lag.
„Da hat wohl jemand versucht, Spuren zu beseitigen“, sagte Horst und versuchte, den Hustenreiz zu unterdrücken, den die Chemikalien sogleich bei ihm hervorriefen. Es gelang ihm jedoch mehr schlecht als recht, und Schorsch deutete ihm an, doch den Club-Schal als Schutz über das Gesicht zu halten.
Auch er hatte Nase und Mund mit seinem Schal abgedeckt und öffnete als Erstes das angrenzende Esszimmerfenster, um einen Durchzug auszulösen. Nach einer kurzen Wartezeit arbeiteten sie sich langsam durch das Wohnzimmer in die anderen Räume voran und stellten schnell fest, dass hier jemand offensichtlich etwas gesucht hatte. Im Büro des Anwesens fanden sie Zeitschriften, Briefe und sonstigen Schriftverkehr verstreut am Boden, Lade- und USB-Kabel lagen abgenabelt auf dem Schreibtisch. Lediglich der Drucker stand noch an Ort und Stelle, auf einem kleinen Beistelltisch neben dem Sekretär. Auch hier waren alle Gegenstände und Möbel mit einer grauen Schicht bedeckt. Als Schorsch um den Schreibtisch herumging, fiel sein Blick auf die zwei Tarotkarten, die dort so demonstrativ platziert waren, dass er sofort spürte, dass dies kein Zufall sein konnte.
Alle Spuren deuteten auf einen gewaltsamen Einbruch hin. Die Telefonbuchse im Flur war herausgerissen, und Horst konnte problemlos Hebelspuren an der Terrassentür ausmachen. Ihre Spusi musste her.
Schorsch griff zu seinem Mobiltelefon und verständigte den Kriminaldauerdienst, kurz KDD. Auch Robert Schenk und sein Team konnten sich den vorzeitigen Feierabend abschminken, es galt einen zweiten Tatort zu sichern. Zudem wurde immer wahrscheinlicher, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Tod der beiden Giegelhundts und dem Einbruch geben musste. Wie es schien, hatten sie es also doch mit einem Kapitalverbrechen zu tun.
Während die beiden Kommissare auf ihre Kollegen warteten, klingelte Schorschs Handy. Es war seine Freundin Rosanne.
„Na, mein Lieber“, flötete sie ins Telefon, „wie ist das Spiel ausgegangen? Ich freu mich ja schon so auf das Konzert heute Abend. Wusstest du, dass es schon seit Wochen ausverkauft ist?“
Schorsch musste kurz überlegen. Stimmt ja, für den heutigen Samstagabend hatten sie von ihrem Freund Leo zwei Karten für das Konzert „La Notte Italiana“ erhalten. Es war eine der schönsten Open-Air-Veranstaltungen in Franken und fand um zwanzig Uhr im Nürnberger Serenadenhof statt. Seit Wochen sprach Rosanne über nichts anderes beziehungsweise hörte die Arien und Duette aus „La Traviata“, „Norma“, „Tosca“ und „Don Giovanni“ rauf und runter. Er durfte sie nicht enttäuschen. Zudem hatte Leo heute auch noch Geburtstag und organisierte für seine engsten Freunde nach dem Konzert eine italienische Nacht in seinem Restaurant am Jakobsplatz.
„Hallo, meine Zaubermaus! Wir haben leider verloren. Und nicht nur das. Vor uns im Stadion ist ein Paar gestorben. Eine schreckliche und äußerst unangenehme Geschichte. Es sieht ganz nach einem Verbrechen aus. Aber später mehr. Ich bin mit Horst gerade noch im Anwesen der Opfer, versuche aber auf jeden Fall pünktlich zu sein, versprochen. Ich melde mich. Kuss!“
Schorsch schmatzte ins Telefon und beendete das Gespräch. Dann wandte er sich an Horst.
„Mensch, Horst, in vier Stunden beginnt ein Konzert, für das ich und Rosanne Karten geschenkt bekommen haben. Ich hoffe, Robert rückt bald mit seiner Mannschaft an. Ich muss diesen Termin heute Abend unbedingt wahrnehmen, sonst könnte es richtig Stress mit Rosanne geben.“
Horst grinste. „Das kriegen wir schon hin. Der KDD wird Robert bereits informiert haben, und die Tatortsicherung werden die auch ohne uns hinbekommen. Wenn es überhaupt noch Spuren gibt! So wie es hier ausschaut, waren Profis am Werk. Spusi, ade! Also mach dir keine Gedanken, sobald die Kollegen eingetroffen sind, rücken wir ab. Wir haben beide ein dienstfreies Wochenende, dafür gibt's ja auch unseren Bereitschaftsdienst.“
Es dauerte noch bis kurz nach fünf, bis die Herbeigerufenen tatsächlich eintrafen. Jetzt erst konnte eine Objektabklärung, also eine genaue Durchsuchung und Skizzierung der Räumlichkeiten, erfolgen. Trotz ihres Vorsatzes entschlossen sich Schorsch und Horst, doch noch ein paar Minuten länger am Tatort zu bleiben. Sie wollten die ersten Eindrücke der Spurensicherer erfahren.
Als Erstes aber legten alle anwesenden Beamten Staubschutzmasken an, bevor sie zur eigentlichen Tatortsicherung übergingen. Bei dieser kamen dann einige Überraschungen ans Licht.
Das alte Backsteinhaus mit seinen grünen Tür- und Fensterelementen passte an sich sehr gut in die Wohngegend. Insbesondere der wilde Wein, der fast die ganze Vorderfront bewucherte, hatte einen besonderen Reiz, dachte Schorsch. Solch ein hübsches Anwesen mit einem großzügigen Garten fand man heute sehr selten in dieser Gegend.
Im Wohnzimmer fiel auch erst einmal das gepflegte – wenn auch von grau-weißem Staub überzogene – Interieur auf, das den Charme eines alten Landhauses versprühte. Der Dielenboden knarrte ein wenig, doch auch das passte zum Ambiente. Genau wie der große offene Kamin, der im englischen Stil gehalten war und dessen beide Seiten aus Sandsteinquadern bestanden. An den oberen Spitzen erkannte Schorsch eine ihm bekannte Steinfigur. Es war eine verkleinerte Nachbildung des „Gargoyle“ von Notre Dame de Paris, dem wasserspeienden Drachen.
Unweit vom Kamin stand eine moderne Couchgarnitur aus schwarzem Leder, vor der sich ein außergewöhnlicher Tisch befand. Als besonderes Merkmal hatte dieser vier bronzefarbene Widderköpfe als Tischbeine, die in alle vier Himmelsrichtungen ausgerichtet waren. Auf den vier Köpfen war eine rechteckige schwarze Steinplatte aufgesetzt, in deren Mitte sich ein seltsames metallenes Zeichen befand.
„Ein Pentagramm“, kommentierte Robert trocken. „Haben wir da etwa einen alten Opfertisch vor uns?“
Schorsch betrachtete das seltsame Möbelstück genauer. Die Widderköpfe waren von Staub, aber auch grüner Patina überzogen, und die Tischplatte wies etliche Kratzspuren auf. Es war augenscheinlich ein wirklich alter Tisch. Aber dass es sich um einen Opfertisch handeln sollte, darauf wäre Schorsch nie gekommen.
„Das ist in der Tat ein Pentagramm“, bestätigte nun auch Horst. „Sieht aus wie ein Teufelstisch!“
Schorsch warf seinem Kollegen einen ungläubigen Blick zu. „Woher weißt denn du, wie so was aussieht? Du bist doch unser Engelchen!“
Horst verzog den Mund zu einem gequälten Lächeln. Er wollte gerade zum Konter ansetzen, da ertönte eine Stimme aus dem Keller: „Leute, kommt mal alle runter und seht euch das hier an! Das glaube ich jetzt nicht!“ Es war Ute Michel, Roberts rechte Hand, die mit zwei Leuten die Kellerörtlichkeiten unter die Lupe nahm.
Schorsch, Horst und Robert begaben sich in den Keller. Der beißende Geruch der chemischen Substanz, die dort verteilt worden war, hatte sich etwas gelegt, nachdem die Beamten für ein wenig Durchzug gesorgt hatten. Ute empfing die drei im Türrahmen einer alten Luftschutztür.
„So etwas habe ich noch nicht gesehen, seht mal!“, forderte sie die drei auf, näher zu kommen.
Neugierig gingen die Männer auf die Tür zu und betraten den Raum, der dahinter lag. Es war jedoch eigentlich kein richtiger Raum, eher ein Zugangsbereich, der auf zwei weitere Räume hinwies. Auf dem Boden bemerkten sie eine abgebrannte Nebelkerze.
Der Raum, der sich links von der alten Luftschutztür befand, war als Wohnraum eingerichtet. Er war circa sechs Meter lang und drei Meter breit und in einer dunklen Petrolfarbe gestrichen, die nun ebenso mit einem grauen Schleier überzogen war. Im hinteren Teil befand sich eine schlichte weiße Kloschüssel ohne Deckel, nur mit Brille, die links von einem weißen Waschbecken flankiert wurde. Im Raum selbst standen ein graues Sofa, ein Regal aus Holz, ein Bett und ein Tisch mit einem Stuhl. Der Boden war mit einem gemusterten Stragula-Bodenbelag versehen. Eine Neonleuchte, die über dem Bett hing, und eine alte schwarze Schiffslampe über der Toilette waren die einzigen Leuchtmittel im Raum. Es gab kein Fenster, lediglich dicke Glasbausteine, die im oberen Viertel der knapp drei Meter hohen Mauern eingelassen waren, ließen Licht in das vermeintliche Verlies. In den vorhandenen Holzkommoden waren neben Frauenbekleidung auch Kosmetiksachen und Hygieneartikel gelagert. Es sah in der Tat nach einer etwas zu komfortabel geratenen Gefängniszelle aus.
„Und das in einem privaten Wohnhaus in einer ach so schicken Wohngegend! Unfassbar!“, grummelte Horst vor sich hin.
„Das ist leider noch nicht alles“, sagte Ute und forderte die Männer auf, ihr in den anderen Raum zu folgen, der rechts hinter der Luftschutztür lag. „Aber ich muss euch gleich enttäuschen, denn auch hier haben die Einbrecher einen Nebelkörper gezündet. Das nenne ich wirklich Spurenvernichtung par excellence!“
Beim Betreten des circa fünfundvierzig Quadratmeter großen Zimmers verschlug es allen die Sprache. Vor ihnen stand eine Art Altar von etwa drei Metern Länge und zwei Metern Breite. In der Mitte dieses Altars – oder Opfertischs? – hing ein tellergroßes Pentagramm, allerdings mit der Spitze nach unten, das von der Gewölbedecke mit einer Kette über dem Altar fixiert war.
Spontan bemerkte Horst: „Schau an, ein gestürztes Pentagramm oder auch Drudenfuß genannt! Wieder ein Zeichen des Bösen. Da sind wir wohl mitten in einem Teufelstempel angelangt.“
Schorsch verzog angewidert den Mund, während Horsts Neugier offensichtlich geweckt war. Er inspizierte die Gegenstände auf dem Altar genauer.
„Diese zwei Schädel hier stammen eindeutig von Tieren, ich vermute mal, es handelt sich um Ziegen- oder Widderschädel. Das würde ja auch zu dem Mobiliar im Wohnzimmer passen. Und das hier –“ Horst deutete auf zwei Brocken, die aussahen wie vertrocknete Organe. „Das könnten die mumifizierten Herzen dieser Tiere sein. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht, das müssen selbstverständlich unsere Spezialisten abklären.“
Direkt unter dem Pentagramm stand ein dickes altes Buch senkrecht aufgestellt auf einer silbernen Schale. Auf beiden Seiten des Buches lag jeweils eine Tarotkarte. Die linke zierte ein Teufelskopf und die römischen Ziffer XV, auf der rechten waren die römische Zahl XIII und das Bild eines Sensenmannes, also des Todes, zu sehen.
„Sieh an, dieselbe Tarotkarte haben wir doch im Obergeschoss gefunden, die mit der römischen Ziffer für dreizehn“, meinte Schorsch.
„Sieht nach einem Schauplatz für Schwarze Messen aus“, stellte Ute Michel nüchtern fest.
Alle drei Männer stimmten ihr zu, obgleich sie kein Wort sagten, sondern nur ein leichtes Kopfnicken andeuteten.
Im hinteren Teil des Raumes befand sich zudem ein schwarzes hölzernes Andreaskreuz, an dessen oberen und unteren Enden Handfesseln angebracht waren.
„Da schau her, so ein Andreaskreuz hatte Gerry Huber auch in seinem Swingerclub“, bemerkte Schorsch lapidar und erinnerte sich an die Mordsache Falk Thalmann am Nürnberger Pulversee, die sie 2009 gemeinsam aufgeklärt hatten.1 Damals hatte er gehofft, so etwas nie wieder zu Gesicht zu bekommen.
„Der markante Tisch im Wohnzimmer, das Verlies und der okkulte Opferraum hier im Keller lassen nur den Schluss zu, dass wir es hier mit Anhängern der Satanistenszene zu tun haben“, fasste er ihre Entdeckungen zusammen. „Unsere beiden Opfer waren offensichtlich nicht so harmlos, wie sie auf den ersten Blick aussahen, sondern ausgefuchste Teufelsanbeter. Darauf hin deutet auch die Mitgliedskarte dieses Clubs, die wir bei ihren Personalien gefunden haben.“
Keiner der Anwesenden widersprach ihm. Schorsch warf einen Blick auf sein Männerspielzeug – so bezeichnete er selbst seine Uhr einer bekannten Schweizer Uhrenmanufaktur, deren Gründer aus dem oberfränkischen Kulmbach stammte, und die er heiß und innig liebte. Schon kurz vor halb sieben! Wenn ich heute nicht selbst noch gevierteilt werden will, muss ich jetzt los, dachte Schorsch, musste aber im selben Moment schmunzeln. Vor seinem inneren Auge tauchte Rosanne mit Teufelshörnern auf dem Kopf und einem Dreizack in der Hand auf. Aus ihren Nasenlöchern trat Dampf aus, und ihre Wangen glühten wie zwei feuerrote Herdplatten. Ein urkomisches Bild, das dem ganzen Spuk hier zumindest ein bisschen Humor verlieh!
Er verdrängte die Vorstellung schnell aus seinem Kopf, bevor er laut loslachen musste, und wandte sich mit ernster Miene an Robert. „Ich nehme an, ihr kommt jetzt ohne mich hier zurecht. Ich habe nämlich noch was vor und außerdem das Wochenende frei. Aber ich bin jetzt schon gespannt auf euer erstes Ergebnis – wenn ihr hier überhaupt noch Spuren findet! Und natürlich auf das, was Doc Fog über die Todesumstände der Giegelhundts in Erfahrung gebracht hat. Wir sehen uns dann am Montag.“ Er blickte zu Horst und forderte ihn auf, ihm zu folgen. „Komm, pack mer's!“
Beide verließen das Anwesen und gingen zu Schorschs Strich-Acht, den sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt hatten.
Die Zeit drängte, Schorsch wollte unbedingt pünktlich sein. Er setzte Horst am U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz ab, denn von dort aus erreichte der bequem den Hauptbahnhof und im Anschluss seine S-Bahn nach Schwarzenbruck, wo der Kriminaloberkommissar Zeit seines Lebens zu Hause war.
Samstag, 23. August 2014, 18.53 Uhr, Pilotystraße, Nürnberg
Schorsch stand gerade noch unter der Dusche, als die Badezimmertür aufging und Rosanne hereinkam. Sie hatte sich für die italienische Nacht besonders herausgeputzt. Ihr enges kirschfarbenes Seidenkleid war supersexy geschnitten, das Dekolleté lag frei und betonte ihren fraulichen und doch athletischen Körper. Dazu trug sie die passenden Ohrringe mit Halskette. Es waren kleine rote Steine in Herzform. Die Halskette mit dem Anhänger lag kunstvoll auf ihrer sonnengebräunten Haut oberhalb ihres Busens. Ihre Haare hatte sie wie immer hochgesteckt, der Lippenstift betonte ihre zarten Lippen, und ihre kirschroten High-Heels waren wie immer waffenscheinpflichtig.
Schorsch blickte auf die Uhr, die über der Badezimmertür hing. Nein, für das, woran er gerade gedacht hatte, blieb ihnen keine Zeit mehr. Ihr Blick verriet, dass sie dieselben Gedanken hatte wie Schorsch, weshalb sie ihn keck ansah und murmelte: „Später, mein Bester! Später …“
Kurz vor drei viertel acht hatten sie den Eingangsbereich zum Serenadenhof erreicht. Leo, der in Begleitung einer hübschen Italienerin bereits ungeduldig auf Rosanne und Schorsch wartete, begrüßte sie freudestrahlend.
Er hatte sich zu seinem Geburtstag so richtig fesch gemacht. Leo trug wie Schorsch einen schwarzen Anzug, wobei er im Gegensatz zu seinem Freund keine Krawatte trug. Bei seinem Seidenhemd hatte er die oberen drei Knöpfe wie immer offen gelassen, sodass sein goldener Kreuzanhänger und seine behaarte Brust zum Vorschein kamen. Das gehörte einfach zu ihm, und an diesem Abend war er damit auch nicht alleine. Schließlich sollte es ja eine italienische Nacht werden.
Das Konzert war berauschend, und Rosanne musste sich zurückhalten, die Opernlieder nicht lauthals mitzusingen. Zum Glück hielt auch das Wetter, sodass es ein wahrlich romantischer Sommerabend wurde, für den sich die Hetzerei am Nachmittag mehr als gelohnt hatte.
Kurz vor dreiundzwanzig Uhr erreichten sie Leos Restaurant. Anlässlich seines Geburtstages hatte sich Leo etwas Besonderes für seine Gäste einfallen lassen. Im hinteren Teil des Lokals, also im Außenbereich, hatten seine Angestellten eine kleine Feuerstelle aufgebaut und ringsherum die Tische eingedeckt. Darauf standen schon verschiedene Weinkaraffen.
Im Hintergrund lief leise der Song „Senza Una Donna“ von Zuccero, als Leo nochmals alle herzlich begrüßte. Rosanne und Schorsch überreichten ihm ein Kuvert. Sie hatten für Leo ebenfalls zwei Konzertkarten besorgt, für ein Klavierkonzert in der Meistersingerhalle.
Kurze Zeit später kam das Essen. Als Vorspeise gab es Arancini, also frittierte Reisbällchen mit einer Hackfleischfüllung, sowie Caponata, eine süß-sauer zubereitete Speise aus Paprika, Auberginen, Kapern und Zwiebeln. Als Hauptspeise reichte Leo dann Sarde a beccafico, das waren gefüllte Sardinen zubereitet nach einem Geheimrezept seiner Oma aus Favara. Zur weiteren Auswahl hatte er noch gegrillten Schwertfisch für seine Gäste auftragen lassen.
Als dann gegen halb eins noch sein hausgemachtes Tiramisu serviert wurde, mussten einige der Gäste ihre Gürtel öffnen. Leos Gastfreundschaft war wie immer grenzenlos und seine Großzügigkeit beispielhaft.
Es war kurz vor drei Uhr nachts, als das Taxi vor der Tür stand, das Schorsch und Rosanne zurück in die Pilotystraße bringen sollte. Leicht beschwipst stiegen sie ein und kuschelten sich auf der Rückbank aneinander, während sie durch die Nürnberger Innenstadt chauffiert wurden.
Was für ein gelungener Abend! Und er war noch nicht zu Ende. Kaum zu Hause angekommen, fielen sie übereinander her. Jede Müdigkeit war wie weggeblasen, und nach diesem üppigen Mahl war ein bisschen „Bewegung“ ja auch mehr als willkommen.
Um kurz nach vier Uhr löschte Rosanne endgültig das Licht, und die beiden fielen sofort in einen tiefen Schlaf.