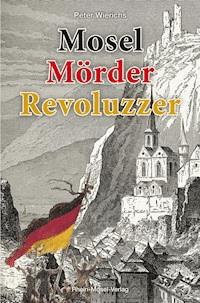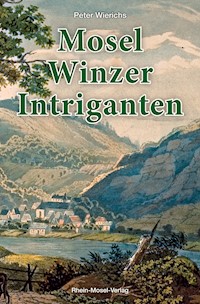
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Revolution von 1848 ist gescheitert, aber ihre Auswirkungen sind noch überall spürbar: Ehemalige Aktivisten werden verfolgt, längst geschlossene Akten wieder geöffnet und auch harmlose freiheitliche Regungen gnadenlos unterdrückt. Bei einem Fluchtversuch kommen die Verlobte des Dorfschulmeisters Alexander Martini und ihr Bruder in der von einer Sturmflut aufgewühlten Mosel ums Leben. Dazu wird der Schulmeister von einem engstirnigen Dorfpfarrer schikaniert und in seiner beruflichen Existenz bedroht. Und erneut kommt es in dem Weindorf bei Bernkastel zu Todesfällen und anderen merkwürdigen Ereignissen. Werden alte Rechnungen beglichen oder spielen noch ganz andere Motive mit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2020 – E-book-Ausgabe RHEIN-MOSEL-VERLAG Zell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel 06542/5151 Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-888-3 Ausstattung: Stefanie Thur Titelbild: Carl Bodmer
Peter Wierichs
Mosel
Winzer
Intriganten
Historischer Krimi
Rhein-Mosel-Verlag
Prolog: Winter 1849/50
Schon seit Wochen goss es wie aus Kübeln. Längst hatte der Fluss sein Bett verlassen und zunächst die zahlreichen Buhnen überflutet, die sein Temperament bremsen sollten, dann den sandigen Uferstreifen. Nun tastete er mit nassen Fingern nach den Schobeln1, den Ställen und Wohnhäusern der Menschen. Die Straßen und Gassen Bernkastels lagen verlassen da, als wüte die Pest im Städtchen, viele Fenster blieben auch an diesem Abend dunkel, weil die Bewohner an Licht sparen mussten. Nur aus einem Fachwerkhaus an der Kallenfelsstraße fiel durch winzige Fenster ein flackernder Schein, drangen laute, manchmal erregte Stimmen auf die steil ansteigende Gasse mit ihrem groben Pflaster. Dort, in der engen, verräucherten Gaststube versuchten ein paar Männer, sich das schlechte Wetter und die Einsicht in eine allgemeine Misere samt gescheiterter Revolution schönzutrinken. Nur in gehobener Stimmung vergaß man die Knute der Preußenherrschaft, denn der König in Berlin samt seinen Helfershelfern in der Rheinprovinz und vor Ort hatte das Land inzwischen wieder voll im Griff.
Gerade setzte einer der Männer sein Weinglas an den Mund und stimmte dann ein melancholisches Lied an, das die gedrückte Stimmung nach dem Ende der Kämpfe um mehr Freiheit und Selbstbestimmung zum Ausdruck brachte:
’S ist wieder März geworden,
von Frühling keine Spur.
Ein kalter Wind aus Norden
erstarret rings die Flur.
Diesem neuen, rauen Wind der Reaktion entsprechend, der auch durch das Moseltal wehte, beschränkte sich der Verfasser auf Bilder und Anspielungen, sprach von üppig blühenden »Pfaffenhütchen«, vom »Wütrich«, von »Königskerzen« und dem überall dicht wachsenden »Zittergras«. Damit meinte er natürlich die nach den Anfeindungen durch einen Teil der Revolutionäre wieder erstarkte Kirche, den rabiat durchgreifenden Staat und einen König, dem nun alle wieder bedingungslos zu gehorchen hatten. Vor diesen Institutionen zitterten die verunsicherten Bürger. Nur in einer einzigen Strophe wurde der Liedtext etwas deutlicher:
Der März ist wohl erschienen.
Doch ward es Frühling? – Nein!
Der Lenz kann uns nur grünen
im Freiheitssonnenschein.
Zögernd stimmten die Zechgenossen ein, und nun klang ein schwermütiger Chor gegen die niedrige Balkendecke. Nur ein einzelner, schmächtiger Mann, der kaum merklich von den anderen abgerückt war, obwohl er augenscheinlich mit zu der Gruppe gehörte, hielt seinen Mund geradezu demonstrativ geschlossen.
Jetzt verklang der Gesang, und ein lastendes Schweigen machte sich breit, während die Männer weiterhin üppige Rauchschwaden produzierten. Endlich brach ein großer, stattlicher Mann das Schweigen: »Et hat wirklich nix gebracht«, stellte er seufzend fest.
»Rein gar nix«, pflichtete ihm ein zweiter bei. »Mir zahlen immer noch Steuern für einen Wein, wo mir nit verkaufen können …«
»›Die Trauben und das Elend blüh’n an der Mosel‹, soll in Berlin in ’ner Zeitung gestanden haben. Un wat tut die Regierung dagegen? Nix!«
»Nix außer Steuern abkassieren«, warf ein dritter wütend ein.
»Un die Leut’ ausspionieren«, rief der erste. »Überall schnüffeln preußische Spitzel erum. Man sagt wat, wenn man unner de Leut’ geht un’n Glas Wein trinkt, un schon hat man ’ne Anzeige weg. ›Anstiftung zum Aufruhr‹ heißt et dann. Vor der Revolution war et ja schon ziemlich schlimm, aber jetzt is et noch viel schlimmer …«
»Aber dat is ja noch nit emal dat schlimmste«, rief ein anderer. »Et gibt einfach zu viele Denunzianten. Wenn einer mit seinem Nachbarn noch’n Hühnchen zu rupfen hat, fällt ihm oft nix besseres ein, als zu melden, dat der Betreffende im letzten Jahr vielleicht doch mit ’ner Flinte in der Stadt erumgelaufen is. Oder dat der irgendwann mal über die Preußenwirtschaft geschimpft hat. Un schon kriegt der Ärger. Sogar wenn einer nur mal dumm erumschwätzt, gibt et vielleicht ’nen anneren, der dat mitkriegt un ihn an’t Messer liefert.«
»In Wintrich han se nu sogar den Herrn Pfarrer Kranz versetzt, weil der letztes Jahr für die Revolution gepredigt hat. Der Neue is natürlich fest auf Linie. Un nu geh’n die Leut’ in Wintrich nit mehr zu dem in de Kirch’. Sie laufen lieber bis Dusemond oder setzen über nach Minheim, wenn se in de Mess’ wollen.«
»Meinen Nachbarn han se eingesteckt, weil der im besoffenen Kopp dat Heckerlied gesungen hat. Als hätt’ der gestohlen oder betrogen.« Er warf einen Blick in die Runde. »Hier weiß man wenigstens, wer mit am Tisch sitzt …«
Mit jedem neuen Glas Wein wurde die Diskussion hitziger, schallten die Stimmen lauter durch den kleinen Gastraum. Wenn ein allzu derbes Kraftwort fiel oder ein Ausdruck wie »Vaterlandsverräter« oder gar »Preußenhunde«, runzelte der hinter seinem winzigen Tresen hantierende Wirt jedesmal missbilligend die Stirn und blickte sorgenvoll zu seinen Gästen herüber. Doch dann wurde jedesmal wieder ein neuer Krug Wein geordert, und der Wirt tauchte unter dem hufeisenförmigen Bogen mit der halb offenstehenden Brettertür ab, um das Gefäß im Keller aufzufüllen. Wenn er dann wieder in der Oberwelt erschien, klangen die Stimmen erneut ein wenig zorniger, waren die Gesichter in noch tieferem Rot angelaufen, war der Volkszorn noch um ein paar weitere Grade hochgekocht.
Nur der kleine, unscheinbare Mann, der inzwischen noch ein wenig mehr von den übrigen Zechern abgerückt war und an seinem Glas nur nippte, beteiligte sich nach wie vor nicht an der Diskussion. Sein schmales, unauffälliges Gesicht drückte Missbilligung, ja Unverständnis aus angesichts der widerborstigen Reden, die hier geschwungen wurden. Es war der Schneider Jansen, ein Zuzug aus dem niederrheinischen Städtchen Kempen, ein stiller, bescheidener, gottesfürchtiger Mann, der freiwillig kaum je eine Weinstube betreten haben würde. Heute hatte er aber bei einem seiner besten Kunden zu tun gehabt, einem der Herren, die jetzt lautstarke Reden führten, und sein Auftraggeber hatte ihn quasi genötigt, nach der letzten Anprobe noch ein Glas mit ihm trinken zu gehen. Natürlich hatte Jansen es nicht gewagt, diese Einladung auszuschlagen, denn Kunden, die großzügig Aufträge erteilten, die geleistete Arbeit umgehend bezahlten und dann auch noch regelmäßig wiederkamen, waren in Zeiten wie diesen dünn gesät. Nun hockte Jansen also auf der schmalen Holzbank und fühlte sich alles andere als wohl in dieser Runde. Er war von Anfang an gegen die Revolution gewesen, weil er überhaupt nichts von Zeitgenossen hielt, die es wagten, eine Herrschaft »von Gottes Gnaden« in Frage zu stellen und eine seit Jahrhunderten bestehende Ordnung umstürzen zu wollen. Sogar für Geistliche wie den Pfarrer Kranz aus Wintrich oder den Kaplan Ohaus aus Bernkastel, die seiner Meinung nach ihren Glauben verraten hatten, verspürte er wenig Sympathie. Einfach aufzustehen und die Weinstube zu verlassen traute er sich aber nicht und schon gar nicht zu protestieren, da ihm nichts mehr zuwider war, als Aufsehen zu erregen. So saß er mit steinerner Miene zwischen den lautstarken Zechern. Erst als sich bei ihm ein gewisses Bedürfnis meldete, stand er schweigend auf und verließ die Gaststube durch eine schmale Hintertür, die auf einen engen Innenhof führte.
Als er sein Geschäft verrichtet hatte und die Gaststube wieder betrat, erreichte die aufrührerische Stimmung gerade einen neuen Höhepunkt. Nun wurden lautstark »Stückelcher« von den Heldentaten im November 1848 zum besten gegeben, als es ein einziges Mal gelungen war, die Preußen aus der Stadt zu vertreiben, um den örtlichen Revolutionsführer Peter Joseph Coblenz samt seinen Anhängern vor einer Verhaftung zu bewahren. Einen halben Tag lang war Bernkastel frei gewesen, eine Art Freie Republik, wie die Revolutionäre sie sich erträumten, im Kleinformat gewissermaßen. Aber schon in der darauffolgenden Nacht waren die Preußen zurückgekommen, mit Soldaten und Kanonen, um das aufmüpfige Städtchen wieder unter ihre Fuchtel zu bringen. Von diesen weiteren Ereignissen war jetzt allerdings wohlweislich nicht die Rede. Stattdessen wurde der schmachvolle Auszug der preußischen Beamten quer durch die ganze Stadt noch einmal genussvoll ausgemalt, einschließlich all der Schimpfwörter und Beleidigungen, die ihnen samt einiger Steine an den Kopf geflogen waren, als sie davonzogen wie geprügelte Hunde und nur dank der Soldaten, die sie eskortierten, vor schlimmerem bewahrt werden konnten, und das alles zu flotter Musik. Vor dem Stadttor in Richtung Veldenz mussten die in die Flucht Geschlagenen dann an einer Phalanx erboster Bürger vorüberdefilieren und sich noch einmal Lästereien und Beschimpfungen anhören, wozu die Musik das Lied »Kein schöner Land in dieser Zeit« spielte. Je länger erzählt wurde, desto mehr redeten sich die Männer in Hitze, als sei das Jahr 1848 noch einmal zurückgekommen, und der Wind der Freiheit wehe wieder durch das Moseltal. Dann stimmte einer der Männer unvermittelt eines der drastischeren Lieder von damals an:
Ein Jäger aus Kurpfalz,
hat seinem Fürst den Arsch geleckt,
jetzt stinkt er aus dem Hals …
Den drei Versen folgte ein ebenso lust- wie kraftvolles »Juja, juja, hat seinem Fürst den Arsch geleckt …«, bei deutlicher Betonung dieses edlen Körperteils.
Jetzt wurde es dem Wirt zuviel. »Aber meine Herren, ich muss doch sehr bitten …«, begann er zögernd.
Seine vorsichtige Intervention erntete nur wütenden Protest. »Wat mischst du dich ein?«, rief einer der Zecher wütend, und ein anderer fragte ironisch nach, ob der Wirt vielleicht fürchte, der Gesang könne sein Lokal beschädigen …
Da wurde die Tür zur Straße mit einem Ruck aufgerissen. In ihrem Rahmen stand der preußische Gendarm Skubovius, eskortiert von seinen Kollegen Ericke und Schmitz. 160 Zentimeter stocksteif gen Himmel gereckte Autorität standen im Raum, und zwei ärgerlich aufgerissene Schweinsäuglein schleuderten Blitze gegen die renitente Tischrunde.
»Aus dem Weg!«, bellte Skubovius den Wirt an, der sich daraufhin eingeschüchtert hinter seinen Tresen verzog. Dann trat der Gendarm mit schwerem Stiefelschritt an den fidelen Wirtshaustisch.
»Meine Herren, mir ist zu Ohren gekommen, dass hier defäkistische Reden gehalten werden«, schnarrte er in altpreußischem Amtston. Falls jemand den sprachlichen Schnitzer bemerkt hatte, traute er sich jedenfalls nicht zu grinsen, denn Skubovius dachte natürlich nicht an »die Darmentleerung betreffende«, sondern »defätistische«, also schwarzseherische, die staatliche Moral untergrabende Reden und meinte damit wohl staatsfeindliche Äußerungen. Aber man verstand ihn auch so.
»Damit ist jetzt jedenfalls Schluss. Die Runde ist aufgelöst«, verkündete er und wandte sich an seine Leute. »Schafft sie allesamt auf die Wache! Wir werden schon herausbringen, wer sich hier durch lose Reden strafbar gemacht hat.«
Alexander Martini stand mit seiner Verlobten Maria und ihrem Bruder Kurt Molitor vor einer unendlichen Wasserwüste, die der außer Rand und Band geratene Fluss in den letzten Tagen geschaffen hatte. Von ruppigen Böen aufgepeitschte Wellen schlugen nun direkt gegen die niedrige Flussterrasse, auf der das Dorf stand, ein paar außerhalb liegende Ställe und Schobel hatten sie längst überflutet. Auch das winzige Fährhaus, kaum mehr als eine wackelige Bretterbude, stand fast bis zum Dach unter Wasser. Pechschwarze Wolken schossen über den Nachthimmel, angetrieben von dem heftigen Sturm, der immer wieder Wasserfontänen gegen die drei in strömendem Regen ausharrenden Menschen peitschte. Von dem schwachen Licht einer Laterne, die Martini in seiner Linken hielt, drang kaum mehr als ein Schimmer durch die Dunkelheit, rundherum sah man kaum die Hand vor Augen, konnte nur mit Mühe die Umrisse des Nachens ausmachen, den der Fährmann vor ein paar Tagen die Uferböschung hochgezogen hatte, damit er bei dem Hochwasser nicht abtrieb.
»Dass ich dich nun schon wieder gehen lassen muss«, murmelte Maria tonlos.
»Wo bleibt denn bloß der Ferger?«, fragte Martini und sah sich dabei unruhig um. »Er wird doch wohl nicht im letzten Augenblick noch anderen Sinnes geworden sein?« Dabei dachte er an seine endlosen Reden, um den örtlichen Fährmann zu der riskanten Überfahrt zu bewegen. »Dat is doch viel zu gefährlich, Schulmeister!«, hatte der ältere Mann immer wieder eingewandt. »Bei dem Wetter saufen mir ab wie die Ratten.« Aber Martini hatte nicht locker gelassen, bis der Mann bereit gewesen war, Kurt Molitor an das gegenüberliegende Flussufer zu bringen, damit er den Preußen nicht in die Hände fiel.
Denn erst vor wenigen Stunden, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, war plötzlich Dietrich Jacoby, der junge Schreiber aus Bernkastel, in Martinis bescheidener Dienstwohnung im ersten Stock der verfallenen Dorfschule aufgetaucht, fast wie ein Fabelwesen aus einer anderen Zeit. Der Schulmeister hatte ihn seit Monaten, seit den letzten Zuckungen der Revolution, nicht mehr zu Gesicht bekommen. Auf Umwegen hatte er lediglich erfahren, dass auch der Schreiber, wie so viele andere, wegen seines Eintretens für Freiheit und Demokratie heftig unter Beschuss geraten war und auf seinem Posten nur überlebt hatte, weil er aus einer alten Bernkasteler Familie stammte und weil Freunde oder Gönner deswegen auch in diesen Zeiten ihre Hand schützend über ihn hielten. Dennoch tat Jacoby, wie so viele andere auch, derzeit gut daran, die Füße still zu halten, denn für politische Aktionen waren die Zeiten schlecht: Nirgendwo fanden mehr Bürgerversammlungen statt, und es gingen auch keine »Adressen«2 mehr nach Berlin, die man unterstützen konnte. Sie hätten ohnehin nichts bewirkt und ihren Urhebern stattdessen viel Ärger eingebracht.
Umso erstaunter war Martini über dieses unerwartete Wiedersehen gewesen. Voll Freude schloss er seinen früheren Mitstreiter in die Arme. »Mein Freund«, rief er. »Wie schön, dich zu sehen! Was führt dich zu mir?«
»Kurt Molitor muss noch heute Nacht untertauchen«, stieß Jacoby hervor. »Am besten wäre es, wenn er fürs erste zurück nach Frankreich ginge.«
Martini starrte den jungen Schreiber an, als fürchte er um dessen geistige Gesundheit. Zugleich spürte er, wie sich sein Herz zusammenzog. »Warum, um alles in der Welt?«, rief er entgeistert. »Kurt war doch während der ganzen Revolution überhaupt nicht in Deutschland.« Tatsächlich hatte Marias Bruder damals im Exil gelebt, in Burgund Wein angebaut und dort sein Lebensglück gefunden. »Und die Zeiten, da er sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt hat, liegen Ewigkeiten zurück.« Außerdem hatte sich dieses politische Engagement auf die Teilnahme an einem demokratischen Zirkel beschränkt, in dem lediglich diskutiert wurde. »Das war doch kaum mehr als ein Kaffeekränzchen«, fuhr er fort. »Selbst den Preußen sollte inzwischen aufgegangen sein, dass sie hoffnungslos falsch lagen, als sie ihn damals zur Fahndung ausschrieben, so dass er ins Ausland fliehen musste …«
»Das ist ja alles richtig«, unterbrach Jacoby ihn ungeduldig. »Aber du weißt, welche Hatz gerade wieder auf alle jene gemacht wird, die es gewagt haben, gegen die unhaltbaren Zustände in diesem Lande aufzubegehren, und wenn auch nur mit friedlichen Mitteln. Nur wenn die Gerichtsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt und mit einem Freispruch abgeschlossen worden sind, haben die Beschuldigten fürs erste Ruhe, es sei denn, irgendwelche missgünstigen Zeitgenossen graben etwas neues aus. Und dies ist leider nicht selten der Fall. Außerdem scheinen gewisse Bürokraten ein besonderes Vergnügen daran zu finden, sich erneut durch die alten Akten zu wühlen wie Wildschweine durch ein Gemüsebeet. Genau das ist offenbar Kurt Molitor widerfahren. Hinzu kommt, dass dein zukünftiger Schwager allem Anschein nach denunziert wurde.«
»Was, um alle Welt, wirft man ihm denn vor?«
»Es scheint, dass der demokratische Zirkel, an dem er vor der Revolution beteiligt war, Verbindungen ins Ausland hatte, genauer gesagt nach Frankreich.«
Martini zuckte zusammen wie unter einem Peitschenhieb. Tatsächlich hatte Kurt ihm einmal erzählt, dass er und seine Freunde sich damals mit Gleichgesinnten von jenseits der Grenze ausgetauscht hatten. Was mochte in diesen Briefen gestanden haben? Wie verfänglich waren sie, besonders aus heutiger Sicht? Und in welche Hände mochten sie geraten sein?
Unterdessen sprach Jacoby weiter: »Und nun steht der Vorwurf des Landesverrates im Raum.«
Spätestens jetzt fuhr es Martini eiskalt durch die Glieder. Auf Landesverrat stand der Tod, in minder schweren Fällen eine langjährige Festungsstrafe. Nur wenn sich der Verdacht als vollkommen gegenstandslos erwies, hatte sein zukünftiger Schwager eine Chance. Aber konnte man in Zeiten wie diesen auf Nachsicht und Milde oder nur Objektivität hoffen? Da war es zweifellos klüger, nichts zu riskieren.
»Hinzu kommt, dass Kurt Molitor damals tatsächlich nach Frankreich geflohen ist und dort längere Zeit gelebt hat …«
»Aber das hatte doch mit seinem harmlosen politischen Engagement rein gar nichts zu tun«, rief Martini.
»Das sagst du! Für gewisse Leute ergibt sich aber ein ganz anderes Bild. Jedenfalls tut Kurt Molitor gut daran, so schnell wie möglich zu verschwinden – zumindest bis sich herausgestellt hat, ob etwas an der Sache ist und ob sein Fall weiterverfolgt wird oder ob die Ermittlungen mangels Substanz eingestellt werden.«
»Hast du eigentlich eine Ahnung, wer Kurt denunziert hat?«, erkundigte Martini sich.
»Leider nicht«, antwortete Jacoby. »Aber es gibt ja inzwischen mehr Spitzel als einem lieb sein kann. Sei so gut und warne Kurt Molitor. Ich muss sofort zurück nach Bernkastel. Es wäre nicht auszudenken, wenn ich Skubovius und seinen Leuten hier über den Weg liefe.«
Der junge Schreiber hatte die Dorfschule kaum verlassen, da stürmte Martini schon aus seiner Wohnung und rannte hinüber zu dem stattlichen Winzerhaus bei der Kirche, um dort Alarm zu schlagen. Als nächstes war er in die Kirchgasse gehastet, eines der Sträßchen, die direkt herunter zum Fluss führten. An deren Ende, jetzt schon fast am Wasser, wohnte der örtliche Fährmann. Heute stand er nicht, wie sonst alle Tage, bereit, um die Leute auf ihren Ruf »Ferger, hol’ über!« hin ans andere Ufer zu bringen, weil bei den herrschenden Witterungsverhältnissen die gesamte Moselschifffahrt eingestellt worden war. So hatte Martini ihn aus seinem ersten Schlaf gerissen, um ihn zu beschwören, heute Nacht eine Ausnahme zu machen.
Während er mit Engelszungen redete, hatte er immer wieder verzweifelt über andere Fluchtrouten nachgedacht, etwa durch den Hunsrück. Aber dort war bei diesem Wetter wohl erst recht kein Durchkommen. Wiederholt war die Nachricht von umgestürzten Bäumen, über die Ufer getretenen Bächen und abgerutschten Hängen ins Dorf gedrungen. Leider war der leichteste und sicherste Weg, die relativ gut ausgebaute Straße nach Bernkastel und weiter in Richtung Veldenz, ebenfalls versperrt, denn dort würde Kurt Molitor den preußischen Gendarmen direkt in die Arme laufen.
Aber dann hatte der Fährmann nach langem Hin und Her plötzlich nachgegeben und sich bereit erklärt, die gefährliche Überfahrt doch zu wagen – nicht zuletzt angesichts der erklecklichen Summe, die der Schulmeister ihm schließlich im Auftrag seines zukünftigen Schwagers geboten hatte.
Nun tauchte in der Tintenschwärze dieser Sturmnacht plötzlich ein weiterer, unsicher flackernder Lichtschein auf. Martini stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Gottlob, der Ferger!«, rief er.
Jetzt hatte der mühsam gegen den Sturm ankämpfende Mann die Wartenden erreicht.
»Ich wollt’ Euch nur Bescheid geben, dat aus der Überfahrt nix wird«, keuchte er. »Et geht einfach nit. Nit heut nacht. Vielleicht morgen früh.«
»Morgen ist es zu spät!«, rief Martini entsetzt. Aber sein Gegenüber ließ sich nicht beirren.
»Seht Euch doch um«, sagte er. »Dat Wasser steigt immer noch, un der Wind wird immer stärker. Wahrscheinlich is’ da oben bei Trier noch mehr Regen eruntergekommen, un nu wird der Fluss immer reißender. Da erüber zu wollen, is lebensgefährlich.«
»Es gibt aber keinen anderen Weg!«, beharrte Martini. »Wollt Ihr denn, dass Kurt Molitor den Preußen in die Hände fällt?«
»Vielleicht wäre es ja ratsam, doch die Strecke durch den Hunsrück zu nehmen«, wandte Maria jetzt mit leiser Stimme ein.
»Da verliert er viel zu viel Zeit«, rief Martini. »Außerdem ist dieser Weg nicht minder gefährlich, ganz abgesehen davon, dass dort derzeit kein Mensch durchkommt. Die einzig sichere Route führt auf dem gegenüberliegenden Flussufer über Cues und Lieser. Ich flehe Euch an, Ihr müsst uns einfach helfen«, beschwor er erneut den Fährmann.
Jetzt mischte sich der Betroffene zum ersten Mal persönlich ein, indem er den versprochenen Fährlohn kuzerhand verdoppelte.
Sein Angebot gab auch diesmal den Ausschlag. »Also dann woll’n mir in Gottes Namen«, sagte der Mann und schlug hastig ein Kreuz. »Tut auch ihr noch’n Gebet, auf dat et gut geht«, fuhr er fort, während er seinen aufs Trockene gezogenen Nachen losmachte.
Alle drei folgten dieser Aufforderung. Endlich hob auch Maria den Kopf und umarmte ihren Bruder. »Gott sei mit dir«, flüsterte sie. Mehr brachte sie nicht heraus, während ihr die Tränen wie kleine Bäche über das ebenmäßige Gesicht rannen.
Auch Martini schloss seinen zukünftigen Schwager, den er inzwischen in sein Herz geschlossen hatte, fest in die Arme. »Viel Glück und alles Gute«, sagte er. »Lasse so bald wie möglich von dir hören«, fuhr er mit bewegter Stimme fort.
Nur der Betroffene blieb gefasst. »Ich werde euch sofort benachrichtigen, wenn ich wieder in Burgund bin. Freilich nicht unter meinem Namen, sondern unter dem des Ehemannes meiner zukünftigen Schwiegermutter. Wenn du einen Brief von einem gewissen Jean Dupuis erhältst, kommt er von mir. Ich werde darin auf Französisch von einer erfolgreichen Inspektionsreise durch die Weingüter berichten, damit die Preußen nicht mitbekommen, worum es in Wirklichkeit geht. Denn solch ein Brief aus dem Ausland könnte natürlich geöffnet werden. Gib ihn dann an Maria oder unsere Eltern weiter und berichte von seinem Inhalt. Ich hoffe, dass dieser unsinnige Verdacht schnell ausgeräumt wird, damit ich so bald wie möglich zurückkommen kann. Denn hier wartet noch viel Arbeit auf mich.«
»Ich halte dich auf dem Laufenden«, versprach Martini. »Jacoby sitzt ja gewissermaßen an der Quelle.«
»Richte deine Post aber um Himmelswillen nicht an mich, sondern an Jean Dupuis. Die Anschrift in Chablis habe ich dir ja bereits mitgeteilt.«
Martini nickte ungeduldig. »Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren«, rief er. »Es würde mich kaum verwundern, wenn Skubovius und seine Leute heute Nacht noch hier auftauchten. Der Kerl lauert ja nur auf eine Möglichkeit, uns eins auszuwischen.«
Der Fährmann hatte seinen Nachen inzwischen klar zum Ablegen gemacht und warf dabei ängstliche Blicke auf die unruhigen Fluten. Martini spürte, dass er seine Zusage am liebsten rückgängig gemacht hätte. Nur der Gedanke an die fürstliche Entlohnung hielt ihn bei der Stange. »Also dann mit Gott!«, seufzte der Mann. »Steigt ein.«
Kurt Molitor löste sich sanft von seiner Schwester, die der Sturm inzwischen fast umwehte, und stieg in den Nachen. Der Fährmann nahm seine Ruder zur Hand und begann, das Boot vom Ufer abzustoßen.
»Nun verliere ich ihn zum zweiten Mal«, schluchzte Maria. Wie zur Salzsäule erstarrt stand sie neben ihrem Verlobten, der seinen Arm schützend um sie gelegt hatte, für den Fall, dass sie zusammenbrach.
Da kam mit einem Mal Leben in Marias erstarrte Gestalt. Wie in einem plötzlichen Entschluss riss sie sich los, lief auf die schwarzen Fluten zu und kletterte ebenfalls in den Nachen, vielleicht um ihren Bruder ein letztes Mal zu umarmen. Oder wollte sie ihm für den ersten Abschnitt seiner Flucht das Geleit geben?
»Maria!«, rief der am Ufer zurückgebliebene Schulmeister entgeistert, während der nicht minder verblüffte Fährmann nur mit Mühe einen Kraftausdruck herunterschluckte. »Macht, dat Ihr hier erauskommt!«, schrie er. »Et is schlimm genug, wenn zwei ihr Leben riskieren.«
»Komm um Himmelswillen zurück!«, schrie Martini, während er ebenfalls auf das heftig schaukelnde Boot zulief.
Plötzlich spürte Martini, wie Wasser durch sein löcheriges Schuhwerk drang. Der Nachen hatte sich also schon ein Stück vom Ufer entfernt und lag jetzt vollständig im Wasser. Gleichzeitig sah der Schulmeister im flackernden Licht der am Bug befestigten Laterne, wie sich der Fährmann mit seinen Riemen abmühte. »Setzt euch hin«, rief er dabei den beiden jungen Menschen zu, die im Heck standen und sich immer noch fest umklammert hielten. »Mir können jetzt nit mehr zurück!«
In dem flachen Wasser, das ihm jetzt vielleicht bis zu den Knöcheln reichte, beugte Martini sich vor, um das Boot mit seiner Rechten festzuhalten und notfalls auch gegen den Willen des Fährmanns wieder ans Ufer zu ziehen, damit seiner Verlobten die gefährliche Überfahrt erspart blieb. Natürlich reichte die Kraft des einen Arms nicht aus, denn mit seiner linken Hand hielt Martini immer noch seine eigene, inzwischen fast erloschene Laterne umklammert. Jetzt ließ er dieses Licht einfach fallen, um mit beiden Händen zugreifen zu können. Mit einem kurzen Zischen verlosch die Kerze, nur das schwache Licht der Bootslaterne erhellte nun noch die abenteuerliche Szenerie. Erneut beugte Martini sich vor und erwischte tatsächlich einen Rand des Nachens. Doch bevor er richtig zupacken konnte, wurde ihm das Boot von der Strömung buchstäblich aus der Hand gerissen, und der Schulmeister fiel bäuchlings ins Wasser. Von Kopf bis Fuß durchnässt kam er mühsam wieder auf die Beine und konnte nur noch ohnmächtig mitansehen, wie sich der Nachen immer weiter entfernte. Im ungewissen Schein der Bootslaterne bemerkte er, dass der Fährmann erneut hektisch mit seinen Rudern hantierte, um das Boot auf Kurs zu bringen. Seine Verlobte kauerte jetzt neben ihrem Bruder im Heck. Immerhin bewegte sich der Nachen aber tatsächlich auf das wegen des Hochwassers scheinbar unendlich weit entfernte andere Ufer zu.
Bis auf die Haut durchnässt, fragte Martini sich, wie es nun weitergehen sollte. Konnte er riskieren, ins Dorf zu laufen, um auf die Schnelle seine Kleider zu wechseln? Hier draußen gab es einstweilen nichts mehr für ihn zu tun, und wenn alles gut ging, würde er rechtzeitig zurück sein, um Maria wieder in Empfang zu nehmen. Das war zweifellos vernünftiger, als in nassen Kleidern hier auszuharren und sich den Tod zu holen.
Er warf noch einen kurzen Blick auf das flackernde Licht über dem tosenden Wasser und wandte sich dann zum Gehen – da geschah das Unheil.
Allem Anschein nach war der Nachen inzwischen in die Hauptströmung geraten. Martini sah, wie der Fährmann, den er nur noch als schattenhafte Gestalt wahrnahm, sich verzweifelt abmühte, sein Gefährt auf Kurs zu halten. Gleichzeitig war kaum zu übersehen, dass der Nachen abzutreiben begann, weil kein Mensch gegen die reißende Strömung ankam. Er konnte nur hoffen, dass es dem erfahrenen Fährmann gelingen würde, das Boot schräg zu dieser Strömung zu steuern, um das rettende Ufer notfalls ein Stück flussabwärts zu erreichen. Wo er auf dem Rückweg landen würde, war die nächste Frage, ebenso die, wo Maria dann die Nacht verbringen sollte.
Während er am ganzen Leib zu zittern begann, weil der Wind gerade wieder auffrischte und wie eisige Finger durch seine nasse Kleidung fuhr, schoss plötzlich eine heftige Bö durch das Tal, die ihn fast zu Boden warf. Gleichzeitig bemerkte der Schulmeister voller Entsetzen, dass dieser Wind nun auch das flache Boot erfasst hatte und es wie ein Spielzeug vor sich her trieb, so dass es vollkommen vom Kurs abkam: Statt auf das gegenüberliegende Ufer bewegte es sich jetzt immer schneller auf die »Hungersteine« mit ihrem gefährlichen Strudel zu. Als »Hungersteine« bezeichneten die Dörfler ein paar Felsbrocken mitten im Flussbett, die nur bei extremem Niedrigwasser, also in heißen und trockenen Sommermonaten, sichtbar wurden. Ihr Auftauchen kündigte in aller Regel Ernteausfälle an, mit anderen Worten: Hunger. Während der Fährmann immer verzweifelter gegen die Macht der Elemente ankämpfte, weil ihn die reißenden Fluten und die in immer kürzeren Abständen aufeinanderfolgenden Sturmböen an die gefährlichste Stelle weit und breit trieben, rannte Martini, der inzwischen wieder, wenn auch patschnass, auf dem Trockenen stand, verzweifelt am Ufer entlang, dem davontreibenden Nachen hinterher. Immer wieder stolperte er über irgendwelche Hindernisse, die er im Dunkeln nicht sehen konnte, mehrmals kam er dabei zu Fall, aber er ignorierte die Schmerzen ebenso wie die Eiseskälte, die seinen Körper immer gefühlloser machte. Sein Blick klebte an dem winzigen Licht, das gar nicht so weit entfernt und doch unerreichbar über den tosenden Fluss torkelte und dabei gnadenlos seinen fatalen Kurs fortsetzte.
Wieder heulte eine Bö wie ein Teufelsgesang durch das Tal. Glücklicherweise trieb sie das vermutlich längst quergeschlagene Boot nicht weiter auf die »Hungersteine«, sondern das Ufer zu, woher es gekommen war. Keuchend hastete Martini weiter. Ihm war es inzwischen gleichgültig, ob Kurts Flucht gelang, wenn nur Maria in dieser teuflischen Nacht wieder sicher an Land kam. Und so stolperte er weiter über Stock und Stein, immer dem flackernden Licht hinterher.
Schon hörte er das Rauschen und Gurgeln der Flut, die sich an den »Hungersteinen« brach und dabei einen Strudel erzeugte, der die Moselschiffer selbst bei besserem Wetter in Gefahr brachte. Zu seinem wachsenden Entsetzen sah er das flackernde Licht jetzt wieder auf genau diese Stelle zutreiben, zunächst langsam, nun immer schneller. Dann, mit einem Mal, wurde es stockfinster. Verzweifelt rieb Martini sich die Augen, aber nirgendwo war ein Licht zu sehen. Am ganzen Leib zitternd blieb er stehen. Was hatte das nun wieder zu bedeuten? War etwa die Bootslaterne erloschen? Oder aber – kaum traute er sich, diesen Gedanken zu fassen – war das Boot gekentert und seine Insassen trieben nun hilflos in den Fluten? Gleichzeitig sagte ihm sein Verstand, dass im Grunde nur diese Erklärung in Frage kam.
Was Maria betraf, konnte sie bestimmt nicht schwimmen, und ihre schweren Kleider würden sie binnen weniger Minuten nach unten ziehen, direkt in ein nasses Grab. Bei diesem Gedanken setzte Martinis Verstand aus, und irgendwelche archaischen Instinkte übernahmen die Regie. Der junge Mann rannte direkt auf den Fluss zu und stolperte dann immer tiefer in das rasant dahinströmende Wasser. Die Flut erreichte seine Waden, seine Knie, die Oberschenkel, schließlich die Hüften. Und dann war es Martini plötzlich, als würden ihm die Füße weggerissen, und nun trieb auch er in dem wild dahinschießenden Fluss.
Das Wasser packte ihn wie eine eiskalte Faust, in seinen Ohren begann es zu gurgeln und zu rauschen wie ein Wasserfall, während der Schulmeister verzweifelt mit Händen und Füßen paddelte. Richtig schwimmen hatte er nie gelernt, aber als Kind war er mit ein paar Spielkameraden manchmal zu einem kleinen See gezogen. Dort hatten die Kinder im Wasser geplanscht, an den tieferen Stellen aber auch ein paar Schwimmstöße versucht. Weitere Erfahrungen mit dem nassen Element hatte Martini nicht vorzuweisen.
Jetzt zog ihn die Strömung unter Wasser, verzweifelt bewegte er seine Hände und Füße, bis er zurück an die Oberfläche gelangte. Keuchend schnappte er nach Luft und bemerkte dabei, dass er ein gutes Stück vom Ufer fortgerissen worden war. Wohin der Fluss ihn getrieben hatte, konnte er beim besten Willen nicht ausmachen. Doch da riss plötzlich die Wolkendecke auf, und ein bleicher Mond illuminierte für ein paar Sekunden das wüste Tableau. Jetzt entdeckte er, nur wenige Meter vor sich, den Nachen. Das Boot trieb tatsächlich kieloben, und von seinen Insassen war weit und breit nichts zu sehen. Mit aller Lungenkraft, die ihm nach seinem Abenteuer noch zur Verfügung stand, rief Martini immer wieder den Namen seiner Verlobten, aber seine Rufe schienen im Tosen des Wassers unterzugehen. Zwischendurch spitzte er verzweifelt die Ohren, doch von nirgendwoher drang so etwas wie der Klang einer menschlichen Stimme herüber, um ihn herum waren nur das Rauschen und Gurgeln des außer Rand und Band geratenen Flusses und das infernalische Heulen des Sturms.
Immer deutlicher spürte Martini jetzt, wie seine Kräfte schwanden, wie ihn seine mit Wasser vollgesogene Kleidung nach unten zog, auf den Grund des Flusses, wo seine Verlobte vielleicht schon auf ihn wartete. Dieser makabere Gedanke mobilisierte einen letzten Schub an Kräften in ihm, und von neuem paddelte er hektisch und hilflos in den Fluten herum, in dem hoffnungslosen Bestreben, das umgekippte Boot vielleicht doch noch zu erreichen und in der vagen Hoffnung, dort oder woanders auf die Schiffbrüchigen zu stoßen. Natürlich blieb all seine Mühe vergebens, die nasskalte Faust zog ihn bald hierhin, bald dorthin, bald drückte sie ihn von neuem unter Wasser, bald gab sie ihn für einen Augenblick frei, so dass er halb erstickt wieder an die Oberfläche schoss. Einmal trieb sie ihn sogar, wie um ihn zu narren, bis auf ein kurzes Stück an den gekenterten Nachen heran, um den erzielten Streckengewinn gleich wieder zunichte zu machen. Mit jedem dieser Versuche ließen seine Kräfte weiter nach, wurden seine Bewegungen langsamer, bis er sich nur noch treiben lassen konnte. Zu der eisigen Kälte kam jetzt eine bleierne Gleichgültigkeit, die in ihm hochstieg, sie ging in eine dumpfe Apathie über, die ihn das grausame Spiel, das Wind und Wellen mit ihm trieben, kaum noch wahrnehmen ließ, und mündete zu guter Letzt in einen Zustand des Vergessens und Vergehens, der sich als tiefe Nacht über sein Bewusstsein legte.
1. Teil: Herbst 1850
An einem schäbigen Novembertag im darauffolgenden Herbst war Dorfschulmeister Alexander Martini schon früh in der Kirche tätig. Als die Turmuhr sechsmal schlug, stellte er resigniert fest, dass inzwischen mehr als eine Stunde an »niederen Küsterdiensten« hinter ihm lag, die ihm bisher »dä Pitter« abgenommen hatte. Doch diese goldenen Zeiten waren vorbei, seit der neue Pfarrer verkündet hatte, er wolle in seiner Kirche keinen »Idioten« bei der Arbeit sehen. Außerdem hätte dieser geistliche Herr, anders als sein humaner Vorgänger, ohnehin kein Geld für solche Zwecke locker gemacht, und Martini konnte nach wie vor keinen roten Heller erübrigen. Infolgedessen nagten der geistig behinderte junge Mann und seine unglückliche Mutter nun am Hungertuch, mehr noch als ein Großteil der übrigen Dorfbewohner.
Als erstes hatte Martini die große Uhr aufgezogen und sich dann daran gemacht, die groben Bodenplatten von Staub und Schmutz zu befreien. Später würde er im Kirchenraum und am Altar die Kerzen anstecken und seinem Vorgesetzten beim Anlegen der Messgewänder helfen.
Das Heulen des Sturms, der die alte Kirche auch an diesem Morgen umtoste, weckte in ihm böse Erinnerungen an jene albtraumhafte Nacht vor einem Dreivierteljahr, als seine Verlobte und ihr Bruder in den wildgewordenen Fluten der Mosel ums Leben gekommen waren. Wie immer, wenn er daran zurückdachte, plagte ihn sein Gewissen. War nicht er es gewesen, der auf dieser gefährlichen Überfahrt bestanden hatte, während Maria für die Strecke durch den Hunsrück plädierte? Hatte nicht er Kurt auf seine Seite gezogen, den Fährmann unter Druck gesetzt und das Unheil so heraufbeschworen? Eine schwere Schuld hatte er damit auf sich geladen und dann auch noch – unverdienterweise, wie er in Momenten besonderer Schwermut fand – überlebt.
Irgendwann hatten ihn die aufgewühlten Fluten ans Ufer geworfen, wo er von dem Fährmann, der sich ebenfalls an Land retten konnte, bewusstlos aufgefunden worden war. Mit letzter Kraft hatte sich der ältere Mann ins Dorf geschleppt und Hilfe geholt. Wochenlang hatte der Schulmeister dann mit hohem Fieber im Bett gelegen, und mehr als einmal hatte der Sensenmann, wie Dorfarzt Dr. Holl sich ausdrückte, schon vor der Tür gestanden. Der zähe Ferger hatte ebenfalls überlebt, wenn auch nur knapp.
Kurt Molitor war am darauffolgenden Tag bei Rachtig ans Ufer gespült worden – tot. Nur Maria war nicht wieder aufgetaucht, als habe der Fluss sie verschlungen. Als er endlich wieder er selbst gewesen war, hatte Martini Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um etwas über ihr Schicksal in Erfahrung zu bringen. Jeden Fremden, der ins Dorf kam, hatte er nach Toten befragt, die bei dem Hochwasser angetrieben worden waren, aber die Antwort war jedes Mal negativ gewesen: Entweder das Geschlecht stimmte nicht oder aber das Alter, wenn nicht sogar beides. Eine Zeit lang hatte er noch gehofft, seine Verlobte könne durch das schreckliche Ereignis ihr Gedächtnis verloren haben und deswegen auch Erkundigungen über verwirrte Personen eingezogen, die man in der Gegend aufgegriffen hatte – gleichfalls ohne Ergebnis.
Seither raunte im Dorf manch abergläubische Seele, allen voran die Pfarrhaushälterin Katharina Metze, in jener schicksalhaften Nacht sei ein Wunder geschehen: Weil Maria so fromm gewesen war, sei sie, genau wie ihre Namenspatronin, direkt in den Himmel aufgefahren. Das hielt Martini natürlich für ausgemachten Unsinn, um nicht zu sagen Blasphemie.
Nach ein paar Monaten hatte er das Handtuch geworfen und war in einen Zustand finsterster Trübnis versunken, blieb ihm doch von seiner großen Liebe nun nicht einmal mehr ein Ort zum Trauern.
Müde schleppte Martini sich durch das rechte Seitenschiff, um die Kirchenbänke zu inspizieren. In jüngster Zeit war es nämlich immer wieder zu Beschädigungen gekommen, meist durch sinnlose Schnitzereien. Auch sonst machten sich neuerdings allerlei Unsitten breit. So wurde beim Betreten oder Verlassen der Kirche immer wieder geschubst und gerempelt, ohne dass man den Übeltäter dingfest machen konnte. Der Schneider Jansen war sogar einmal fast gestürzt, weil ihm jemand heimlich ein Bein gestellt hatte. Einmal mehr konnte nicht geklärt werden, wer den Zwischenfall verursacht hatte.
Tatsächlich entdeckte Martini auf der Männerseite, gleich in der dritten Reihe, wo während der Messe normalerweise der Schneider saß, einen Kniebalken, der mit einer dicken Schicht aus Schlamm und Kuhdung beschmiert worden war. Er stieß einen leisen Seufzer aus. Diese Schmierage musste er vor Beginn der Messe nun auch noch beseitigen, und zwar so schnell wie möglich, damit das Holz noch trocknen konnte, bevor einer der Gläubigen hier niederkniete und seine Hosenbeine einnässte.
Als er mit eiligen Schritten die Kirche verlassen wollte, um an der nächsten Pütz Wasser zu holen, entdeckte er im Halbdunkel eine einsame Gestalt, die heute vornübergebeugt in einer der hinteren Bänke, dicht beim Turm, saß und offensichtlich den Rosenkranz betete.
Wieder tat sein Herz einen falschen Schlag, weil ihn dieser Anblick an Maria erinnerte, die oft schon eine ganze Zeit vor Beginn der Messe in der leeren Kirche gesessen hatte, um zu beten – oder sich an seinem Orgelspiel zu erfreuen. Auch mit diesen musikalischen Darbietungen war es übrigens vorbei, weil der neue Pfarrer seinem Schulmeister eine solche halb private Nutzung der Kirchenorgel untersagt hatte. Das Orgelspiel außerhalb der Messe lenke Martini zu sehr von seinen zahlreichen Dienstpflichten ab, denen der Schulmeister ohnehin in nur unzureichender Weise nachkomme, hatte er kurz angebunden erklärt und damit auch den Orgelbuben Josef Thiesen um seine ergiebigste Geldquelle gebracht.
Nun saß statt Maria also der Schneider Jansen allein in dem leeren Kirchenraum und suchte Trost im Gebet, vielleicht, weil man ihn im Dorf neuerdings schnitt. Kaum jemand hätte derzeit noch einen Rock oder einen Mantel bei ihm schneidern lassen. Objektiv machte das allerdings keinen großen Unterschied, weil die meisten hier ohnehin kein Geld für neue Kleider hatten und die alten immer wieder flickten, bis sie auseinanderfielen. Hätte Jansen nicht einen festen Kreis treuer Kunden überall im Umland gehabt, bis nach Traben, Zell oder Wittlich, er wäre auch schon verhungert, bevor er in seinem Dorf in Misskredit geriet.
Der Grund für diese Feindseligkeit war, dass man ihn allgemein für einen Denunzianten hielt. Zweifellos gehörte der Schneider nicht zu jenen ehrlosen Subjekten, die vor zwei Jahren sehr wohl für die Revolution gewesen waren, dabei aber zu feige, um wirklich Flagge zu zeigen und für ihre Ziele zu kämpfen. Nun lieferten viele dieser sauberen Mitbürger ihre früheren Gesinnungsgenossen ans Messer, um sich bei den Preußen Liebkind zu machen und damit das eigene, nicht immer ganz staatstreue Denken und Handeln in Vergessenheit geraten zu lassen. Jansen hingegen hatte seine politische Überzeugung nie gewechselt, außerdem wurde sie im Dorf von vielen geteilt. Denunziation bei den verhassten Preußen stand allerdings auf einem ganz anderen Blatt. War es wirklich nur ein Zufall gewesen, dass wenige Minuten, nachdem Jansen sich in Bernkastel für kurze Zeit aus der fidelen Runde verabschiedet hatte, angeblich eines gewissen Bedürfnisses wegen, preußische Gendarmen in die Weinstube stürmten? Wenn der Schneider tatsächlich für diesen Zwischenfall verantwortlich war, wäre er in seiner Ablehnung der Revolution und ihrer Akteure eindeutig einen Schritt zu weit gegangen. So wenigstens dachten die meisten im Dorf.
Als Folge kursierte nun außerdem das Gerücht, Jansen sei auch derjenige gewesen, der Kurt Molitor angezeigt habe, er und kein anderer sei also für den Tod der Geschwister verantwortlich. Ihm deswegen beim Verlassen der Kirche ein Bein zu stellen, war in den Augen seiner Mitbürger zweifellos eine Ungehörigkeit gewesen, lieber strafte man ihn mit stiller Verachtung: Man erwiderte seinen Gruß nicht, wich jeglichem Gespräch mit ihm aus oder wechselte die Straßenseite, wenn Jansen durch das Dorf ging. So konnte ein jeder sein Missfallen kundtun, ohne eine gewisse Grenze zu überschreiten.
Was Martini anbetraf, war er von Jansens Schuld weniger überzeugt. Das plötzliche Auftauchen der Gendarmen ließ sich ebensogut als purer Zufall erklären, schließlich hatten die Zecher ordentlich gelärmt. Vermutlich war ihr freches Lied bis auf die Straße zu hören gewesen. In diesem Fall musste nur noch einer der Gendarmen auf seinem Patrouillengang durch das stille Städtchen ausgerechnet in diesem Augenblick vor der Weinstube landen und, von dem ungewohnten Lärm angelockt, die Ohren spitzen, um jedes einzelne Wort nicht weniger deutlich mitzubekommen als jeder, der mit am Wirtshaustisch saß. Martini hatte diese Meinung im Dorf wiederholt geäußert, sein jeweiliges Gegenüber aber nur selten zu überzeugen vermocht.
»Dat glauben ich nit!«, hatte es dann geheißen. »Wer soll den Kurt Molitor denn sonst verraten han?«
Auf diese Frage hatte auch Martini keine Antwort gewusst, seine Meinung aber trotzdem nicht geändert. Für ihn gehörte der stille, bescheidene Schneider einfach nicht zu jener Sorte Mensch, die anderen voll Heimtücke und Hinterlist in den Rücken fällt. Andererseits würde er aber auch niemals vergessen, dass er selbst seinerzeit auf den Studenten Lars Lürsen hereingefallen war, den er lange Zeit für einen treuen Mitstreiter, ja seinen besten Freund gehalten und der sich zu guter Letzt als eiskalter Mörder entpuppt hatte. Wer konnte schon in einen anderen Menschen hineinsehen?
Während ihm dies alles zum tausendsten Mal durch den Kopf ging, machte Martini sich mit schnellen Schritten auf den Weg, um nun endlich Wasser zu holen und die Schweinerei an der Kirchenbank zu beseitigen.
Als er das schmale Seitenpförtchen zum Kirchhof öffnete, riss ihm eine heftige Bö den Türgriff fast aus der Hand. Gleichzeitig ertönte von drinnen ein lautes Scheppern. Mit einem Ruck stellte Martini seinen Putzeimer ab und eilte nach hinten, um nachzusehen. Kurz darauf schloss er mit einer fahrigen Bewegung ein kleines Fenster, das vom Wind aufgedrückt worden war, weil jemand – wer außer ihm selbst? – es nicht richtig verriegelt hatte. Nun blieb ihm nichts anderes übrig, als auch noch alle anderen Fenster zu kontrollieren, obwohl die Zeit langsam knapp wurde. Erst danach konnte er die begonnene Arbeit fortsetzen, und nun musste er sich heftig sputen. Dabei fragte er sich, nicht zum ersten Mal, ob er den »niederen Küsterdiensten« wirklich gewachsen war.
Während er den Kniebalken abwischte und sich dabei besonders fehl am Platz fühlte, dachte er noch einmal an die letzten Monate zurück. Ohne die hingebungsvolle Pflege von Frau Molitor wäre er zweifellos auf dem Kirchhof gelandet. Vielleicht hatte der älteren Frau ja die Sorge um einen Schwiegersohn, der nun niemals zur Familie gehören würde, ein wenig über ihren entsetzlichen Verlust hinweggeholfen, denn Martini war kaum wieder auf den Beinen gewesen, da brach sie selbst zusammen und musste für längere Zeit das Bett hüten. Inzwischen waren alle drei Personen, die der Schicksalsschlag übrig gelassen hatte – Marias Vater, ihre Mutter und ihr zwölfjähriger Bruder – aus dem Dorf verschwunden, um in Burgund ein neues Leben zu beginnen – ein großzügiges, wenn auch wohl nicht ganz uneigennütziges Angebot. Wahrscheinlich baute die französische Winzerstochter Solange Picard, nachdem sie mit ihrem Verlobten zugleich einen tüchtigen Fachmann verloren hatte, nun auf das Wissen und Können seines Vaters. Da mit der Eheschließung auch die Mitgift ausfiel, die Molitor zur Tilgung seiner Schulden einsetzen wollte, hatte die Familie kaum eine Wahl gehabt, wenn sie nicht früher oder später an den Bettelstab geraten wollte. Vielleicht waren der ehemalige Bürgermeister und seine Frau aber auch heilfroh gewesen, ihrer Heimat den Rücken kehren zu können, nachdem ihnen dort so viel Unheil widerfahren war.
So hatten die Molitors also im Frühsommer ihre Wingerte verkauft, um in die Fremde zu ziehen, nur für das Haus hatte sich kein Käufer gefunden. Viel war nach Abzug sämtlicher Schulden, die sich im Lauf der endlosen Krisenjahre angehäuft hatten, nicht übrig geblieben, aber für die Reise hatte es wohl gelangt. Wie es den Dreien dort drüben in Frankreich ging, ob sie Fuß gefasst hatten und sich in ihrer neuen Umgebung wohl fühlten, hatte Martini bislang nicht in Erfahrung bringen können, denn bis auf ein kurzes Schreiben, das ihre Ankunft in einem Dorf bei Chablis vermeldete, waren keine weiteren Neuigkeiten zu ihm gedrungen.
Nachdem Martini nun seine letzten Arbeiten erledigt hatte, näherte sich unausweichlich jener Augenblick, in dem er seinem neuen Dienstherrn, Pfarrer Clemens Olivier, unter die Augen treten musste. Mit nicht nur vor Müdigkeit hängenden Schultern schlich der unglückliche Dorfschulmeister auf die Sakristei zu und wurde dabei mit jedem Schritt langsamer. Er ahnte, dass die nächste Viertelstunde alles andere als ein Zuckerschlecken sein würde und ging deshalb auf die Sakristeitür zu, als nähere er sich den Pforten der Hölle.
Pfarrer Olivier stand inmitten der Sakristei und sah demonstrativ auf die kleine Uhr an der gegenüberliegenden Wand. Er war ein großer, stattlicher, fast korpulent zu nennender Mann, der die meisten Dorfbewohner nahezu um Haupteslänge überragte, die gewöhnlich eher kleinen, oft gebückt gehenden Frauen ohnehin. Dem eintretenden Schulmeister warf er einen jener Blicke zu, die seine Schäflein unweigerlich einschüchterten.
»Sie kommen zu spät«, stellte er fest. Seine Stimme klang etwas ölig und dabei merkwürdig teilnahmslos.
»Das tut mir ausgesprochen Leid, aber es gab heute früh sehr viel zu tun«, entschuldigte Martini sich und stellte dabei ärgerlich fest, wie kleinlaut seine Stimme klang. War er wirklich so ein jämmerlicher Duckmäuser, wie es ihm sein falscher Freund Lars Lürsen immer wieder vorgeworfen hatte? Andererseits: Konnte er es sich leisten, nicht so zu sein?
»Leider war einer der Kniebalken beschmutzt worden«, setzte er leise hinzu. »Außerdem …«
»Das interessiert mich nicht«, unterbrach ihn Olivier. »Behelligen Sie mich gefälligst nicht mit Banalitäten, die in Ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Außerdem kann es wohl kaum angehen, dass Sie für ein paar lächerliche Aufräumarbeiten Stunden benötigen. Sie haben hier pünktlich zu erscheinen und mich nicht warten zu lassen. Dann müssen Sie eben früher aufstehen.«
»Ich bin seit fünf Uhr auf den Beinen«, wagte Martini einzuwenden. »Es bleibt doch immer noch genügend Zeit bis zum Beginn der Messe.«
Aber Olivier ließ sich nicht besänftigen. »Um Ihrer Pflicht Genüge zu tun, müssen Sie eben, falls notwendig, schon um halb fünf aus den Federn«, erwiderte er kühl. »Jedenfalls haben Sie hier nicht zu erscheinen, wenn es Ihnen gut und richtig dünkt, sondern zu dem von mir bestimmten Zeitpunkt. Es kommt mir fast vor, als seien Sie den Anforderungen Ihres Dienstes nicht gewachsen.«
»Ich habe nahezu alles erledigt, was mir aufgetragen wurde«, verteidigte Martini sich.
»Nahezu«, echote Olivier in süffisantem Tonfall. »Dazu noch in unvollkommener und unzureichender Art und Weise. Weder wurden die Messgewänder gründlich von Staub befreit, was über einen längeren Zeitraum verabsäumt worden ist, noch die Schäden beim rückseitigen Portal beseitigt.«
»Dazu bin ich leider nicht gekommen«, musste Martini zugeben.
Olivier warf ihm erneut einen jener Blicke zu, die bei den meisten Dörflern dazu führten, dass sie den Kopf senkten. Martini hingegen mühte sich tapfer, standzuhalten.
»Es wäre klug, wenn Sie sich Ihren Aufgaben mit mehr Eifer widmen würden«, sagte der Pfarrer jetzt. »Ich würde es nämlich außerordentlich bedauern, wenn ich höheren Ortes melden müsste, dass Sie Ihren Dienst nachlässig versehen.«
Martini lief es eiskalt den Rücken herunter. Eine solche Meldung konnte in Zeiten wie diesen, da Schulmeister ohnehin unter Beschuss standen, das Ende einer bürgerlichen Existenz bedeuten, die zwar kümmerlich war, aber immer noch besser als gar nichts. Hatte der Preußenkönig nicht erst unlängst vor allem die Lehrer für die Ereignisse von 1848/49 verantwortlich gemacht und sie als die »gefährlichsten Feinde von Thron und Altar« bezeichnet? Mit ihrer subversiven Wühlarbeit verdürben Sie seine geliebten Untertanen. In dieser Situation bedurfte es nur eines winzigen Fehlverhaltens, um auf der Straße zu landen. Das wusste der Pfarrer natürlich genauso gut wie er und genoss ganz offensichtlich eine Machtfülle, die ihm neben seinem Amt als Vorgesetzter nun auch noch die allgemeine politische Lage bescherte.
»Es täte mir aufrichtig Leid, wenn Sie sich auf diese Weise Ihrer Existenz als Schulmeister beraubten«, fuhr Olivier fort, aber sein eisiger Ton erweckte nicht den Eindruck, als tue ihm irgendetwas Leid. »Sie werden jedoch einsehen, dass auch ich meine Pflicht zu erfüllen habe, selbst wenn diese Pflicht bisweilen schmerzlich ist. Nehmen Sie sich diese Mahnung daher zu Herzen, da nicht viele weitere folgen werden. Und nun helfen Sie mir beim Anziehen, damit die Messe pünktlich beginnen kann.«
Endlich saß Martini hinter seiner Orgel, die er nun so oft schmerzlich vermisste, da er ihr statt virtuoser Klänge nur noch die musikalische Begleitung zu ein paar simplen Kirchenliedern entlocken durfte. Dennoch atmete er ein wenig auf und fragte sich, ob Olivier seine Drohung wirklich wahr machen würde. Schließlich stünde er dann ohne Küster und Organist da und das Dorf ohne Schulmeister. Er seufzte leise. In wirtschaftlich schlechten Zeiten wie diesen wäre es sicherlich kein großes Problem, Ersatz zu finden, vor allem, wenn keinerlei Wert auf Qualität und Qualifikationen gelegt wurde: Ein ungehobelter Steißtrommler, der die Kinder mehr prügelte als sie zu unterrichten, würde sich allemal finden, ebenso wie irgendein Musikus, der imstande war, der Orgel ein paar Töne für den Gesang während der Messe zu entlocken. Vermutlich wäre ein solches Individuum ohnehin besser in der Lage als er, den Putzfeudel zu schwingen oder beschmierte Kirchenbänke abzuwischen. Wieder stieß er einen seiner unhörbaren Seufzer aus. Er saß ganz eindeutig am kürzeren Hebel. Dabei fiel ihm ein Spruch ein, der unter seinen Leidensgenossen seit Jahrzehnten kursierte:
Des Lehrers Leid
Ist die Geistlichkeit.
Was für ein unverschämtes Glück er mit seinem früheren Vorgesetzten gehabt hatte, wurde ihm im Grunde erst bewusst, seit er auf dem harten Boden der Realität gelandet war.
Als er von seiner Empore aus nach unten blickte, stellte er fest, dass die Kirche auch an diesem 22. November, dem Fest der heiligen Caecilia, besser gefüllt war als zu Zeiten von Pfarrer Pütz, obwohl die einfachen Werktagsmessen bei Olivier viel länger dauerten. Denn anders als Pütz, der immer nur kurz gepredigt hatte und in dessen Worten jedes Mal ein gewisses Verständnis für die Tatsache durchschimmerte, dass Menschen eben keine Engel sind, gab Olivier sich konsequent als Anhänger der reinen Lehre. Neuerdings kamen daher tagtäglich nicht mehr nur jene im ganzen Dorf bekannten Frauen in die Kirche, die manch einer hinter der hohlen Hand als »Betschwestern« bezeichnete, sondern auch viele andere und sogar eine gewisse Anzahl Männer, der eine oder andere vielleicht, weil er den strengen Blick Oliviers oder dessen scharfen Tadel fürchtete, wenn er sich an Werktagen allzu selten blicken ließ.
Olivier begann seine Predigt mit ein paar allgemeinen Sätzen über den Zustand der Dorfkirche, Worte, die er mit dem »allergrößten Bedauern« vorbringen müsse. Auch wenn der Schulmeister sich zweifellos Mühe gebe, so habe sich dennoch einiges zu ändern. Dafür gedenke er Sorge zu tragen. Martini sah, wie sich die Köpfe in Richtung Orgelempore drehten und spürte zahlreiche, nicht immer freundliche Blicke. Am liebsten hätte er sich in einer seiner Orgelpfeifen verkrochen.
Dann pries Olivier die heilige Caecilia, die gegen ihren Willen verheiratet worden war, obwohl sie jungfräulich bleiben wollte und schon bei ihrer Hochzeit um den Erhalt ihrer Reinheit gefleht hatte, als Vorbild für jeden Christen, um als nächstes allgemein auf die Sünde der Unkeuschheit einzugehen. »Das beste Mittel gegen Unkeuschheit, meine lieben Pfarrkinder, sind Enthaltsamkeit sogar im Erlaubten und die ständige Erinnerung an den Schmuck der Keuschheit«, fuhr er fort. »Bereits beim ersten bösen Gedanken oder beim geringsten Zureden gilt es zu widerstehen und, wenn möglich, alsbald zu entfliehen.« In der Versuchung seien alle Widerstandskräfte aufzubieten. Jeder gläubige Christ müsse darüberhinaus bereit sein, lieber den Tod auszustehen als in Unkeuschheit zu leben. Olivier verwies auch auf das Beispiel der heiligen Perpetua, die mit anderen Täuflingen im Amphitheater wilden Tieren vorgeworfen worden war. Von einem dieser Tiere zu Boden gestoßen, hatte die Heilige als erstes daran gedacht, ihre Blößen zu bedecken. Dies sei das wahre Christentum. Er, Olivier, werde jeden noch so geringen Verstoß gegen Sitte und Anstand in seiner Gemeinde unerbittlich ahnden, da er für das Seelenheil seiner Schäflein verantwortlich sei. Dieser Verantwortung werde er sich jederzeit bewusst sein.
Im zweiten Teil seiner Predigt kam Olivier dann ohne Heilige, Gleichnisse oder Beispiele aus. Stattdessen beschränkte er sich darauf, die bereits geäußerten Thesen und Postulate in verschiedenen Varianten immer von neuem zu wiederholen, als wolle er sie seinen Zuhörern auf ewig einhämmern. Seine endlosen Wiederholungen schienen aber kaum jemanden zu stören, denn fast alle hörten andächtig zu und manch einer – nicht nur unter den »Betschwestern« – nickte sogar jedes Mal.
Als die Predigt zu Ende war, griff Martini mit fast unüberwindlichem Widerwillen nach dem Weidenkörbchen für die Kollekte. Die Pflicht, bei seinen Mitmenschen Geld einzusammeln, war ihm seit jeher peinlich gewesen, weswegen Pfarrer Pütz ihn lange Zeit davon verschont hatte, indem er den geistig behinderten Pitter mit der Kollekte betraute. Nach den kritischen Worten des Pfarrers zu Beginn der Predigt empfand Martini diesen Gang heute geradezu als Spießrutenlaufen, und in der Tat trafen ihn immer wieder vorwurfsvolle Blicke, als er durch die Bankreihen ging. Trotzdem hielt er den Gläubigen tapfer sein Körbchen hin und hörte mit abgewandtem Gesicht auf das leise Klicken der Kupferstücke, wenn sie zu den übrigen fielen. Bisher waren ihm die meisten Dörfler ausgesprochen wohlgesonnen gewesen, weil ihre Kinder ihn mochten. Nun schienen die abwertenden Sätze des Pfarrers einen allgemeinen Sinneswandel einzuleiten. Wieder tat Martini einen lautlosen Seufzer. Auch mit dieser neuen Situation würde er fertigwerden müssen.
Seine Stimmung hellte sich kurz auf, als der neue Großwinzer Emil Breitenbach ihm einen aufmunternden Blick schenkte und dabei demonstrativ eine Silbermünze in den Korb fallen ließ, die sich neben all dem Kupfergeld wie ein Fremdkörper ausnahm.
Breitenbach hatte im vergangenen Herbst, für alle im Dorf überraschend, den »Mattheiserhof« gekauft. Warum Ludwig Nicolay, der Vorbesitzer, sich von seinem Weingut getrennt hatte, wusste niemand so recht. Die einen vermuteten, der enorme finanzielle Aderlass durch den Überfall einer Bande rabiater Ex-Revolutionäre sei dem Großwinzer finanziell derart an die Substanz gegangen, dass er aufgeben musste. Andere machten eine dorfbekannte Blamage für diesen Entschluss verantwortlich: Weil Nicolay ihm aus Eifersucht ein paar Raufbolde auf den Hals gehetzt hatte, war er von Martini und Josef Ehles, den der Großwinzer ebenfalls schlecht behandelt hatte, im Dorf mit blankem Hintern zur Schau gestellt worden. Vielleicht war auch beides zusammen für Nicolays Entscheidung verantwortlich, sich von dem früheren Kirchengut zu trennen, das sein Großvater nach der Säkularisation unter Napoleon ersteigert und lange Zeit mit großem Erfolg bewirtschaftet hatte.
Die Messe ging mit einem kurzen Orgelsolo zu Ende, das Olivier seinem Schulmeister erst nach zähem Ringen zugestanden hatte. Dann machte Martini sich auf den Weg zur Schule, wo seine Arbeit nun, nur von einer einstündigen Mittagspause unterbrochen, bis zirka vier Uhr nachmittags weitergehen würde. Was Olivier an Arbeitsleistung danach noch von Martini fordern würde, stand in den Sternen.
Das Dorf lag genauso öde und leblos da wie in all den langen Jahren seit Beginn der Weinkrise, selbst der kleine Funke Hoffnung, der im vorletzten Jahr aufgeflammt war, schien längst wieder erloschen. Immerhin hatte das »tolle Jahr« 1848 den Winzern ein freundliches Souvenir in Form eines recht akzeptablen, wenn auch nicht spitzenmäßigen Weinjahres hinterlassen. Daher waren zum ersten Mal wieder Händler ins Dorf gekommen und hatten sich für die in den Kellern lagernden Vorräte interessiert. So war ein Teil der Winzer in die Lage versetzt worden, die allerdrückendsten Schulden zu tilgen oder drohende Pfändungen abzuwenden – wenigstens für die nächste Zeit.
Doch schon das darauffolgende Jahr war wieder unerfreulich geworden und das jetzt zu Ende gehende geradezu katastrophal: Schon im Frühjahr 1850 hatten mehrere Frostperioden die Traubenreife um drei bis vier Wochen nach hinten verlagert. Damit war im Grunde bereits abzusehen gewesen, dass die Rieslingtrauben in diesem Jahr kaum ausreifen würden. Der Frühsommer, vor allem von Mitte Juni bis Ende Juli, der Zeit also, da die Rebstöcke dringend Wärme benötigten, hatte kaum etwas anderes als nasskaltes Wetter gebracht, und dabei war es, mit kurzen Unterbrechungen, auch geblieben. Infolgedessen krochen einzelne Winzer noch jetzt, in der zweiten Novemberhälfte, bei Regen und Sturm in den Steilhängen herum, um ein paar letzte Trauben zu ernten. Dabei lohnte sich die Mühe kaum: Wo es überhaupt zu Verkäufen gekommen war, bei den etwas Glücklicheren mit ihren günstigeren Lagen, hatte man dem Vernehmen nach ganze 20 bis 25 Taler pro Fuder erzielt – einschließlich Fass. In guten Jahren kam leicht das sechs- bis siebenfache zusammen. Die restlichen Winzer waren, wie so oft, auf ihrem Most sitzengeblieben.
Martini überquerte die Dorfstraße und erreichte seine Schule, ein heruntergekommenes Gebäude aus dem letzten Jahrhundert, vor dem seine Schüler schon warteten. Wie immer taten ihm die Kinder von Herzen Leid, da sie in ihren viel zu dünnen, oft abenteuerlich geflickten Kleidern und dem unzureichenden Schuhwerk erbärmlich froren. Ein warmer Wintermantel war für die allermeisten ein unerschwinglicher Luxus. Daher beeilte er sich, sie in die Schulstube zu führen. Der Raum war nicht verschlossen gewesen, da es ohnehin nichts zu stehlen gab, aber natürlich hatte sich keines der Dorfkinder getraut, ihn ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Schulmeisters zu betreten.
Nun saßen sie also vor ihm, durch zwei Bankreihen streng nach Geschlechtern getrennt, genau wie in der Kirche, mehr als 70 an der Zahl, die meisten blass und unterernährt, nicht wenige husteten. Martini fragte sich wieder einmal, wie viele dieser Kinder wohl hungrig aus dem Haus gegangen waren und wer von ihnen den kommenden Winter nicht überstehen würde. Mit solch düsteren Gedanken, die seiner momentanen Lage entsprachen, stellte er sich hinter sein Pult und eröffnete den Unterricht, wie jeden Tag, mit einem Gebet.
Danach beschäftigte Martini die Kleinen mit Buchstabenmalen und die Größeren mit kniffligen Rechenaufgaben, die er nach Schulschluss an die Tafel geschrieben hatte. Zwischendurch warf er immer wieder scharfe Blicke in die hintere rechte Ecke, wo die älteren Jungen saßen. Von diesem Teil seiner Schüler ging nämlich neuerdings eine gewisse Unruhe aus. Durch einschlägige Erfahrung gewitzt, meinte Martini auch eine unterschwellige Renitenz wahrzunehmen. Gestern Nachmittag war in der letzten Bank eine Schiefertafel heruntergefallen und zu Bruch gegangen, angeblich aus Versehen. Martini war sich nicht ganz sicher, meinte aber, von seinem Pult aus eine schnelle Handbewegung wahrgenommen zu haben, mit der die Tafel vom Tisch gefegt worden war. Den Übeltäter hatte er leider nicht herausfinden können, zumal der Geschädigte sich nicht traute, etwas zu sagen. Der Schulmeister beschloss, diese Ecke besonders im Auge zu behalten.
Das zweite Schuljahr hatte Religion.
»Was geschah in Kanaa?«, fragte Martini.
Die kluge, etwas schüchterne Elisabeth Schabbach hob ihre Hand. Als Martini ihr zunickte, stand sie auf und sagte in fast akzentfreiem Hochdeutsch: »Da hat unser Herr Jesus aus Wasser Wein gemacht.«
»Und warum hat Jesus dieses Wunder getan?«
»Ei, die han zu viel getrunken, un da war der Wein eben alle«, platzte der etwas altkluge Otto heraus, eines der elf Kinder des Kleinwinzers Michaelis.
In dem verwohnten Fachwerkhaus dieser Familie, das aus allen Nähten zu platzen schien, lieferte der Klapperstorch fast in jedem Jahr sein Bündel ab. Wie der Kleinwinzer die ganze Bagage ernährte, war jedem im Dorf ein Rätsel. Es wurde gemunkelt, dass bei den Michaelis nur Fleisch auf den Tisch kam, wenn im Dorf eine Katze verschwand oder der Vater sich nachts in Richtung Hunsrück absetzte. Dass er wegen Holzdiebstahls schon wiederholt einen Monat lang in Trier eingesessen hatte, war hingegen offiziell bekannt.
Sein gewitzter Filius stellte sich die Hochzeit zu Kanaa offenbar als fröhliches Gelage vor, was vermutlich auf eigene Beobachtungen zurückging. Diese Antwort entsprach allerdings nicht dem Ziel einer moralisch-sittlichen Erziehung, und so schien es Martini opportun, nicht weiter darauf einzugehen. Er nickte nur stumm. Schließlich waren die Weinvorräte damals in der Tat vorzeitig zur Neige gegangen.
»Un der Wein war auch viel besser«, fügte nun Adolf Resch hinzu.
»Dat is doch klar, wo der von Jesus kam«, ergänzte die kleine Franziska Moog im Brustton der Überzeugung.
»So wat müsste auch mal bei uns passieren«, warf jetzt der rothaarige, mit Sommersprossen übersäte Franz Dusemond ein.