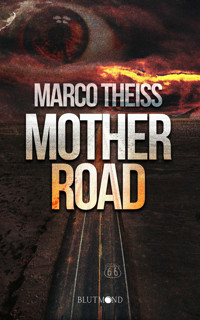
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blutmond Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Chicago nach L.A., 2.448 Meilen durch acht Bundesstaaten. Einmal die berühmte Route 66 entlangfahren – der Traum jedes Motorradfahrers. Für Layla geht er schon mit 18 Jahren in Er-füllung. Der Zeitpunkt des Trips gleicht jedoch eher einer Flucht. Nur drei Wochen zuvor muss-te Layla Abschied von ihrer Mutter nehmen. Von Schuldgefühlen geplagt glaubt sie immer wie-der, ihre tote Mutter zu sehen, traut sich aber nicht, sich ihrem verschlossenen Vater und ihrem heißblütigen Bruder anzuvertrauen. Die Reise durch das fremde Land wird zu einer Reise ins Herz der Finsternis. Als sich die Wege der zerrütteten Biker-Familie mit denen des Serienmör-ders Patch-Over kreuzen, verwandelt sich der Traum vollends in einen blutigen Albtraum aus Wahnsinn und Gewalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M O T H E R R O A D
von
Marco Theiss
1
NARBEN
Dieses Land ist voller Narben. Warum sind wir ausgerechnet hierhergekommen, um zu heilen?
Ich hätte es wissen sollen, als ich den Sarg gesehen habe. Das letzte Mal, dass ich ihn zuvor gesehen hatte, war in der Leichenhalle des Friedhofs in Köln gewesen, bevor er in die Flammen gefahren war.
Wir hatten uns für eine Feuerbestattung entschieden. Der Sarg war weg. Wir hatten uns von ihr verabschiedet. Was anschließend hinter den Kulissen geschehen ist, kann ich nur vermuten. Ich vermute, der Verbrennungsofen des Krematoriums wurde angefeuert. Der Sarg auf eine Art Förderband gelegt und von dort aus ist er langsam in die Flammen gefahren, bis sie ihn sich züngelnd und zischend einverleibt hatten, bis von Holz, Fleisch und Knochen nur noch ein Häufchen Asche übrig war.
Auf dem Gepäckförderband des O’Hare International Airport in Chicago hatte er jedenfalls nichts verloren. Und doch sah ich ihn dort, zwei Wochen später. Als würde das Förderband des Krematoriums nicht in den Flammen des Ofens enden, sondern durch sie hindurch führen, direkt in den Gepäckabfertigungsbereich dieses Flughafens am anderen Ende der Welt, wo er plötzlich zwischen Koffern und Reisetaschen der anderen Passagiere auf die Runde geschickt wurde.
Mein Blick haftete auf der Holzkiste, so wie er jetzt auf der zerfurchten, harten Erde haftet, die sich in ihrer Endlosigkeit aus Narben dem Horizont entgegenstreckt, hinter dem die Sonne gerade rot glühend versinkt. Sie fühlt sich warm an auf meiner Haut. Fast tröstend.
Grand Canyon heißt die riesige Narbe, in die ich herabblicke. Sie macht ihrem Namen alle Ehre. Wenn man von hier oben über ihn hinwegsieht, fällt es schwer zu glauben, dass das Panorama, das die Nachmittagssonne auf der anderen Seite gerade in Pastelltöne färbt, real ist. Dass das Land eine Wunde wie diese überleben konnte …
Als hätte Gott ein Messer in die Erde gerammt und tief in ihr Fleisch geschnitten. Er liebt es, das zu tun. Es war Jahrtausende her. Aber Gott schneidet tief. Glaubt mir, ich weiß es.
Normalerweise stürzen sich Passagiere nach einer langen Reise ungeduldig auf ihr Gepäck. Hieven es vom Band und können es gar nicht erwarten, die Hallen des Flughafens endlich hinter sich zu lassen. Obwohl ich den Sarg meiner Mutter in dem Moment erblickt hatte, als er durch das rechteckige Loch in der Wand gekommen war, machte ich keine Anstalten, mich auf ihn zuzubewegen. Ich starrte ihn einfach nur an, obwohl ich genau wusste, dass es mein Gepäck war. Ich würde ihn einfach durchlaufen lassen. Zusehen, wie er am anderen Ende des Laufbands wieder in der Wand verschwand. Hoffen, dass hinter den Kulissen jemand bemerkte, dass er nichts auf dem Gepäckband verloren hatte und ihn auf den Rückweg in die Flammen des Krematoriums schickte.
Ich würde ihn jedenfalls nicht mit mir rumschleppen. Deshalb waren wir nicht gekommen.
»Das ist doch deiner, oder?«, hörte ich die Stimme meines Vaters aus weiter Ferne, als würde er durch das alte Dosentelefon sprechen, das er gebastelt hatte, als ich ein Kind war.
Erst als er mich im Vorbeigehen anrempelte, bemerkte ich, dass er direkt hinter mir gestanden hatte. Er schob sich vor mich und versperrte mir den Blick auf den Sarg, den er mit beiden Händen vom Förderband hob.
War das sein verdammter Ernst? Es war doch seine Idee gewesen, hierherzukommen. Alles erst mal hinter uns zu lassen. Und jetzt … drehte er sich zu mir um und hielt meine abgewetzte braune Ledertasche mit den Aufklebern meiner Lieblingsbands in der Hand. Mit fragendem Blick sah er zwischen mir und der Tasche hin und her.
Ich reckte den Hals, um an ihm vorbeisehen zu können. Suchte nach dem Sarg, den er ja offensichtlich nicht vom Band genommen hatte.
Er war weg.
Natürlich war er das. Er war nie wirklich da gewesen.
Und doch hatte er es geschafft, alles, was wirklich da war, um mich herum auszublenden. Den Lärm in der Halle. Die Gespräche der anderen Passagiere. Das Rattern von Rollkoffern. Die Schreie der Kinder, die zwischen den Gepäckstücken ihrer genervten Eltern herumtobten. Meinen Vater. Meinen Koffer.
»Können wir dann jetzt endlich?«, erklang eine weitere Männerstimme hinter mir.
Auch meinen Bruder Marc hatte er ausgeblendet. Er bewachte die Taschen der beiden Männer, die bereits vor Minuten aufs Gepäckband gekommen waren, hatte die Arme ungeduldig vor der Brust verschränkt, während ich – seine kleine Schwester – den Verkehr aufhielt.
Papa drückte mir die Tasche in die Arme, so schwungvoll, dass ich ins Stolpern geriet. Sanft war nie seine Stärke gewesen. Hinfallen aber auch nicht meine. Zumindest nicht mehr in den letzten Jahren. Wenn man in dieser Familie stürzte, kam man unter die Räder. Mit zwei kleinen Schritten gewann ich das Gleichgewicht zurück und ließ den Vorfall unkommentiert.
Während wir an den zahlreichen Sicherheitsleuten und Zollbeamten vorbeigingen, die uns, die Eindringlinge in ihr Land, aufmerksam musterten, fragte ich mich, wie sie wohl reagiert hätten, wenn ich einen Sarg statt der Tasche mit mir herumschleppen würde. Sicherlich hätten sie mich beiseitegenommen und ich hätte ihn öffnen müssen.
Als ein Deutscher Schäferhund an der Leine eines der Beamten einen Schritt auf mich zumachte und die Nase im Vorbeigehen interessiert an meinem Koffer rieb, machte sich Unsicherheit in mir breit. Was, wenn er anschlug? Was, wenn ich den Koffer doch noch öffnen musste? Ich wusste, ich hatte nichts zu verbergen. Ich bin nicht schüchtern und würde nicht rot werden, wenn einer der Zollbeamten vor den Augen meines Vaters und meines Bruders einen meiner Tangas daraus hervorzog.
Aber was, wenn der Zollbeamte statt meiner Unterwäsche einen kalten Frauenkörper darin vorfand? Der Sarg hatte sich einmal in einen Koffer verwandelt. Wie konnte ich ausschließen, dass er sich nicht wieder zurückverwandelte? Oder die Inhalte beider bei dem Wechselspiel durcheinandergeraten waren, wie die Gene von Mensch und Fliege in Doktor Brundles Teleportationskammer.
Der Hund ließ mich unbehelligt ziehen.
Minuten später wurden unsere Reisepässe gestempelt. Es war ein Wunder, dass wir ohne Mom daran gedacht hatten, sie einzustecken. In diesem Fall hatte ich ihre Rolle übernommen. Schränke und Schubladen im ganzen Haus durchsucht und die Dokumente letztendlich in der obersten Schublade ihres Nachttisches gefunden. Der kleine silberne Vibrator, der darunter zum Vorschein gekommen war, hatte schon eher das Zeug dazu, mich erröten zu lassen. Gleichzeitig hatte er mir ein kurzes Lächeln auf die Lippen gezaubert.
So, so, Mama!
Ich hatte die vier Pässe durchgesehen, hatte Mamas bereits aussortiert und ihr Sexspielzeug wieder darunter verschwinden lassen. Doch als ich jetzt mit ihren beiden Jungs das Flughafenterminal verließ, steckte ihr Pass zusammen mit meinem eigenen in meinem Rucksack.
Ich kann nicht sagen, warum ich ihn letztendlich doch eingesteckt hatte. Wir waren immer gemeinsam im Urlaub gewesen und es hatte sich irgendwie richtig angefühlt.
2
FREIHEIT AUF ZWEI RÄDERN
Es fühlte sich auch richtig an, das Knattern und Vibrieren zwischen meinen Schenkeln zu spüren. Nein, diesmal rede ich nicht von Sexspielzeug, auch wenn es ohne Zweifel etwas sehr Sinnliches und Erotisches hat, zu spüren, wie das eng anliegende Leder zwischen den Beinen warm wird. Wie die Vibration zunimmt, wenn man den Gashebel mit der rechten Hand auf Anschlag dreht und das Dröhnen in den Ohren anschwillt, bis man in einer eigenen Welt ist.
Verkauft man Menschen diesen Moment in einem Film, dann dröhnt »Born to be Wild« oder irgendein anderer angestaubter Rocker aus den 70ern dazu aus den Boxen. Aber fuck, kein Biker, der bei klarem Verstand ist, fährt ne Maschine mit eingebautem Radio! Wir wollen die Kraft hören. Die Rakete, auf der wir reiten.
Es gab in den vergangenen 14 Tagen nicht vieles, was sich richtig angefühlt hatte, aber endlich wieder eine Maschine unter mir zu haben, gehörte definitiv dazu.
Unser Weg hatte uns vom Terminal direkt zur Autovermietung geführt. Ein ganzer Strom von Passagieren war mit uns geflossen. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass es noch Stunden dauern würde, bis ich mich auf den Sattel schwingen würde. Ich hätte es besser wissen, meinen Vater besser kennen müssen.
Das Gros der Passagiere reihte sich nach Zoll und Einwanderungsbehörde nun in die Schlangen von HERTZ, Sixt, Enterprise und wie sie alle hießen ein, wo sie alle die gleichen Dokumente ausfüllen, die gleichen Kreditkarten durch den Scanner ziehen würden, um dann auf einen riesigen Parkplatz entlassen zu werden, wo sie sich sorgfältig zwischen den gleichen Autos entschieden. Klar, sie hatten unterschiedliche Markennamen, manche waren größer, andere kleiner, einige sportlicher, andere gemütlicher, aber am Ende kamen sie alle vom Fließband. Hatten jeden modernen Scheiß eingebaut, den die Autoindustrie sich in den letzten Jahrzehnten hatte einfallen lassen und rochen nach Reinigungsmitteln und Raumerfrischer, um den Mietern vorzugaukeln, dass sie neu wären. Und doch war das Einzige, was sie voneinander unterschied und personalisierte, das Gepäck, das die Gäste in ihnen von einem Ort zum anderen kutschierten.
Mehr brauchen Autofahrer meistens nicht. Sie wollen von A nach B kommen. Wege sind für sie wie Mauern, die überwunden werden müssen.
Dad hatte keine Motorräder von der Stange gemietet, und so mussten wir uns an diesem Tag in keine weitere Schlange mehr einreihen. Wir folgten der Taxispur vor dem Terminal bis zu einem kleinen Parkplatz, auf dem unsere Bestellung auf uns wartete. Gerade frisch von einem Anhänger geladen, der an einem Pick-up-Truck hing, mit Reifen so dick, dass er in Deutschland wohl als Monster-Truck durchgehen würde. Chrom schimmerte im warmen Licht der Nachmittagssonne, als wollte meine Maschine mir zuzwinkern. In dem Moment, in dem ich sie erblickte, wusste ich sofort, dass sie meine war. Ich stand nicht unbedingt auf typische Mädchen-Bikes. Zu klein, zu schrill. Aber sie waren auch leicht und ich noch Anfängerin, und so fuhr ich zu Hause eine Kawasaki Z650.
Auf diesem Anhänger, weit weg von zu Hause, erwartete mich ein anderes Biest.
***
Von der klassischen Panhead, die sie einst gewesen war, war nicht mehr viel übrig, aber die Grundsteine der Harley erkannte ich sofort. Ansonsten hatte sich jemand viel Mühe gegeben, dem Motorrad eine Seele zu geben. Ein Gesicht, das man wie das seines Fahrers kein zweites Mal auf der Welt genauso wiederfinden würde. Der Tank war in Erdtönen gehalten und wurde von detailverliebten Bildern geziert. Ein Wüstenpanorama im Licht der untergehenden Sonne, komplett mit kreisenden Geiern und dem Schädel eines Longhorns im Vordergrund. Als würde es die Landschaft Arizonas reflektieren, schon Tausende von Meilen, bevor wir sie erreichten. Meins!
Dad hatte sich für eine Kopie des Motorrads entschieden, das Dennis Hopper in Easy Rider fuhr. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er eigentlich nach dem von Peter Fonda gesucht hatte. Anscheinend ohne Erfolg. Für Marc stand die Fat Boy bereit, kein Zweifel! Die dicken, verchromten und schräg nach oben ausgerichteten Auspuffrohre gehörten definitiv nicht zur Standardausstattung. Über die meisten Bauteile hinweg erstreckte sich das braun-schwarze Gefieder des Adlers, der der Maschine sein Gesicht lieh und zudem die Galionsfigur der Harley Davidson Motorcycle Company war.
Eine wunderschöne Maschine, aber für mich ein bisschen zu wuchtig. Zu Hause bin ich mal auf der von Dad gefahren. Die Straße war nicht so sehr das Problem. Ein geiles Gefühl, aber bei einem Meter achtundsechzig und 55 Kilo Körpergewicht kämpft man an jeder Ampel und jeder Kreuzung ums Überleben gegen ein 320 Kilo Biest aus Metall. Ich hatte Blut und Wasser geschwitzt und war froh, als ich das Dickerchen wieder in der Auffahrt hatte und der Ständer meine müden, zitternden Beine endlich erlöste.
Natürlich hatte ich Dad verschwiegen, wie sehr ich gekämpft hatte, aber die Haare, die mir klatschnass im Gesicht klebten, als ich den Helm abnahm, waren miese kleine Verräter.
Dad begrüßte die beiden Männer, bei denen er die Motorräder gemietet hatte, in seinem schlechten Englisch und stammelte sich einen ab, als er seine Bewunderung für die drei Harleys zum Ausdruck bringen wollte. Ich kam ihm zu Hilfe. Er stellte mich und Marc mit wirren Handbewegungen vor, also übernahmen wir den Rest selbst.
Schon lustig. Der alte Mann hatte sein Leben lang von Amerika geträumt und sprach doch kaum ein Wort Englisch.
Zugegeben, so alt war der alte Mann gar nicht. Aber er hat Marc und mich zu sehr zu Bikern erzogen, als dass wir ihn im Alltag Papa oder Papi nennen würden, wenn wir über ihn sprachen. Es war ein Wunder, dass ihn keiner von uns mit Vornamen ansprach. Dad schluckte er, weil es englisch war und damit irgendwie in das Lebensmodell passte, das er sich immer erträumt hatte.
Ich stellte mich als die Tochter des alten Manns vor und Marc als meinen Bruder. Hände wurden geschüttelt und Schultern geklopft. Der größere der beiden Männer, der sich als Trevor Hopkins vorgestellt hatte, führte uns einmal um alle drei Motorräder herum und erzählte uns, dass sie top in Schuss seien. Dennoch verwies er darauf, dass es sich um Oldtimer handelte und wir mit den üblichen kleinen Macken zu rechnen hätten. Er billigte uns aber zu, dass wir alle drei aussahen, als wüssten wir, wie man mit einem Schraubenschlüssel und einer bockigen Maschine umgeht.
Aber hallo! Dad war ein begeisterter Hobby-Schrauber, der mir alles beigebracht hatte, was ich wusste, seit ich 14 war. Marc hatte sogar eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker gemacht und arbeitete in einer Werkstatt.
Der Besitzer zeigte sich beruhigt, dass seine Babys in guten Händen waren.
Ich zweifelte keine Sekunde daran, dass es seine Babys waren. Dass er jede der Maschinen auf die Welt gebracht hatte. Ihre individuelle Umgestaltung mitgemacht hatte und an jeder von ihnen hing, auch wenn er sie nicht selbst fuhr. Er würde sie nicht einfach leichtfertig an einen der Touristen vermieten, die hinten bei Sixt oder HERTZ in der Schlange standen. Sein dichter Schnäuzer zog sich links und rechts in die Höhe, als er breit lächelte, weil seine Babys an uns gingen. Er nahm uns mit zur Ladefläche seines Trucks und breitete einen Vertrag darauf aus. Nahm sich die Zeit, uns jede einzelne Klausel zu erklären und beantwortete geduldig alle Rückfragen. Ich übersetzte für Dad das Nötigste. Er war nur mäßig interessiert. Er vertraute dem dichten Schnauzbart ähnlich bedingungslos wie er uns.
Fünf Minuten später unterschrieb der alte Mann den Vertrag und wir schüttelten zum zweiten Mal Hände zu ausufernden Verabschiedungsfloskeln.
Der Schnauzbart wünschte uns eine gute Fahrt und beteuerte, dass er sich darauf freue, uns in vier Wochen in L.A. wiederzusehen. Er fragte uns nicht, was wir dazwischen alles geplant hatten. Wir waren keine Autofahrer, und wenn er nicht gerade Motorräder auslieferte, fühlte er sich sicherlich auch auf zwei Rädern wohler als auf den vieren seines Monster-Trucks.
Wir waren Motorradfahrer unter sich.
Der Weg war das Ziel – und wir alle wussten es.
3
AUSSERHALB DER ZEIT
Wir waren müde und erschöpft von der Reise. Acht Stunden in einem engen Schlauch aus Metall und Plastik eingesperrt zu sein, 10.000 Meter über der Erde machte mir nicht wirklich etwas aus, aber für Dad war es die Hölle. Für ihn begann die Klaustrophobie schon zwischen den beiden Armlehnen. Er war nicht wirklich dick, aber groß und kräftig gebaut. Außerdem kämpfte er seit Jahren dagegen an, dass sein Bauch seinem alten Gürtel endgültig entkam, in den er bereits zusätzliche Löcher gestanzt hatte. Er war der Economyclass eigentlich entwachsen, gehörte aber zu der Art von Mensch, die es nicht einsah, einen Aufpreis für zusätzlichen Luxus zu zahlen. Also ertrug er die Enge der vollgestopften Flugkabine, ertrug die Übelkeit, die das Fehlen von festem Boden bei ihm auslöste, ertrug die stickige Luft – oder zumindest die Vorstellung davon, die die Angst in ihm auslöste.
Zurück auf der Erde ertrug er die Enge jedoch nicht länger. Chicago war sicher eine Stadt, die ihre Reize hatte, aber wir sollten es nicht erfahren. Wir sahen sie als Skyline zu unserer Linken vorbeiziehen, während wir die Innenstadt auf dem Freeway umfuhren.
Dad wollte nicht von Wolkenkratzern umstellt sein. Er brauchte dringend Freiheit. Nicht nur vom Flugzeug, sondern von dem ganzen Scheiß, den wir zu Hause zurückgelassen hatten.
Es war … ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie spät es war. Wir waren von der Nacht in den Tag geflogen, allerdings nicht in den nächsten, sondern den vergangenen. Die Uhr hatte sich rückwärts bewegt, und so senkte die Sonne sich das zweite Mal dem Horizont entgegen, nur eben am anderen Ende der Welt.
Ich wusste, dass ich mich durch eine andere Zeitzone bewegte, aber ich lebte noch nicht in ihr. Außerdem war ich kein Fan von Armbanduhren, also beschloss ich, für den Moment außerhalb der Zeit zu existieren.
Fünfzehn Meilen südwestlich der Stadt ließ der Verkehr nach. Der Freeway lief aus und ging in eine zweispurige Landstraße über. Häuser wurden spärlicher. Die Verkehrsschilder kündigten unsere Heimat für die nächsten Wochen bereits an, doch erst als Dad unseren kleinen Konvoi über die erste Bodenmarkierung führte, die dem legendären Straßenschild der Route 66 nachempfunden war, wussten wir, dass unsere Reise wirklich begonnen hatte.
4
FROM CHICAGO TO L.A.
2448 Meilen weit würde uns diese endlose Schlange aus Asphalt durch die Vereinigten Staaten führen. From Chicago to L.A. Von zwei Millionen Menschen in gläsernen Türmen am Ufer des Lake Michigan zu drei Millionen Menschen in gläsernen Türmen am Ufer des Pazifiks.
Durch das große Dazwischen. Den alten Westen, der voller Nichts war. Sand, Staub, Canyons. Und doch war es genau das, weshalb wir hier waren.
Get your kicks on Route 66.
5
ROUTE 66 (ILLINOIS)
In Wilmington, Illinois, trafen wir den ersten der drei Giganten. Der Gemini Giant wachte am Straßenrand neben der Einfahrt eines geschlossenen Diners. Sechs Meter hoch hielt der Fieberglas-Raumfahrer noch immer die Rakete in Händen, auch wenn die Farbe schon lange von beiden abplatzte. Wie ein warnendes Zeichen stand er neben den vernagelten Fenstern des Gebäudes, das über Jahrzehnte hinweg Reisende mit Nahrung und Getränken versorgt hatte und das jetzt nur noch ein Gebäude war, ohne Zweck, ohne Schick.
Mir entging nicht, dass Dad abbremste, als er den Giganten als Erster von uns am Straßenrand erblickte.
Er mochte die Sprache nicht sprechen, aber er kannte die Route 66 wie kaum ein Zweiter. Die Mother Road, von der er immer wieder gesprochen und geträumt hatte. Diesem schier endlosen Trip von Ost nach West durch ein Land, in dem Motorräder zu den einzig legitimen Nachfolgern der Pferde geworden waren, auf deren Rücken es früher auf der gleichen Strecke Männer durchquert hatten, wie man sie heute nicht mehr fand.
Mother Road, spukte einer der zahlreichen Spitznamen für die Straße durch meinen Kopf und erinnerte mich schmerzlich daran, dass man manche Frauen heute auch nicht mehr fand.
Verloren starrte Dad auf das Diner am Straßenrand mit seinen vernagelten Fenstern, und ich wusste, es war sein erster Stopp auf unserer Strecke gewesen. Irgendein Laden, über den er irgendwelche Geschichten gehört hatte, und sei es nur, dass es ihn schon besonders lange gab.
Leider waren seine Quellen veraltet und es gab ihn nicht mehr, ganz gleich, wie lange das zuvor der Fall gewesen sein mochte. Es tat mir leid für meinen alten Herrn, doch es sollte nicht die einzige Enttäuschung bleiben, die er auf unserer Reise erleben würde.
Als er den Gashebel seiner Harley wieder durchdrehte, beschleunigte die Maschine, fest entschlossen, die Enttäuschung möglichst schnell hinter sich zu lassen. Marc folgte seinem Beispiel.
Ich tingelte noch einen Moment länger in der Geschwindigkeit, die Dad vorgegeben hatte, als er noch geplant hatte, auf den Parkplatz neben dem Fieberglasgiganten einzubiegen, und sah zu dem Riesen auf. Ich suchte das Besondere an ihm. Fragte mich, was er hier sollte. Er sah nicht einmal annähernd nach einem echten Raumfahrer aus. Mal ganz davon abgesehen, dass Cape Canaveral weit weg war. Ich zog den Gashebel meiner Maschine an und spürte, wie das Brummen zwischen meinen Schenkeln anschwoll und wie die Panhead mich mit Wucht vorantrug, bis ich zu meinem Vater und meinem Bruder aufschloss.
Minuten später reckte sich die Sonne ein letztes Mal hinter Häusern und Hügeln empor. Sie tat es nicht, weil sie es wollte, sondern weil wir den Horizont stetig weiter verschoben. Mit jeder Meile, die wir unsere Maschinen vorantrieben, zwangen wir sie in neue Täler oder Schluchten zwischen Häusern, Scheunen und Silos, doch lange würden wir sie nicht mehr festnageln können. Wir hatten es geschafft, sie auf dem Weg von Deutschland hier her in die Defensive zu zwingen, obwohl sie drüben auf der anderen Seite des Atlantiks eigentlich schon lange Feierabend hatte. Doch wir wussten, hier drüben würden wir sie nicht genauso halten können. Nicht auf den Maschinen, die uns zur Verfügung standen, so geil und einzigartig sie auch waren. Wir verloren die Sonne und mit ihr das Licht und den Tag.
Kurz bevor wir endgültig in die Dunkelheit dieser neuen Welt eintauchten, zeichneten sich am Straßenrand vor uns die Umrisse von Gebäuden ab. Es war aber letztendlich die Duftfahne, die von diesen steinernen Schatten ausging, die uns einmal mehr dazu zwang, die heilige Grenze von fünfzig Meilen pro Stunde zu unterschreiten und eine Zufahrt anzusteuern.
6
FLEISCHFRESSER
Die Heilige Dreifaltigkeit des BBQ, das waren Beef Brisket, Pulled Pork und Spareribs. Und wenn ich von Spareribs spreche, dann hat das nichts mit den labberigen, durchwachsenen Rippchen zu tun, die man aus der deutschen Küche kennt, und die Mom, wie ihre Mutter zuvor, gerne in Töpfen voll kochendem Wasser zubereitet hatte.
Nein, die Heilige Dreifaltigkeit des amerikanischen BBQ zeichnet sich dadurch aus, dass ihre klassischen Gerichte für Stunden und Tage bei niedriger Hitze im Smoker gegart werden, bis jegliches Fett in ihnen zerfließt und sich in ansonsten zähe Fleischstücke wie die Brustmuskulatur ergießt, die dadurch herrlich zart und weich werden.
Das musste ich erkennen, als ich mir den ersten Bissen eines Babyback-Rippchens genehmigte. Das Fleisch fiel vom Knochen, als wollte es von mir gegessen werden, und ich konnte nicht anders, als ihm den Gefallen zu tun. Schon in dem Moment, in dem sich das Aroma über meine Zunge ergoss, wusste ich, dass ich nie im Leben Vegetarierin werden würde. Ich hatte Fleisch immer gemocht, auch wenn ich nie das Gefühl hatte, dass es ein elementarer Teil meines Lebens war, ohne den ich nicht hätte leben können. Der erste Tag in den Staaten änderte diese Einstellung grundlegend. Dieses Fleisch triefte und tropfte in meinen Mund, ergoss sich förmlich in mein Leben, bis ich Fleischsaft und meinen eigenen Speichelfluss nicht mehr voneinander unterscheiden konnte. Genauso hatte es sich auch in mein Blut geschmuggelt, da war ich sicher. Und in Zukunft würde ich regelmäßig passende Infusionen brauchen!
Vor diesem ersten Bissen legte sich eine Hand auf meine Schulter und ich hörte meine Mutter sagen: »Achtung mein Schatz, heiß und fettig.«
Ich zuckte zurück, weg vom Tisch, als eine Hand über mich hinweg langte und die Platte mit der Dreifaltigkeit des BBQ vor mir platzierte.
Eine schwarze Hand, deren Finger mit mehr Ringen bestückt waren, als sie meine Mutter je besessen hatte. Ihr war immer nur ihr Ehering wichtig gewesen.
Ich folgte dem dunkelhäutigen Arm bis hoch in das von Afrolocken umrahmte Gesicht einer breit grinsenden Frau, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte. Dennoch hatte ich sie für eine andere gehalten. Mehr noch: für den Menschen, den ich zeitlebens vielleicht am besten, auf jeden Fall aber am längsten gekannt hatte. Es überraschte mich, als sie die nächsten Worte in tiefstem Südstaatenslang auf Englisch folgen ließ.
»Y’all doin alright?«
Ich hätte schwören können, sie hatte mich vorher auf Deutsch angesprochen. Allerdings hätte ich auch geschworen, die Stimme meiner Mutter hinter mir gehört zu haben.
Ich vergrub mein Gesicht in den Händen und schob es auf meine Müdigkeit, die sich inzwischen, wo ich kein Motorrad mehr aufrecht halten musste, das schwerer war als ich selbst, langsam Bahn brach.
Die schwergewichtige Dame war nicht meine Mutter, aber sie stellte das zauberhafteste Essen meines Lebens in die Tischmitte und wir machten uns darüber her. Sie hatte gekocht wie unsere Mutter. Nein, besser als sie! Und wir genossen es in vollen Zügen. Das letzte, was wir hatten, war ein lausiges Flugzeugessen aus verkochten Nudeln und einer Art Pesto gewesen, das wir irgendwo über dem Atlantik einhellig verschmäht hatten. Nun also Beef Brisket, Pulled Pork und Spareribs, serviert mit Maisbrot, Kartoffel- und Krautsalat.
Ich fühlte mich schlecht, weil ich es so sehr genoss. Als ich zu Marc hinüberblickte, wusste ich, dass es ihm nicht anders ging. Er war immer der skeptische Esser gewesen. Ein Fleischfresser vor dem Herrn, aber zu sehen, wie er sich schmatzend über den Krautsalat hermachte und ihn zusammen mit dem in dünne Scheiben geschnittenen Brisket in sich schaufelte, war befremdlich.
7
NEUE BEKANNTSCHAFTEN
Unser Motel befand sich gleich gegenüber dem Restaurant, in dem wir gegessen hatten. Es zeichnete sich dadurch aus, dass es die perfekteste Kopie des Bates Motels war, wenn man versuchte, die legendäre Filmkulisse auf die reale Welt zu übertragen. Es war ein unspektakulärer einstöckiger Bau mit zwölf Zimmern in Form eines großen L, der etwas außerhalb der kleinen Siedlung gelegen war.
Es erstreckte sich keine Wüste um es herum und es gab kein düsteres Herrenhaus auf dem Hügel dahinter. Eigentlich gab es nicht mal den Hügel. Es erinnerte mich trotzdem an Norman Bates’ Jagdrevier, und ich fragte mich, warum ich all diese Filme viel zu früh gesehen hatte.
Dad scherte sich nicht um solche Gedankenspiele. Für ihn war das Motel okay. Er hatte ein Kilo BBQ vernichtet und sich nicht viel um die Beilagen geschert. Die zwei Bier danach hatten ihm den Rest gegeben, und so hatte ich Marc auf das Schild des Motels auf der anderen Straßenseite hingewiesen.
Dad buchte drei Zimmer mit seiner American Express Card und wir waren zu Hause. Zumindest für diese Nacht.
Was unser Motel dem von Norman Bates voraushatte, war ein Pool. Nichts Besonderes. Nur ein rechteckiges Becken mit einer Leiter und zwei Tiefenangaben, die auf den Rand geschrieben waren, um Kinder vor dem Ertrinken zu warnen.
An diesem Pool waren wir alle drei eine halbe Stunde, nachdem wir eingecheckt hatten und die Sonne untergegangen war. Ich wusste immer noch nicht, wie spät es war, aber ich wusste, es war Sommer und mindestens noch 25 Grad warm, auch ohne den glühenden Ball am Himmel. Die warme Brise zauberte eine Gänsehaut auf meinen nassen Körper, als ich mich aus dem Wasser drückte und auf den Rand setzte, sodass meine Beine weiterhin in der Suppe baumelten.
Aus dem Augenwinkel sah ich Dad vom Tisch in der Ecke des umzäunten Poolareals aufstehen, seine Bierdose zerquetschen und in den Mülleimer werfen. Dann schlenderte er auf mich zu, rieb sich den Bauch.
»Ich geh pennen«, knurrte er, als er hinter mir vorbeiging. »Macht nicht zu lange. Wir stehen früh auf.« Unsere Blicke wanderten rüber zur anderen Seite des Pools, wo Marc mit einem Mädchen saß. Dad winkte zu ihnen rüber, doch Marc war zu sehr mit Flirten beschäftigt, um es zu bemerken. »Erinner deinen Bruder bitte noch mal daran«, forderte Dad mich auf.
»Alles klar«, nickte ich. »Schlaf gut.«
Als ich das Zuschlagen des kleinen Gittertors hinter mir hörte, glitt ich ins Wasser und schwamm rüber auf die andere Seite, wo ich vor den beiden Wasser trat. Marc unterbrach seinen Vortrag über deutsches Bier.
»Hi«, begrüßte ich das Mädchen, das neben ihm am Beckenrand saß und deren nackte Füße sanfte Strömungen in Richtung meines Körpers schickten, die an meinem Bauch kitzelten.
Sadie war bildhübsch. Ein echtes American Girl mit perfektem Körper und langen blonden Locken, die ihr bezauberndes Lächeln einrahmten. Eine junge Frau wie gemacht für den Campus einer amerikanischen Uni, ein Cheerleader-Team oder eine angesagte Studentenverbindung.
Auf jeden Fall aber wie gemacht für den Bikini, den sie trug und der gleichzeitig verbarg und betonte.
Ich fragte mich, ob sie Marc angesprochen hatte oder ob mein Bruder sich auf sie gestürzt hatte. Jedenfalls schien sie die Aufmerksamkeit zu genießen.
»Hey«, grüßte sie zurück und schenkte mir ihr perfektes Lächeln.
»Ich bin Layla«, stellte ich mich vor und streckte ihr die Hand aus dem Wasser entgegen. »Marcs Schwester.«
»Sadie«, stellte sich die amerikanische Schönheit vor. »Schön dich kennenzulernen.«
Dann wandte ich mich an Marc.
»Dad ist ins Bett gegangen«, informierte ich ihn kurz auf Deutsch. »Er will morgen früh los.«
Er nahm es mit einem Nicken zur Kenntnis. Früh ins Bett schickte ich ihn nicht. Marc hatte sich nie besonders um Autoritäten geschert und von seiner kleinen Schwester würde er sich erst recht nichts sagen lassen.
»Du fährst auch Motorrad?«, fragte Sadie.
Ich nickte. »Ja.«
»Wow«, staunte sie ehrlich beeindruckt. »Das ist so cool!«
Ich lächelte geschmeichelt, auch wenn es das für mich nicht war. Es war das Normalste auf der Welt. Trotzdem wusste ich, dass das viele Frauen anders sahen. Sogar, dass viele Frauen versuchten, es ihren Männern zu verbieten, weil sie sich Sorgen um sie machten. Weil sie glauben, Motorradfahren sei etwas Gefährliches. Ein Hobby, bei dem sich Männer als Männer beweisen wollten und bei dem Frauen nur Deko auf ihrem Sozius waren.
Mutige Deko vielleicht, aber trotzdem Deko.
Ich war weder Deko, die sich an den Rücken von irgendjemandem klammerte, noch hatte ich je das Gefühl gehabt, mich auf einem Motorrad besonderer Gefahr auszusetzen. Vielleicht von meiner ersten Fahrstunde mal abgesehen. Und von dem Ritt auf Dads Fat Boy.
Trotzdem schmeichelte mir ihre Anerkennung. Ich schwamm neben sie an den Beckenrand und stützte mich mit den Unterarmen auf, drückte mich so weit aus dem Wasser, dass mein Dekolleté ihr zublinzelte.
8
EIN SANFTES KRIBBELN
In meinem Zimmer waren es meine nackten Brustwarzen, die ihr zublinzelten, hart und fest wie kleine Perlen. Sie verstand die Einladung und stülpte die vollen Lippen über die linke von ihnen. Sie saugte nur sanft daran und schickte doch Wogen durch meinen Körper.
Meinen Bikini gab es nur noch zwischen meinen Schenkeln, und sie hatte dafür gesorgt, dass der Stoff dort nicht getrocknet war, nachdem ich aus dem Pool gestiegen war. Sie zog mir das schwarze Höschen aus und streifte es nach unten bis zu den Knöcheln. Sie rieb ihren Oberschenkel zwischen meinen Beinen und brachte mich immer wieder leise zum Stöhnen. Ich sah ihr zu, wie sie sich ihres Bikinioberteils entledigte. Brüste entblößte, die zwei Nummern größer als mein A-Körbchen waren, aber in ihrer kleinen Mitte genauso hart. Sie schob eine Hand unter meinen Hinterkopf und hob mich an, führte meinen Mund an ihre rechte Brust und ließ mich saugen, während sie ihren nackten, glatt rasierten Schlitz auf meinen presste und ihr Becken rhythmisch kreisen ließ.
Ich schloss die Augen, wurde von einem Kribbeln erfüllt, das zwischen meinen Schenkeln startete, sich aufbaute wie ein Vulkanausbruch und sich in Wellen durch meinen ganzen Körper ausbreitete. Tausende kitzelnde Finger auf meiner Haut, zart wie ein Windhauch. Ich öffnete den Mund, stöhnte, und sofort spürte ich ihre Zunge hineinkriechen und mit meiner spielen.
Als ich die Augen wieder öffnete, war ich allein. Sadie war weg. Nur das Kribbeln war geblieben. Nachwehen meines feuchten Traums. Und Sadies Zunge in meinem Mund, die auf meiner eigenen kitzelte und sich dann Richtung Rachen vortastete. Mit kleinen Beinen und Fühlern meinen Würgereiz auslöste, noch bevor ich begriff, was ich da tatsächlich im Mund hatte.
Ich spuckte eilig aus. Wollte ihre Zunge nicht mehr! Hörte, wie etwas mit einem feuchten Plopp auf dem Teppich neben dem Bett landete. Mit meinem plötzlichen Gewusel artete auch das Kribbeln auf mir in Gewusel aus, wurde zielloser, hektischer, war auf einmal meilenweit entfernt vom Gefühl streichelnder Finger und eines sich anbahnenden Orgasmus.
Ich tastete aufgeregt nach dem Nachttisch und fand den Schalter der kleinen Stehlampe. Sie tauchte meinen Körper in warmes, aber spärliches Licht – und mit ihm die hundert Körper, die auf ihm umherkrabbelten.
Das Licht versetzte die Armee der Kakerlaken in zusätzliche Aufregung. Sie rannten, suchten nach dunklen Spalten.
Dunkle Spalten!, schoss es mir panisch durch den Kopf und mein erster Griff ging zwischen meine Beine.





























