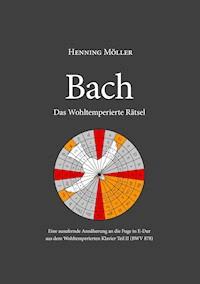Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Kompositionen von Johann Sebastian Bach sind inhaltsleer und bedeutungslos. Zu dieser radikalen und irritierenden Erkenntnis gelangt das vorliegende Buch gerade deshalb, weil Bachs Musik geprägt ist durch latente Mehrdeutigkeiten, semantische Bezüge und individuelle Erinnerungsmotive. Bachs Musikstücke bilden ein eigenes kognitives Netzwerk, das im strukturellen Kern auf iterativen Rekursionen basiert, die einerseits eine motivische Begrifflichkeit sui generis im Sinne der Hermeneutik entstehen lassen, und die andererseits Spiegelbild kognitiver Prozesse schlechthin sind, die deshalb auch als Grundmuster unseres Denkens aufgefasst werden können. Dabei greift Bach auf induktiv semantische Motive zurück, deren Entstehung und Verwendung an Hand von eingehenden Analysen ausgewählter Kompositionen aufgezeigt werden. In weiteren, diskursiven Kapiteln verweist das Buch interdisziplinär auf analoges Schaffen anderer Künstler. So lassen sich Vergleiche ziehen, die von Michelangelo bis Gerhard Richter und von Ovid bis Wittgenstein reichen. Das Buch wendet sich sowohl an diejenigen, die im Bereich musiktheoretischer Analysen neue Impulse für die eigene Beschäftigung mit Bachs Musik suchen, als auch an solche Leser, die in den Strukturen der Kompositionen mathematisch interpretierbare Muster bereits selbst erkannt haben und besser verstehen wollen. In den zentralen Kapiteln des Buches wird eingegangen auf Bachs Auffassung vom musikalischen Dualismus, seine Beschäftigung mit Heinichens „Der General-Bass in der Composition“ aus dem Jahr 1728 und den Grund wechselseitiger Zitate in den Musikstücken Bachs. Gleichzeitig werden die dahinter liegenden, mathematisch interpretierbaren Strukturmuster aufgedeckt, die jenseits einer Zahlensymbolik und Kryptographie zu finden und zu deuten sind. Das Buch verbindet beide Aspekte - Musiktheorie und Algorithmik - zur Idee einer produktiven Inversion und kreativen Kraft in Bachs Musik, verdichtet zum semantischen Zeichen, aufgefasst als Symbol und Nukleus einer universellen Bedeutung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen,
der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind –
oder doch ähnliche Gedanken – schon selbst einmal gedacht hat. –
Es ist also kein Lehrbuch. – Sein Zweck wäre erreicht,
wenn es einem, der es mit Verständnis liest, Vergnügen bereitete.“
LUDWIG WITTGENSTEIN,
TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS, VORWORT.
Inhalt
Vorrede: Was wir gerne über Bach wissen würden, was wir über Bach wissen können und wie wir etwas über Bach erfahren
„Bachs Clavier-, Orgel- und Kompositionsschüler wussten all das, was wir heute gern über Bach wissen würden…“, so lautete die Überzeugung des Direktors des Bach-Archivs Leipzig. Folgerichtig hat das dortige Forschungsinstitut die Projekte „Bachs Thomaner“ und „Bachs Privatschüler“ ins Leben gerufen, um bisher unbekannte Dokumente, Briefe oder Tagebücher aus dem unmittelbaren Umfeld Johann Sebastian Bachs zu entdecken, die uns etwas über den Komponisten und den Menschen Bach erzählen können. Ausdehnungen der Forschungstätigkeit um das eigentliche Objekt der Wissbegierde herum haben bereits in der Vergangenheit unerwartete Fundstücke, wie etwa autografe Kompositionen Bachs, ans Licht gebracht, und solche Partituren sind jede Anstrengung der Spurensuche wert. So ist es nur konsequent und erfolgversprechend, diese Art der Recherche mit Hilfe von zahlungskräftigen Sponsoren fortzusetzen.
Der damit verbundene Forscherdrang springt allerdings etwas hastig über die beiden Teilaspekte der zitierten These hinweg. Da ist zum einen die Frage, was wir über Bach eigentlich wissen wollen, und zum anderen, was Bachs Schüler möglicherweise wussten. Erst wenn diese beiden Fragen vom Grundsatz her geklärt sind, kann man beurteilen, ob ihre Lösungsmengen sich signifikant überschneiden oder gar übereinstimmen.
Zunächst scheint jede Information, die wir zusätzlich über Bach erhalten können, relevant zu sein, da wir schlichtweg alles wissen wollen. Unser Wissensdurst ist im Falle Bachs deshalb so unstillbar, weil wir über verschiedentliche biografische Fakten hinaus kaum etwas über die Person an sich sagen könnten, und weil sich Bach selbst nur in wenigen Briefen mit eher geschäftlichem Inhalt geäußert hat. Wer wäre nicht entzückt über Aussagen eines damaligen Thomaners, wie Bach eine Chorprobe organisiert hat, oder eines Klavierschülers, wie Bach einzelne Stücke erläuterte und einüben ließ.
Etwas stutzig sollte man dann aber schon werden, denn auch über andere Komponisten aus der Zeit Bachs wissen wir sehr wenig und dennoch richten wir für diese Musiker nicht in gleicher Weise Institute ein und fördern Forschungsprojekte. So steht beispielsweise der seinerzeit berühmte und europaweit gefeierte Opernsänger, Hofkapellmeister und hochbezahlte Komponist Johann Adolf Hasse, dessen einstiger Ruhm den des Thomaskantors bei weitem überstrahlte, heute eher abseits des allgemeinen Interesses. Die Unwissenheit über die Person alleine ist also nicht der Auslöser der Beschäftigung mit Bach. Ursache für unsere Neugier ist das eigentümliche Genie Bachs, das wir in seinem Werk meinen ausmachen zu können und das wir begreifen wollen. Wäre Bach nur ein talentierter Musiker und sonst wie geistreicher Komponist gewesen, hätten uns seine Unterrichtsmethoden keinen Deut interessiert. Das bemerkenswerte Genie Bachs und die Frage nach seinem Selbstverständnis und seiner Selbstwahrnehmung sind der Kern unserer Wissbegierde. Ob Bach seine Chorproben penibel pünktlich zu beginnen pflegte, oder wie er seinen Kompositionsschülern Begrifflichkeiten der Harmonik oder Kontrapunktik erklärt haben mag, sind da eher unterhaltsames Beiwerk. Bedenkt man zudem, wie sich die wenigen neueren Erkenntnis zu biografischen Details auf das Bild, das wir von Bach entwerfen, ausgewirkt haben, so resigniert man vollends, denn der damit vollzogene Wandel vom tiefgläubigen, dienstbeflissenen und frömmelnden Kantor zum aufmüpfigen und weltlichen Genüssen zugeneigten Komponisten, mit einem Faible für pulsierende Tanzrhythmen auch in geistlicher Musik, der in seiner Jugend das ein oder andere Mal die Schule schwänzte und auch körperliche Auseinandersetzungen nicht scheute, der in seinen letzten Jahren in Leipzig kein Interesse an der Erfüllung seiner Dienste mehr hatte und sich vertreten ließ, ist nur der Wechsel von einem Klischee zum anderen. Welcher Wahrheit wollte man sich so nähern? Zu Recht gibt es heute maßgebliche Interpreten, die es nahezu als Glücksfall ansehen, dass wir so wenig über die Person Bach wissen. So können wir uns mehr mit der Musik befassen.
An diesem Punkt angelangt fällt unser Blick auf den zweiten Teil der zitierten These des Bach Archiv Direktors, nämlich auf das Wissen der Zeitgenossen Bachs. Es ist schon eine Überlegung wert, ob wir durch die beabsichtigte Befragung der Verstorbenen, vermittels der vom jeweiligen Erzähler gefärbten Geschichten und Mixturen aus Dichtung und Wahrheit auch über das allzu Menschliche und den bloßen Lokalkolorit hinausgehende Erkenntnisse über das Genie Bachs erlangen können, denn es ist nicht auszuschließen, dass der äußerlich wahrnehmbare Mensch Johann Sebastian Bach im alltäglichen Leben, aber auch im Unterrichten seiner Schüler, sich nicht von einem durchschnittlichen Musiker und Komponisten seiner Zeit, der uns eben nicht sonderlich interessiert, nennenswert unterschieden hat. Ob wir also mittels der Methode posthumer Interviews etwas über das Wirken des Genies hinter der Fassade der Person erfahren können, hängt vor allem davon ab, welche Einblicke in seine Gedankenwelt Bach seinen Schülern gewährt hat. Erste Zweifel am diesbezüglichen Optimismus und den Erfolgsaussichten auf Begreifbarkeit des Genies in der Wahrnehmung der Zeitgenossen Bachs mögen sich aus dem Umstand ergeben, dass die für Bach persönlich wichtigsten Schüler, seine Söhne Wilhelm Friedemann Bach und Carl Philipp Emanuel Bach, aber auch seine Schwiegersöhne und Schüler Johann Christoph Altnikol und Johann Friedrich Agricola der Nachwelt nahezu nichts über die musiktheoretischen Auffassungen und kompositorischen Ansichten des alten Bach zu berichten wussten - und Musiktheorie und Kompositionslehre dürften ja nur die Basis des Genies und der Anfang der in Wahrheit zu erzählenden Geschichte gewesen sein. Selbst die Gelegenheit zur Darlegung der Denk- und Sichtweise des Vaters bzw. Lehrers im Nekrolog wurde scheinbar versäumt. (Das Versäumnis ist ein scheinbares, denn Bach hat ihnen schlichtweh nichts mitgeteilt, was sie hätten berichten können.) In diesem Nachruf auf den verstorbenen Bach, gemeinschaftlich verfasst von Carl Philipp Emanuel Bach, Lorenz Christoph Mizler, einem weiteren bedeutenden Schüler Bachs, und Johann Friedrich Agricola, finden wir neben biographischen Informationen und der zu erwartenden Lobeshymne auf den Verstorbenen nur eher anekdotisch wirkende Berichte über einzelne Vorfälle aus dem Leben Bachs. Die Ursache hierfür scheint der Nekrolog selbst zu benennen. Dort heißt es im letzten Absatz, der über die Mitwirkung Bachs in der von Mizler gegründeten Societät der musikalischen Wissenschaften berichtet, höchst aufschlussreich: „Unser seel. Bach ließ sich zwar nicht in tiefe theoretische Betrachtungen der Musik ein, war aber desto stärker in der Ausübung.“ Bach galt – auch und gerade dem unmittelbaren Umfeld - offensichtlich als Praktiker und nicht als Theoretiker. Was sollte nun Bach, dessen Überzeugung demnach „sola musica“ lautete, einem Thomaner anvertraut haben, was er nicht auch den genannten, persönlich nahestehenden Schülern mitgeteilt hätte? Zudem bestand eine der gängigsten Unterrichtsmethoden dieser Zeit darin, seine Schüler durch Nachahmung des vom Lehrer Vorgegebenen und nicht durch Erklärungen an den zu vermittelnden Wissensstoff, wie etwa die Kompositionslehre mit ihren Schemata der Harmonik und Kontrapunktik, heranzuführen. Zu dieser Wahrnehmung passt völlig schlüssig die Wiedergabe eines Berichtes von Heinrich Nikolaus Gerber, Bachs Schüler in den Jahren 1724 bis 1726, durch seinen Sohn Ernst Ludwig Gerber, wie Bach den Vater unterrichtet hatte: „Er versprach ihm den erbetenen Unterricht und fragte zugleich, ob er fleißig Fugen gespielt habe? In der ersten Stunde legte er ihm seine Inventionen vor. Nachdem er diese zu Bachs Zufriedenheit durchstudirt hatte, folgten eine Reihe Suiten und dann das temperirte Clavier. Dies letztere hat ihm Bach mit seiner unerreichbaren Kunst dreimal durchaus vorgespielt, und er rechnete die unter seine seligsten Stunden, wo sich Bach, unter dem Vorwande, keine Lust zum Informiren zu haben, an eines seiner vortrefflichen Instrumente setzte und so diese Stunden in Minuten verwandelte.“
Bach hatte wohl ganz allgemein, so wird auch aus den überlieferten Diskussionen anlässlich seines Amtsantritts in Leipzig geschlossen, wenig Interesse am Unterrichten und schrieb bekanntermaßen kein einziges Lehrbuch (seine „Generalbasslehre“ von 1738 ist von der Quellenlage nicht eindeutig und als Lehrbuch nur bedingt aussagekräftig), sondern lediglich auf den didaktischen Wert des jeweiligen kompositorischen Werkes verweisende Titelblätter (z.B. für seine zwei- und dreistimmigen Inventionen bzw. das Wohltemperierte Klavier), und auch sein Spätwerk „Kunst der Fuge“ ist bei ihm eine Komposition und keine theoretische Abhandlung wie später bei Marpurg. Weder hat Bach einem Johann Mattheson, wie von diesem erbeten, erläuterndes Material für dessen Publikation „Grundlage einer Ehren-Pforte“ zur Verfügung gestellt, noch hat Bach eine musiktheoretische Abhandlung bei der Societät der musikalischen Wissenschaften eingereicht, dessen Mitglied er war. Damit gehörte Bach eindeutig zu jenen Komponisten, die Johann Mattheson in der anstelle eines Vorwortes verfassten Ode auf Heinichen in dessen Abhandlung „Der General-Bass in der Composition“ dafür tadelte, dass diese nur komponierten, aber der Nachwelt nicht erklärten, nach welchen Prinzipien sie dies taten.
Bach schweigt, reicht der Societät eine alternativ zur Abhandlung zulässige Komposition ein und zwingt uns damit eine Analyse seiner Kompositionen, seiner Musica auf, wenn wir etwas über ihn selbst und das Wirken seines kompositorischen Genies erfahren wollen. Wir kommen also nicht um die Mühe herum, uns wieder mit Bachs Werk zu befassen. „Ad fontem!“, möchte man ausrufen. Nach der Frage also, was kann ich wissen, stellen sich nun – ganz im Sinne Kants - die Frage, was soll ich tun und was darf ich hoffen. Dieser Problematik wird in den nun nachfolgenden Anmerkungen des zweiten Teils der Vorrede auf den Grund gegangen.
Die eher rückwärtsgewandt erscheinende, erneute inhaltliche Beschäftigung mit den unmittelbaren Quellen aus der Feder Bachs, die nach den bisherigen Überlegungen aber so dringend erforderlich wäre, ist weder Aufgabe des Bach-Archivs noch erscheint sie angesichts der bereits existierenden, umfassenden und nahezu erdrückenden Sekundärliteratur zu diesem Thema gewinnbringend und der Mühe wert zu sein. Was soll man da noch entdecken? Welcher Gedanke lohnt die Mühe der Arbeit, wenn doch alle Gedanken bereits gedacht sind? Und ist nicht die Aussicht auf zeitgenössische Dokumente aus dem Umfeld Bachs, die uns berichten können, wie er z.B. als Lehrer seinen Schülern einzelne Kompositionen näher gebracht hat, viel verlockender? Nochmals, Bach mag vielleicht seine Kompositionen in gängiger Form erklärt haben, und dies ist schon zu bezweifeln, aber sicher nicht sich selbst.
Wenn nun im Folgenden der Versuch unternommen wird, Neues und gleichzeitig Relevantes in einzelnen Stücken insbesondere des Wohltemperierten Klaviers zu entdecken, dann stehen dem ganz offensichtlich die genannte Flut der Veröffentlichungen und das hohe Niveau der wissenschaftlichen Befassung mit Bach entgegen. Zweifel an diesem Pessimismus hinsichtlich einer eigenen Beschäftigung mit dem Werk ergeben sich jedoch schon bei der ersten Durchsicht der veröffentlichten wissenschaftlichen Analysen einzelner Kompositionen. So erfahren wir etwa über eine Fuge des Wohltemperierten Klaviers die Anzahl ihrer Stimmeinsätze, das Spektrum der verwendeten Tonarten, den Umfang der themenfreien Zwischenspiele, wie weit das Fugenthema und die erste Durchführung reichen, oder es wird diskutiert, ob es sich um eine Doppelfuge oder eine Fuge mit zwei obligaten Themen handelt, was natürlich eine völlig andere Sache ist. Diese Statistik der Komponenten und des Materials der vorgefundenen Komposition und ihre penible Einordnung in die Terminologie der Musikwissenschaft hinterlassen den Eindruck eines Defizits. Lichtblicke sind hier allenfalls stilistische Vergleiche und aufgezeigte Verbindungen zu weiteren Werken Bachs oder zu Stücken anderer Komponisten. Das wahrnehmbare Defizit resultiert wiederum daraus, dass die Anhäufung von Tatsachen nichts sagt über die Gedanken, die hinter den Sachverhalten stehen, nichts über das Genie, ja, noch nicht einmal etwas über das Denken als strukturgebender Prozess für das Vorgefundene. Der Grund dafür mag sein, dass man sich in der Wissenschaft nicht in Spekulationen verlieren möchte und alles, was über reine Tatsachenbeschreibungen hinausgeht, ist ja doch schließlich nur Spekulation, und darauf will man sich nicht einlassen. Wie sich zeigen lässt, sind in der Tat die auf Fakten beruhenden Analysen der Kompositionen Bachs jenseits jeder Spekulation der wesentliche Schlüssel zum Verständnis des Genies, aber auch hier entdeckt man Defizite der bisherigen Betrachtungen in der Literatur, da selbst einfachste Werkzeuge kompositorischer Analyse des Materials, mit ihren Kategorien von Abweichung, Ähnlichkeit, Übereinstimmung, Vertauschung, Umkehrung etc., nicht zur Hand genommen werden.
Ob wiederum rein sachbezogene Analysen der Werke Bachs tatsächlich über die Feststellung hinaus, welche „genialen“ Einfälle in einer Komposition verarbeitet wurden – wie etwa die geistreich gelehrige Auswahl von Gestaltungsmitteln der Fugentechnik etc. -, auch Einblicke gewähren in das Selbstverständnis Bachs, also zu einer Begreifbarkeit des Genies führen, hängt maßgeblich davon ab, ob Bach sich in seiner Musik in dieser Weise mitgeteilt hat. Dass Komponisten mit ihrer Musik immer etwas zum Ausdruck bringen wollen, ist heutzutage nahezu trivial. Um aber das eigene Musik- und Selbstverständnis und damit das eigene Denken ausdrücken zu können, hätte Bachs Musik jedoch zweierlei zu leisten. Sie müsste zum einen Träger von Bedeutung sein und zum anderen gleichzeitig ihre eigene Erläuterung, die uns zeigt, dass sie und wie sie Bedeutung besitzt. Dieses kommunikative Element setzt musikalische Motive, die Zeichen im Sinne der Semantik sind, voraus. Erst dann kann ein Mitteilen und Verstehen einsetzen. Bach darf also nicht auch in seiner Musik schweigen. Dies ist – um erneut Kant zu bemühen – eine der Bedingungen, ja, die Grundvoraussetzung der Möglichkeit von Erkenntnis, wenn alle anderen Quellen versiegt sind. Das geforderte „ad fontem“ kann nur Erfolg haben, wenn diese Quelle sprudelt.
Die Suche nach einer Bedeutung hat sich dennoch ausschließlich an der Musik, an Stimmführung, Harmonik und motivischer Arbeit zu orientieren und nicht etwa an Zahlensymbolik, von denen manche meinen, dies sei die Art und Weise gewesen, mit der Bach Inhalte in seiner Musik transportiert hätte. Dies zu behaupten, hieße, Bach hätte sich nicht mit seiner Musik, sondern mit Zahlen mitgeteilt. Eine der ersten Thesen dieser Abhandlung, die wie die noch folgenden als Richtschnur für Analysen dienen soll, ist also, dass wir stets und an aller erster Stelle das musikalische Material vollständig analysieren und verstehen müssen, bevor wir uns weiterführenden Überlegungen widmen. Dies schließt nicht aus, dass Betrachtungen zur Zahlensymbolik die Überlegungen abrunden, wie etwa Hypothesen zur Verwendung der prominenten Zahl 14 (die Buchstaben bach im Zahlenalphabet haben bekanntermaßen die Quersumme 14) als Platzhalter für Bach selbst. In der vorliegenden Abhandlungen beschränkt sich die Verwendung von Zahlensymbolik auf diese Zahl 14 sowie die im biblischen Kontext zu verstehende Zahl 40, worauf später eingegangen werden soll, und einige wenige vergleichbare Zahlen. Alle anderen Zahlen, denen man bei der Analyse begegnen wird, bleiben hingegen inhaltsleer, sie bleiben das, was sie sind, nämlich Zahlen. In jedem Fall aber muss die Analyse der motivischen Arbeit Bachs jenseits der Zahlensymbolik auch in der Lage sein, zu erklären, warum Bach sich immer wieder auf konkrete Zahlenrelationen in der Architektur seiner Kompositionen gestützt hat.
* * *
Die eingeforderte Analyse der musikalischen Substanz darf allerdings nicht stecken bleiben im Sumpf der Statistik und bei einer rein quantitativen Erfassung der Komposition. Sie muss vielmehr Bezüge und Zusammenhänge aufdecken und zu einem echten Verstehen des Materials führen. Wie bedeutsam das Verständnis des harmonischen Konzeptes sein kann, das hinter einem Motiv oder einem Thema verborgen ist, zeigt die Analyse der Befassung Bachs mit Johann David Heinichen im WK II, da sie eine Einteilung des Schaffens Bachs in die Zeit vor und nach Heinichen erlaubt.
Als Heinichen 1728 seine musiktheoretische Abhandlung „Der General-Bass in der Composition“ in Dresden veröffentlichte, mit dem darin enthaltenen Quintenzirkel sowie der Tabelle der Verwandtschaftsverhältnisse der neuen 24 Tonarten, da entfaltete dieses Lehrbuch des Hofkapellmeisters Heinichen rasch seine Wirkung in Theorie und Praxis. Johann Mattheson veröffentlichte 1731 – also nach Heinichens Tod im Jahr 1729 – einen vermeintlich „verbesserten“ Quintenzirkel und Georg Andreas Sorge, der als 15. Mitglied der Correspondierenden Socität der musicalischen Wissenschaften Johann Sebastian Bach folgte, gibt 1730 seine „Clavierübung aus 24 Präludia durch den ganzen Circulum Modorum“ in Druck, die in ihrer Ordnung der Tonarten dem Quintenzirkel folgt. Demgegenüber scheint Bach auf den ersten Blick von dieser neuen Ordnung völlig unbeeindruckt gewesen zu sein. Irgendwann nach 1730 komponierte er seine zweite Sammlung von Präludien und Fugen in allen 24 Tonarten, die er unbeirrt und anscheinend unbeeinflusst vom „Musicalischen Circul“ Heinichens wieder in einer chromatisch aufsteigenden Reihe anordnete, wie schon 1722 bei seinem sog. ersten Teil des Wohltemperierten Klavier. (Die Bezeichnungen „Teil 1“ und „Teil 2“ sind insoweit irreführend, als dass Teil 1 bereits vollständig und abgeschlossen war und keines zweiten Teils bedurfte; dementsprechend hat Bach selbst diese Bezeichnungen auch nicht verwendet.)
Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, wie ich an anderer Stelle bei der Analyse der E-Dur Fuge des WK II (BWV 878) ausführlich erläutert habe (hierauf wird im Folgenden der Einfachheit halber stets mit der Wendung „an anderer Stelle“ Bezug genommen), dass Bach im Stimmanzahlmuster des WK II – also in der Art und Weise, wie er die Stimmanzahlen für die Fugen von drei oder vier Stimmen auf die Tonarten verteilte – mittels der dreistimmigen Fugenpaare eine zweite, innere Struktur zum Ausdruck bringt, nämlich den Quintenzirkel nach Heinichen mit seinem steten Wechsel von Dur zur parallelen Moll-Tonart, während die chromatische Reihe, als beibehaltene äußere Ordnung des WK II, beständig wechselt von Dur zur gleichnamigen Moll-Tonart (s. hierzu ausführlicher das Kapitel „Die große Iteration der E-Dur Fuge“). In der E-Dur Fuge des WK II setzt Bach dann dieses Gegeneinander von parallelen und gleichnamigen Tonarten und damit der Ordnungen von Ca GeDh etc. auf der einen Seite und Cc Cis cis Dd etc. auf der anderen Seite kompositorisch um und markiert mit dem Ambitus der E-Dur Fuge von H-Dur, cis-Mol, fis-Moll, gis-Moll und E-Dur nicht nur einen markanten Ausschnitt aus Heinichens Zirkel, sondern auch eine besondere Position innerhalb des als Ambitus-Mechanismus interpretierbaren Stimmanzahlmusters, die zu einer Identität des Ambitus für beide Ordnungsprinzipien - für den Quintenzirkel und die chromatische Reihe – führt. Die Anfangstöne von Dux und Comes der E-Dur Fuge lauten dabei e, fis und a bzw. h, cis und e sowie später fis, gis und h, die in dieser Reihung der Abfolge der Grundtöne in Heinichens Zirkel entsprechen. Bach hat sich also nachweislich im WK II mit Heinichen beschäftigt und man kann letztlich davon ausgehen, dass Heinichens „Generalbass“ und sein früher Tod Auslöser der Komposition des WK II gewesen sind. Basis für diese Schlussfolgerung ist dabei nicht nur das erste Motiv des Fugenthemas der E-Dur Fuge des WK II, sondern das harmonische Gesamtkonzept der Fuge. Wie fundamental diese Wahrnehmung der Harmonik für die Deutung von Motiven ist, zeigt sich an einem einfachen Gegenbeispiel zur E-Dur Fuge des WK II, an der Fuge in B-Dur aus dem WK I (BWV 866).
Die B-Dur Fuge des WK I beginnt mit einem eingängigen und charmanten Thema, dessen erste sechs Noten ebenfalls wie eine Tonfolge wirken, die eine Reihung von Grundtönen in Heinichens Zirkel ergeben, genauso, wie es für die E-Dur Fuge des WK II unterstellt wurde. Besonders die latente Zweistimmigkeit des Fugenanfangs legen diese Vermutung nahe.
(Anfang der B-Dur Fuge des WK I, gedeutet als Abfolge von Grundtönen einer Tonart)
Die besondere Bedeutung der Anfangsnoten und damit des Anfangsmotives der B-Dur Fuge des WK I hebt Bach zudem dadurch hervor, dass er mit diesen sechs Anfangsnoten alle im Verlauf punktuell auftretenden, markanten Ostinato-Motive der Fuge gestaltet, in den Takten 7 und 8 (unter Verwendung des Tones c), 11 und 12 (f), 15 und 16 (c), 17 und 18 (d), 24 und 25 (d), 28 und 29 (g), 39 und 40 (b), 43 und 44 (f) sowie 45 und 46 (f). Liegt also auch hier eine Beschäftigung Bachs mit Heinichens Zirkel vor? Das harmonische Konzept der B-Dur Fuge spricht jedoch eine andere Sprache, denn die Ostinato-Passagen der Fuge sind verknüpft mit den Tonarten C-Dur, F-Dur, D-Dur, G-Dur und B-Dur, allesamt Dur-Tonarten also, die nicht auf den Quintenzirkel nach Heinichen verweisen, mit seinem Wechsel von z.B. B-Dur zu g-Moll zu F-Dur zu d-Moll zu C-Dur etc., sondern die eine Dur Quintenreihe ergeben, D-G-C-F-B, die schon vor Heinichen geläufig war. Fasst man diese Feststellung mit den Beobachtungen für ähnliche Dur-Quintenreihen des WK I, z.B. in der e-Moll Fuge oder der b-Moll Fuge, zusammen, so kann gerade das Fugenthema der B-Dur Fuge des WK I belegen, dass Bach bei der Komposition des WK I noch nicht mit Heinichen befasst war, während die E-Dur Fuge des WK II die gegenteilige Hypothese für das WK II zulässt. Wie sich später zeigen lässt, demonstriert die E-Dur Fuge des WK II aus sich selbst heraus in ihrem persiflierenden, musikhistorischen Abriss der Entwicklung der Tonarten und der damit verbundenen Auto-Referenzialität sehr anschaulich, dass dem WK I und seiner Entstehungsgeschichte noch nicht eine Beschäftigung Bachs mit Heinichen zu Grunde lag. Bach selbst gibt diesen Hinweis (s. hierzu das Kapitel „Motiv und Identität“).
* * *
Um aber solche Zusammenhänge von Motiv und harmonischem Konzept erkennen zu können, ist ein freies und experimentelles Denken erforderlich, welches uns befähigt, spekulativ z.B. Heinichens Zirkel grafisch gegen Bachs chromatische Reihe zu setzen, Stimmanzahlen zu vermerken und Muster zu erkennen. Dieses freie Denken und die daraus erwachsenden Denk-Experimente sollen in der dritten und letzten Vorrede zu den Erkenntnismöglichkeiten besprochen werden.
Die an anderer Stelle entwickelte und ausführlich dargelegte Idee, dass Bach in der Fuge in b-Moll aus dem WK I (BWV 867) den Kanon “Frère Jacques” verarbeitet hat, ist recht schnell erzählt und vor allem ist sie für den inhaltlichen Fortgang der systematischen und abstrakten Überlegungen in diesem Buch nicht weiter von Belang, denn die vier Motive des Kanons, die in der Fuge verarbeitet wurden, könnten wir auch als eine beliebige Motiv-Folge Nummer soundso bezeichnen, mit den Einzel-Motiven I bis IV und damit abkoppeln vom realen Kanon „Frère Jacques“, ohne dass die nachfolgenden Entdeckungen und Schlussfolgerungen in Frage gestellt würden. Dennoch möchte ich die „Frère Jacques“ Idee zu Beginn dieser Abhandlung nochmals als Vorbemerkung aufgreifen, um etwas sehr Wesentliches darzulegen, nämlich die Bedeutung der Freiheit des Denkens bei der Analyse der Werke Bachs.
In Kurzform besagt die „Frère Jacques“ Idee, dass Bach in der b-Moll Fuge motivisch und lautmalerisch den Klang von Glocken imitiert hat, dass darüber hinaus alle Motive des zeitgenössischen Kanons „Frère Jacques“ in der Fuge wiederzufinden sind, dass sich umgekehrt das Fugenthema und alle damit verknüpften Motive der Kontrasubjekt freien Fuge auf die Motive des Kanons zurückführen lassen – also eine motivische 1:1 Übereinstimmung, oder im Sinne der Aussagenlogik, eine Eineindeutigkeit vorliegt -, dass das wichtigste Motiv des Kanons, das „Frère Jacques“ Motiv, an exponierter Stelle als letztes Motiv der fünften und letzten Stimme mit einem gleichzeitigen Wechsel von Moll nach Dur eingeführt wird, dass sich einzelne Motive in der Fuge mehr und mehr vervollständigen zur identischen Tonfolge der Kanon-Motive und dass in der letzten Engführung die Idee eines Kanons vollständig umgesetzt wird. Diese Verarbeitung des Kanons mag biografische Gründe haben. Denkbar ist insbesondere eine Bezugnahme dieser Fuge Nummer 22 mit ihrem vorangehenden Präludium, das in Takt 22 in einem verminderten Septakkord innehält, auf den Tod des Bruders Johann Jacob Bach im Jahr 1722. Gleichzeitig könnte die zweite fünfstimmige Fuge des WK I, die cis-Moll Fuge (BWV 849), mit ihrem Kreuz Motiv auf den nur ein Jahr zuvor verstorbenen Bruder Johann Christoph Bach verweisen. Beide Fugen zusammen, die in einer kreisförmig gedachten Darstellung der chromatischen Reihe der Grundtöne der Tonarten des WK I eine Symmetrie um C-Dur erzeugen, stünden so für das Bruderpaar Jacob und Christoph, aber auch für die Einteilung der Tonarten links und rechts von C-Dur in Kreuz- und in B-Tonarten. Soweit die „Frère Jacques“ Hypothese.
Am eindrücklichsten lässt sich der „Frère Jacques“ Kanon und seine Motive in der Basslinie der Takte 18 bis 25 der b-Moll Fuge wiedererkennen, die hier quasi als Quintessenz der „Frère Jacques“ Hypothese wiedergegeben wird. Vergleicht man dies mit der großen g-Moll Orgelfuge (BWV 542), bei der Bach nachweislich – vermutlich als Hommage für seinen Besuch bei Johann Adam Reincken in Hamburg – das holländische Volkslied „Ik ben gegroet van“ motivisch verarbeitet hat, so erscheint diese Idee nicht mehr ganz so abwegig. Der Unterschied zum französischen Kanon in der b-Moll Fuge ist allerdings, dass wir nach dem holländischen Volkslied in der Orgelfuge nicht mehr suchen mussten, denn bereits Johann Mattheson hat vor über 250 Jahren diesen Hinweis gegeben. Hier nun aber die Kanon-Passage der b-Moll Fuge:
(Vollständiger Bruder Jakob Kanon in der b-Moll Fuge des WK I in den Takten 18 bis 25 mit der Abfolge „Sonnez les matines“, „Frère Jacques“, „Dormez vous“ und „Ding ding dong“)
Diese Passage wird uns später noch intensiv beschäftigen, denn dort führt uns Bach das strukturelle Entstehen eines semantischen Motives in Reinform vor. Hier an dieser Stelle möchte ich lediglich erläutern, wie ich zur „Frère Jacques“ Idee gelangt bin, denn ohne weiteres stolpert man nicht über diese Motiv-Kette, die in der Regel nur im Bass auftaucht. Ausgangspunkt der Idee war die praktische Beschäftigung mit der Fuge, das Spielen und Hören der Musik. Dabei hatte ich immer wieder bei den Takten 39 ff. den Eindruck, dass mich der Klang dieser Passage an etwas erinnert, ich konnte nur nicht sagen, was dies war. Es ging hier wohlgemerkt nicht um ein ähnliches Musikstück, sondern um einen ähnlichen Klang. Erst nach längerer Zeit bin ich darauf gekommen, dass es der Klang eines Glockenspiels war. Am Anfang der Entdeckungen stand also die Bereitschaft, über eine so kleine Passage der Fuge und die damit verbundenen subjektiven Irritationen immer und immer wieder nachzudenken. Der Effekt wiederholten Nachdenkens in „endlosen“ Schleifen besteht nicht einfach darin, dass mit dem selben Instrumentarium ein erneuter Versuch unternommen wird, ein bisher ungelöstes Rätsel zu lösen, sondern darin, dass mit jeder Wiederholung all die kleinen Veränderungen, die sich durch neue Ideen, Eindrücke oder Fragestellungen ergeben haben, im Gedankenfluss aufgenommen werden, um mit solcherart geändertem Blickwinkel die Sache zu betrachten. Im Nachhinein war es dann aber doch verwunderlich, dass ich nicht zeitgleich mit der Idee des Glockenspiels auch die „Frère Jacques“ und „Sonnez les matines“ Motive entdeckt hatte, obwohl diese Motive - neben der Imitation eines Glockenklangs - die markantesten Elemente dieser Passage der Takte 39 ff. sind.
(„Frère Jacques“ und „Sonnez les matines“ in den Takten 39 bis 42 der b-Moll Fuge des WK I)
Die weiteren Gedankengänge folgten zunächst rasch, nachdem nun ein einigermaßen konkretes Bild entstanden war. Die Idee des Klangs eines Glockenspiels führte unweigerlich zur Erkenntnis, dass die Takte 50 bis 55 mit ihren unverkennbaren Schlag-Motiven im Bass und den dagegen gesetzten hohen Akkorden in den Oberstimmen den metallisch-voluminösen Klang von Glocken imitieren und dass bereits das Fugenthema mit seiner Glockenschlag-Quart abwärts und der dissonanten kleinen None aufwärts dieses Klangbild erzeugt. Der zweite, wesentliche Faktor für die Entdeckung des „Frère Jacques“ Kanons in der Fuge war also ein „zu Ende denken“, das Ausreizen des ursprünglichen Gedankens. (Wie präzise Bach den Klang von Glocken nachgeahmt hat, werden wir später noch genauer betrachten; s. hierzu das Kapitel „Motiv und Erinnerung“.) Die Bedeutung dieses „zu Ende denken“ liegt gerade darin, einen anfänglich eher vagen Gedanken aufzugreifen, ihn für bare Münze zu nehmen und in allen Facetten bis ins Letzte auszureizen, und sei es auf den ersten Blick noch so abwegig, um dann auf völlig neuem Terrain einen Abgleich vornehmen zu können mit dem Ausgangsmaterial. Die Ergebnisse rechtfertigen dieses Vorgehen.
Doch dann setzte eine Art Selbstzensur ein, die mir untersagte, beim Spielen der Fuge zu Beginn immer an „Bimbam“ als lautmalerische Wiedergabe eines Glockenklangs zu denken, denn schließlich war die fünfstimmige b-Moll Fuge ein ernstzunehmendes Werk und kein Kinderkanon wie „Frère Jacques“. Da war plötzlich – vermutlich unbewusst - diese Idee des Kanons, aber als Negation und Warnung. Die Fuge ist keine Kinderlied, soviel stand fest. Diese Selbstzensur ist vermutlich der Grund, warum bisher der Kanon in der Fuge unentdeckt geblieben ist. Jeder, der sich jemals mit dieser Fuge befasst hat, kennt den Kanon, aber offensichtlich ist da ein Mechanismus am Werk, der diese Bereiche voneinander trennt. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Eines Tages beim weiteren Nachdenken gab ich den Widerstand allerdings auf und kam wenigstens zu dem Schluss, dass ich der „Frère Jacques“ Angelegenheit - aus welcher Zeit und von wem stammt der Kanon - einmal „ins Blaue hinein“ nachgehen sollte. Diese wiedererlangte Freiheit des Denkens hat letztlich zu allem anderen geführt. Bach selbst hatte solche Schranken wohl nicht im Kopfe, wie das Quodlibet der Goldbergvariationen beweist, in dem er zwei zeitgenössische Gassenhauer mit einer von Händel übernommenen Basslinie kanonisch kombiniert. Auch solcherlei musikalische Mixturen haben weitere historische Vorbilder, wie Guillaume de Machaut (ca. 1300 – 1377), der in einer Motette ein sakrales Lied mit einem französischen Liebeslied kombinierte. Das Verbinden von unvereinbar scheinenden Gegensätzen ist offensichtlich eine der treibenden Kräfte menschlichen Denkens.
Nach kurzer Beschäftigung mit dem Kanon und der Theorie, Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764) sei der Urheber dieses Liedes gewesen, kam ich auf die Idee, den Kanon auch in Moll zu spielen, konkret in b-Moll, der Grundtonart der Fuge. Interessanter Weise erhält der Kanon dadurch eine höhere musikalische Qualität und größere Tiefe, denn der höchste Ton, das g (bei der Ausgangstonart B-Dur), wird durch das Transponieren nach b-Moll zum ges – der kleinen None des Fugenthemas -, das in Bezug zum b-Moll Dreiklang b-des-f ein neapolitanisches Ges-Dur ergibt (b-des-ges) mit ges als „theatralische“ Vorhaltenote zu f. Auch der Text des „Dormez vous?“ verwandelt sich in der Moll-Fassung zu einer eher bedrohlich schicksalhaften Vorahnung.
Dieses naive Experimentieren setzte ich fort, indem ich Kanon und Fuge gegeneinander stellte, parallel spielte und die motivischen und kontrapunktischen Entsprechungen entdeckte, einschließlich der exponierten Einführung des „Frère Jacques“ als letztes Motiv der fünften und letzten Stimme, als Höhepunkt der Exposition mit dem Wechsel von b-Moll nach Des-Dur. Genau dieses kleine Gedankenexperiment wird im Nachfolgenden noch einmal angestellt werden, nämlich mit den Themen der Fugen in cis-Moll und in b-Moll des WK I, mit einem wunderbaren Ergebnis (dargestellt im Kapitel „Motiv und Identität“).
Freies Denken, Wiederholung von Denkprozessen, naives Experimentieren, Neugierde und das „kontrapunktische“ Zusammenfügen von Ideen haben letztlich auch zur Entdeckung strukturell semantischer Motive bei Bach geführt, deren Entstehung er uns im Zusammenspiel der b-Moll und der cis-Moll Fuge des WK I demonstriert. Der Begriff des semantischen Motivs und seine Differenzierung in deduktiv semantische und induktiv semantische Motive stehen dabei am Anfang der Darlegung dieses fundamentalen Zusammenhangs der beiden Fugen. Und damit beginnen die eigentliche, in ihrem Detaillierungsgrad mühevolle Arbeit und die akribische Untersuchung der Verbindung von Motiv und Gedanke bei Johann Sebastian Bach.
„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“ALBERT CAMUS, LE MYTHE DE SISYPHE. ESSAI SUR L’ABSURDE.
Motiv und Semantik
„Die Grammophonplatte, der musikalische Gedanke, die Notenschrift, die Schallwellen, stehen alle in jener abbildenden internen Beziehung zu einander, die zwischen Sprache und Welt besteht. Ihnen allen ist der logische Bau gemeinsam. (Wie im Märchen die zwei Jünglinge, ihre zwei Pferde und ihre Lilien. Sie sind alle in gewissem Sinne Eins.)“
LUDWIG WITTGENSTEIN, TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS, SATZ 4.014
„Daß es eine allgemeine Regel gibt, durch die der Musiker aus der Partitur die Symphonie entnehmen kann, durch welche man aus der Linie auf der Grammophonplatte die Symphonie und nach der ersten Regel wieder die Partitur ableiten kann, darin besteht eben die innere Ähnlichkeit dieser scheinbar so ganz verschiedenen Gebilde. Und jene Regel ist das Gesetz der Projektion, welches die Symphonie in die Notensprache projiziert. Sie ist die Regel der Übersetzung der Notensprache in die Sprache der Grammophonplatte.“
LUDWIG WITTGENSTEIN, TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS, SATZ 4.0141
Unter einem Motiv versteht man gemeinhin die kleinste musikalische Formeinheit, die in der Regel ein klares rhythmisches Muster und eine klare melodische Linie aufweist und dabei wesentlicher Baustein und Ausgangspunkt der Kraftentfaltung einer Komposition ist. Es ist abzugrenzen von musikalischen Floskeln oder geläufigen Wendungen in Kadenzen, die auf Grund ihrer gefälligen Struktur bzw. ihrer Funktionalität eine häufige und eher beiläufige Verwendung in verschiedensten Kompositionen finden.
Diese noch rudimentäre Begriffsdefinition verweist bereits auf eine wesentliche Eigenschaft der als Motiv betitelten musikalischen Sequenz. Grundvoraussetzung für die Annahme eines Motivs ist seine Erkennbarkeit und Wiedererkennbarkeit. Damit weist jedes so definierte musikalische Motiv eine potentiell semantische Struktur auf, ohne dass bereits eine Bedeutung mit dem Motiv intendiert wäre. Die Begriffsdefinition verweist nämlich indirekt auf die kognitiven Prozesse, die mit dem Phänomen der Wiedererkennbarkeit verbunden sind. Ein per se „bedeutungsloses“ Motiv erinnert uns zwar an nichts, aber wir erinnern uns an das – einprägsame - Motiv. Es ist prägnant und seine Wiedererkennbarkeit impliziert die hypothetische Struktur zweier semantischer Ebenen. Dieses Phänomen könnte man als Vermeintlichkeit einer Bedeutung bezeichnen. Alle Motive haben auf diese Weise a priori eine strukturelle Bezugsebene, die allerdings nicht konkret durch einen externen Bezugspunkt, sondern nur durch sich selbst ausgefüllt ist. Das Motiv an sich ist bereits per definitionem Zeichen – aber noch ohne Bezeichnetes. Es ähnelt so dem Funktionsbegriff der Mathematik, ausgedrückt durch f(x). In diesem Sinne ist also jedes Motiv bereits strukturell semantisch. Daraus folgt auch, dass eine tatsächlich bedeutungslose Musik eine Musik ohne Motive wäre, die man vermutlich deshalb nicht mehr als Musik bezeichnen würde. Musik ist a priori semantisch, ihre Motive sind a priori semantische Zeichen und ihr Zusammenwirken ist Sprache. Besonders deutlich wird dieser Vergleich, wenn Motive zu Ketten, den sogenannten Phrasen, verbunden werden, die strukturell eine eigene Art Grammatik aufweisen. Die Entstehung der Idee einer a priori semantischen Musik lässt sich einerseits ableiten aus einer schlichten Übertragung der mit der menschlichen Sprache verbundenen kognitiven Prozesse auf die Musik, oder aber andererseits aus der Wahrnehmung der Musik, der Faszination, die damit für den Menschen verbunden ist, und somit aus sich selbst heraus. Dieses Gegeneinander – Projektion von Denkmustern auf die Musik versus Erkennen eigenständiger kognitiver Prozesse in der Musik – ist der Schlüssel für das Verständnis des Zusammenhangs von Motiv und Gedanke bei Johann Sebastian Bach.
Losgelöst vom Erfordernis der Wiedererkennbarkeit und der Idee eines abstrakten semantischen Zeichens haben Motive an sich jedoch keine Bedeutung. Im engeren Sinne der Semantik sind sie bedeutungslos, es sei denn, der Komponist weist ihnen eine konkrete Bedeutung zu. Das Motiv steht dann als Platzhalter für etwas anderes außerhalb der Musik. Recht einfach geschieht diese Zuweisung einer Bedeutung durch den Komponisten z.B. im Falle der im 19. Jahrhundert aufkommenden Leitmotive, da die motivische Bedeutung der Leitmotive durch die simple, reale Verknüpfung der Musik mit einer erdachten Handlung, die parallel zur Musik dem Betrachter vorgeführt wird, entsteht (Siegfried erscheint und ein bestimmtes Motiv erklingt). Als einprägsame Melodiefragmente und Gestaltungsmittel werden sie vom Komponisten gekoppelt an die Protagonisten eines Musikdramas und können so bei jeder weiteren Verwendung auf diese Gestalten verweisen, unabhängig von deren Präsenz. Richard Wagner nannte sie Erinnerungsmotive und nach Thomas Mann ist ein Leitmotiv eine „vor- und zurückdeutende magische Formel, die das Mittel ist, einer inneren Gesamtheit in jedem Augenblick Präsenz zu verleihen.“ Da die Bedeutung eines Leitmotives abgeleitet wird aus der Simultanität von Motiv und Handlung, werden diese Motive im Folgenden als deduktiv semantische Motive bezeichnet.
Motive können aber auf eine noch viel einfachere Art und Weise eine Bedeutungsebene besitzen, denn mit ihnen lassen sich durch lautmalerische Imitation reale akustische Vorgänge – vom Zwitschern der Vögel bis zum Donnerhall - wiedergegeben. Dies entspricht dem modelltheoretischen Zusammenhang von Abbildung und Abgebildetem. Dabei ist es nicht erforderlich, dass alle Informationen in der Abbildung wiedergegeben werden. Vielmehr reicht es im Sinne der Modelltheorie aus, dass selektiv solche Informationen transportiert werden, die in der Syntax des Modells die realen Vorgänge als wiedererkennbares Muster nachbilden können. Die Informationen sind quantitativ unvollständig, aber qualitativ ausreichend. Diese einfachen semantischen Motive ähneln den visuellen Symbolen der Zeichensprache oder den Piktogrammen, und sie wirken in ihrer Simplizität eher naturalistisch als künstlerisch hochstehend. Auch hier wird die Bedeutung des Motives abgeleitet aus seinem Zusammenhang zu realen Vorgängen. Diese Motive sind folglich gleichermaßen deduktiv semantisch.
Da ein musikalisches Motiv eine zeitliche Abfolge akustischer Signale darstellt, lassen sich besonders gut reale Vorgänge mit explizit zeitlich-akustischer Dimension wie Tanzen, Hüpfen, Marschieren etc. wiedergeben. Das Fällen eines Baumes ließe sich so leichter musikalisch darstellen als der Baum selbst. In dieser Ausgestaltung sind die Motive bereits komplexer als die einfachen deduktiv semantischen Motive. Einen besonderen Komplexitätsgrad erlangen Motive durch ihre Verwendung im Zusammenhang mit der menschlichen Sprache, etwa bei der Vertonung eines Liedtextes. So sind die vier Motive des Kanons „Frère Jacques“ wegen der aus dem Liedtext ableitbaren Bedeutung deduktiv semantische Motive, aber die Bedeutungsebene selbst, der Liedtext, ist in sich bereits abstraktes Zeichen für eine weitere, dahinter liegende Realität. Man könnte also von doppelstufig-deduktiv semantischen Motiven sprechen. Auch ein Instrumentalwerk ohne unmittelbar zugeordnetem Text kann solche Motive enthalten, sofern sich diese an unsere Sprache anlehnen, indem sie den Tonfall einer Frage, eines Befehls oder eines Seufzers wiedergeben. Besonders die musikalischen Phrasen, die verketteten Motive, können wegen ihres grammatikalisch wirkenden Zusammenspiels, wegen ihrer Syntax und ihres differenzierten Klangbildes an den mitteilenden Charakter und den Klang des Sprechens erinnern.
Allen deduktiv semantischen Motiven – auch den komplexeren von ihnen – ist gemeinsam, dass der Komponist ihnen auf sehr triviale Art eine Bedeutung zuweisen kann, sei es, dass ihnen bereits durch die allgemeine Erfahrung akustischer Wahrnehmungen eine Bedeutung zukommt, oder dass sie eine Bedeutung durch ihre simultane Verknüpfung mit einer erdachten Realität – sei es eine Bühnenhandlung oder ein gesungener Liedtext - erlangen.
Betrachtet man die beiden für die weitere Analyse maßgebenden Fugen, nämlich die b-Moll und die cis-Moll Fuge des WK I, so finden sich hier zwei sehr unterschiedliche, deduktiv semantische Motive im jeweiligen Fugenthema. Da ist zum einen das Glockenschlag Motiv der absteigenden Quart des b-Moll Fugenthemas, das eben lautmalerisch den Klang von Glocken imitiert und so unmittelbarer Platzhalter hierfür wird, und zum anderen, in völlig unterschiedlicher Art und Weise, das cis-Moll Fugenthema, das visuell an ein liegendes Kreuz, Zeichen der Kreuzträger, erinnert. Weder ein Kreuz noch das Liegen eines solchen kann man aber hören. Folglich lässt sich ein Kreuz nicht im engeren Sinne deduktiv musikalisch darstellen. Vielmehr wirkt erst das Notenbild, also die schriftliche Kodifizierung der Musik, wie eine grafische Darstellung eines Kreuzes. Das musikalische Motiv kann folglich nur mittels der mit dem Klang verbundenen Assoziation zu einem bestimmten Notenbild ein Kreuz symbolisieren. Diese enge Verbindung zwischen visuellem Notenbild und musikalischem Motiv wird für das Verständnis der kognitiven Prozesse bei Bach noch eine größere Rolle spielen. Ganz allgemein muss man feststellen, dass Bach immer wieder Konstruktionen und Architekturen in seinen Kompositionen wählte, die man nicht im engeren Sinne hören kann. Dass z.B. eine bestimmte musikalische Sequenz ausgerechnet in Takt 14 erklingt und die 14 für den Namen Bach steht, kann man nicht hören. Selbst wenn man beim Zuhören die Takte mitzählen würde, um besonders darauf zu achten, was in Takt 14 erklingt, so würde man eben nicht die Zahl 14 hören können.
Komponisten können den Motiven ihrer Kompositionen auch völlig losgelöst von deduktiv ableitbaren Inhalten lediglich individuell bzw. nur subjektiv verständliche und damit aus Sicht eines Außenstehenden quasi willkürliche Bedeutungen zuweisen. Solche Konstrukte ähneln den Texten der Kryptographie oder den Betrachtungsgegenständen der Hermeneutik, die ohne eine Dekodierungsmöglichkeit unzugänglich bleiben. Bestenfalls könnte man aus der Art und Weise der Verwendung einzelner Motive im Gesamtzusammenhang und Wechselspiel mit anderen Motiven, aus ihrer erkennbaren Syntax heraus, Schlüsse ziehen auf ihre Bedeutungsmöglichkeiten. Solche rudimentären grammatischen Zusammenhänge einzelner Motive können z.B. in ihrem Gegeneinander (hohe und tiefe Stimmlagen, schnelles und langsames Tempo, auf- und absteigende Melodien etc.) oder auch Miteinander (parallele Verwendung, harmonischer Zusammenhang, Klang-Identitäten etc.) bestehen und führen nur sehr begrenzt zu einem Verständnis des vom Komponisten intendierten Inhalts. Die Grammatik der motivischen Arbeit zeigt dabei deduktiv das Zusammenwirken der Motive auf, die Motive selbst bleiben jedoch ohne eine dem Betrachter mitgeteilte oder aus der Erfahrung ableitbare Bedeutung. Das beschriebene Zusammenwirken einzelner Motive mittels deduktiver Syntax Regeln kann dabei jedoch einen so hohen Wiedererkennungswert haben, dass die Syntax selbst zum Motiv wird.
Werden in der Musik solche, nicht unmittelbar verständlichen Motive verwendet, die man als verschlüsselte semantische Motive bezeichnen könnte (auch wenn der Komponist ihre Bedeutung aus den von ihm getroffenen Festlegungen herleiten kann), so benötigt man für eine Übersetzung so etwas wie den Stein von Rosetta aus dem Jahr 196 v. Chr., der in seiner Gegenüberstellung ägyptischer Hieroglyphen und demotischer bzw. altgriechischer Schrift einen Zugang zur Bedeutung der Hieroglyphen Schrift ermöglichte. Dass ein Komponist im Barock die Motive eines Musikstückes als abstrakte Chiffre empfunden hat, ist eher unwahrscheinlich, obwohl das Chiffrieren sich einer gewissen Beliebtheit bereits in der Renaissance und später im Barock erfreut hat, wie die Spiegelschrift Leonardos und nicht zuletzt die Ende des 17. Jahrhunderts von Gottfried Wilhelm Leibniz erfundene Chiffriermaschine zeigen. In der Musik ist vielmehr davon auszugehen, dass die deduktiv semantischen Motive, und hierbei vor allem die Motive von Liedern, eine dominierende Rolle im musikalischen Denken – neben der Beliebtheit gängiger Floskeln und virtuoser Kunstfertigkeiten – gespielt haben. So wird ein Komponist auch seine verschlüsselten semantischen Motive in Ansätzen immer aus deduktiv semantischen Motiven herleiten und erst danach einen für den Außenstehenden nicht mehr ohne weiteres nachvollziehbaren Abstraktionsgrad entwickeln, der seine Motive zu Chiffren werden lässt. Und selbstverständlich gibt es eine vermutlich mit Abstand größere Zahl von Komponisten, die ihren Motiven, ihrer Musik überhaupt keine Bedeutung in diesem Sinne beimessen wollten, sondern die ihre Musik als etwas Absolutes angesehen haben, also als eine Kunstform, die keinerlei Bezugspunkte außerhalb ihrer selbst bedarf
Einen völlig anderen, fundamentaleren Weg, um ein Motiv mit Bedeutung zu versehen, zeigt Bach im Zusammenwirken der Fugen in b-Moll und cis-Moll des WK I auf, indem er weder Chiffrierungen, wie etwa durch die Verwendung von Zahlensymbolik, noch deduktive Ableitungen aus geläufigen Vorlagen verwendet, sondern indem er über das Phänomen der Iteration, Reduzierung und Verdichtung von Motiven und der schließlich erlangten Identität von Abbildung und Abgebildeten eine abstrakte Bedeutung für ein Motiv erzeugt, die gleichzeitig in der Lage ist, zu erklären, wie überhaupt Bedeutung entsteht, nämlich aus sich heraus, aus dem eigenen Entstehungsprozess. Solche Motive werden im Folgenden deshalb als induktiv semantische Motive bezeichnet. Der Vorgang der Induktion benötigt dabei kein semantisches Umfeld wie die deduktiv semantischen Motive, und für sich genommen bedeuten die induktiv semantischen Motive auch nichts, was sich in eine Sprache außerhalb der Musik übersetzen ließe, aber sie sind Artefakte der abstrakten kognitiven Leistung der Erinnerung und des Denkens. Diesen Zusammenhang aufzuzeigen, ist eine der Hauptaufgaben dieses Buches.
Hinter dem kompositorischen Zusammenfügen von Fugenthemen und Kontrasubjekten und ihrer mathematischen Interpretation liegen auf einer dritten Bedeutungsschicht wiederum urtypische, kognitive Primärprozesse, wie sie etwa im Tauschen und neu Kombinieren der drei Themen der Fuge zu erkennen sind, sowie vor allem iterative Rekursionen, die zu einer komprimierten und verstetigten Struktur führen. Dass und warum dies fundamentale Vorgänge des Denkens sind, wird Bach vermutlich nicht hinterfragt oder wahrgenommen haben. Er hat sich also nicht selbst die Frage gestellt, warum Menschen überhaupt Interesse an Kombinatorik und Mustern haben. Gleichwohl wird er aber eine eigene Auffassung dazu gehabt haben, warum Menschen z.B. im Kanon singen, was nichts anderes ist als Kombinatorik. Auch die wahre Ursache für den noch darzustellenden Entstehungsprozess eines induktiv semantischen Motivs wird Bach nicht bewusst gewesen sein, aber dieser Vorgang, abgebildet auf der Oberfläche seines Bewusstseins, ist ihm klar vor Augen gewesen. Im Falle der fis-Moll Fuge bestand nun die musikalische Herausforderung darin, drei Themen und Motive zu finden, die sich wie beschrieben kombinieren lassen. Bach hat diese sich selbst gestellte Aufgabe meisterlich gelöst, und eine Analyse der fis-Moll Fuge darf den prozessualen Charakter dieser auch mathematisch interpretierbaren Kombinatorik nicht außer Acht lassen. Solche Prozesse führen letztlich auch zum Verständnis der genannten induktiv semantischen Motive.
Um den Blick für induktiv semantische Motive zu schärfen, soll im Folgenden zunächst die Wirkungsweise zweier einfacher, deduktiv semantischer Motive dargestellt werden, die zudem jeweils eine einfache Syntax aufweisen. Gleichzeitig soll aber anhand dieser Einführungsbeispiele auch gezeigt werden, wie Bach bereits bei diesen einfachen Motiven und Zusammenhängen durchaus komplexe Inhalte transportiert und Mehrdeutigkeit entstehen lässt. Erst in einem weiteren Schritt soll dann dargelegt werden, wie Bach die hier aufgezeigten Spielarten deduktiv semantischer Motive hinter sich lässt und ein induktiv semantisches Motiv als Resultat eines iterativen Prozesses erzeugt.
Bach rückwärts oder hcaB vorwärts?
Einen ersten Eindruck von der semantischen Qualität motivischer Arbeit bei Johann Sebastian Bach gibt auf einfache Art und Weise die E-Dur Fuge aus dem WK II (BWV 878), obwohl dies vor einem recht komplexen Bedeutungshintergrund geschieht. Die motivische Arbeit ist hier sehr einfach gestaltet, da sie auf den üblichen Werkzeugen der Fugentechnik wie Diminution, Engführung, Umkehrung und Krebsgang basiert. Zum Verständnis der konkreten, hier analysierten Motivgestaltung ist vorab eine kurze Darstellung der Deutungsebenen der E-Dur Fuge notwendig, die umfänglich an anderer Stelle ausgearbeitet wurden.
Mit der E-Dur Fuge stellt Bach das Gegeneinander von parallelen und gleichnamigen Dur-/Moll-Tonarten dar und damit das Gegeneinander des Quintenzirkels nach Johann David Heinichen mit seinem steten Wechsel von Dur- und paralleler Moll-Tonart, sowie Bachs eigener Anordnung der Tonarten im Wohltemperierten Klavier mit dem Wechsel einer Dur- zur gleichnamigen Moll-Tonart in der chromatischen Reihe.
Auffällig bei dieser Gegenüberstellung ist, dass Heinichens Ambitus Definition, die wie sein Quintenzirkel vollständig abzielt auf parallele Dur-/Moll-Tonarten, im Falle einer Moll Tonika nicht die quintverwandte Oberdominante, sondern nur die schwächere Dominante auf der siebten Stufe umfasst (also z.B. H-Dur anstelle von Gis-Dur als Dominante für cis-Moll; für den Grundton gis führt Heinichen an dieser Stelle im Ambitus lediglich gis-Moll auf, aufgefasst als Parallel-Tonart zu H-Dur). Gleichzeitig lehnt Heinichen im Generalbass auch die weitere Verwendung der ihm überholt erscheinenden Kirchentonarten ab. Es fehlen in seiner Kompositionslehre dementsprechend die plagalen Ganz- und Halbschlüsse der alten Modi, z.B. ein phrygischer Halbschluss von fis-Moll (fis als Penultima) zu Gis-Dur (gis als Ultima). Heinichen lehnt diese Kadenzen ausdrücklich ab, da sie nach seiner Auffassung nicht der naturgemäßen Ordnung der Tonarten entsprechen. Diesem Denken stellt Bach, in einer Art theologisch geprägten Reflexion auf Basis des Trinitatis Schemas, kompositorisch in der E-Dur Fuge ein Kadenz-Modell entgegen, das in der Abfolge von phrygischem Halbschluss und quintverwandter Oberdominante zur Tonika besteht – eben in der heute gängigen Abfolge cis-Moll, fis-Moll, Gis-Dur und cis-Moll -, die beide in Heinichens Theorie nicht enthaltenen sind.
Bach persifliert nun darauf aufbauend im gis-Moll Teil, dem dritten Mittelteil der E-Dur Fuge (Takt 23 bis 25) eine zentrale Passage aus Heinichens Buch „Der General-Bass in der Composition“, die hier im Wortlaut wiedergegeben wird, und in der sich Heinichen über die Fürsprecher („Diesen Leuthen“) der alten Tonarten („…die Modi (nehmlich die alten)…“), die er selbst abschaffen möchte, spöttisch äußert, und in der Heinichen insbesondere auf Andreas Werckmeister als deren vornehmsten Vertreter eingeht (Der General-Bass in der Composition, Kapitel V., S. 914):
„Diesen Leuthen redet nun Werckmeister in seiner Harmonologie vortreflich das Wort, wenn er p. 73 sich also vernehmen lässet:
‚Diejenigen aber so dennoch vorwenden, daß die Modi (nehmlich die alten) nicht im Brauch wären, werden dadurch verführt, indem sie sehen, wenn etwan einige vornehme Componisten ihre schöne Degressiones oder künstliche Abweichungen haben, meinen sie, die Modi würden überschritten, und dannenhero nicht mehr im Gebrauch, indem sie aber in solcher Opinion stecken, wissen sie nicht, daß auch der Modus eine Richtschnur sey wie man solche Degressiones einrichten und anbringen möge, damit man wieder zur selben Clave, und gleichsam zu der Thür, da man ist ausgegangen, wieder gelangen könte, denn wenn solches nicht wäre, ginge man gleichsam in einem Irrgarten und Labyrinth, da man nicht wüßte, wo man sich sollte zuletzt hinwenden.‘
Da habt ihr es, ihr heutigen Practici! Ihr werdet keine künstlichen Degressiones mehr machen können, und werdet euch in dem Labyrinth eurer 24. Modorum ganz und gar verliehren, wofern ihr euch nicht von den alten Modis, gleich als vom Faden Ariadnes, werdet wieder heraus führen lassen: da mögt ihr euch nun feste anhalten.“
Diese von Heinichen zitierte und gleichzeitig ironisch kommentierte Ansicht Weckmeisters, dass die abschweifend künstlerische Verwendung der Tonarten („…künstlichen Degressiones…“) ein Labyrinth sei, indem man sich nur mittels der alten Kirchentonarten zurecht finden kann, greift Heinichen direkt zu Beginn des Kapitels über die Verwandtschaftsverhältnisse der neuen 24 Tonarten ablehnend auf und erläutert (ebenda S. 837), dass man mittels seines Zirkels „…vor- und rückwärts in nahe und weit abgelegene Modos gehen könne, ohne sich im geringsten zu verirren“.
Bach übernimmt dieses Bild des Labyrinths und des Ariadne Fadens, indem er ab Takt 23 der E-Dur Fuge über vier Takte hinweg eine verwirrende Harmoniefolge auf Basis der alten Kirchentonart gis-Phrygisch gestaltet, um dann ab Takt 27 mit einer befreienden, mustergültigen Sequenz im Sinne von Heinichens Ambitus-Begriff dieses Labyrinth zielgerichtet zu verlassen, mit kurzen Kadenzen für E-Dur, H-Dur und gis-Moll, also mit Hilfe der Syntax paralleler Tonarten – im letzten Falle mit zugehöriger Dominante Fis-Dur und nicht etwa Dis-Dur, mit dem Bach dann aber als Darlegung seines Gegenmodells den gis-Moll Teil letztlich beschließt. Das einmalige an dieser Persiflage ist, dass mit Heinichens Generalbass quasi der bereits erwähnte Stein von Rosetta für Bachs Komposition gefunden wurde, der eine Übersetzung des Musikstückes Bachs in die Sprache Heinichens und damit überhaupt in Sprache ermöglicht.
Diese Persiflage setzt Bach nicht nur im harmonischen Konzept sondern auch motivisch um, indem er das Labyrinth aus dem Werckmeister Zitat Anfang Takt 27 der E-Dur Fuge (nach den so verwirrenden vier Takten des gis-Phrygisch) mit einer Diminution des Fugenthemas verlässt.
Im Labyrinth selbst aber erscheint direkt zu Beginn in Takt 23 dieses Motiv singulär in der Fuge rückwärts:
So stellt Bach auf recht einfache Weise das „vor- und rückwärts“ Heinichens dar. Wir betreten das Labyrinth rückwärts und verlassen es mit Heinichens Ambitus wieder vorwärts. Die simplen Motive konnten also in ihrer Verschlüsselung sehr anschaulich diese komplexe Bedeutung transportieren.
Doch Bach wäre nicht Bach, wenn er es dabei belassen würde, denn das über vier Takte reichende Labyrinth des gis-Phrygisch steht auch für den Irrgarten des irdischen Lebens (vier steht für 40 und damit für die biblischen 40 Tage/ Jahre etc. der Suche) und Heinichens Zirkel für die natürliche und deshalb göttliche Ordnung der Tonarten. Dieses Gegeneinander von Mensch und Gott verlangt nach einer Auflösung. Nur, wie sieht eine Synthese von vorwärts und rückwärts aus? Ein Stillstand wäre sicher eine falsche Synthese, aber welche Bewegungsform ist die Lösung? Und wo in der E-Dur Fuge hat Bach diese Synthese dargestellt?
An dieser Stelle zeigt sich, dass theologische oder biographische Deutungen der Werke Bachs durchaus hilfreich sein können, um motivische Arbeit zu erkennen und zu lokalisieren. Denn in einer weiteren Deutungsebene stellt die Fuge das Trinitatis Schema dar mit Vater, Sohn und Heiligem Geist. Gottes Sohn wiederum ist wiedergegeben in den Dimensionen „incarnatus“, „crucifixus“ und „resurrexit“. Das Erscheinen des Quintenzirkels nach Heinichen in der Welt der alten Modi wird dabei in Takt 29 schlüssig von Bach als „incarnatus“ gedeutet. Dann wird ab Takt 32 diese natürliche, gottgegebene Harmoniefolge torpediert mit cis-Phrygisch. Bach installiert an dieser Stelle erneut sein Gegenmodell mit einem phrygischen Halbschluss von h-Moll (Penultima) zu Cis-Dur (Ultima in Dur) in Takt 32, um dann mittels der Syntax gleichnamiger Tonarten von Cis-Dur (am Ende von Takt 32 als Septakkord gesetzt) zu fis-Moll Anfang Takt 33 zu gelangen. Beides – Verwendung von Phrygisch und Abschluss von Cis-Dur zu fis-Moll – ist in Heinichens Ambitus Begriff wie dargelegt nicht enthalten bzw. läuft seiner Vorstellung von den Verwandtschaftsverhältnissen der Tonarten zuwider. Die nachfolgenden Dissonanzen in Takt 33 wiederum stehen für das „crucifixus“, dem in den Takten 35 und 36 das strahlende „resurrexit“ in Gestalt einer vollständigen, aufsteigenden E-Dur Tonleiter folgt. (Man vergleiche dies mit den Takten 17 bis 20 des „Et resurrexit“ der h-Moll Messe – „tertia die, resurrexit tertia die“ – um die Herkunft dieser Motiv-Kette nachzuvollziehen.)
Wo also sollte man suchen, um die Synthese des Gegeneinanders von vorwärts und rückwärts zu finden? Nun, das in der Deutungsebene vorhandene Gegeneinander von Gott und Mensch wurde durch Gott selbst aufgelöst, indem er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Um zur Lösung der Fragestellung und zur Auflösung der Widersprüche zu gelangen muss man also das „incarnatus“ näher betrachten. Der hierfür maßgebliche Takt 29 beginnt mit folgender Sequenz:
Bach löst folglich das Gegeneinander, das Vor und Zurück der Motive durch eine Spiegelung und damit auf eine ebenso überzeugende wie einfache Weise auf. Diese Spieglung mag Bach zwar einfach nur von Johann Jakob Froberger übernommen haben, der dasselbe Thema in seinem Ricercar No. 4 in gespiegelter Form beantwortet (auch das Kontrasubjekt der E-Dur Fuge könnte Bach aus Frobergers Themenfortführung entlehnt haben), aber Bach setzt die Spiegelung bewusst an eben jene Stelle, die für das „incarnatus“ steht. Er schafft damit gleichzeitig eine Einheit von Deutungsebene, harmonischem Konzept und motivischer Gestaltung. Trotz einfachster Motive gelingt ihm eine deutlich komplexere, assoziative Struktur innerhalb dieser Fuge.