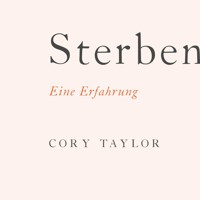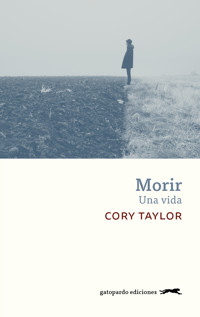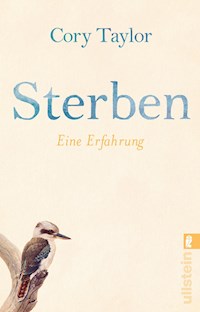11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Nachhinein konnte Martha nicht sagen, wann sie Mr. Booker das erste Mal küsste Vernünftig wäre es gewesen, den verheirateten Mann nicht zu begehren. Doch Martha ist sechzehn und lebt in einer Kleinstadt, die in ihren Augen ein Friedhof mit Beleuchtung ist. Sie wartet darauf, dass der Rest ihres Lebens endlich beginnt. Mr. Booker erhellt ihre Welt mit Stil, Abenteuer, Whiskey, Zigaretten und Sex. Die Wucht ihres Verlangens zerstört und ermächtigt sie. Nur hat Martha die Konsequenzen nicht bedacht. "Mr. Booker und ich" erzählt von dem Gefühl, erwachsen zu sein, wenn man jung ist, und sich jung zu geben, wenn man es nicht mehr ist. "Eine beinahe zärtliche Geschichte von Liebe, Sex, Macht und dem Erwachsenwerden." Australian Bookseller "Der Roman erinnert uns daran, dass Jugendliche so schnell erwachsen werden, weil sie von Erwachsenen umgeben sind, die sich wie Kinder benehmen." Sydney Morning Herald
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mr. Booker und ich
Die Autorin
Cory Taylor (1955 – 2016) gehört zu den renommiertesten Schriftstellerinnen Australiens. Sie war Drehbuchautorin und hat neben ihren zwei Romanen ein Memoir über ihre Krebserkrankung und ihr Sterben veröffentlicht. Alle ihre Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet. Ihr Debut Mr. Booker und ich erhielt den Commonwealth Writers Prize.
Das Buch
Martha ist sechzehn, lebt in einer Kleinstadt im australischen Nirgendwo und wartet darauf, dass ihr Leben endlich beginnt. Das neu hinzugezogene englische Ehepaar Booker, leicht exzentrisch, oft angetrunken, dabei kultiviert und von lässiger Weltläufi gkeit, ist für sie das Versprechen auf eine aufregende Zukunft. Vernünftig wäre es gewesen, Mr. Booker nicht zu begehren. Doch nach dem ersten Kuss treibt Martha ihr Verlangen souverän voran. Jenseits aller Klischees liebt sie den älteren Mann, der ihr ermöglicht, der Enge ihrer Welt auf geistreiche Weise zu entkommen. Mr. Booker und ich erzählt von dem Gefühl, erwachsen zu sein, wenn man jung ist, und sich jung zu geben, wenn man es nicht mehr ist.
Cory Taylor
Mr. Booker und ich
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Roth
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Me and Mr. Booker« bei Text Publishing, Melbourne.
Zitiert wurde aus: S. 90 (MS): T. S. Eliot, Sweeney Agonistes, dt. von Erich Fried, Die Dramen, Suhrkamp 1974; S. 92: Samuel Beckett, Warten auf Godot, dt. von Elmar Tophoven, Suhrkamp 1971; S. 96: Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln, dt. von Christian Enzensberger, Insel 1974; S. 187: T. S. Eliot, Vier Quartette, dt. von Norbert Hummel, Suhrkamp 2015; S. 195: Philip Larkin, This Bethe Verse, aus High Windows, 1974, dt. von Sabine Roth.
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN 978-3-8437-2075-5
© 2010 by Cory Taylor© der deutschsprachigen Ausgabe2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagabbildung: © Duncan HannahAutorenfoto: © Text PublishingE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Die Seele der Party
Wahllose Küsse
Die Teezeremonie
Bambi fällt ins Kaninchenloch
Familienglück
Im Wald sind keine Räuber
Selbstmord ist ungesund
Es geht nicht vor und nicht zurück
Aufbruchsträume
Ach Gott, wie weh tut scheiden
Wolkenbruch
Die Liebe wächst mit der Entfernung
Stets sprießt die Hoffnung in des Menschen Brust
Andere Umstände
Dicke Freunde
These foolish things
Sur la plage
Maikäfer, flieg!
Wenn dir das Pflaster zu heiß wird
Trautes Heim
Das Lied der Straße
Hochzeitsglocken
Briefe, die von Herzen kommen
Abgedreht
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Die Seele der Party
Für Ev
»Erst lieben wir den Ort, den wir hassen,dann hassen wir den Ort, den wir lieben.«
Terence Davies
Wahllose Küsse
In diesem Sommer unternahm ich viel mit den Bookers, weil es sonst nichts zu tun gab und ich keine Lust mehr hatte, zu Alice zu gehen. Alice war meine Freundin aus der Schule. Sie wohnte im Haus gegenüber, und früher war ich ständig bei ihr gewesen, um von daheim wegzukommen.
Das war, solange mein Vater noch da war. Nach seinem Auszug sagten Alice’ Eltern mir, ich würde Alice zu sehr mit Beschlag belegen. Ich merkte ihnen an, dass sie sich fragten, wie meine Mutter zurechtkommen wollte, jetzt wo sie keinen Mann mehr hatte. Als ich ihnen sagte, dass meine Mutter heilfroh sei, keinen Mann mehr zu haben, sahen sie mich merkwürdig an, als ob ich eine unpassende Bemerkung gemacht hätte. Ab da ging ich nicht mehr zu ihnen, und ein paar Monate später schickten sie Alice in ein Internat auf dem Land.
Als sie in den Sommerferien zurückkam, hatten wir uns nichts mehr zu sagen. Teils, weil Alice inzwischen mit dem Exfreund ihrer Schwester ging, der so viel kiffte, dass er bei allen nur The Space Captain hieß, teils auch, weil sie mich dafür bemitleidete, dass meine Eltern getrennt waren und ich keinen Freund hatte. Ich hätte ihr gern gesagt, dass ich auf ihr Mitleid verzichten konnte, aber Alice hatte eine gehässige Ader, und ich war nicht scharf darauf, sie hervorzukitzeln.
Die Bookers gaben sich nicht aus Mitleid mit mir ab. Sie sehnten sich selbst nach Abwechslung. Und alle ihre sonstigen Bekannten hatten Kinder. Vielleicht dachten sie anfangs, sie täten ein gutes Werk, aber dann wurde etwas anderes daraus. Was genau, kann ich nicht sagen, aber wir spürten es alle fast augenblicklich.
In der Regel rief Mrs. Booker meine Mutter an und fragte sie, ob sie mich zum Mittagessen entführen dürften, und das durften sie natürlich. Meine Mutter mochte die Bookers. Ihr gefielen ihre Umgangsformen. Sie kamen mich nie abholen, ohne dass Mr. Booker ihr Blumen oder Pralinen mitbrachte und ihr die Hand küsste.
»Die Bookers haben Stil«, sagte sie.
Die Bookers schauten hochzufrieden, als sie das hörten.
»Wir wuchern mit unserem Pfund, so gut wir können«, sagte Mr. Booker.
Das stimmte. Sie legten sich enorm ins Zeug. Sie zogen sich noch für einen Pub-Besuch schick an, wodurch selbst ein Mittagessen ein besonderer Anlass schien.
Manchmal war es das auch. Einmal hatten sie Hochzeitstag, ihren elften. Sie hatten sich im Zug kennengelernt, als sie beide in Manchester studierten.
»Das Erste, was mir an ihr aufgefallen ist, waren ihre Beine«, sagte Mr. Booker.
»Werd nicht frech!«, sagte Mrs. Booker.
Sie sei vor ihm in den Zug gestiegen, sagte er, in einem Rock, den sie bis unter die Achseln hochgezogen hatte, und so lange Beine wie bei ihr habe er noch bei keiner Frau gesehen. »Es war Wollust auf den ersten Blick.«
»Drei Monate später haben wir geheiratet«, ergänzte Mrs. Booker. »Auf dem Standesamt.«
»Völlig schwanzgesteuert«, sagte Mr. Booker.
Mrs. Booker schlug ihn auf den Arm und befahl ihm, nicht so unflätig daherzureden.
»Ich nenne das Kind nur beim Namen«, sagte er. Dann bestellte er beim Ober die dritte Flasche Wein.
Eine Weile schwiegen wir alle, dann erzählte mir Mrs. Booker, dass sie sich jetzt doch nach einem Haus zum Kaufen umsahen, weil sie einen Garten wollten und eine Katze. Warum sie eigentlich keine Kinder hätten, fragte ich sie. Sie machten bedrückte Gesichter.
»Die lassen auf sich warten, leider«, sagte Mrs. Booker.
»Bis dahin adoptieren wir einfach dich«, verkündete Mr. Booker.
Es war etwas Bedrohliches an der Art, wie er mich dabei ansah. Es lag so viel Gewaltsamkeit und Trauer in seinem Blick, als wollte er jeden Moment den Tisch hochheben und durchs Fenster schleudern. Aber er wandte sich nur ab und starrte hinaus auf den See. Das Restaurant lag im obersten Stock eines Hotels mit Aussicht auf das silbrige Wasser und die Berge dahinter. Wir saßen schon über zwei Stunden hier oben.
»Wann soll ich einziehen?«, fragte ich.
Mrs. Booker lächelte mich mit feuchten Augen an.
»Deine Mutter könnte doch gar nicht ohne dich sein«, sagte sie.
Das Gefühl hatte ich bei meiner Mutter auch. Sie war eine starke Frau, aber nicht so stark, dass sie es daheim ausgehalten hätte, wenn nicht wenigstens einer von uns bei ihr lebte, und da Eddie weg war, blieb nur ich.
»Sie betet dich an«, sagte Mrs. Booker. »Du bist ihr ganzer Stolz.«
»Ewig kann ich sowieso nicht zu Hause wohnen bleiben«, sagte ich.
An diesem Punkt drehte sich Mr. Booker zu mir um und sagte, er sei bereit, meine Mutter mitzuadoptieren, wenn das die Sache leichter mache. Dann könnten wir alle eine große, glückliche Familie sein.
Der Ober kam und fragte, ob wir noch einen Wunsch hätten, und die Bookers sagten Nein und baten um die Rechnung und entschuldigten sich, dass wir die Letzten im Lokal waren.
»Ich hab mich nicht mehr so amüsiert, seit meine Oma ihre Titten in der Mangel eingeklemmt hatte«, erklärte Mr. Booker dem Ober.
»Freut mich zu hören«, sagte der Ober nur trocken, da er ja sah, wie betrunken die Bookers waren.
Mrs. Booker war so betrunken, dass sie Mr. Booker bitten musste, sie heim ins Bett zu fahren.
»Nichts lieber als das, mein Herzblatt«, sagte er und stützte sie, als wir in den Lift stiegen. Dort standen sie aneinandergelehnt wie zwei Spielkarten, den ganzen Weg bis hinunter zum Parkdeck.
Ihre Wohnung bestand nur aus zwei schachtelartigen Schlafzimmern, die von einem Flur abgingen, und einem Wohnzimmer mit niedriger Decke. Die Möbel gehörten nicht ihnen, sagten sie, und die meisten Sachen, die sie aus England mitgebracht hätten, steckten noch in ihren Kisten.
Ich setzte mich an den Esstisch und wartete, während Mr. Booker Mrs. Booker ins Bett half. Sie entschuldigte sich in einer Tour bei ihm. Ich hörte es durch die angelehnte Schlafzimmertür.
»Es tut mir so leid, Liebling. Ich bin zu nichts nütze. Ich bin völlig unbrauchbar.«
»Ach was, Dummerchen«, sagte er. »Leg dich hin und schlaf.«
»Gib mir einen Gutenachtkuss.«
Ich hörte ihn die Vorhänge zuziehen, und dann drang einen Augenblick kein Laut mehr zu mir bis auf die Autos, die unten auf der Straße vorbeifuhren. Ich stellte mich auf den Balkon und sah ihnen zu. Als Mr. Booker zu mir herauskam, legte er mir den Arm um die Taille, womit ich nicht gerechnet hatte, und wir standen zusammen da und betrachteten die Aussicht. Viel war nicht zu sehen, nur die Straße und der Parkplatz gegenüber und hinter dem Parkplatz das Einkaufszentrum. Das hier war die Stadtmitte, aber genauso gut hätte es ein x-beliebiger Vorort sein können.
»Wenigstens haben Sie hier alles gleich vor der Tür«, sagte ich. »Nicht meilenweit weg wie bei uns draußen.«
Er wandte sich mir zu, und es war etwas Abwesendes in seinem Blick, als hätte er völlig den Faden verloren. Ich wusste, dass er mich küssen würde, weil sein Arm mich näher an ihn heranzog und er sich vorbeugte, sodass sein Mund dicht an meinem war.
»Darf ich?«, sagte er. »Das habe ich mir schon den ganzen Tag gewünscht.«
»Was?«, fragte ich. Ich wollte mich nicht dumm stellen, mir fiel bloß nichts anderes ein.
Es war nicht mein erster Kuss. Ich hatte schon zwei Jungen aus meiner Schule geküsst, David Simmons und Luc Carriere, einfach um herauszufinden, wie sich das anfühlte, aber ihre Küsse hatten nichts gemeinsam mit dem Kuss von Mr. Booker. Mr. Bookers Kuss konnte einem Angst machen. Es fühlte sich an, als versuchte er mich im Ganzen zu verschlingen. Als ich keine Luft mehr bekam, schob ich ihn weg.
»Meinen Sie, das ist eine gute Idee?«, fragte ich. Ich hatte richtig weiche Knie von dem Sauerstoffmangel.
»Hast du eine bessere?«, fragte er zurück.
Auf der Fahrt wieder zu mir nach Hause drehte er das Radio laut, und wir ließen Dionne Warwick zu den Fenstern herausdröhnen. Er sagte, Motown hätte er schon gekannt, als er noch so grün hinter den Ohren war wie ich jetzt. Als wir vor unserem Haus anhielten, stellte er den Motor ab. Ich wartete, während er eine Zigarette anzündete, und nahm sie ihm dann aus der Hand, sodass er sich eine neue anzünden musste.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich. Ich war das Rauchen nicht gewohnt. Weder dieses schlagartige Flauheitsgefühl unterm Brustbein noch die Art, wie mir davon die Hände zitterten.
»So tun, als wäre nichts gewesen«, sagte er. Er lächelte. Ich konnte ihm ansehen, dass er noch vom Mittagessen her betrunken war. Deshalb war er auch so übervorsichtig gefahren. Er musste bei allem, was er tat, überlegen. Selbst die brennende Zigarette musste er erst einmal betrachten und überlegen, wozu sie gut war. Dann fiel es ihm wieder ein, und er machte ein kleines Glucksgeräusch hinten in der Kehle.
»Meinst du, das schaffst du?«, fragte er.
»Ich kann’s versuchen«, sagte ich.
»Braves Mädchen«, sagte er. »Chapeau!«
Ich lachte.
»Was ist so lustig?«
»Nichts«, sagte ich. »Ich bin eben leicht zum Lachen zu bringen.«
»Das ist nicht zu übersehen.« Und er nahm meine Hand und verschränkte seine Finger mit meinen. Dann sagte er, ich solle hineingehen, bevor er sich zu einer Dummheit hinreißen ließ. Aber ich mochte mich nicht wegrühren, weil er ja meine Hand hielt und keine Anstalten machte, sie freizugeben.
Also saß ich neben ihm im Auto, rauchte meine Zigarette und sagte ihm, dass er besser nicht rumlaufen und wahllos Küsse verteilen sollte, denn damit würde er sich nur Ärger einhandeln.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Die Seele der Party
Zu der ganzen Geschichte kam es nur deshalb, weil ich bereit dafür war. Vielleicht nicht konkret dafür, aber für etwas in der Art. Es liegt jetzt eine Weile zurück, aber meine Devise war damals, dass ein Mädchen schlicht eine Frau ohne Erfahrung ist. Ich weiß, was Mr. Booker zum Thema Erfahrung sagen würde. Er würde sagen, wenn bei den Schiffschaukeln nichts läuft, brummt’s bei den Karussells umso mehr.
Da war zunächst die Altersfrage. Ich war sechzehn, als ich Mr. Booker kennenlernte, was je nach Person jung oder alt sein kann. In meinem Fall war es alt. Ich fühlte mich schon alt, seit ich zehn war, also grob geschätzt seit der Zeit, als meine Eltern zu dem Schluss gekommen waren, dass sie ihr Leben in den Sand gesetzt hatten. Das wusste ich, weil sie es jedem erzählten, der es hören wollte, mich eingeschlossen. Ihre Enttäuschung gehört zu den Dingen, die sie mir beide gemeinsam vererbt haben, wie auch ihr welliges Haar und die Tischmanieren. Im Speziellen, so glaube ich, verdanke ich es Victor, dass ich meine Erwartungen so früh herunterzuschrauben lernte.
Auf den ersten Blick wirkte mein Vater noch ganz annehmbar, zwar aufgeblasen und verbohrt, aber das sind viele Männer und kommen damit durch. Es gibt Schlimmeres als Verbohrtheit und Aufgeblasenheit. Sogar ich fand ihn halbwegs annehmbar, bis ich alt genug wurde, um ihn zu durchschauen. Ab da sah ich Victor als das, was er war: pures Gift. Wenn man das einmal kapiert hatte, hielt man sich nach Möglichkeit fern von ihm. Einen tollwütigen Hund streichelt man schließlich auch nicht, wenn man nicht lebensmüde ist.
Dann war da die Frage meines Aussehens. Die Leute reagierten auf mich, das stellte ich schon seit einiger Zeit fest. Ich war nicht hübsch, dazu war ich zu melancholisch und blass, an meinem Gesicht konnte es also nicht liegen. Aber etwas an mir brachte die Leute – und mit Leuten meine ich eigentlich die Männer, die mit den Freundinnen meiner Mutter verheiratet waren – dazu, mir nachzuschauen. Das hatte mit meinem Bereitsein zu tun, meinem Warten. Ich wusste es schon, ehe sie es wussten, und deshalb mochten sie mich und küssten mich zur Begrüßung auf die Wange. Diejenigen, die Kinder hatten, fanden es auch gut, wenn ich bei ihnen babysittete, weil sie mich dann anschließend heimfahren konnten. Mich störte das nicht. Es waren nette Männer. Sie redeten mit mir wie mit einer Freundin, und keiner wurde zudringlich, bis auf den Gitarrenlehrer, der Italiener war, also hörte ich auf, seine Kinder zu hüten, und hängte die Gitarrenstunden an den Nagel.
Meine Schulnoten waren so lala. Es gab nur ein Fach, das mir wirklich Spaß machte, und das war Französisch. Für Jessica, meine Mutter, stand bereits fest, dass ich nach der Schule studieren und Lehrerin werden würde wie sie, aber das hatte ich nicht vor. Der einzige Grund, warum ich Französisch mochte, war, dass wir Mr. Jolly als Lehrer hatten und es mir vollkommen gereicht hätte, bis an mein Lebensende nur Mr. Jolly anzustarren und ihm zuzuhören, wie er französische Vokabeln vorlas. Aber das sagte ich meiner Mutter nicht. Ich sagte ihr, dass ich warten und erst einmal meine Optionen ausloten wollte, bevor ich eine Entscheidung über meine Zukunft traf.
»Du kannst alles schaffen, was du nur willst«, sagte meine Mutter. »Vorausgesetzt, du klemmst dich richtig dahinter.«
Was eine reichlich seltsame Aussage aus ihrem Mund war, denn sie hatte es als Einziges geschafft, ihre besten Jahre an einen hoffnungslosen Fall wie Victor zu verschwenden. Nicht dass ich ihr das hätte sagen müssen – sie wusste es selbst am besten. Das war das Problem bei meiner Mutter. Sie redete sich ein, sie könnte mich davor bewahren, die gleichen Fehler wie sie zu machen, aber im Grunde ihres Herzens glaubte sie an Vorbestimmung, an Schicksal.
Deshalb würgte ich sie auch meistens sehr schnell ab, wenn sie davon anfing, wie viel Potenzial ich doch hätte, denn das klang immer so, als würde ich absichtlich hinter meinen Möglichkeiten zurückbleiben, und das stimmte nicht. Wie schon gesagt, ich wartete; ich war bereit.
Ich träumte außerdem davon, von daheim wegzugehen, aber das sagte ich ihr erst recht nicht, weil es sie nur noch trauriger gemacht hätte. Meine Mutter war an einem ziemlichen Tiefpunkt, und sie wollte nicht allein sein. Das wusste ich, auch ohne dass sie es aussprach. Ich merkte es an der Art, wie sie manchmal schaute, als wäre sie ihr Leben lang nur von allen verlassen worden und ich würde die Nächste sein.
»Was täte ich bloß ohne dich?«, fragte sie.
Ich sagte ihr, dass diese Frage rein hypothetisch und darum sinnlos war. Aber sie stellte sie trotzdem immer wieder.
Ich glaube, das, was passierte, hatte auch eine Menge mit der Stadt zu tun, in der wir damals wohnten, die nichts Großstädtisches an sich hatte, aber auch nichts Ländliches. Es war eine Art Niemandsland, ein Ort viele Meilen entfernt von allem, was zählte, von allem mit irgendeiner Art Eigengeruch. Und alle dort waren wie ich, alle wollten nur weg und etwas erleben, völlig egal was, selbst wenn das Scheitern quasi schon vorprogrammiert war.
Nur darum saß ich ja Ende dieses ersten Sommers statt in der Schule, wo ich hingehörte, im Five Ways Hotel in Sydney und wartete auf Mr. Booker.
Mr. Booker hatte mir versprochen, sich von seiner Frau zu trennen und zu mir nach Sydney zu kommen. Und so, wie er es sagte, glaubte ich ihm. Es war ein fiebrig-heißer Februarabend, und er saß mit mir auf der dunklen Terrasse, die Hand an meinem nackten Arm.
»Lass uns einfach weglaufen«, sagte er. »Irgendwohin, wo uns keiner findet.« Und dann lachte er, nicht weil er es nicht ernst meinte, sondern weil er betrunken war. Das war ich auch. Ich nahm noch einen Schluck von seinem Whisky und spürte ein stechendes Gefühl hinter den Augen. Der Garten meiner Mutter verschwamm immer mehr.
Das ist auch so etwas, das ich erwähnen muss, nämlich dass alle, die wir in dieser Stadt kannten, zu viel tranken. Es war, als könnte keiner den Tag ohne Alkohol durchstehen.
Ich hatte die Bookers Anfang des Sommers kennengelernt, im November. Ich war frisch mit den Prüfungen fertig, und vor mir lag ein letztes, wenig verheißungsvolles Schuljahr. Sie kamen zu einer Party bei meiner Mutter. Mein Vater war da schon ausgezogen. Er wohnte in einer Art Motel am anderen Ende der Stadt. Wenn ich ihn besuchte, zeigte er mir regelmäßig sein Gewehr. Es lag in eine Decke gewickelt ganz hinten in seinem Kleiderschrank. Zum Karnickel-Schießen, sagte er, aber für mich klang das etwas arg schwammig. Ihm gefiel es ganz einfach, das Ding zu haben. Es bewies, dass er noch ein paar Überraschungen für die Menschheit bereithielt. Meine Mutter war überzeugt, dass er es irgendwann gegen sie richten würde.
»Verrückt genug ist er«, sagte sie.
Wobei er ihr noch nie ernstlich etwas getan hatte, außer das eine Mal, als ihr Arm gebrochen war und mein Bruder Eddie sie ins Krankenhaus fahren und dort zwei Stunden warten musste, während sie geröntgt wurde. Es sei ein Unfall gewesen, hatte sie behauptet, und mein Bruder hatte es ihr geglaubt. Sie sei ausgerutscht und mit dem Arm gegen die Schreibtischkante geschlagen, sagte sie.
Eddie ging danach nach Neuguinea. Soweit ich weiß, arbeitete er auf einer Bohrinsel. Meine Mutter schrieb ihm jede Woche, aber er schrieb nie zurück.
Ich habe mich oft gefragt, was meine Mutter in Victor gesehen haben mag, zu Anfang, bevor Eddie und ich kamen. Gut, damals war er um einiges dünner. Sie hatte ein Foto von ihm aus der Zeit kurz nach ihrer Hochzeit, auf dem er in Anzug und Krawatte an einer Straßenecke stand und mit einem schlauen Lächeln in die Kamera blickte. Er sah gut aus auf dem Bild, auf so eine schmale, hohlwangige Art. Ich nahm das Foto immer wieder aus dem Album und studierte es. Schwer zu glauben, dass Victor und der Mann von der Fotografie ein und derselbe Mensch sein sollten. Welcher war der echte: der dünne Mann oder der aufgeschwemmte – der lächelnde Jüngling oder der mittelalte Choleriker? Meine Mutter muss das gleiche Problem gehabt haben. Sie hatte sich in den einen verliebt, nur um dann festzustellen, dass er in Wahrheit ein völlig anderer war.
»Er war ganz in Ordnung, bis Eddie kam«, meinte sie einmal zu mir. »Danach bekam er es mit der Panik.«
Meine Mutter brauchte ihre Partys fast so sehr wie die Luft zum Atmen. Sie halfen ihr, die Wochenenden zu überstehen, denn andernfalls dehnte sich die Zeit jeden Freitagabend vor ihr aus wie eine staubige Straße, die nie jemand entlangkommt. Meine Mutter war ein Mädchen vom Land, aus einer Gegend ohne Bäume und ohne Nachbarn, und hatte ihre Jugend hindurch nach Gesellschaft gelechzt wie ein Verdurstender nach einem Schluck Wasser.
Sie hatte außerdem starken Nachholbedarf, da mein Vater ihr jahrelang den Kontakt zu Leuten vermiest hatte, die er nicht mochte. Victor hatte sie viele Freundschaften gekostet. Jetzt ließ sie die Woche über alle wissen, dass es am Samstag Abendessen oder am Sonntag Mittagessen bei uns geben würde, zu dem jeder mitbringen konnte, wen er wollte. Auf diese Weise kamen immer neue Leute zu uns, die wir vorher noch nie gesehen hatten, Leute wie die Bookers.
Die Bookers kamen, weil Mrs. Booker zusammen mit Mums Freundin Hilary beim Metzger um deutsche Würste angestanden hatte. Hilary war aus Schottland und konnte deshalb, sagte sie uns, ein Lied davon singen, wie sich das anfühlte, in einem Land neu Fuß fassen zu müssen, wo man keinen Menschen kannte. Ihr Problemsohn Philip ging in die gleiche Jahrgangsstufe wie ich.
»Ich habe sie mitgebracht, damit sie das hiesige Brauchtum kennenlernen«, erklärte sie meiner Mutter.
Meine Mutter forderte die Bookers auf, hereinzukommen und sich mit allen bekannt zu machen.
»Drink gefällig?«, fragte sie und führte sie in die Küche, wo ich die Flaschen samt Eiswürfeln und Gläsern auf der Arbeitsplatte aufgereiht hatte, damit jeder sich bedienen konnte.
»Eine Frau nach meinem Herzen«, sagte Mr. Booker, woraufhin sie strahlte, seinen Arm nahm und wissen wollte, wo er und Mrs. Booker sich bisher versteckt hatten.
»Wir waren uns nicht sicher, ob die Eingeborenen friedlich gesinnt sind«, sagte Mr. Booker.
»Nicht alle«, sagte meine Mutter. »Aber hier sind Sie unter Freunden.«
Als sie zurück ins Wohnzimmer kamen, sah ich Mr. Booker zum ersten Mal richtig. Er war ganz in Weiß gekleidet, mit einem roten Einstecktuch in der Brusttasche seines Jacketts. Er zog es heraus, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, und mir fielen seine Hände auf, die trotz ihrer Größe etwas Feingliedriges hatten, und seine Augen, die schokoladenbraun waren und verträumt wie bei einem kleinen Jungen.
»Martha, meine Tochter«, stellte meine Mutter mich vor.
»Enchanté«, sagte Mr. Booker und sah mich auf die Art an, die ich schon gewohnt war.
Mr. Booker kam aus England, seine Frau ebenso. Sie stammten aus derselben Kleinstadt irgendwo an der Grenze zu Wales. Sie sprachen beide gleich. Sie sahen sogar gleich aus. Das gleiche schwarze, gelockte Haar, der gleiche leuchtende Teint, die gleiche Art, zu gehen und Zigaretten zu rauchen, als hätten sie sich von klein auf gegenseitig beobachtet und ihre Gesten aufeinander abgestimmt. Nichts an ihnen war unbeholfen. Besonders Mrs. Booker bewegte sich auf eine zurückgenommene, katzenhafte Art, die gleichsam eine Aufforderung zum Hinsehen war. Sie verbarg ihre Augen hinter getönten Brillengläsern, weil es ihr vollkommener Körper war, den man bewundern sollte. Sie hätten Bruder und Schwester sein können. Mr. Booker erklärte meiner Mutter, sie hätten England verlassen, um das Abenteuer zu suchen.
»England ist am Ende«, sagte er.
»Da ordnen sie nur noch die Liegestühle um«, sagte sie.
Sie übertönten einander, als versuchten sie um die Wette einen guten Eindruck zu machen.
»Na«, sagte Lorraine, eine andere Freundin meiner Mutter, auf ihre unverblümte amerikanische Art, »wenn ihr auf Abenteuer aus seid, dann seid ihr hier am richtigen Ort.« Alle lachten, weil unser Nest so verschlafen war. Ein Friedhof mit Beleuchtung, nannte Lorraine es immer.
Danach saß ich nur noch da und sah sie beide an. Es war, als wäre die Sonne hinter den Wolken hervorgekommen und brächte alles zum Glänzen. Eine solche Ausstrahlung hatten sie. Jetzt, wo ich sie kannte, tat es mir um all die Zeit leid, die ich sie noch nicht gekannt hatte.
Und Mr. Booker beobachtete mich; selbst wenn er scheinbar Mrs. Booker oder irgendjemand anders im Zimmer ansah, beobachtete er mich, und sooft ich etwas sagte, wandte er den Blick in meine Richtung und tat ganz erstaunt, dass ich noch da war. Und bei jeder Gelegenheit nahm er meinen Namen in den Mund.
»Ja, Martha? Ich bin ganz Ohr, Martha. Du hast meine volle Aufmerksamkeit, Martha.«
»Wollen Sie mich hochnehmen?«, fragte ich.
»Wie könnte ich, Martha«, sagte er. »Wofür hältst du mich?«
Später fuhr ich mit ihnen zum Laden, Bier- und Zigaretten-Nachschub holen. Sie hatten einen goldenen Datsun, zweisitzig mit Lederausstattung und einer Bank unterhalb der Heckscheibe, auf der ich quer saß, die Beine ausgestreckt, und ihren Geruch einatmete. Ich erzählte ihnen von meinen Eltern.
»Sie haben sich getrennt«, sagte ich. »Dadurch habe ich einen Knacks fürs Leben. Zumindest ist das meine Entschuldigung.«
»Wofür?«, fragte Mrs. Booker.
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Bis jetzt ist es noch nicht passiert.«
Das fanden sie lustig. Sie warfen einander einen Blick zu und lächelten, und Mr. Booker sagte, er sei schon sehr gespannt, was es sein würde.
»Ich auch«, sagte ich.
Beim Laden wartete ich mit Mrs. Booker im Wagen, während Mr. Booker hineinging, um das Bier zu kaufen. Ich sagte ihr, dass ihr Parfüm sehr gut roch. Sie langte in ihre Handtasche, holte ein winziges Fläschchen heraus und schraubte es auf. Dann griff sie nach hinten und drehte mein Handgelenk mit der Innenseite nach oben, um mir einen Spritzer von dem Parfüm aufzutupfen, und sofort duftete das ganze Auto. Eigentlich eine Kleinigkeit, aber damals erfüllte es mich mit einem seltsamen Hochgefühl, als hätte Mrs. Booker bereits Pläne mit mir, deren nähere Natur sie selbst noch nicht kannte – als wären wir drei irgendwie füreinander bestimmt.
»Es ist französisch«, sagte sie, eine Fingerspitze an ihrer vergoldeten Brille. Die Gläser bedeckten ihr halbes Gesicht und färbten sich im Sonnenschein dunkler, was ihr etwas von einer Blinden gab.
»Was auch sonst«, sagte ich.
Als Mr. Booker zurückkam, stellte er das Bier in den Kofferraum und warf die Zigaretten zum Fenster herein. Mrs. Booker zündete sofort zwei an und gab eine Mr. Booker, und ein Weilchen saßen sie nur da und sogen Schwaden von Rauch in sich hinein, um ihn dann in Spiralen und Kringeln aus ihren Mündern strömen zu lassen wie Haarlocken. Mr. Booker beobachtete mich im Rückspiegel, schweigend, aber mit einem wohlwollenden Lächeln. Ich konnte sein Alter und auch das von Mrs. Booker schwer schätzen. Sie sahen jung aus, aber durch ihre förmliche Kleidung – er in seinem weißen Leinenanzug, sie in Seidenstrümpfen trotz der Sommerhitze – schienen sie einer vergangenen Zeit anzugehören, und das ließ sie alt wirken, so wie Schwarz-Weiß-Filme alt wirken, selbst wenn sie es nicht sind.
Mr. Booker sagte, er wolle nicht direkt zur Party zurück, weil dies eine gute Gelegenheit sei, sich von mir ein bisschen durch die Stadt lotsen und die Sehenswürdigkeiten zeigen zu lassen.
»Das wird nicht lang dauern«, sagte ich.
»Darf ich die Damen zu einer kleinen Spritztour einladen«, sagte er mit Schauspielerstimme. Ich wiederholte den Satz exakt in seinem Tonfall, nicht um ihn nachzuäffen, sondern weil das Englische aus seinem Mund so schön exotisch klang.
»Wohin?«, fragte Mrs. Booker.
Er antwortete nicht. Er reichte mir seine Zigarette nach hinten. Ich zog einmal daran und gab sie zurück.
»Oje«, sagte ich. »Jetzt habe ich sie ganz voller Spucke gemacht.«
»Sprach die Schauspielerin zum Bischof«, sagte er.
Das verstand ich nicht, tat aber so, als ob.
»Nicht anzüglich werden«, warnte Mrs. Booker und wollte ihrem Mann einen Klaps aufs Bein geben. Da musste ich lachen, weil er ihren Arm abfing und ihn einen Moment in der Luft festhielt.
»Fass mich nicht an, Weib«, sagte er. »Du weißt nicht, wo ich mich rumgetrieben habe.«
Eine Stunde lang kurvten wir durch den Ort. Sie fuhren mit mir an der Universität vorbei, wo Mr. Booker Filmgeschichte unterrichtete, und an der Schule, in der Mrs. Booker Lehrerin für die zweite Klasse war. Sie zeigten mir, wo sie wohnten, im vierten Stock eines Gebäudes, das wie ein Parkhaus aussah.
»Château Booker«, sagten sie und übertönten sich dabei wieder gegenseitig.
Ich zeigte ihnen das Motel, in dem mein Vater wohnte.
»Aber er fühlt sich anscheinend ganz wohl da«, sagte ich. »Mit Häusern hatte er’s noch nie. Deshalb sind wir auch so oft umgezogen.«
Ich zählte sämtliche Wohnorte auf, an die ich mich noch erinnerte.
»Was hat er gegen Häuser?«, fragte Mr. Booker.
»Fragen Sie mich nicht«, sagte ich und erzählte ihnen von dem zusammengerollten Bettzeug, das er immer im Kofferraum liegen hatte, um jederzeit losfahren und im Busch schlafen zu können, wenn ihm danach war.
Ich zeigte ihnen den Wagen meines Vaters, der an seinem üblichen Platz geparkt war, einen pflaumenblauen Jaguar. Er hatte ihn gebraucht gekauft, von dem Geld, das ihm meine Mutter gegeben hatte, wenn er ihr dafür versprach, sie nie wieder anzubetteln.
»Er gibt gern Gas«, sagte ich.
»Hört, hört«, sagte Mr. Booker. »Ein Hoch auf die freie Fahrt.«
Zurück zur Party fuhren wir durch die Kiefernpflanzungen, die bis an unseren Vorort heranreichten. In der Nachmittagshitze verströmten die Bäume einen wachsigen Geruch, als würden sie schmelzen. Als wir über die Hügelkuppe kamen, schimmerten die Häuser ringsum wie Spiegelungen in einer Scheibe. Ich wollte wissen, ob es das in England auch gab, und sie sagten, nein, schon weil es in England nie so heiß wurde, jedenfalls nicht, seit sie denken konnten.
»Irgendwann möchte ich auch mal nach England«, sagte ich.
»Wozu das denn?«, fragte Mr. Booker.
»Um nach meinen Wurzeln zu suchen«, sagte ich.
»Wie bitte?«, sagte er mit einem Blick zu mir nach hinten, um zu sehen, ob das mein Ernst war.
Es stimmte nicht. Ich hatte keinen speziellen Grund, außer dass ich Bilder von England im Fernsehen gesehen hatte. Ich wollte einfach nur weg hier, wohin, war egal.
»England oder Amerika«, sagte ich. »Mir ist beides recht. Oder Paris.«
»Du musst dich schon entscheiden«, sagte Mr. Booker.
Ich sagte, dass er mich nicht drängen dürfe, und er wartete erst einen Moment, bevor er im Rückspiegel zu mir hinsah.
»Nicht im Traum«, sagte er.
Sie blieben noch zwei Stunden auf der Party, trinkend und tanzend. Ich hatte noch nie jemanden so gut tanzen sehen wie Mrs. Booker. Das lag an ihren Ballettstunden früher, erklärte sie mir, sie sei schon mit vier ins Ballett geschickt worden. Und dann, als alle anderen Freunde meiner Mutter aufgebrochen waren, meinten sie, langsam würde es für sie auch Zeit. Meine Mutter dankte ihnen für den Besuch und sagte ihnen, wie schön sie es mit ihnen gefunden habe.
»Kommen Sie bald wieder«, sagte sie. »Wann immer Sie Lust haben.« Nachdem sie den ganzen heißen Nachmittag durch Sekt getrunken hatte, sah sie aus, als müsste sie schleunigst ins Bett. Sie hatte zum Tanzen die Schuhe ausgezogen, und ihre Haare waren aus dem Paisleytuch gerutscht, mit dem sie sie aus dem Gesicht hielt.
»Danke«, sagte Mr. Booker.
»Es war ein ganz wunderbarer Tag«, sagte Mrs. Booker.
»Wir haben vor, Ihre Tochter zu rauben«, sagte Mr. Booker. »Wenn Sie nichts einzuwenden haben.«
Meine Mutter lachte und legte mir den Arm um die Schultern, wie um mich zu beschützen, überlegte es sich dann aber anders und gab mich frei. Sofort beugte sich Mr. Booker vor, um mich auf die Backe zu küssen. »Du bist gewarnt«, flüsterte er mir so laut ins Ohr, dass alle es hören konnten.
Und dann gingen wir vier Arm in Arm die Einfahrt entlang bis zu ihrem Auto. Meine Mutter und ich winkten ihnen nach, als sie auf die Straße hinausbogen und wegfuhren.
»Was für reizende Leute«, sagte meine Mutter, nachdem sie um die Kurve verschwunden waren. Sie war glücklich, dass ihre Party so gut gelaufen war und so viele gekommen waren. Aus ihrer Sicht konnte man gar nicht genug Freunde haben. Je mehr, desto besser, fand sie.
Wie schon gesagt, mein Vater hatte die Freunde meiner Mutter nie leiden können. Für ihn waren es alles Blender. Und die Frauen hätten meine Mutter gegen ihn aufgehetzt.
»Als ob da jemand nachhelfen müsste«, sagte meine Mutter.
Später sagte mir Mr. Booker, ich hätte mich durch den Hut verraten, den ich an diesem Tag getragen hatte. Ich sagte, der Hut sei der von meinem Vater, den er immer beim Rasenmähen aufgehabt hatte, noch so eine Aufgabe, die nach seinem Abgang an mir hängen geblieben war. Ich hätte ihn nur aufgesetzt, um meine Haare zu verdecken, weil sie so furchtbar lang und zottlig geworden waren. Er habe noch meinen grünen Rock vor Augen, sagte er, und das Jungshemd mit den Druckknöpfen und die roten Plastiksandalen an meinen Füßen.
»Du hast wie eine minderjährige Nutte ausgesehen«, behauptete Mr. Booker.
»Du bist der Charme in Person«, sagte ich und bog mich nach hinten, um ihm die Eier zu lecken, so wie er es mochte.