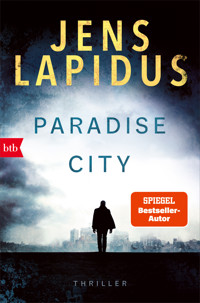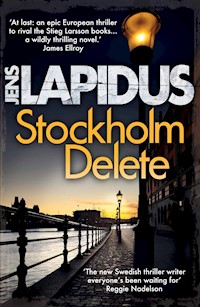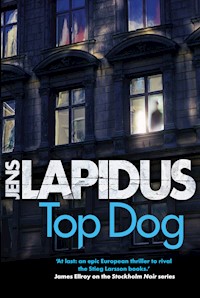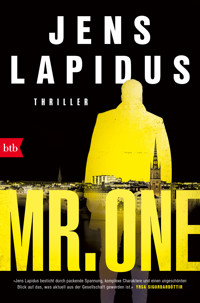
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Stockholm Reihe
- Sprache: Deutsch
In Stockholms Unterwelt tobt der Krieg - der schwedische Thrillermeister Jens Lapidus taucht tief ein in die düsteren Seiten einer Großstadt
Isak Nimrod will sich nach vielen Jahren als Boss der Unterwelt aus dem Gangsterleben zurückziehen und ein legales Leben führen. Sofort beginnt ein wilder Kampf um sein Erbe. Wer wird der neue Mr. One? Seinen Platz möchte Kerim Celali einnehmen, der anders als Isak, mit brutaler Gewalt regiert. Als Isaks Sohn Max verschwindet, setzt sich eine fürchterliche Spirale der Gewalt in Gang, in die auch der ehemalige Kleinganove Teddy hineingezogen wird, der als V-Mann ins Gangstermilieu eigeschleust wird. Der Krieg auf Stockholms Straßen hat längst die Vororte verlassen und hält Einzug in die schicken Viertel und Milieus der Stadt. Keiner ist mehr sicher, wenn es um die tödliche Frage geht, wer in dieser düsteren Welt die Oberhand behält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
Wer wird der neue Mr. One?
Wer wird ihm zur Seite stehen?
Und wer wird ihn aufhalten?
Isak Nimrod ist es leid, Mr. One zu sein. Er ist im Begriff, seinen Anteil zu verkaufen und den Weg der Legalität einzuschlagen. Der nächste Drahtzieher, Kerim, kann es kaum erwarten, seine Nachfolge anzutreten. Doch als Isaks Sohn auf mysteriöse Weise verschwindet, platzt der Deal, und Isak muss zurück auf die Straße.
Auch der ehemalige Kleinganove Teddy und Staatsanwältin Emelie haben die Nase voll – vor allem voneinander. Teddy schafft es einfach nicht, ehrlich zu sein, und sie will nicht, dass ihr Sohn mit einem Vater aufwächst, der nicht auf der richtigen Seite des Gesetzes steht. Nach und nach werden sie in den Machtkampf hineingezogen, der nach Isaks Abdankung entbrennt.
Zum Autor
JENSLAPIDUS, geboren 1974, hat eine der erstaunlichsten Karrieren Schwedens hinter sich. Er war nicht nur einer der angesehensten Strafverteidiger des Landes, sondern ist auch einer der erfolgreichsten Autoren. Durch seine anwaltliche Tätigkeit verfügt er über mannigfaltige Kontakte zu Schwerverbrechern und genuine Einblicke in die schwedische Unterwelt, die Normalsterblichen üblicherweise verwehrt bleiben. Die Authentizität, Schnelligkeit und Direktheit seiner Romane suchen ihresgleichen. Seine Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt, vielfach preisgekrönt und mehrfach verfilmt.
JENS LAPIDUS
MR. ONE
THRILLER
Aus dem Schwedischen von Max Stadler
Die schwedische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Mr Ett« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Dies ist eine Fiktion. Alle Verweise auf reale Begebenheiten, Institutionen, Orte oder Personen dienen lediglich dazu, ein fiktives Universum zu erschaffen.
Deutsche Erstausgabe August 2025
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 Mü[email protected]
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)Copyright © 2022 Jens Lapidus
Published by agreement with Salomonsson Agency
Covergestaltung: Semper Smile, München
Covermotiv: Plainpicture (Mark Owen), Shutterstock/AGehring, Ensuper
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MA · Herstellung: han
ISBN 978-3-641-30885-8V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
»Meine Hand zittert nie – niemals.«
Billy Costigan inDeparted – Unter Feinden
Der Anfang vom Ende
Teddy ließ die schwarze Mündung der Glock nicht aus den Augen. Die Distanz war kurz. Kerim Celali würde nicht zögern.
Gleich könnte es vorbei sein. Vielleicht sollte es vorbei sein.
Teddy war selbst schuld – frohe Weihnachten, Idiot.
»Ich habe den Film über Elizabeth Holmes gesehen. Weißt du, es stimmt alles.« Kerim hielt die Waffe entspannt, den Ellbogen seitlich aufgestützt, den Lauf angewinkelt, fast so, als würde er sie gleich fallen lassen. Aber Teddy ließ sich nicht täuschen. Kerim war einer dieser stacheligen Fische, die er als Achtjähriger im Aquarium in Skansen gesehen hatte, ruhig und gelassen, sozusagen im Wasser schwebend. Doch ehe man sich versah, stach er zu, und das Gift war tödlich.
»Elizabeth wer?« In einer anderen Situation hätte sich Teddy gewundert, dass Kerim von Dokumentarfilmen sprach, aber jetzt war es ihm egal – er wollte nur das Ende hinauszögern.
Der Schnee war körnig, der Himmel dunkel. Das Licht hier kam aus den Fenstern der Wohnungen und von einer schwachen Lichterkette an dem Baum, den die Wohngenossenschaft aufgestellt hatte. Die Dunkelheit sorgte dafür, dass Kerim noch ruhiger wirkte.
Der Boss lachte auf. »Scheiß drauf. Bruder, ich werde dich jetzt nicht nur ausknipsen und auf deinem Grab tanzen. Ich werde mir auch deine Familie holen, jeden, den du kennst.«
»Meine Familie?« Teddy sprach langsam und versuchte, so etwas wie Würde zu bewahren. »Ich habe keine Familie.«
»Deinen Sohn.«
»Erzähl mir lieber von dem Film.«
Kerim Celalis Tätowierungen zuckten an seinem Hals, als er lachte. »Es ging um die Frage, wie Menschen lügen können. Sie haben Tests mit Würfeln und einem Lügendetektor gemacht. Weißt du, was dabei rausgekommen ist?«
»Keine Ahnung.«
»Sie haben festgestellt, dass Menschen sehr leicht lügen können, wenn sie glauben, dass sie für eine gute Sache lügen, verstehst du?«
»Nein.«
Kerim hörte auf zu lachen. »Menschen haben kein Problem damit zu lügen, solange sie glauben, dass sie etwas Gutes tun.«
Teddy fröstelte, und das lag nicht an der Kälte. Der Boss hatte noch nie so ernst gewirkt, und obendrein hatte er recht. Es war nicht schwer zu lügen, jedenfalls nicht für Teddy, das war es noch nie gewesen.
Kerim streckte den Arm aus, hob die Glock.
Teddy belog sich sogar selbst. Er redete sich ein, dass er ruhig bleiben würde, dass er keine Angst hatte, dass er Kerim dazu bringen konnte, noch zu warten, aber das war Quatsch im Quadrat. Eigentlich sollte er sich jetzt in die Hose scheißen, er sollte rumheulen und sich in den Schnee knien. Kerim Celali meinte es ernst, das hatte er schon einmal bewiesen.
Die Lichter am Baum blinkten. Ein Versuch, Weihnachtsstimmung zu erzeugen.
Alle hier stammten aus unterschiedlichen Traditionen: sunnitische Muslime, Orthodoxe, Zoroastrier. Alle waren in Schweden aufgewachsen, in Teddys Fall: hier geboren. Sie waren umgeben, umarmt, durchdrungen von dem, was man ein normales Weihnachten nannte.
Ein normales Weihnachten – was war das genau? Es gab einen Weihnachtsbaum, es gab Geschenke. Dazu aß man Lachs und Schinken, trank vielleicht ein Gläschen Schnaps. Keiner von Teddys Freunden benutzte das Wort »Schnaps«. Gewürzschnaps in kleinen Gläsern nannten sie shots. Weihnachten: Das bedeutete Schnee, Weihnachtsmann, Lebkuchen und Glühwein. An Heiligabend war es draußen dunkel, und drinnen funkelten die Lichter. Linda hatte ihm immer drei Geschenke geschickt, während er im Bau gesessen hatte – alle geöffnet und von den Wärtern kontrolliert. Eine Parfümflasche, ein Hemd, eine Schachtel Pralinen – Aladdin. Er mochte nur die Pralinen. Was sollte er mit einem Hemd und Parfüm in einer Zelle anfangen?
Er dachte an das letzte Mal, als er mit seinem Vater, Linda und Nikola gefeiert hatte, bevor er in den Knast gegangen war, es war über dreizehn Jahre her. Bojan hatte gefüllte Paprika und Sauerkrautknödel gekocht und einen Lamm- und Schinkenbraten zubereitet, dann hatte er gegrinst, für einen kurzen Moment glücklich trotz all des Unglücks: »Heute ist zwar nicht wirklich Heiligabend, aber da du …« Er hatte den Satz mittendrin abgebrochen, nur Nikola hatte nicht kapiert, was er meinte. Da Teddy seine Haft antreten würde, hatten sie beschlossen, sich bereits früher zu treffen.
Heute Mittag hatte er ein ganz normales Weihnachten gefeiert. Das war sein Leben in Kurzform: versuchen, etwas Schönes zu tun, und dann alles kaputt machen. Er dachte an Bojan und Linda, an Emelie und Nikola. Aber vor allem dachte er an Lucas.
Das hier fühlte sich an wie der friedlichste Ort in ganz Stockholm. Der Schnee, die Weihnachtsstimmung, der windstille, kalte Hof.
Kerim quatschte weiter, ohne die Waffe zu senken. »Ich hätte dich schon längst abknallen sollen. Du bist von der alten Schule, Mann, du schnallst es nicht.«
Teddy blickte zum Auto.
»Was verstehe ich nicht?«
»Du glaubst, es gibt Spielregeln.«
Gehirnmasse. Schädelfragmente. Blut. Und Lucas, was würde mit ihm geschehen?
Ein Klicken hallte durch die Stille, als Kerim den Hahn spannte. »Jetzt weiß ich, wer du bist«, sagte der Boss.
Trotz der Kälte lief ihm ein Schweißtropfen über den Rücken. Jetzt war es wirklich vorbei. Kerim wusste Bescheid.
Keine Bilder zogen vorbei. Das Einzige, was Teddy sah, war das Weihnachtsgeschenk, das sein Vater ihm vor langer Zeit gegeben hatte. Ein Buch: Magellan. Stefan Zweig.
»Hast du davon gehört?«, hatte Bojan gefragt.
Teddy hatte den Kopf geschüttelt.
»Es handelt von einem Mann, der etwas getan hat, was noch nie ein Mensch zuvor getan hat. Er ist um die Welt gesegelt.«
Teddy hatte das Buch beiseitegelegt. Es klang nicht nach etwas, das ihm gefallen würde, er las sowieso keine Bücher.
»Du kannst Dinge tun, die niemand für möglich hält«, sagte sein Vater. »Jeder Mensch kann das. Auch du, Najdan.«
Die Glock.
Der Schnee auf dem Boden, der sich blutig färben würde. Was war eigentlich möglich, und was war unmöglich?
Das Auto stand ein Stück entfernt.
Kerim trat vor, drückte die Mündung gegen Teddys Kopf.
Viereinhalb Monate zuvor
EINS
1Teddy
Trotz des Werbebanners, auf dem »das Premium-Feeling der kostenlosen Internetverbindung« angepriesen wurde, war das WLAN im Flugzeug so langsam, dass Teddy nicht einmal auf die Website der Fluggesellschaft zugreifen konnte. Er hatte nichts heruntergeladen, das er sich offline ansehen konnte, und auch nichts zum Lesen gekauft. Er hätte ohnehin nicht gelesen.
Dennoch erinnerte er sich deutlich an das Quietschen der Räder des Bibliothekswagens, wenn dieser den Gang hinunterrollte – ein bisschen wie das fröhliche Signal eines Eiswagens, sozusagen das Premium-Feeling im Knast. Damals hatte er Bücher verschlungen, das Weihnachtsgeschenk seines Vaters war der Anfang gewesen, aber das lag daran, dass er nichts anderes zu tun hatte, als Karten zu spielen und sich einen runterzuholen. Damals hatte er sich seinem Vater näher gefühlt. Vielleicht glaubte Teddy immer noch, dass er eines Tages so werden würde wie er. Du kannst Dinge tun, die niemand für möglich hält, und in gewisser Weise stimmte das auch. Dass er auf dem Weg zu diesem Treffen war, schien in den Augen vieler ein Ding der Unmöglichkeit. Und doch saß er hier.
Die Zeiten hatten sich geändert. In den letzten Monaten hatte er total mies geschlafen, war nicht zur Ruhe gekommen, hatte versucht, seine Gedanken zu ordnen, die sich ohne Struktur im Kreis drehten. Er hatte begonnen, unsaubere Geschäfte zu machen, die dunkleren Stunden des Tages bekamen eine andere Bedeutung, wurden zu Arbeitszeiten, Geschäftszeiten. Er hatte nicht geglaubt, wieder dort zu landen. Acht Jahre Gefängnis sollten eigentlich wie eine Impfung gegen die Straße wirken – aber offenbar nicht für ihn. Er schien Antikörper gegen Impfungen zu haben, war immun gegen Veränderungen. Er würde nie sein wie sein Vater oder wie Emelie, aber er wusste, warum er das hier tat, warum er sich in die Todeszone begab. Er hatte seine Gründe.
Lucas – sein Sohn – sollte eines Tages stolz auf ihn sein.
Aber das beantwortete eine Frage nicht: War es das wert?
Er kippte die Rückenlehne seines Sitzes nach hinten, er musste versuchen zu schlafen.
»Was machen Sie da?« Ein Gesicht lugte durch den Spalt zur Reihe hinter ihm. »Passen Sie doch mit dem Sitz auf. Jetzt habe ich etwas verschüttet.«
»Tut mir leid«, sagte Teddy.
Ein alter Mann, braun gebrannt, als wäre er in die falsche Richtung unterwegs, das graue Haar zurückgekämmt, Wutfalten zwischen den Augen: »Sie sind nicht allein in diesem Flugzeug.«
Teddy sollte aufstehen, sich umdrehen und dem Idioten eine rechte Gerade verpassen. Er sollte ihm das Tablett um die Ohren hauen und ihm die kleine Flasche Cava in den Arsch schieben. Wobei, der Alte hatte sich vor den Augen aller anderen über ihn beschwert, da reichte eine Ohrfeige nicht aus. Teddy sollte ihn durch den Notausgang ins Freie befördern. Dort gab es keine Stuhllehnen, gegen die man klopfen konnte. Dort gab es keine Cava-Flaschen, die er verschütten konnte.
Stattdessen drehte er sich wieder nach vorne und starrte auf die leuchtenden kleinen Zeilen: Premium-Feeling. Er war jetzt anders, er war nicht mehr derselbe Teddy wie früher.
Es gab Gründe, warum er nicht ausflippen durfte. Seine Mission auf der Insel war zu wichtig, er durfte jetzt keine Aufmerksamkeit erregen, er wollte keine Probleme mit den Behörden bekommen, wenn er landete.
Das Dröhnen der Flugzeugturbinen übertönte die anderen Geräusche: das Gequassel auf dem iPad eines Mädchens ganz außen in der Reihe, das Gequengel eines Kindes ein paar Reihen weiter wegen irgendwelchen roten Bonbons, das Gegröle einiger junger, im Gang stehender Männer über Jet-Skis und Palmas Stripclubs. Auflösung, Lärmreduktion, Ausblendung der Realität. Das war es, was er brauchte.
Er legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
Bei seinem letzten Aufenthalt auf Mallorca war Emelie dabei gewesen. Der Schlamassel, in den sie geraten waren, hatte sie gezwungen zusammenzuarbeiten, um den Pädophilenring zu zerschlagen. Zwischendrin hatten sie sich gefunden, und eins hatte zum anderen geführt.
Sie zogen zusammen, nachts liebten sie sich oder schliefen nebeneinander, sie frühstückten jeden Morgen gemeinsam, bevor Emelie zur Arbeit ging, sie sprachen darüber, wie es wäre, Eltern zu sein, sie diskutierten ihre Vorstellungen von Kindererziehung und darüber, wie und wo sie in der Welt leben wollten, wenn sie die Wahl hätten. Mallorca war auf jeden Fall eine Option. Dann kam Lucas zur Welt.
Sie statteten Emelies Wohnung mit Kissen und einem Kinderbett aus, sie schoben einen ultraschicken Kinderwagen durch Vasastan, sie kuschelten sich auf dem Sofa zusammen, alle drei wie eine kleine Familie, wie das Zielbild, von dem die Hebamme gesprochen hatte. Sie saßen in den Cafés entlang der Rörstrandsgatan, während Lucas schlief, und tranken Caffè Americano. Emelie grüßte Bekannte, die sich tief in den Wagen beugten und das Wunder dort bestaunten. Sie fuhren zu Linda raus, die Lucas so süß fand, dass sie ihn am liebsten behalten wollte, sie gingen zur Kinderärztin und fühlten sich harmonisch, sie übten, damit Teddy Lucas die Flasche geben konnte, obwohl er tief in seinem Inneren der Meinung war, dass sein Sohn nur gestillt werden sollte.
Es war wohl Stockholms flüchtigstes Zielbild, eher ein Zielschnappschuss, eine Sekunde der Euphorie. Nach wenigen Wochen holte ihn die Realität ein. Emelie bekam Elterngeld, aber das würde nicht ewig reichen. Teddy suchte einen Job, aber er fand keinen anständigen, er hatte ein achtjähriges schwarzes Loch in seinem Lebenslauf. Auch die Anwaltskanzlei Leijon wollte ihn nicht zurück, und er konnte das verstehen – sie wussten, dass er irgendwie in die Explosion der gesamten Kanzlei vor ein paar Jahren verwickelt war. Vielleicht sollte Emelie in ihren Beruf zurückkehren und er Elternzeit machen? Emelie weigerte sich.
Nach neun Monaten sagte Emelie, dass sie zwei Tage pro Woche arbeiten müsse, sonst würde sie »einige Mandanten für immer verlieren, und das will keiner von uns«.
Das war eine klare Ansage, außerdem hatte Teddy nur Gelegenheitsjobs gefunden. Gleichzeitig fiel es ihm schwer zu akzeptieren, dass sie von ihm verlangte, jeden Tag bis 17:30 Uhr zu Hause zu bleiben, um im Haushalt zu helfen – er war kein Kind. Er musste etwas tun, Geld verdienen, sich wie ein Mann benehmen.
An einem Tag meinte Emelie, er solle Lucas in eine sogenannte offene Kita im Vasapark bringen. »Ich habe heute eine Anhörung, darum kann ich nicht«, sagte sie. »Es würde ihm guttun, andere Kinder zu treffen.« Lucas war vierzehn Monate alt und liebte es, Dinge von den Tischen zu stoßen und Emelies Gesetzesbücher aus dem untersten Fach des Bücherregals zu reißen. Er liebte es, Squeezies mit Aprikosengeschmack zu essen und einfach süß zu sein. Er musste nicht ständig andere Kinder sehen. Lucas war auch so glücklich. Trotzdem packte Teddy ihn in die schlafsackähnliche Einlage des Kinderwagens und machte sich auf den Weg in den Park. Auf dem Asphalt lag noch eine blasse Raureifschicht, der Himmel war wolkenlos, keine Vögel, keine Flugzeuge in Sicht. Sie könnten einfach spazieren gehen, auch wenn Lucas noch wach war, er würde erst in ein paar Stunden seinen Mittagsschlaf machen, und stillsitzen war nicht sein Ding.
Die offene Kita war eigentlich nur ein kleines Häuschen auf dem Spielplatz des Parks. Es roch darin nach nassen Overalls und Mikrowellenessen. Nachdem Teddy seine Schuhe ausgezogen hatte – er hasste es, in Socken herumzutapsen, aber es gab Schilder, auf denen stand, dass man keinen Sand hereinbringen sollte – und Lucas ausgepackt hatte, stellte sich heraus, dass er zu spät gekommen war. Die anderen Eltern saßen schon mit ihren Kindern auf dem Schoß im Kreis auf dem Boden und wippten im Takt mit dem Kopf.
»Hallo, hallo«, sagte die Erzieherin und legte ihre Gitarre beiseite. »Wie heißt ihr?«
»Wir sind Teddy und Lucas.« Teddy setzte sich zwischen zwei Mütter, die wie Zwillinge aussahen: blonde Haare, helle Strickpullover mit hohem Kragen aus teurer Wolle.
»Und welches Lied möchte Lucas sich aussuchen?«, fragte die Erzieherin. Hatte sie nicht gecheckt, wer von beiden wer war, oder war das eine pädagogische Methode, mit den Kleinen über die Eltern zu kommunizieren?
Teddy kannte kein einziges Lied. Und Lucas konnte nicht einmal das Wort »Lied« aussprechen.
Die Erzieherin hatte unnatürlich weiße Zähne.
Teddy klopfte Lucas auf den Rücken. Die blonden Mütter starrten ihn an. Gegenüber saßen ein paar Väter mit runden Brillengläsern und dünnen Armen und warteten auf einen Liedvorschlag. Teddy fragte sich, ob sie ahnten, dass seine Stimme extrem nasal klang, dass er sang wie ein kastrierter Pfau, weil seine Nase in seinem Leben schon öfter gebrochen worden war, als sie ihre Brille gewechselt hatten.
Die Erzieherin lächelte immer noch. »Hat Lucas ein Lieblingslied?«
Das Ganze war völlig absurd. Teddy hatte keinen blassen Schimmer von irgendwelchen Kinderliedern.
Das Lächeln der Erzieherin blendete ihn.
Ihm fiel nur eines ein: »Živeo, Živeo, i srećan nam bio«, sagte er schließlich. Das einzige Lied, das Bojan ihm und Linda an ihren Geburtstagen vorgesungen hatte.
Die Erzieherin griff zur Gitarre. »Das kenne ich sogar.« Sie wandte sich an die anderen. »Das ist ›Zum Geburtstag viel Glück‹ auf Serbisch, oder?«
Teddy nickte.
Die Erzieherin fragte: »Kannst du die Melodie vorsingen?«
Das war zu viel. Teddy stand auf und ging.
Er wollte sich nicht wie ein Hund benehmen, aber er konnte auch nicht alles machen, was sie ihm befahlen. Weder Emelie noch die Behörden noch die Arbeitgeber, nicht einmal diese Erzieherin in dieser offenen Kita respektierten ihn. Als Emelie nach Hause kam, sagte er zu ihr: »Ich bin nicht wie ihr.«
»Ich würde mich auch unwohl fühlen, wenn man mich zum Singen auffordern würde«, sagte sie.
»Das geht tiefer«, sagte Teddy. »Es geht darum, wer ich in meinem Innersten bin.«
Emelie öffnete die obersten Knöpfe ihrer Bluse. Sie trug einen dunkelgrauen Anzug. »Komm schon. Es liegt nicht in deinen Genen, falls du das glaubst – du willst ja auch ein normales Leben wie alle anderen führen.«
»Du vergleichst mich mit deiner Art von Leuten.«
»Gib dir ein bisschen Mühe.«
»Ich kann nicht ändern, was ich bin.«
»Was du bist? Du bist kein Ding, Teddy. Du bist ein Mensch, und Menschen können sich ändern.«
Er verstand, was sie meinte. Aber was ist, wenn das, was ich bin, dazu führt, dass ich mich nicht ändern will?, dachte er, sagte aber nichts, sie kamen nicht weiter. Emelie wollte arbeiten und ein normales Leben führen. Die Arbeit einer Frau musste respektiert werden, aber Teddy war altmodisch – musste sie so respektiert werden? Er fühlte, was er fühlte, und das ließ sich nicht wegzaubern. Er musste für seine Familie sorgen, er musste das Gefühl haben, etwas beizutragen.
Die Diskussionen gingen weiter. »Gib mir mehr Zeit«, sagte er am nächsten Tag.
Er bewarb sich auf mehr als sechzig verschiedene Stellen, aber er war nun mal kein illegaler Einwanderer, der sich für sechzig Kronen die Stunde abrackerte.
Ein paar Wochen später wollte Emelie wieder Vollzeit in ihrer Kanzlei arbeiten.
Teddy wurde Hausmann.
Die Stewardess schob den Wagen gelangweilt vor sich her.
»Ein Mineralwasser, bitte«, sagte Teddy.
Ihr Gesicht war seltsam blass für ein so sonniges Reiseziel.
Er reichte ihr das Geld.
»Tut mir leid, wir nehmen kein Bargeld.« Die Zähne der Stewardess wirkten gelb im Vergleich zu ihrem Gesicht. »Aber Sie können gerne mit Karte bezahlen.«
Teddy schüttelte den Kopf, er war ein Bargeldtyp, auch das noch.
Er und Emelie hatten sich nach weniger als zwei Jahren getrennt, als sie versuchten, aus dem Stadtzentrum wegzuziehen, in eine Gegend in Richtung Södertälje. Vielleicht war das der Moment, in dem sich wirklich etwas in ihm veränderte. Er wurde aktiv, versuchte, nebenher ein Business aufzubauen, mit anderen Worten: Er versuchte, in seine alte Welt zurückzukehren. Er musste die Fassade nicht mehr aufrechterhalten, außer wenn er Emelie traf. Aber trotzdem – nichts war mehr wie zuvor, wirklich nichts.
Vielleicht war es eine Strafe. Gott glaubte nicht, dass acht Jahre genug waren für eine Entführung. Gott glaubte nicht, dass er genug gelitten hatte: all die Male, die er Bojan verraten hatte, all die Male, die er Linda und Darko gezwungen hatte, seine falschen Alibis zu sein, all die Male, die er nicht nur getan hatte, was Kum ihm befohlen hatte, sondern es auch noch mit Genugtuung getan hatte. Sein Sündenrucksack war zu schwer. Andererseits war Gott ein fieser Mistkerl – denn Teddy hatte es versucht. Wie viele Typen wie er bekamen ein Kind und lebten zwei Jahre lang ein normales Leben mit einer Anwältin aus Jönköping?
Das war nun unwichtig.
Die einzigen Menschen, die zählten, waren Lucas und sein Neffe Nikola.
Was Teddy auf der Insel vorhatte, konnte alles verändern. Er wusste nur noch nicht, ob es das Richtige war.
Sie setzten zur Landung an. Die Rückenlehnen der Sitze wurden hochgeklappt, die Fasten-Seatbelt-Lämpchen leuchteten rot.
Das Mädchen neben ihm packte ihr iPad in ihren Rucksack. Der Junge weiter hinten war verstummt, selbst der Trupp junger Schweden schwieg jetzt. Das Geräusch des Fahrwerks, das unter dem Flugzeug ausgefahren wurde, erinnerte ihn an eine Bohrmaschine, die sich in eine Trockenbauwand fräste.
Er dachte über die unterschiedlichen Optionen nach, wie er das, was er vorhatte, angehen konnte. Es gab viele Ebenen, viele Fallen. Er hatte sich selbst in diese Lage gebracht. Am liebsten würde er im Flugzeug sitzen bleiben und zurück nach Schweden fliegen.
Er beugte sich vor und stieß mit dem Fuß gegen etwas unter dem Sitz. Vielleicht war es die Schwimmweste, von der sie immer sprachen. Warum hatten sie keine Fallschirme unter den Sitzen? Er hatte noch nie von einer Notlandung auf dem Meer gehört, von abgestürzten Flugzeugen hingegen schon.
Sie setzten mit einem dumpfen Aufprall auf. Draußen sah er die verschwommene Silhouette des Flughafens.
Das Flugzeug bremste scharf, es waren die klammen Sekunden, bevor alles still wurde.
Kurz darauf erloschen die Lämpchen der Anschnallgurte.
Teddy stand schnell auf.
Er holte seine Tasche aus dem Gepäckfach. Drängte sich nach vorne.
Seine Aufmerksamkeit galt jetzt zu hundert Prozent dem Ausgang des Flugzeugs. Kein Polizist, kein behördlicher Mitarbeiter war in Sicht. Niemand wirkte gestresst.
Er musste den Flughafen durchqueren, ohne aufgehalten zu werden, und auf der anderen Seite herauskommen. Er musste die Person treffen, die er treffen sollte, und tun, was er tun musste. Er wollte nie wieder Hausmann sein.
Die Hitze schlug ihm entgegen wie ein Saunaaufguss. Die Treppe war wackelig.
Er trug die Tasche über der Schulter, in der er den Schuh verstaut hatte, der unter dem Sitz gelegen hatte. Das geschah dem Idioten hinter ihm nur recht. Man konnte Teddy die Straße nicht austreiben.
Der alte Dreckskerl würde das Flugzeug barfuß verlassen müssen.
Am Boden wartete die zickige Stewardess. Ihr weißes Gesicht strahlte. »Gracias«, sagte sie, obwohl sie vorher Schwedisch gesprochen hatte.
Scheiße, die Straße konnte man Teddy nicht austreiben, aber was war die Straße eigentlich? Nichts war schwarz oder weiß, er wusste selbst kaum, wer er war. Er kramte in seiner Tasche, zog den Schuh heraus und reichte ihn der Stewardess. Sie zog die Augenbrauen hoch.
»Geben Sie das dem Idioten aus Reihe zwölf«, sagte er.
2 Gabriel
Es waren keine Mikrofone eingeschaltet, die Tür war geschlossen, und die Richterin sprach leise, fast flüsternd, als hätte sie Angst, dass jemand draußen stand und zuhörte.
Es war eine besondere Sitzung. Sie hieß nicht einmal Verhandlung, sondern Besprechung, und es war die geheimste Art von Besprechung, die in einem schwedischen Gericht stattfinden konnte.
Gabriel brauchte sich nicht umzudrehen, um alle Anwesenden zu sehen, der Raum war so klein, dass er alles mit einem Wimpernschlag erfassen konnte.
Keine Parteien. Nur die Staatsanwältin und ein sogenannter öffentlicher Ombudsmann, der eigentlich ein simpler Anwalt war, und dann die Richterin. Gabriel selbst war als Sachverständiger geladen. Es war nicht üblich, dass Polizeibeamte an solchen Sitzungen teilnahmen, aber heute wollte seine Chefin, die Staatsanwältin Cilla Frank, die Grenzen ausloten.
»Polizeiinspektor Gabriel Dolk«, sagte Cilla und nickte in seine Richtung, »hat langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Bandenkriminalität. Er gehört zu der speziellen Aktionsgruppe im Rahmen der Stockholmer Initiative gegen Bandenkriminalität: Aktionsgruppe Acht.«
Die Richterin sah Gabriel träge an, eine Müdigkeit in ihren Augen, die nicht nur gleichgültig, sondern geradezu feindselig wirkte. Er bedauerte, dass er sich nicht, wie immer, wenn er nicht rauchen konnte, eine Portion Snus unter die Oberlippe gesteckt hatte, aber die Richterin würde ihn noch mehr verachten, wenn ihm der Tabak an den Zähnen herunterlief.
»Und warum kann die Frau Staatsanwältin den Sachverhalt nicht selbst schildern?«
Cilla Franks Augenbrauen zuckten. »Es gibt niemanden, der besser über unsere Bemühungen gegen die kriminellen Netzwerke im Süden Stockholms Bescheid weiß als Kriminalkommissar Gabriel Dolk. Er ist der Beste, den wir haben.«
Die Richterin verzog keine Miene, aber Cilla Frank hatte sich am Morgen noch optimistisch gezeigt. »Wir werden diese Telefonüberwachung durchsetzen. Glauben Sie mir.«
Jetzt war Gabriel nicht mehr so zuversichtlich.
Die Richterin lehnte sich zurück, die Lehne des Schreibtischstuhls wackelte bedenklich, vielleicht war sie falsch eingestellt. Die Anwältin, Emelie Jansson hieß sie offenbar, trug ein Jackett und hatte ihr Haar zu einem Dutt gebunden. Sie sah grimmig aus, war aber unverschämt attraktiv, mit markanten Wangenknochen und einer geraden Nase, das musste Gabriel zugeben, obwohl er Anwälte nicht mochte. Sie glaubten, Gerechtigkeit sei ein Spiel, Moral eine Frage von Beweisen und Rechtsprinzipien. Noch schlimmer war es, wenn sie bei Vernehmungen und im Gerichtssaal selbstbewusst auftraten und, wie dieses Exemplar vermutlich, nach außen hin sympathisch und erfolgreich wirkten und nicht nur cool spielten. Auf dem Revier kursierten die aktuellen Einkommenslisten der Strafverteidiger. Einige von ihnen verdienten mehr als zehn Millionen Kronen im Jahr. ZEHNMILLIONENKRONEN an Steuergeldern, um Schwerverbrechern zu helfen. Wenn man den Stundensatz aufs Jahr umlegte, wurde es komplett verrückt. Es gab niemanden, der wirklich achtzehn Stunden am Tag arbeitete und nur an Heiligabend frei hatte, und schon gar nicht Pflichtverteidiger. Es stimmte zwar, dass keine der Spitzenpositionen in der Rechtsprechung mit Juristinnen besetzt war, aber es war doch eine große Heuchelei, mit der einen Hand das Verbrechen zu bekämpfen und mit der anderen diejenigen zu belohnen, die dafür sorgten, dass es weitergehen konnte, und die sich durch offensichtlich überhöhte Rechnungen selbst des Betrugs schuldig machten.
»Nun, vielen Dank. Dann fangen wir mal an«, seufzte die Richterin. »Bitte sehr, Frau Staatsanwältin.«
Cilla Frank räusperte sich. Sie war ein paar Jahre älter als Gabriel und strahlte stets die Kraft und Klarheit aus, wie es sich für eine Vertreterin des Staates gehörte.
»Die Staatsanwaltschaft beantragt die Ermächtigung zur präventiven geheimen Telefonüberwachung, zur geheimen Raumüberwachung und zum geheimen Auslesen von Daten gegen Kerim Celali und alle seine Aliasnamen für die Dauer von drei Monaten.« Sie fuhr fort, eine Reihe weiterer Personen aus Celalis Netzwerk aufzulisten, für die sie ebenfalls diverse Abhörgenehmigungen erwirken wollte.
Die Richterin nickte Rechtsanwältin Jansson zu, die sich schnell über den Tisch beugte und kurz ihren Standpunkt darlegte: »Der Antrag wird abgelehnt.«
Die Richterin sank in ihren Stuhl zurück und schnaufte tief, als wäre sie nicht nur dieses Streits, sondern ihrer ganzen Arbeit überdrüssig. »Dann bitte ich die Staatsanwältin, ihren Antrag zu erläutern.«
»Vielen Dank, Euer Ehren«, sagte Cilla Frank. »Ich möchte Polizeiinspektor Gabriel Dolk ein paar Fragen stellen, wenn Euer Ehren es erlaubt.«
Die Richterin nickte.
»Können Sie, Gabriel Dolk, uns etwas über die aktuelle Situation in Söderort in Bezug auf schwere Bandenkriminalität sagen?«
Gabriel hatte darauf gewartet, er war voller Energie, aber er wusste, dass er sich zurückhalten, langsam und eindringlich sprechen musste. »Die Situation ist sehr ernst«, sagte er. »Auf der Straße nennen die Leute den Süden der Stadt inzwischen offen Little Juárez.«
»Juárez?« Plötzlich war die Richterin neugierig.
»Ja, die Stadt im Norden Mexikos, in der die Drogenkartelle ihre Kriege geführt haben.« Er fuhr fort. »Es gibt mehr als dreißig aktive Netzwerke in diesem Teil der Region, und vor etwas mehr als einem Jahr hat der Anführer des sogenannten Södertälje-Netzwerks, Isak Nimrod, erklärt, dass er seine Position aufgeben wolle. In der Unterwelt brach daraufhin Chaos aus, und viele verschiedene Gruppen stritten sich darum, wie sie dieses mögliche Vakuum füllen sollten. Insgesamt wurden siebenundfünfzig Personen wegen schwerer Straftaten angeklagt. Mit anderen Worten: Die Lage ist äußerst instabil und gewalttätig. So wurde im Mai ein Sprengsatz in der Polizeiwache gezündet, eine Woche später wurden in Norsborg zwei Kinder erschossen.«
»Kommen Sie zum Punkt«, sagte die Richterin.
Gabriel verlor fast die Fassung. Neben ihm beugte sich Cilla Frank über den Tisch und starrte die Richterin entgeistert an.
»Im Rahmen der behördenübergreifenden Arbeit ist es der Polizei gelungen, neue Anführer zu identifizieren, die versuchen, die Region unter ihre Kontrolle zu bringen. Einer von ihnen ist Kerim Celali. Er hat alles auf eine neue Ebene gehoben.«
»Alles? In einem Gerichtssaal muss man präzise sein.«
Gabriel atmete durch die Nase ein. »Euer Ehren, die Gewalt und Brutalität ist mit nichts zu vergleichen, was wir bisher gesehen haben. Kerim Celalis Netzwerk umfasst mehr als hundert Männer und eine Reihe von Frauen. Es herrscht eine militärische Hierarchie, sie haben verschiedene Ränge, Kapitäne und Soldaten, und Zehn- oder Elfjährige werden unter anderem benutzt, um Drogen und Waffen zu verwahren. Sie benutzen Vespas und Elektroroller statt Autos, um sich unregistriert fortzubewegen, sie kommunizieren über digitale Dienste, die schwer zurückzuverfolgen sind, sie nutzen Sport- und Kulturvereine, um Männer zu rekrutieren und Drogen zu verstecken. Was aber auffällt, ist die Gewalt. Wir haben ähnliche Negativspiralen schon früher erlebt, aber nicht in diesem Ausmaß. Wir vermuten, dass neunzehn Morde mit der Eskalation des Konflikts zusammenhängen. Wir hatten noch nie so viele ungeklärte Morde in der Region Stockholm-Süd.«
Es waren verdeckte Morde, wie immer bei Bandenschießereien, aber die Analysten der Aktionsgruppe Acht waren sich sicher, denn sie hatten Zugang zu allen Ermittlungen und Geheimdienstinformationen: Kerim Celali war involviert.
»Danke, ich glaube, das reicht«, brummte die Richterin. »Was sagt die Verteidigung?«
Die Anwältin Emelie Jansson saß reglos da wie eines von Kerim Celalis steifen Opfern, aber ihre Stimme war nicht nur klar, sondern auch scharf und verdammt nervig. »Wir widersprechen der Darstellung des Polizeiinspektors Gabriel Dolk im Wesentlichen nicht, außer in einem Punkt. Kerim Celali selbst ist keiner schweren Straftat verdächtig.«
Das Räuspern der Richterin war so laut, dass es wahrscheinlich bis in den Warteraum hallte. »Was sagen Sie da?«
Emelie Jansson wiederholte den letzten Satz. »Soweit ich weiß, behaupten weder die Staatsanwältin noch der Polizeiinspektor, dass Kerim Celali derzeit persönlich einer Straftat verdächtigt wird. Viele Menschen, die ihm nahestehen, viele aus seinem Bekanntenkreis schon, aber nicht Herr Celali selbst.«
Der Blick der Richterin war nicht mehr müde oder neugierig. Jetzt starrte sie Gabriel und Cilla an, als wären sie Idioten. »Deshalb beantragt die Staatsanwaltschaft eine präventive Abhöraktion, nicht wahr?«
Cilla Frank nickte. »Das ist richtig. Nach dem Präventivgesetz, erster Absatz.«
»Das verstehe ich. Aber es gibt keinen direkten Tatvorwurf gegen Kerim Celali? Nicht einmal etwas Kleines?«
»Nein. Wir beantragen die Abhörung aus rein präventiven Gründen. Kerim Celali ist der Kopf eines Netzwerks von Personen, von denen mehrere einer Straftat verdächtigt werden, aber Celali selbst ist derzeit nicht hinreichend verdächtig.«
»Aus präventiven Gründen«, wiederholte die Richterin. »Ich denke, Sie wissen, dass das Präventionsgesetz hauptsächlich den Zuständigkeitsbereich der Sicherheitspolizei betrifft, zum Beispiel bei terroristischen Straftaten. Das hier ist nichts dergleichen, oder?«
Die Anwältin verneigte sich triumphierend in ihre Richtung.
Cilla ignorierte dies und wandte sich an die Richterin. »Wie Euer Ehren bekannt ist, wurden in den letzten zwei Jahren verschiedene Arten von verschlüsselten Chat-Diensten in großem Umfang abgehört. Dabei handelte es sich um schwedische Bürger, die zum Zeitpunkt des Abhörens keiner Straftat verdächtigt wurden. Dennoch wurden die Abhörmaßnahmen von zahlreichen schwedischen Gerichten, einschließlich des Obersten Gerichtshofs, als Beweismittel anerkannt. Darüber hinaus hat die Regierung aufgrund der hohen Gewaltrate in den Stockholmer Vorstädten das Gesetz über präventive Zwangsmaßnahmen beschleunigt. Das Präventionsgesetz soll demnächst geändert werden.«
Emelie Jansson unterbrach sie. »Es wurde noch nicht geändert. Zwangsmaßnahmen wie Abhören dürfen nur zu den im Gesetz genannten Zwecken eingesetzt werden, das wissen Sie so gut wie ich.« Sie wandte sich an die Richterin. »Deshalb, Euer Ehren, muss der Antrag auf Abhörung abgelehnt werden. Es spielt keine Rolle, was das Parlament in ein paar Wochen tun wird. Das schwedische Recht geht von der Gegenwart aus.«
Die Richterin sah abwechselnd Emelie Jansson und Cilla Frank an, jetzt schien sie sich zu amüsieren.
Es war verrückt. Jeder wusste, was Kerim Celali und sein Netzwerk trieben. Wollte diese Richterin Abhörmaßnahmen verhindern, nur weil man nicht genau sagen konnte, wo, wann und wie Kerim Verbrechen begangen hatte? Es war ein Zirkelschluss, zumal Kerim Celali an der Spitze stand, er machte sich bei schweren Straftaten nie die Finger schmutzig, er kontrollierte sie.
Aus irgendeinem Grund dachte Gabriel an Alma. Sollte seine Tochter in dieser Scheiße aufwachsen? Dann korrigierte er sich: Sie war schon aufgewachsen, mitten in der Pubertät, und der Süden Stockholms sah schon lange so aus. Gabriel konnte sich nicht länger zurückhalten, er stand auf.
Die Augen der Richterin weiteten sich.
»Euer Ehren, bei allem Respekt.« Er sprach schnell. »Wir können zwar keinen konkreten Tatverdacht gegen Kerim Celali vorbringen, aber innerhalb der Polizei wissen wir, dass er täglich schwerste Straftaten anstiftet und vorbereitet. Wenn wir ihn nicht abhören dürfen, werden wir nie Beweise dafür bekommen, dass er diese Taten in Auftrag gibt, und sie werden weitergehen.«
Gabriel spürte Cilla Franks Hand auf seinem Arm, aber es war zu spät, er konnte sich nicht mehr bremsen. Er hörte seine eigene Stimme, viel zu laut: »Kerim Celali ist die größte Bedrohung für die Menschen im Süden Stockholms. Wenn wir ihn nicht zur Strecke bringen, werden noch mehr Menschen erschossen, noch mehr in die Luft gesprengt, noch mehr Drogen werden die Straßen überschwemmen. Sie müssen verstehen, wie ernst die Lage ist.«
Es herrschte Stille.
Die Richterin nahm ein Taschentuch, putzte sich vorsichtig die Nase und faltete es wieder zusammen. »Ich glaube, Sie setzen sich besser, Inspektor Dolk.«
Gabriel hörte seinen eigenen Atem. Was für ein Idiot er war, vor einer Richterin die Stimme zu erheben, aufzustehen und emotional zu werden. Er setzte sich. Aber es reichte einfach nicht, der Hydra die Zehennägel zu schneiden, um sie aufzuhalten.
Er hatte einen Plan, wie er es anstellen wollte, er brauchte diese Abhöraktion, sie war wichtig, mehr als Cilla Frank ahnte.
Die Richterin erhob sich. »Dann erkläre ich die Sitzung für geschlossen. Ich werde mich zurückziehen und dann meine Entscheidung treffen. Ich danke Ihnen einstweilen.«
Gabriel stand auf. Die Entscheidung würde wahrscheinlich in ein paar Minuten fallen, aber trotzdem mussten sie draußen warten.
Die Anwältin lächelte.
Diese eingebildete, aufgeblasene Anwältin besaß die Frechheit zu lächeln.
3 Emelie
Der Polizist drinnen hatte ausgesehen, als würde er sich gleich in die Hose machen: angespannter Körper, rotes Gesicht, hinkender Gang. Er war aufgestanden wie ein Anfänger, obwohl jeder in der Justiz wusste, dass man so etwas in Schweden im Gerichtssaal nicht tat. Es war nicht wie in den USA, wo die Anwälte und Staatsanwälte vor den Geschworenen auf und ab liefen und die Zeugen im Zeugenstand stramm standen und einen Eid schworen.
Der Polizeiinspektor und die Staatsanwältin tuschelten drüben bei der Cafeteria. Sie hatten Emelie nicht gegrüßt, als sie aus dem Sitzungssaal kam, ihr nicht einmal zugenickt. Es war nicht ungewöhnlich, dass Polizisten bei Verhandlungen Schwierigkeiten machten – sie verstanden die Spielregeln nicht. Andererseits war es nicht üblich, dass Staatsanwälte so stur wurden, und wenn es vorkam, dann meistens in richtigen Hauptverhandlungen, wenn es um ein wichtiges Urteil ging. Hier handelte es sich nur um die Frage einer Maßnahmengenehmigung.
Sie ging auf die beiden zu, sagte nichts und bestellte einen Kaffee.
Bald würde das Gericht seine Entscheidung verkünden, und obwohl Emelie glaubte, dass alles gut gegangen war, war sie sich nicht sicher. Gleichzeitig war es ihr auch egal. Sie war zur öffentlichen Vertreterin ernannt worden, was bedeutete, dass sie die Unversehrtheit des Einzelnen gegen die Forderung der Öffentlichkeit nach Abhörung verteidigte, wobei sie Kerim Celali oder einen der anderen noch nie getroffen hatte. Sie wusste nicht einmal, wie sie zu der Maßnahme standen. Das lag in der Natur der Sache, denn es war geheim. Kerim Celali durfte nicht wissen, dass sie sich mit ihm befassten. Für Emelie war das alles dadurch weniger heikel, völlig unpersönlich und rein professionell. Für Polizeiinspektor Gabriel Dolk und die Staatsanwältin schien es das Gegenteil zu sein.
Plötzlich kam ihr ein unangenehmer Gedanke: Sie war dabei, ihren Ehrgeiz zu verlieren. Sie hatte das Wirtschaftsrecht aufgegeben, weil sie an die Rechte und die Integrität des Einzelnen glaubte. Sie erinnerte sich an die kleine Rede oder besser gesagt die Rüge, die sie Magnus Hassel, einem Partner der Kanzlei Leijon, erteilt hatte. Dass sie die wichtigste Aufgabe eines Anwalts darin sehe, ein soziales System zu verteidigen, das die Interessen des Einzelnen schütze, dass sie nicht Anwältin geworden sei, um mit Geld zu arbeiten, dass sie es leid sei, stinkreichen Risikokapitalgebern dabei behilflich zu sein, noch reicher zu werden. Sie wollte mit Menschen arbeiten, mit denen, die sie wirklich brauchten. Ein System, das jeden unterstützte, auch diejenigen, die von der Staatsanwaltschaft und der Polizei für schuldig befunden worden waren, ein System, das dem Einzelnen half, sich zu äußern, und kontrollierte, was ihm vorgeworfen wurde. Ein gerechtes System, das sich auch um die Schwachen und Einsamen kümmerte.
Sie hatte geglaubt, das Abhören würde sie nicht tangieren, weil sie keine Beziehung zu Herrn Celali hatte. Aber jetzt erkannte sie, dass dieser Gedanke falsch war. Das Recht des Einzelnen war immer noch ein Recht, das es zu verteidigen galt.
Der Kaffee hatte eine dünne ölige Schicht und schmeckte bitter. Heute Morgen hatte sie keine Zeit zum Frühstücken gehabt. Lucas hatte geweint, als sie ihn in den Kindergarten gebracht hatte. Allen anderen Eltern schien es nichts auszumachen, wenn ihre Kinder weinten, aber Lucas weinte mehr als alle anderen zusammen, so schien es. Einige meinten, dass die Eltern dem Kind zuliebe Kälte zeigen sollten, dass es dadurch lernen müsse. Wahre Liebe bedeute, einen langfristigen Plan zur Stärkung des Kindes zu haben, selbst wenn es dabei Tränen gab. Trotzdem wurde Emelie das Gefühl nicht los, dass sie ihn verriet. Wie konnte es Lucas stärken, sich von seiner Mutter verlassen und abgeschoben zu fühlen, vor allem nachdem er schon von seinem Vater verlassen worden war?
Teddy sah das nicht so, das wusste sie. Für ihn war sie diejenige, die mit ihm Schluss gemacht hatte, die ihn gebeten hatte auszuziehen. »Trennen«, hatte er mit zusammengebissenen Zähnen gesagt, als würde das Wort in seinem Mund eklig schmecken. »Das hätte ich nie von dir gedacht.«
Aber was wusste er wirklich von ihr, und was wusste sie von ihm? Es war möglich, dass er es gut meinte, aber er schaffte es nicht, und schon das enttäuschte sie. Er sollte in der Lage sein, sich die Fähigkeit anzueignen, zu einem Psychologen, einem Lebensberater, einem Priester oder sonst jemandem zu gehen, wenn er es brauchte. Er musste sich zusammenreißen können wie jeder andere auch. Er war ein erwachsener Mann, aber er hatte nie einen richtigen Job gehabt. Natürlich wusste Emelie, dass es nicht einfach war mit seiner Vorgeschichte: ein schweres Verbrechen, zwölf Jahre Gefängnis, nach acht Jahren auf Bewährung entlassen. Doch wenigstens als Aushilfe bei einem Handwerker oder als Wachmann bei der U-Bahn sollte er arbeiten können. Aber nein, stattdessen machte er »Business«, wie er es nannte. Sie weigerte sich, Lucas mit einem Vater aufwachsen zu lassen, der bald wieder ins Gefängnis musste.
Sie wünschte sich, es wäre schon Abend. Ihre Lieblingszeit war die Schlafenszeit, wenn Lucas müde und ruhig war und sie einfach nur abhängen, Geschichten vorlesen und kuscheln konnten. Lucas schlief immer in ihrem Bett. Mag sein, dass sie ihn in die Kita abschob, aber nachts ließ sie ihn nicht im Stich.
»Die Entscheidung wird in Raum sieben verkündet«, teilte eine formell klingende Stimme über die Lautsprecheranlage mit.
Emelie wartete, bis die Staatsanwältin und der miesepetrige Polizist hineingegangen waren, um nicht mit ihnen an der Tür zusammenzustoßen.
Die Richterin machte einen entspannten Eindruck. Emelie vermutete, dass sie einfach froh war, wenn sie die Sache gleich hinter sich gebracht hatte.
Sie wandte sich einem nach dem anderen zu und sagte dann mit ihrer rauen Stimme: »Der Antrag wird abgelehnt.«
Die Staatsanwältin rührte sich keinen Millimeter. Der Polizist hingegen zuckte sichtlich zusammen.
»Jeder schwedische Bürger wird vor dem heimlichen Abhören, Aufzeichnen von Telefongesprächen oder anderen vertraulichen Nachrichten und dem Auslesen von Daten geschützt«, fuhr die Richterin fort.
Der Polizist erblasste, obwohl ihm klar gewesen sein musste, dass dies passieren könnte.
»Eine Einschränkung dieses Rechts muss durch das Gesetz gestützt sein. Nach geltendem Recht können die beantragten Maßnahmen genehmigt werden, wenn sie für die Ermittlungen von besonderer Bedeutung sind.«
Das war zum Teil die Schuld des Polizeibeamten, der sich in seiner Tirade angehört hatte, als ob in Stockholm Krieg herrschte. Jeder wusste, dass das stimmte, aber die Richter wollten es nicht so hören, sie wollten Fakten sehen, keine Weltuntergangsszenarien.
Plötzlich wurde die Richterin lauter. »Ich zweifle nicht daran, dass Kerim Celali ein gefährlicher, krimineller Mensch ist. Aber es gibt kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen ihn. Er steht nicht im Verdacht, schwere Straftaten begangen zu haben, und es spielt keine Rolle, dass das Parlament in ein paar Wochen das Gesetz ändern könnte. Die Dinge sind, wie sie sind.«
Alle saßen still da und warteten darauf, dass sie noch etwas sagen würde. Stattdessen stand sie auf. »Das war’s. Die Staatsanwaltschaft kann jederzeit einen neuen Antrag stellen, wenn Sie etwas Handfestes vorweisen können.«
Emelies Aktentasche war weniger schwer als zu Beginn ihrer anwaltlichen Tätigkeit. Inzwischen hatte sie alle Protokolle des Ermittlungsverfahrens auf einem Tablet. Aber ganz so federleicht war die Tasche dann doch nicht: Dazu kamen noch ein Laptop, diverse Ladekabel und eine Reihe von Papierdokumenten, die das Gericht unbedingt per Post verschicken wollte, obwohl es schon vor einigen Jahren auf digitale Aktenführung umgestellt hatte. Außerdem hatte sie Energieriegel, Energydrinks und einige Dosen mit Nahrungsergänzungsmitteln dabei. Zeit zum Mittagessen fand sie nur selten. Der Boden des Amtsgerichts war wunderschön, die Fossilien im Marmor sammelten sich unter ihren Füßen, als wäre die Institution direkt auf einem prähistorischen Meer erbaut worden, als gäbe es das Stockholmer Amtsgericht, die Hallen der Justitia, schon länger als die Stadt selbst. Das war ein Irrtum: Das Recht war ein menschliches Produkt. Es gab kein Richtig und Falsch außerhalb der Regeln des Gesetzgebers, keine von der Natur gegebene Ethik. Moral war persönlich und variabel oder Teil eines religiösen oder philosophischen Systems. Das Gesetz hingegen war klar und einfach zu verstehen; es war, was es war, unabhängig von Religion, Philosophie oder persönlicher Meinung. Sie mochte starr und unsensibel sein, aber sie liebte ihre Arbeit.
Jetzt musste sie nur noch in ihr Büro fahren, ein paar Dinge erledigen und dann Lucas abholen. Die Wachen an der Sicherheitskontrolle nickten ihr zu, sie war hier ein bekanntes Gesicht.
Die Luft draußen war kühl, die Sonnenstrahlen sanft, aber sie wärmten nicht. Ein schöner Hochsommertag. Emelie stand oben auf der Treppe. Unten lag die Scheelegatan. Teddy nannte sie immer eine Avocado, einen Menschen mit einem harten Äußeren und einem harten Inneren. Lucas dagegen sagte, sie arbeite als Advokado – seine Art, sich auszudrücken, gefiel ihr viel besser. Nicht nur, weil er das Wort falsch aussprach, sondern auch, weil er ihren Titel und ihren Beruf kannte.
Hinter sich hörte sie Schritte, die zu ihrem eigenen Takt passten, jemand folgte ihr die Treppe hinunter.
Es war der Polizist, Gabriel Dolk. Vielleicht war er wütend – falls ja, dann war es nicht das erste Mal, dass ein Polizist ihr einen bösen Blick zuwarf.
Die Haarfarbe des Polizisten war schwer zu bestimmen, ähnlich wie ihre eigene, in manchen Lichtverhältnissen dunkelblond, in manchen kompakt dunkel, aber sein Kinn war wie das von Teddy, stark und ausgeprägt.
»Das haben Sie gut gemacht«, sagte er.
»Danke.«
Sie kamen unten an der Straße an. Gabriels Haltung war gerade, er wirkte größer, als er war.
»Aber es kann nicht ewig so weitergehen.«
»Was meinen Sie damit?«
»Die Banden müssen verschwinden. Und Sie stehen dieser Säuberung im Weg.«
»Jeder hat ein Recht auf Verteidigung, das ist immer noch wichtig. Auch auf Privatsphäre.«
Gabriel Dolk spuckte Kautabak auf den Boden. »Hören Sie auf mit den Plattitüden. Was Sie heute gemacht haben, hat nichts mit Verteidigung zu tun. Das Einzige, was passiert, ist, dass ein Schwerverbrecher weiter Menschen schaden kann.«
Sie überlegte, ob sie diesen Idioten zurechtweisen oder einfach auf dem Absatz kehrtmachen und gehen sollte.
Da klingelte ihr Telefon, eine unterdrückte Nummer, normalerweise jemand von der Polizei.
»Hallo, hier ist das Polizeirevier Flemingsberg. Wir haben einen Verhafteten, der Sie als Pflichtverteidigerin verlangt. Anscheinend ein alter Mandant von Ihnen.«
»Aha. Wie ist sein Name?«
»Er weigert sich, ihn zu nennen. Sie können mit ihm sprechen.«
Emelie hörte eine andere Stimme am Telefon.
»Hallo, Emelie.«
Sie schnappte nach Luft – Nikola. Teddys Neffe und Lucas’ geliebter Cousin. Nikola, den sie vor langer Zeit bei einem Raubüberfall verteidigt hatte. Nikola, von dem sie glaubte, dass er sich gebessert hatte. Er hatte sogar seinen Nachnamen von Maksumic in Lind geändert, wahrscheinlich wollte er nicht mehr mit seinem Onkel in Verbindung gebracht werden.
Gabriel Dolk stand ihr immer noch gegenüber und wartete darauf, das Gespräch fortzusetzen.
»Ich habe keine Zeit für eine Diskussion«, sagte sie und ging. Dabei flüsterte sie ins Telefon: »Was hast du angestellt?«
4 Isak
Die Aussicht in dem Besprechungszimmer war herrlich. Unter Isak erstreckte sich Stockholm, so weit er sehen konnte. Das war seine Stadt, vielleicht sollte er sie auch seine Hölle nennen. Die Reise, die er hinter sich hatte, wurde ihm besonders bewusst, wenn er hier oben stand, hoch über den Gebäuden und Straßen. In einem solchen Raum fühlte er sich immer wie ein Fremder, ganz gleich, in wie vielen Luxushotels er übernachtete, wie viele Luxusrestaurants er besuchte, wie viel Geld er hatte, als wäre er nicht mehr Teil dessen, was ihn hierher gebracht hatte.
Isak erinnerte sich an alles, auch an Details, die er lieber vergessen hätte. War er ein schlechter Mensch? Er kannte die Antwort auf diese Frage nicht, aber er wusste, dass er das Beste getan hatte, was er unter den gegebenen Bedingungen tun konnte. Vielleicht hatte er nicht immer richtig gehandelt, doch die Umstände hatten ihm keine Wahl gelassen. Vielleicht belog er sich aber auch selbst, wie die Mädchen, die er manchmal zum Golfspielen nach Smådalarö mitnahm und die so taten, als gehörten sie zur schwedischen Oberschicht, nur weil sie in einem Range Rover vorfuhren. Oder dass er so tat, als wäre er selbst Schwede, nur weil seine Eltern zufällig hierher geflohen waren. Aber so durfte er jetzt nicht denken, das war destruktiv – er wusste, wie das Land für manche Menschen sein konnte. Er war ganz unten gewesen und hatte sich wieder hochgearbeitet. Jetzt war er bereit, auf die andere Seite zu wechseln.
In zwei Stunden würde er etwas tun, was kaum jemand in seiner Welt getan hatte. Er würde aussteigen, gehen, sauber werden. Oder technischer ausgedrückt: Er würde ein Immobilienportfolio durch eine komplizierte Regelung, die er selbst nicht verstand, die ihm aber seine Anwälte mehrfach erklärt hatten, übertragen und damit die letzten Spuren der Straße auslöschen. Im Klartext: Die Überreste seines früheren Lebens würden gewaschen, verändert und in etwas Legales verwandelt werden, und in dem Moment, in dem dies geschah, würde auch er in gewisser Weise seine Geschichte zurücklassen und zu etwas Neuem werden. Zum ersten Mal in Isaks Leben als Erwachsener würde er legit sein, praktisch unantastbar, ein normaler Bürger. Er würde nicht mehr Teil der Nacht sein, sondern Teil des Tages. Er würde den Stress des Ghettos und die Albträume loswerden. Er würde endlich ruhig schlafen können.
Die meisten Menschen, die das durchgemacht hatten, was Isak erlebt hatte, die gesehen hatten, was er gesehen hatte, und die vor allem getan hatten, was er getan hatte, waren entweder unter der Erde oder in einer Zelle gelandet. So wie Dragan Joksovic vor langer Zeit oder Berno, wie Jonas Falk und Radovan.
Es gab einige, die entkommen waren, aber die meisten von ihnen waren völlig fertig mit der Welt, sie hatten nicht genug Reichtum geschaffen, um finanziell unabhängig zu sein, oder nicht genug Einfluss, um sicher zu sein. Sie waren gezwungen, wie jeder andere zu schuften und auf der untersten Ebene zu arbeiten wie in jüngeren Jahren, während die schwedischen Strafverfolgungs- und Steuerbehörden sie jagten. Dann gab es einen winzigen Prozentsatz, der es schaffte durchzukommen, der nie zu langen Haftstrafen verurteilt wurde, der nicht erschossen wurde oder in der Hierarchie abstieg, sondern immer umzog, das Land verließ, nach Serbien oder Dubai ging, nach London oder in den Libanon.
Nur einer hatte die Wende geschafft und war zugleichan der Spitze geblieben, nur einer hatte die Straße in good standing verlassen und war hier in Schweden ein ganz normaler Mensch geworden. Jeder kannte seinen Namen: Emilijan Mazer-Pavić, den die meisten nur Kum nannten. Isak würde so einzigartig sein wie Stockholms ehemaliger Pate. Er würde es schaffen, weil er jahrelang alles geplant und sich vorbereitet hatte und weil er die richtigen Anwälte hatte. Es gab noch einen Grund, warum er der Zweite sein würde, der es schaffte – aber darüber wollte er jetzt nicht nachdenken.
Die Tür öffnete sich fast lautlos, und einer der Anwälte schlenderte herein – jedenfalls kam es Isak so vor, als schwebte Magnus Hassel geradezu, und doch trug er ein Paar handgemachte Schuhe für fünfzehntausend Kronen mit Ledersohlen und Zeheneisen – »die müssen vertieft werden, Isak, sonst werden die Zeheneisen zu überflüssigem Unsinn«.
Der Anwalt lächelte. »Sind Sie irgendwie krank, mein Freund?«
Isak grinste. »Weil ich pünktlich bin, meinen Sie?«
»Ja, ein bisschen. Das sieht Ihnen nicht ähnlich, aber ich verstehe, dass Sie nichts verpassen wollen, heute ist ein großer Tag.«
Das stimmte, wenngleich der eigentliche Grund für sein pünktliches Erscheinen die Besichtigung einer dreihundert Quadratmeter großen Wohnung in der Grevgatan war, die er gerade hinter sich hatte. Grevgatan – das klang sehr gut. Ein Graf – das war er, und von nun an würde er zum Frälset gehören, dem höchsten Adelsstand im kriminellen Stockholm. Oder vielmehr der höchsten Kaste des Systems, das er verlassen wollte.
Seine zweite Anwältin kam herein, eine fünfunddreißigjährige Frau namens Josephine. Sie hatte einen Rollwagen voller Akten und Papiere bei sich, trug wie immer einen schicken Anzug, aber unnötig große Ohrringe, die im Licht der Panoramafenster funkelten. Jossan, wie Magnus sie nannte, schob den Wagen mit leichter Hand vor sich her, und das Schönste an ihr war nicht nur, dass sie sich so sicher bewegte, sondern auch, dass sie so verdammt teuer aussah. Isak wusste, dass sie das Gehirn war. Magnus Hassel hatte es nie laut ausgesprochen, aber Isak hatte es sofort gemerkt: Josephine war diejenige, die hier das Denken übernahm.
Sie hatte hier gearbeitet, als vor ein paar Jahren die ganze Kanzlei in die Luft geflogen war. Isak wollte nicht an diese Scheiße denken, aber er wusste, dass Teddy irgendwie damit zu tun hatte. Gleichzeitig war das der Grund, warum er sich gerade diese Kanzlei ausgesucht hatte – er fühlte sich schuldig.
Sie warteten. Alles war für das signing vorbereitet, der Käufer und seine Anwälte würden bald eintreffen, ein paar Kleinigkeiten würden überprüft und die Verträge in due order unterzeichnet werden, wie Magnus es ausdrückte – er benutzte gerne englische Wörter, um die Dinge schwieriger erscheinen zu lassen, als sie waren, das merkte man.
Josephine redete nur Schwedisch. Wahrscheinlich begriff sie, dass dies ein schwedisches Wunder war. Isak hatte heute absichtlich ein T-Shirt angezogen, seine Tätowierung war deutlich zu erkennen, der syrische Adler. Nur weil er die Straße verließ, hieß das nicht, dass er nicht weiterhin wie er selbst aussehen würde.
»Haben Sie irgendwelche Tätowierungen?«, fragte er, als er sah, dass sie den Adler bemerkt hatte.
Josephine zeigte auf ihren Arm. »Zwei Tattoo-Ärmel, um genau zu sein. Haben je sechzig Riesen gekostet.«
Damit hatte er nicht gerechnet, wirklich nicht. Sie lachte. »Das war ein Scherz, Isak.«
Die Tür zum Besprechungsraum öffnete sich, diesmal geräuschvoll. Der Käufer, Kim Barent, unterhielt sich lautstark mit seinen Anwälten, die hinter ihm her tappten.
»Wissen Sie, warum sich Mädchen immer im Gesicht kratzen, wenn sie aufwachen?«, sagte Barent und zwinkerte Josephine zu. »Weil sie keine Eier haben.«
Er lachte laut und brüllend.
Magnus Hassel war der Einzige, der lächelte, und das war gut so, denn jetzt sollte die Stimmung locker und gelöst sein, und es war nicht der Moment, eine Szene zu machen. Isak wusste, dass in der Konferenzküche drei Flaschen Dom Pérignon kühlten.
Sie gaben sich die Hand, und Kim Barent nahm Platz. Der Stahltisch war modern und minimalistisch. Barents Anwälte begannen, die Verträge und Anhänge durchzugehen, aber nicht, um sie genauestens zu prüfen, denn das hatte seine Anwältin in den letzten Nächten schon drei- oder viermal getan. Josephine übersah kein Komma. Es war nur ein Spiel. Wahrscheinlich wollten die Anwälte ein letztes Detail aushandeln, obwohl sie wussten, dass alles geregelt war.
Josephine hatte ihre Lakaien rote und grüne Post-it-Zettel an die Stellen kleben lassen, wo sie unterschreiben sollten. Selbst ein Blinder konnte nicht übersehen, wo der Stift anzusetzen war.
In einer Stunde war Isak einer, deres geschafft hatte.
Die Anwälte diskutierten und stritten über Kleinigkeiten.
Kim Barent beugte sich über den Tisch und sprach ihn direkt an. »Ich finde, wir sollten mit einem richtigen Füller unterschreiben.« Er holte ein ledernes Etui hervor und zog einen dicken Füllfederhalter heraus, einen Montblanc mit einem Diamanten an der Spitze, eingefasst in Glas, als wäre er ein winziges Museumsstück oder eine dieser Spielzeugkugeln, die man schüttelt, damit es schneit. Der Diamant funkelte stärker als Josephines Ohrringe.
Plötzlich: eine Hand auf Isaks Schulter. Es war Josephine, die sich vorbeugte.
»Sie müssen mal kurz mit rauskommen.« Ihre Stimme klang unsicher, nicht so selbstbewusst und voller Autorität wie sonst.
»Was?«
»Lassen Sie uns das draußen klären«, flüsterte sie. Ihre hochhackigen Schuhe glänzten.
An den Wänden des Flurs hingen düstere Gemälde. Ein weißer Hintergrund mit breiten schwarzen Linien in dicker Farbe. Ein halbnackter Mann, dessen Gesicht mehrere Profile auf einmal hatte.
»Ihr Sohn hat angerufen«, sagte Josephine.
»Wen, Sie?«
»Ja, gerade eben, er sagt, er kann Sie nicht erreichen. Sie sollen ihn zurückrufen.«
»Worum geht es, hat er etwas gesagt?«
Josephine runzelte die Stirn, sie sah älter aus, als sie war, obwohl sie sich bestimmt an manchen Stellen Botox spritzen ließ. »Nein«, sagte sie. »Er hat nichts gesagt, nur dass es sehr dringend ist.«
»Warum hast du dein Handy ausgeschaltet?«, war der erste Vorwurf, den Max ihm entgegenschleuderte.
»Was ist passiert?«, fragte Isak, der sich nicht streiten wollte, obwohl er und sein Sohn seit Monaten nicht miteinander gesprochen hatten und Max’ Ton unverschämt war.
»Sie sind hinter mir her, Papa.«
»Wer?«
»Hol mich einfach«, zischte Max, und jetzt konnte Isak hören, wie er keuchte. »Es wird nichts passieren, wenn ich bei dir bin.«
»Was könnte passieren?«
»Ich habe jetzt keine Zeit … Papa.«
»Max?«
Im Hintergrund war ein Rauschen zu hören, die Stimme des Sohnes verschwand für ein paar Sekunden, dann: »Papa, hol mich vor dem Fittja-Einkaufszentrum ab. Bitte.«
Er erstarrte nicht, das war ein Ausdruck, den sich Leute ausgedacht hatten, die selbst noch keine ernsten Situationen erlebt hatten. Niemand erstarrte, es fühlte sich nie so an. Stattdessen zog sich alles um ihn herum zusammen, die Wände des Korridors neigten sich, die Luft drückte gegen seine Schläfen, das durch das Fenster hereinfallende Licht verursachte ein Schwindelgefühl in ihm. Er fröstelte nicht, er erstickte.
»Ich komme«, brachte er hervor.
»Jetzt?«
»Jetzt.«
Es gab ein Prinzip: Isak fiel nie. Er handelte.
Kim Barents Anwalt entblößte seine Zähne – sie waren amerikanisch weiß. »Dann sind wir uns ja einig. Kommt der feine Füller jetzt zum Einsatz?«
Isaks wichtigster Deal aller Zeiten, die Unterzeichnung aller Verträge würde vielleicht zehn Minuten dauern.
Magnus Hassel hatte Schweißperlen auf der Stirn wie Morgentau, während Josephine vollkommen cool war – sie erinnerte an einen erfahrenen Verbrecher kurz vor einem Raubüberfall.
Kim Barent strahlte, stand auf und beugte sich über die Papiere, bereit zu unterschreiben. Der Deal war perfekt.
»Ich kann jetzt nicht«, sagte Isak.
Kim Barent hob den Kopf. Seine Augen waren grau, nicht grün-blau oder gesprenkelt, sondern einfach grau, und in diesem Moment standen sie aus seinem Gesicht hervor wie Glaskugeln, die in Schlamm getaucht waren.
»Mein Sohn braucht mich«, sagte Isak. »Ich muss gehen.« Barent wollte etwas sagen, aber Isak hörte nicht zu.
Die Blicke brannten in seinem Nacken, als er den Raum verließ.
5 Teddy
Der Taxifahrer behauptete, auf diesem Straßenabschnitt habe die Geschwindigkeitsbegrenzung bei hundertzwanzig gelegen, bis die Idioten in Madrid letzten Monat beschlossen hätten, sie auf achtzig zu senken.
»Ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich lasse nicht zu, dass das Festland die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Mallorca bestimmt.«
Teddy konnte Madrid verstehen. Die Autobahn oder la carótida, wie der Fahrer sie nannte, war alles andere als für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Schmale Spuren, scharfe Kurven und Autos, die so nah von hinten heranfuhren, als wollten sie die Arschhaare des Vordermanns studieren. Teddy fluchte innerlich. Geschwindigkeitsbegrenzungen – was war das für ein Müll? Hatten die Jahre mit Emelie aus ihm einen Festlandspanier gemacht?
Die warme Luft strömte durch das heruntergekurbelte Fenster herein, als würde jemand einen Fön auf ihn richten. Die Berge hoben sich von einem Himmel ab, der so unglaublich blau war, als hätte jemand einen Instagram-Filter über die ganze Insel gelegt.
Ihm war übel. Er wusste immer noch nicht, ob er sein Vorhaben wirklich durchziehen konnte. Teddy hatte dieses Leben schon einmal gelebt, es hatte ihm acht Jahre Gefängnis eingebracht. Er war ein Idiot, weil er wieder hier war, weil er es erneut versuchte. Er sollte dem Fahrer sagen, dass er ihn zurück zum Flughafen bringen solle.
Nach der Trennung hatte er sich in seine eigene Welt zurückgezogen und versucht, das bisschen Familienleben zu bewahren, das ihm mit Lucas geblieben war. Auf Nachrichten von seinen alten Freunden Dejan, Loki, Tagg und den anderen hatte er nicht geantwortet. Er zog sich zurück, ging abends und nachts spazieren, fuhr nach Södertälje, Norsborg, Fittja, in seine alten Viertel. Er konnte die Nacht, die Straße nicht komplett sein lassen, er beobachtete den Drogenhandel, die Gruppen, die Verhältnisse.
Emelie hatte Lucas, und wenn sie anrief, sagte er, er trinke ein Bier mit Dejan oder gehe mit den Kampfhunden seines Freundes, The Mauler und Khabib, Gassi. Er war allein, in seiner eigenen Blase. Sie würde ihn nicht verstehen, Bojan und Linda auch nicht. Nur Nikola, denn der war auch da draußen, frei, aber mit ihm wollte Teddy nicht so reden. Er war Nikolas Onkel, kein gleichrangiger Freund.
Er hatte verstanden, dass er seinen eigenen Weg gehen musste. Er wusste diesmal, warum er tat, was er tat. Er handelte langfristig, auf einer ganz anderen Ebene als früher.
Irgendwann würde er mit Lucas nach Mallorca fliegen, nur sie beide. Vielleicht würde Nikola mitkommen. Er war nett zu seinem kleinen Cousin, sie hatten eine natürliche Verbindung, sie fanden sogar dieselben Witze lustig, wirklich. Teddy und Nikola würden in der Sonne sitzen, und Lucas würde am Strand spielen, im Sand buddeln, im Meer planschen – Strände waren magische Orte, sie boten so viel mehr Unterhaltung als zehn Bildschirme. Vor ein paar Jahren waren sie zusammen an einem solchen Ort gewesen, die ganze Familie: Emelie, er selbst, Lucas und dazu Linda und Nikola. Eklundsnäsbadet hieß der Ort. Badeplätze in Schweden waren so weit von Teddys Lebensraum entfernt wie nur möglich, er fühlte sich eher auf einer Zirkusbühne zu Hause als am Strand. Es war nicht so, dass er sich für seinen Körper schämte – er war einer der Fittesten dort –, es war etwas anderes: der Familiensinn. Alle schienen so selbstverständlich mit ihren Familien umzugehen.
Sie hatten nebeneinander auf den Klappstühlen gesessen, die Linda mitgebracht hatte, und Lucas beobachtet. Der Sand, der Steg und der Rettungsring, der an einem Baum hing, die anderen Kinder, eine sehr angenehme Stimmung – vielleicht konnte Teddy es doch genießen. »Weißt du, das ist ein See, das Wasser ist warm. Du kannst mit Lucas schwimmen gehen«, sagte Emelie. »Aber wir haben doch gerade gegessen«, sagte Teddy. Linda schnaubte. »Das ist ein Märchen, Bruder. Nikola, geh mit deinem Onkel und deinem Cousin ins Wasser.«
Teddy und Nikola nahmen Lucas an die Hand und gingen ins kühle Nass.
»Nicht gerade das Mittelmeer, aber wenigstens nicht eiskalt«, sagte Nikola.
»Eis«, rief Lucas.
Nikola lachte und bespritzte seinen Cousin mit Wasser.
Lucas rief »Eiswasser« und begann, Nikola nass zu spritzen. Teddy mochte es nicht, nass zu werden, aber er liebte es, ihnen bei ihrer Wasserschlacht zuzusehen.