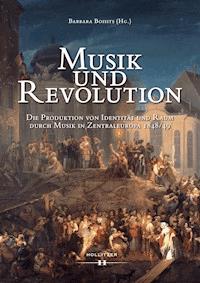
Musik und Revolution E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hollitzer Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Keine Revolution kommt ohne Musik aus, und dennoch wird dieser Zusammenhang selten thematisiert. Das gilt insbesondere für das "tolle Jahr" 1848. Der Bedarf an Revolutionsmusik war groß: jede Kompagnie einer Nationalgarde oder Akademischen Legion wollte ihre eigenen Lieder und Märsche. Diese erklangen bei Aufzügen, Fackelzügen, Fahnenweihen, in den Straßen, auf den Barrikaden, in Konzerten und sogar in den Salons. Auch bekannte Lieder wie das studentische Fuchslied oder die Kaiserhymne wurden in den Dienst der Revolution gestellt. So gut wie alle Komponisten dieser Zeit (darunter auch einige Komponistinnen) beteiligten sich an der Produktion einschlägiger Werke, viele MusikerInnen an deren Ausführung, wenngleich so mancher sich in der nachrevolutionären, neoabsolutistischen Phase wieder davon distanzierte. Auch die Konzert- und Theaterprogramme reagierten musikalisch auf die politischen Ereignisse. Im Zentrum der Untersuchung steht Wien, doch wird der musikalischen Seite der Revolution auch in Graz, Klagenfurt, Triest, Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Budapest, Pressburg, Prag und in Lombardo-Venetien wird nachgegangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1094
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
MUSIK UND REVOLUTION
DIE PRODUKTION VON IDENTITÄT UND RAUMDURCH MUSIK IN ZENTRALEUROPA 1848/49
Herausgegeben vonBARBARA BOISITS
LEKTORAT: BARBARA BOISITS (Wien, Österreich),
LAYOUT UND COVERDESIGN: DANIELA SEILER (Wien, Österreich)
BARBARA BOISITS (Hg.): Musik und Revolution.
Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49
Wien: HOLLITZER Wissenschaftsverlag 2013
© HOLLITZER Wissenschaftsverlag, Wien 2013
HOLLITZER Wissenschaftsverlag
Trautsongasse 6/6, A–1080 Wien
Eine Abteilung der
HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH
Stadiongasse 6–8, A–1010 Wien
www.hollitzer.at
Alle Rechte vorbehalten.
COVERBILD: ANTON ZIEGLER,Die Barrikade auf dem Michaelerplatzin der Nacht vom 26. auf den 27. Mai (1848), © Wien Museum
RÜCKSEITE:Flugschrift gegen die Liguorianer
© Institut für Österreichische Geschichtsforschung
Die Abbildungsrechte sind nach bestem Wissen und Gewissen geprüft worden.
Im Falle noch offener, berechtigter Ansprüche wird um Mitteilungdes Rechteinhabers ersucht.
Für den Inhalt der Beiträge sind die Autorinnen bzw. Autoren verantwortlich.
ISBN 978-3-99012-127-6 hbk
ISBN 978-3-99012-128-3 pdf
ISBN 978-3-99012-129-0 epub
VORWORT
Der vorliegende Band ist zum einen das Ergebnis einer internationalen Tagung, die unter dem Titel Die Revolution 1848/49und die Musik im November 2008 von der damaligen Kommission für Musikforschung (seit 2013 Abteilung Musikwissenschaft des Instituts für kunst- und musikhistorische Forschungen) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien veranstaltet wurde. Zum anderen wurde für die Druckfassung die Zahl der Beiträge erheblich erweitert, um insbesondere den räumlichen Aspekt bzw. die zentraleuropäische Perspektive in ihrer faszinierenden Vielheit aufzuzeigen.
Die Thematik verdankt sich dem Forschungsprojekt Musik – Identität – Raum (MIR), das von 2007 bis 2012 unter der Leitung von Gernot Gruber an der Kommission für Musikforschung durchgeführt wurde und das neben drei weiteren historischen Schnittstellen auch die Rolle der Musik in der Revolution 1848/49 untersuchte.
Mein Dank gilt allen Beiträgerinnen und Beiträgern des Bandes sowie Angelika Roch für ihre organisatorische Unterstützung bei der Tagung, Daniela Seiler, die für das Layout des Bandes verantwortlich zeichnet, Michael Hüttler vom Hollitzer Wissenschaftsverlag für sein Engagement und die unkomplizierte Zusammenarbeit, nicht zuletzt aber Gernot Gruber, der mit dem MIR-Projekt dieses Thema überhaupt erst ermöglicht und stets interessiert verfolgt hat.
Während der Redaktionsarbeiten verstarb unsere so überaus geschätzte Kollegin, die Volksmusikforscherin Gerlinde Haid. Dieses Buch sei daher auch Ihrem Andenken gewidmet.
BARBARA BOISITS, im September 2013
PIETER M. JUDSON
ABOUT THIS BOOK
What happens when we place music – its performance, its ability to create group coherence, its creative influence – at the center of our historical investigations rather than at the margins? What would happen if we viewed musical practice as a constitutive element of the revolutions of 1848/49, without which we could not truly understand what these events meant to their participants? Why is it that music, a phenomenon that gave coherence to often contradictory revolutionary demands, that helped to shape revolutionary identities, and that formed common meanings for activists in 1848, has remained strangely marginal to historians’ research?
This remarkable volume goes a long way to answering those questions by treating music – its production, performance, emotional impact, and meanings – as a central factor in the revolutions of 1848/49 in Habsburg Central Europe. Whether encountered on the streets, on the barricades, in private salons or in public concert halls, music generated a powerful sense of common purpose from the very first moments of the March revolution. The essays in Musik und Revolution explore the ways in which musical performance created sites of revolutionary commitment in Habsburg Central Europe. It also demonstrates how music gave meaning to revolutionary events (often by memorializing them), and how music helped to popularize new ideological forms of identification such as nationalism. As Barbara Boisits asserts in her programmatic introduction, many of the scholars in this volume investigate the role of music specifically in the context of its performance.
Musical performances – both formal and informal – forged the momentary and lasting solidarities in the streets that produced common understandings of politics in 1848/49. Music, we learn, was critical to the creation of viscerally experienced group cohesion. One’s very participation with others in a musical performance, whether in a rowdy Katzenmusik on the street or in a choir memorializing the March fallen, stimulated a powerful sense of common political purpose. Individuals within the crowds that massed in Vienna, Ljubljana, Prague, Trieste, or L’viv demanding revolutionary change in March 1848 often held very different visions of what ought to follow the revolution. In the weeks and months after the heroic March days, for example, initial solidarities fell apart, thanks to conflicts over particular issues. On the other hand, however, musical performance helped to solidify a popular sense of community identity, and to give common meaning to the often-vague demands made by people who belonged to very different social groups.
The questions addressed by the authors in this volume are less about the content of particular musical texts (whether they were, for example, openly political), but rather, about the ways in which musical performances generated political activism and gave meaning to confusing events. Thus, where we might once have studied specific texts for their revolutionary messages, or musical institutions for their potentially political programs, the essays in this volume focus more on examining context and performance history.
Clearly 1848/49 was indeed a musical year in many senses! Musical performances became sites of patriotic and revolutionary outbursts. Poems written in the first glow of revolutionary accomplishment were set to music almost simultaneously and immediately sung. In the weeks following the revolution’s outbreak in March, for example, music accompanied public and private memorials to the fallen and thus helped to define the meaning of revolutionary sacrifice. Music was also indispensable at ceremonies to honor National Guard and Academic Legion companies, from flag dedications to festive parades. A particularly important contribution made by this volume is the argument that music and its performance could create a perception of revolutionary space as well as identity. The music of 1848 defined the spaces in which it was performed as political spaces, spaces whose occupants shared similar revolutionary commitments. One can also apply this argument to new forms of identification and loyalty in 1848, such as the nation. Nationalist songs in various regions of the Habsburg Monarchy identified certain spaces with specific (Czech, Italian, Hungarian, Polish, Slovak, German, etc.) cultural identities, not only where these songs were sung but also in the lands claimed for the nation in their texts. If, as Benedict Anderson and others have argued, the concept of a national community is an abstract one, then the singing of national songs was an effective way to make the abstract concept of national territory real. Moreover, songs themselves helped to define an identity for the nation by claiming for it specific attributes such as bravery, loyalty, or fairness.
This volume offers a range of intellectually exciting comparative, cultural, and transnational approaches to the study of music in 1848/49. It also proposes several highly promising avenues for future research and analysis. Above all, the essays here demand that we rethink the ways we have interpreted the society of mid-nineteenth-century and the revolutionary moment in Europe as a whole.
PIETER M. JUDSON
Department of History and Civilization
European University Institute
Florence
BARBARA BOISITS
EINLEITUNG
REVOLUTIONSMUSIK: EIN GEGENSTAND DER MUSIKWISSENSCHAFT?
Vor wenigen Jahrzehnten hätte es im deutschen Sprachraum noch einer besonderen Rechtfertigung bedurft, im größeren Umfang dem Zusammenhang zwischen einer Revolution und dem gleichzeitigen Musikschaffen und -leben nachzugehen, ohne sofort nach den Spuren der politischen Ereignisse im Werk selbst oder wenigstens in den Musikinstitutionen zu suchen.1 Fragen nach einem notwendigen Zusammenhang von politischen und künstlerischen Erneuerungen, genauer nach den kompositions- wie institutionengeschichtlichen Konsequenzen revolutionärer Umwälzungen, hätten also im Mittelpunkt stehen müssen. Ein solcher entwicklungsgeschichtlicher Ansatz läuft allerdings Gefahr, weniger zu fragen, was war, als vielmehr, wohin es geführt habe.
Die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der Revolution von 1848/49 auf die Musik selbst sowie auf institutionengeschichtliche, musikästhetische und -historiographische Entwicklungen mit einem Seitenblick auf die Situation von Literatur und bildender Kunst werden auch in diesem Band ausführlich thematisiert. Zunächst richtet sich das Interesse allerdings auf die vielfältigen Formen von Musik, derer sich die Revolution bedient hat und bedienen musste, sowie auf die Bedeutung, die sie für die damaligen Musikschaffenden und das Musikleben hatte. Kaum ein Dichter (mitunter brachte auch die Revolution erst einen solchen hervor), kaum ein Musiker, der von ihr nicht betroffen war; kaum einer, der nicht zur Märzbegeisterung mit eigenen Werken beigetragen hat; aber auch kaum einer, der nicht im weiteren Verlaufe den äußeren oder inneren Rückzug antrat, als ein Sieg nicht mehr möglich schien. Während der Unruhen war das öffentliche Musikleben in Gestalt von Opern- und Konzertaufführungen drastisch eingeschränkt. Umso mehr dominierte die Musik auf der Straße: Studentenlieder, Nationalgarden- und Katzenmusik beherrschten den öffentlichen Raum. Beim Exerzieren, bei Umzügen, bei Protestveranstaltungen war Musik geradezu von existentieller Notwendigkeit, ohne sie das Marschieren, Defilieren und Protestieren gar nicht denkbar. Musik wurde dabei zwangsläufig funktionalisiert, sie war aber auch ein eminent wirkender Faktor, der bei der emotionalen Mobilisierung der Massen eine entscheidende Rolle spielte.
Die Idee zu diesem Buch und dem ihm vorangegangenen Symposion im Jahre 2008 entstand im Rahmen des mittelfristigen Forschungsprojektes Musik – Identität – Raum an der Abteilung Musikwissenschaft des Instituts für kunst- und musikhistorische Forschungen (bis 2012 Kommission für Musikforschung) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.2 Ziel dieses Projektes war die vergleichend-differenzierende Untersuchung von vier historischen Schnittstellen (um 1430, 1740, 1848, 1945–55/56), die in der bisherigen, auf Österreich bezogenen Musikgeschichtsschreibung wenig Aufmerksamkeit erfahren haben (im Vergleich etwa zur „Wiener Klassik“ oder „Wiener Moderne“ um 1900). Unter kulturwissenschaftlicher Perspektive standen bei allen vier Teilprojekten Fragen der Bildung kollektiver Identitäten3 im zentraleuropäischen Raum mit Hilfe von Musik im Mittelpunkt. Die Entstehung und Aufrechterhaltung des Zusammengehörigkeitsgefühls einer (sozialen, nationalen, ethnischen, religiösen, kulturellen, politischen usw.) Gruppe bedarf ja neben gemeinsamen Erzählungen – im nationalen Kontext oft in Gestalt langlebiger Ursprungsmythen – vor allem griffiger Symbole und symbolischer Handlungen (Rituale). Gemeinsame Lieder, Fahnen oder Denkmäler markieren den tatsächlichen oder imaginierten Geltungsbereich eines Kollektivs, mittels festgelegter und genau wiederholter Rituale wird die Sozialisierung eingeübt. Der Konstruktion von Identität ist aber stets, und dies gilt verstärkt von Umbruchzeiten, jene von Alterität inhärent. Der Identität steht die Differenz gegenüber, dem Eigenen das Fremde. Beide verbindet ein dialektisches und im Revolutionsjahr 1848 auch ausgesprochen dynamisches Verhältnis.
Denn von welcher Revolution sprechen wir eigentlich: vom bürgerlichen Kampf um Emanzipation, um Gewährung von Grundrechten wie Presse- und Glaubensfreiheit und einer Verfassung, die die politische Mitbestimmung garantiert, oder vom sozialen Kampf der nicht nur entrechteten, sondern von schlimmster Armut bedrohten Arbeiter und Bauern? Für wen war das Ziel eine reformierte, d. h. konstitutionelle Monarchie, wer kämpfte für eine Republik? Die Einigkeit der Märztage, eindrucksvoll zur Schau gestellt bei der Massenkundgebung anlässlich des Begräbnisses der ersten Revolutionsopfer, währte nicht lange. Die sozialen, nationalen und religiösen Spannungen machten auch vor der Revolution nicht Halt und verhinderten bald ein gemeinsames Vorgehen. Und so bedeutet das Jahr 1848 auch eine gewaltige Zunahme des Nationalismus sowie des Antisemitismus, beide paradoxer Weise gerade durch die Erfüllung einer der Forderungen der Revolution, nämlich der nach Aufhebung der Zensur, gewaltig angefacht. Die Ziele der sich um einen großdeutschen Nationalstaat in den Grenzen des Deutschen Bundes bemühenden Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche waren nicht dieselben wie jene des in Wien und Kremsier tagenden österreichischen Reichstages, dessen Abgeordnete sich auch aus den mehrheitlich slawischen Kronländern zusammensetzten. Der Freiheitskampf der Ungarn zielte – wie bei den Italienern in Lombardo-Venetien – auf eine Loslösung vom Habsburger Reich, strebte aber für seine nicht-magyarische Bevölkerung eine stark zentralistische Lösung an, was unter anderem dazu führte, dass sich die Kroaten unter Ban Josip Jelačić im nationalen Kampf lieber mit den Kaiserlichen als mit den revolutionären Ungarn verbündeten bzw., wie auch die Tschechen, Slowaken und Slowenen, zwischen pan- und austroslawistischen Lösungen schwankten. Auch der Wunsch nach nationaler Selbstbestimmung hatte also viele Gesichter.
Die Absetzung der verschiedenen revolutionären und antirevolutionären Gruppierungen voneinander sowie die Kohärenz nach innen wurden – gerade auf der wichtigen emotionalen Ebene – symbolisch hergestellt. Die Fahne der Revolution in Österreich war schwarz-rot-gold: Sie wehte vom Stephansdom, mit ihr wurde die Statue Josephs II., des „deutschen“ Habsburgers, am Josephsplatz geschmückt. Ihre musikalische Entsprechung fand sie in Ernst Moritz Arndts bereits 1813 verfasstem Gedicht Des Deutschen Vaterland in der Vertonung von Gustav Reichardt, programmgemäß oder ad hoc aufgeführt bei zahllosen Demonstrationen, Fackelzügen, Fahnenweihen und anderen Feierlichkeiten, bei Gedenkveranstaltungen, Konzerten und Akademien, im Theater und im Freien. Dieses musikalische Manifest imaginierter Gebietsansprüche hatte auch Nachahmer und kannte unter anderem ein österreichisches (Joseph Dessauers Des Oesterreichers Vaterland) und italienisches Pendant (Antonio Gazzolettis La patria dell’Italiano).
In Ungarn war es das Nationallied ( Nemzeti dal) Sándor Petőfis, das den Unabhängigkeitsbestrebungen populären Ausdruck verlieh. Es gehört zu den musikhistorischen Topoi jener Zeit, dass solche Gedichte noch am Tage ihrer Niederschrift vertont wurden bzw. während des Einsatzes für die Revolution (beim Wachestehen als Nationalgardist o. ä.) entstanden. Letzteres gilt beispielsweise für das erste zensurfreie Gedicht, Ludwig August Frankls Die Universität, jenen gleich mehrfach in Musik gesetzten Lobgesang auf den studentischen Kampf um Freiheit. Von solcher Musik sollte Eduard Hanslick bald sagen, dass seiner Meinung nach „noch Niemand den 13. März würdig besungen hat, der am 14ten schon mit dem Manuscript fertig war.“4 Im Unterschied zur ungarischen Revolutionsmusik konnten sich in der Wiener Revolution tatsächlich keine Lieder oder Märsche derart durchsetzen, dass sie in das kollektive Musikgedächtnis Eingang gefunden hätten. Ganz im Gegenteil: Die einzige bis zum heutigen Tag – nicht zuletzt durch das Neujahrskonzert – lebendige und populäre musikalische Erinnerung an 1848, der Radetzkymarsch von Johann Strauss Vater, gedenkt vielmehr der siegreichen Konterrevolution, während die von Strauss Vater und Sohn der Revolution und ihren Trägern gewidmeten Werke kaum mehr bekannt sind.
Ambivalent war der Einsatz des Kaiserliedes bzw. der Volkshymne (des „Gott erhalte“). Einerseits symbolisierte sie die unverbrüchliche Treue der Revolutionäre zum Kaiser, den man gegenüber der ihn umgebenden und ihn abschirmenden „Hofkamarilla“ in Schutz nahm, und sie wurde in diesem Sinne gerne – auch mit aktualisierten Strophen – am Schluss diverser Veranstaltungen gesungen bzw. in Revolutionskompositionen zitiert (so als „versöhnendes und siegreiches Motiv“5 in Alfred Julius Bechers Trauermarsch und Chor „Ueber den Gräbern der am 13. März Gefallenen“). Andererseits wurde sie aber auch mit der Reaktion gleichgesetzt. Hanslick berichtet, wie in dem Haus, in dem er wohnte, die Volkshymne von einem Militärbeamten regelmäßig als erboste Antwort auf das Fuchslied („Was kommt dort von der Höh“) eines Mitbewohners gespielt wurde.6 Jenes harmlose Studentenlied war im Revolutionsjahr überaus beliebt und wurde ebenfalls in zahlreichen Werken zitiert, so auch im Marsch der Studenten-Legion von Strauss Vater.
Fast alle bereits aus dem Vormärz bekannten Komponisten wie Franz von Suppè, Eduard von Lannoy, Benedict Randhartinger, Josef Fischhof, Carl Haslinger, Salomon Sulzer, Albert Lortzing, Heinrich Proch, Adolph Müller, Philipp Fahrbach sen., Vater und Sohn Strauss sowie einige Komponistinnen wie Emilie Stiller, Nina Stollewerk und Constanze Geiger lieferten musikalische Beiträge zur Revolution. Auch konzertierende Gäste von auswärts steuerten einschlägige Werke bei, so Henry Litolff einen Chorgesang der Wiener Studenten-Legion (mit großem Orchester). Gespielt wurden diese Werke bei Konzerten von Veranstaltern wie den Concerts spirituels oder dem Wiener Männergesang-Verein, bei sogenannten Akademien mit ihren bunten Programmen aus musikalischen und gesprochenen Anteilen, vor allem aber im Rahmen der unzähligen Wohltätigkeitskonzerte, deren Erlös diversen Revolutionserfordernissen (Uniformierung der Nationalgarden und Akademischen Legionen, Unterstützung für die Verwundeten der Kämpfe und die Hinterbliebenen der Märzopfer usw.) gewidmet war. Das Revolutionspathos wurde bei solchen Gelegenheiten ordentlich angefacht. Studierende erhielten teils Freikarten und wirkten begeistert bei den häufig ans Ende der Programme gesetzten Studenten- und Freiheitsliedern mit. Am Schluss eines Konzertes des Wiener Männer-gesang-Vereins am 9. April 1848 ergriff ein Mitwirkender, während Des Deutschen Vaterland gesungen wurde, die deutsche Fahne und schwang sie unter größter Begeisterung des Publikums vor dem Chor.7 Bei der Deklamation des Gedichtes Die drei Farben von Franz Karl Weidmann im Rahmen einer der notorischen Akademien Anton von Klesheims im Theater in der Josephstadt drei Tage zuvor ließ man gar die drei Vortragenden jeweils in den Farben schwarz, rot und gold auftreten.8
Bezeichnend für die revolutionär-patriotische Stimmung ist auch das Programm des von Litolff initiierten Konzerts am 22. März 1848 im Theater an der Wien, dessen Erlös für die Errichtung eines Denkmals für die Märzgefallenen verwendet werden sollte. Neben Beethovens Ouvertüre zu Egmont, Litolffs Symphonie hollandaise und Hubert Léonards Souvenirde Haydn (einer bereits vor 1848 komponierten, jetzt aber thematisch besonders geeigneten Fantasie über das „Gott erhalte“ für Solovioline und Streichquartettbegleitung) gelangten vor allem einschlägige Gelegenheitswerke zur Aufführung: Friedrich Kaisers Gedicht Jubelgruß an Oesterreichs Nationen wurde in der Vertonung von Suppè vorgetragen, auf eine Melodie von Friedrich Wilhelm Kücken erklang Otto Prechtlers Gedicht Drei Tage! und bei Litolffs Marsch und Chor der Studenten traten letztere auf die Bühne, schwangen die Fahnen und sangen kräftig im Chor mit. Den Abschluss bildete wie so oft das Kaiserlied, hier auf einen neuen Text von Karl Meisl.9 Demselben Zweck der Denkmalerrichtung diente auch eine Soirée beim Sperl, die Strauss Vater am nächsten Tag veranstaltete.10
Bei der Beurteilung solcher Werke kommt man mit Analysemethoden, die vor allem auf den Notentext fixiert sind, meist nicht sehr weit, und die Einsicht, dass – musikalisch gesehen – „die Revolution von 1848 lediglich Parerga“11 hervorgebracht habe, zielt am Eigentlichen vorbei. Denn zu stark sind diese Werke mit ihrem Anlass und ihrem Zweck, mit den spezifischen Umständen ihrer Aufführung verwoben, der Ereignischarakter steht im Vordergrund. Erst die mediale Inszenierung, der Einsatz von Farben, Fahnen und anderen Symbolen, der Vortrag durch beliebte Sänger und Musiker, die Mitwirkung der begeisterten Studenten, der Inhalt der Stücke (nicht so sehr ihr konkretes poetisch-musikalisches Gewand) erklärt ihre Wirkung; der performative Aspekt ist also entscheidend. Das war auch den damaligen Musikkritikern durchaus bewusst, und es bedurfte nicht erst eines kritisch-resümierenden Hanslick, um den „rein“ musikalischen Gehalt vieler Werke dieser Revolutionsmusik als dürftig zu entlarven. Dieser stand ja nicht so sehr auf dem Prüfstand, sondern es ging um den Ereignischarakter der Aufführungen, um ihre Fähigkeit, Publikum und Mitwirkende für die Revolution zu begeistern, ja deren Ziele durch ein enthusiastisches Miteinander geradezu vorwegzunehmen. Und in diesem Sinne bedeutete die regelmäßig berichtete „Transformation der Zuschauer in Akteure“12 keine Pervertierung bürgerlich-geordneter Konzertgepflogenheiten, sondern – überspitzt formuliert – den „Vorschein“ emanzipatorischer Zugeständnisse.
Die Beschäftigung mit Fragen von Performanz und Performativität in den letzten Jahren hat dazu geführt, Aufführungen nicht als devianten Modus eines gedachten Ideals zu sehen, sondern die „Realisierung als Überschuss“13, nicht als Mangel zu begreifen. Ohne damit gleich einem radikalen performative turn in den Kulturwissenschaften das Wort reden und damit die heikle Frage nach dem Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem oder gar nach der Existenz des Letzteren14 (in unserem Falle des Aufgeführten) aufwerfen zu wollen, bedeutet eine solche Sichtweise jedenfalls eine möglichst umfassende Kontextualisierung. Die Bedeutung von Musik wird unter dieser Perspektive nicht nur (im Extremfall auch gar nicht) aus ihrer Beschaffenheit eruiert, sondern die Formen ihres Vollzugs, die Bedingungen ihres Gebrauchs werden als wesentlich erachtet. Ein entwicklungsgeschichtlicher oder gar materialästhetisch argumentierender Ansatz griffe hier entschieden zu kurz.
Einer linearen Geschichtsbetrachtung ist auch inhärent, dass sie die synchrone Vielfalt vor Ort vernachlässigt. Der in Anlehnung an Fredric Jamesons berühmter Aufforderung „Always historicize“15 geprägte Kampfruf „Always spatialize!“ rückt die buchstäbliche Verortung kultureller Praktiken und Prozesse ins Zentrum, ohne sogleich nach deren diachroner Relevanz zu fragen.16 Definiert man Raum als einen Ort, „mit dem man etwas macht“17, so sollte „das Auditive [als] grundlegende Dimension des Raumes“18 nicht vergessen werden. Die bisherige Vernachlässigung von Musik in kulturwissenschaftlichen Raumtheorien bzw. in der Geschichtswissenschaft bedeutet somit auch ein verkürztes Raum- bzw. Geschichtsverständnis.19 Umgekehrt hat sich aber auch die Musikwissenschaft bis jetzt zu wenig auf raumtheoretische Fragen eingelassen.20
Im vorliegenden Buch wird der Versuch unternommen, die „musikalische“ Sicht auf die Revolution von möglichst verschiedenen Standorten aus zu beleuchten. Der Fokus auf Zentraleuropa21 scheint dafür besonders geeignet, weil durch die hier anzutreffende Vielzahl an national, ethnisch, konfessionell und sozial unterschiedlichen Gruppierungen die verschiedenen Richtungen der Revolution und Gegenrevolution vor allem in den urbanen Zentren auf engstem Raum aufeinander trafen, mitunter auch in musikalisch konfliktreicher Form. Denn bei der Eroberung des öffentlichen Raumes im Revolutionsjahr spielte Musik eine entscheidende Rolle. Als bei einem Fackelzug für den zu Gesprächen in Wien weilenden kroatischen Ban Jelačić am 28. Juli 1848 begeisterte Slava-Rufe sowie „slavische Melodien mit der Volkshymne verwebt“22 erklangen, protestierten Zuschauer durch Absingen von DesDeutschen Vaterland und des Fuchsliedes. Ein Fackelzug der Studenten und der Nationalgarde am 10. Juni musste um Stunden verschoben werden, weil die Musikbanda nicht rechtzeitig eintraf. Als man schließlich ohne sie losmarschierte, behalf man sich einmal mehr mit Des Deutschen Vaterland, musste aber feststellen, dass bei einer solchen Gelegenheit, „der beste Männergesang […] die schlechteste türkische Musik nicht auf[wiegt]“.23
Die weitgehende Beschränkung auf das Gebiet der Habsburgermonarchie ist der Grund dafür, dass Komponisten, an die man beim Thema Musik und Revolution 1848/49 zunächst denkt, kein eigener Beitrag gewidmet ist. Hier ist in erster Linie natürlich an Richard Wagner zu denken. Mit seinem Gruß aus Sachsen an die Wiener24 hatte er im Juni 1848 zunächst die Aufständischen ermuntert, war dann im Juli 1848 selbst nach Wien gereist, um seine von der Revolution neuerlich beflügelten Pläne, das deutsche Theater unter nationalem Gesichtspunkt zu reformieren25, auch hier voranzutreiben. Solche auf Wien bezogenen Pläne besprach er unter anderem mit Eduard von Bauernfeld, Ludwig August Frankl, Josef Fischhof, Friedrich Uhl und Johann Vesque von Püttlingen.26
Die Kehrseite der massiven Bemühungen um eine deutsche Nationaloper (als Institution wie als Gattung) bestand in der Abwertung nichtdeutscher Opern, allen voran der italienischen. Diese Entwicklung war aber keineswegs erst ein Ergebnis von 1848. Der Interpretationsrahmen, in den die italienische, aber auch die französische Oper von deutscher und österreichischer Seite eingespannt wurde und der inner- wie außermusikalische Gründe gleichermaßen umfasste, stand längst fest und bildete nur einen Teil eines bürgerlichen Diskurses, in dem der Kampf um (national-)politische Emanzipation mit dem Kampf um eine ihr entsprechende, „würdige“ Kunst verbunden wurde. Die italienische Oper als bevorzugte Gattung höfischer Unterhaltung einerseits wie jener eines „ungebildeten“ Publikums andererseits galt nicht nur als national, sondern auch als sozial diffamiert. Bereits existierende Argumentationslinien in der Kritik an der italienischen Oper wurden durch die revolutionären Ereignisse – nicht zuletzt durch die am 26. März erfolgte Kriegserklärung des piemontesischen Königs Carlo Alberto an Österreich – erneut aufgegriffen und dabei anlasskonform zugespitzt. So durchzieht die Musikberichterstattung, beginnend mit der nach heftigen Protesten erzwungenen Absage der für den 1. April mit Verdis Ernani angekündigten dreimonatigen italienischen Stagione an der Wiener Hofoper, eine hämische Abrechnung, wobei ästhetische, moralische und politische Kategorien eine prekäre diskursive Allianz eingehen und sich gegenseitig stützen. Wie bei kollektiven Identitätsbildungen mit ihren Auto- und Heterostereotypien üblich, bediente man sich dabei gerne binärer Oppositionen (geistig – sinnlich, innerlich – äußerlich, tiefsinnig – oberflächlich, sittenrein – frivol), mit denen ein möglichst großer Abstand zum jeweils „Anderen“ hergestellt werden sollte.
Diese zahlreichen, hier nur angedeuteten Facetten des Zusammenhangs von Revolution und Musik in Zentraleuropa fanden bisher kaum Beachtung.27 Das mag mit der allgemein prekären Rolle zusammenhängen, die das Revolutionsjahr als Gedächtnisort spielt. Von Ungarn abgesehen, ist die kollektive Erinnerung an 1848 vor allem in Österreich – etwa im Vergleich zu anderen „Schicksalsjahren“ wie 1914, 1918, 1934, 1938, 1945 oder 1955 – äußerst schwach ausgeprägt.28 Gerade die vielfachen Möglichkeiten einer Anknüpfung, sei es an liberale, (sozial)demokratische oder deutschnationale Ziele der Revolution, scheinen eine eindeutige Identifikation mit ihr zu verhindern. Im Gedächtnis blieb in erster Linie die siegreiche Gegenrevolution:
Denn als Helden des Jahres 1848 gelten in Österreich bis heute nicht die Freiheitskämpfer und Demokraten, sondern die Generäle, welche die Revolution erstickten: Jellačić, Windischgrätz, vor allem aber Radetzky, dem Johann Strauß’ Vater den beliebtesten österreichischen Marsch widmete.29
Dieses Buch möge dazu beitragen, zumindest auf dem Gebiet der Musik diese einseitige Betrachtungsweise durch eine differenziertere zu ersetzen.
DIE BEITRÄGE DIESES BANDES
Musikalische Protestformen – insbesondere Kontrafakturen der Marseillaise und des Fuchsliedes sowie die Katzenmusik – behandelt der Beitrag von Wolfgang Häusler. Einen neuen Text zur Marseillaise sangen unter anderem die Wiener Erdarbeiterinnen im August 1848 in ihrem Kampf um Brot und Freiheit. Im September folgte der ehemalige Offizier Eduard (von) Callot ebenfalls mit einem Gedicht „frei nach der Marseillaise“, und zwar mit dem Wienermarsch, der die inneren und äußeren Feinde der Revolution anprangert. Häusler betont die Rolle der Rezeption der Marseillaise für die folgende Arbeiterbewegung und erinnert daran, dass das erste zensurfreie Gedicht der Revolution, Ludwig August Frankls Die Universität, verschiedentlich auch als „Marseillaise autrichienne“ bezeichnet worden ist und der Revolutions-Marsch von Johann Strauss Sohn als „deutsche Marseillaise“. Dass Strauss noch am 3. Dezember 1848 neben diesem und dem Fuchslied auch die Marseillaise mehrfach spielen ließ, hat bekanntlich seine Ernennung zum k. k. Hofball-Musikdirektor um Jahre verzögert.
Das studentische Fuchslied, allgemein populär geworden durch die Aufführung des Lustspiels Das bemooste Haupt oder: Der lange Israel von Roderich Benedix am 1. April 1848 im Theater an der Wien, erhielt zahlreiche, durch Flugblätter massenhaft verbreitete, aktualisierte Texte, in denen die Gegner der Revolution (wie Metternich, Bürgermeister Czapka oder Außenminister Ficquelmont) verhöhnt wurden. Seine Melodie fand auch Eingang in einige Instrumentalwerke (v. a. Märsche wie den Marsch der Studenten-Legion von Strauss Vater), seine Aufführung wurde aber mit Fortgang der Revolution bisweilen zu einem riskanten Unternehmen. So erboste am 19. August 1848 beim Defilee des Juristenkorps der Akademischen Legion die Aufführung des Mediziner-Marsches (wegen seiner Verwendung des Fuchsliedes auch Fuchs-Marsch genannt) von Romeo Kosak unter Georg Hellmesberger nach einer Feldmesse anlässlich der Rückkehr des Kaisers aus Innsbruck die wieder an Boden gewinnenden, reaktionären Kräfte.
Wie das Fuchslied wurde auch die Katzenmusik als alte Form des Rügegerichts durch Benedix’ Lustspiel populär (beides findet sich auch in Nestroys Freiheit in Krähwinkel). Sie richtete sich – beinahe täglich – nicht nur gegen die weltliche und geistliche Obrigkeit ( Ficquelmont, Erzbischof Milde, Redemptoristen bzw. Liguorianer), sondern auch – meist wegen überhöhter Preise – gegen Bäcker, Fleischhauer, Wirte, Vermieter und Fabrikanten. Neben politischen wurden also gerade soziale Anliegen der unteren Schichten auf diese Weise lautstark zum Ausdruck gebracht. Aber auch der Juridisch-Politische Leseverein, zuvor liberaler Hoffnungsträger, wurde am 2. Mai Adressat einer Katzenmusik.
Die bröckelnde Allianz der an der Revolution beteiligten Gruppierungen äußerte sich ebenfalls in diesen musikalischen Protestformen. Die am 14. Juni mit Katzenmusik begleitete Ausweisung tschechischer Studenten – Teilnehmer am Burschenkommers zu Hainbach, die sich ihrerseits mit Spottliedern hervorgetan hatten – nahm etwa bereits die kommenden nationalen Auseinandersetzungen vorweg. Das um seinen Besitz bangende Kleinbürgertum verweigerte wiederum den Arbeitern die Solidarität, diese verfassten in Vorahnung des künftigen Klassengegners Spottlieder auf die Studentenschaft. So fand auch der innere Widerspruch der Revolution von 1848 – bürgerliches Streben nach politischer Emanzipation einerseits, Sozialprotest der ausgebeuteten Arbeiterschaft andererseits – seinen musikalischen Ausdruck.
Die Katzenmusik ist auch Thema des Beitrags von Hubert Reitterer. Seine Quelle, die Tagebücher des Wiener Beamten Matthias Franz Perth, stellt überhaupt eine bisher kaum genutzte Dokumentation des vormärzlichen Wiener Musiklebens dar. Das Revolutionsjahr verleidet Perth – wie so vielen – die Lust am fast täglichen Theaterbesuch, verstört protokolliert er die von Katzenmusik begleiteten Massenkundgebungen und flüchtet schließlich in das von der Revolution verschonte Baden bei Wien. Ein Anhang beschäftigt sich mit Romeo Kosak, dem Medizinstudenten und Kapellmeister des Medizinerkorps innerhalb der Akademischen Legion, dessen Musikbanda sich hauptsächlich aus Zöglingen des Konservatoriums der Gesellschaft der Musikfreunde zusammensetzte.
Dass Kosaks dem Kaiser gewidmeter und diesem einst so gefallender Fuchs-Marsch mit Fortdauer der Revolution auch in Graz nicht mehr geschätzt und seine Aufführung gar mit einer Arreststrafe bedroht wurde, zeigt der Beitrag von Ingeborg Harer. Die Hochstimmung der Märztage ist dagegen an einem Konzert ablesbar, in dem das Versprechen einer Konstitution gefeiert wurde (und zwar mit Castellis Lied für die Nationalgarde und Frankls Universität, beide vertont von in Graz wirkenden Musikern, sowie dem unvermeidlichen Was ist des Deutschen Vaterland). Noch im Juni waren tausende Menschen zum Bahnhof geeilt, um eine Abordnung der Wiener Akademischen Legion – auch und gerade mit Musik – zu begrüßen. Doch die Euphorie war hier gleichfalls bald vorbei. Die im Mai erstmals erschienene satirische Zeitung Gratzer Katzen-Musik beeilte sich schon im Juli, ihren Titel in Gratzer Schnellpost umzuändern, um sich von der mittlerweile diskreditierten Form des Sozialprotests von unten abzugrenzen. Zu diesen benachteiligten Gruppen gehörten übrigens auch viele zivile Musiker, da für Aufführungen in Gasthäusern und Hotels oft ihre Kollegen von der Militärmusik bevorzugt wurden.
Ein weiteres autobiographisches Zeugnis, nämlich die Lebenserinnerungen des aus Kärnten stammenden Schriftstellers und Historikers Friedrich Pichler, ist der Ausgangspunkt für Walburga Litschauer in ihrem Beitrag über das Klagenfurter Musikleben 1848. Pichler, damals noch Schüler, schildert die aufgeheizte, euphorische Stimmung der Märztage, in die auch das erste Konzert des Klagenfurter Männergesangvereins mit einschlägigem Programm sowie Darbietungen einer eilig zusammengestellten Musikbanda fallen. Wiederum fehlen Katzenmusiken nicht, die hier wie überall als Protest des „Pöbels“ mit sozialer Sprengkraft missbilligt wurden. Beispiele von Kärntner Revolutionsliedern zeigen einmal mehr die Verbindung von Aufbruchsstimmung und Kaisertreue, aber auch – am Beispiel der Verurteilung des italienischen Aufstandes – den eskalierenden Nationalismus.
Dieser erfasste insbesondere die Männergesangbewegung. Nachdem sich auf österreichischem Gebiet aufgrund von Metternichs restriktiver Haltung gegenüber Vereinen erst relativ spät eine solche etablieren konnte, kam es in den 1840er Jahren zu einer Welle von Vereinsgründungen. Christian Fastl gibt einen Überblick der 1848 existierenden Männergesangvereine sowie eine Auflistung der in diesem und im folgenden Jahr stattgefundenen Aufführungen speziell in Wien, Graz, Salzburg und Linz. Sehr oft gaben politische Ereignisse (Nachricht über die Zusage einer Konstitution, Verabschiedung der österreichischen Delegierten für das Frankfurter Parlament, Wahl Erzherzog Johanns zum Reichsverweser u. a.) den Anlass zu Konzerten, musikalisch umrahmten Festen, Fackelzügen u. dgl. Nicht zu vergessen ist auch die Mitwirkung bei diversen, symbolisch hoch aufgeladenen Fahnenweihen und Verbrüderungsfesten. Ein Höhepunkt war wohl das Konzert des Wiener Männergesang-Vereins vom 9. April 1848 im Redoutensaal der Hofburg mit seiner Kombination aus deutschnationalem und Österreichpatriotischem Geist (musikalisch symbolisiert durch Des Deutschen Vaterland einerseits und die Volkshymne bzw. das Kaiserlied andererseits; letztere mit neuem, auf die Konstitution bezogenem Text), wobei sich die Begeisterung des Publikums bis zur Raserei steigerte.
Des Deutschen Vaterland als inoffizielle Hymne deutschnationaler Bestrebungen konnte in Triest bei einer Feier am 6. August 1848 anlässlich Erzherzog Johanns Ernennung zum Reichsverweser mit Rücksicht auf die italienische und slawische Bevölkerung nicht gesungen, sehr wohl aber aus gleichem Anlass die schwarz-rot-goldene Fahne gehisst werden. Das musikalische Symbol nationaler Identität mit seiner ungeheuer emotionalisierenden Kraft, die so viele Schilderungen aus diesem Jahr bezeugen, übertrifft, so scheint es, selbst die Wirkung der symbolträchtigen nationalen Farben. Gregor Kokorz geht diesem Phänomen am Beispiel Triests nach und verweist darauf, dass die Nationalisierung des öffentlichen Raumes eben ein Ergebnis nicht nur diskursiver Konstruktion, sondern gerade auch performativer Inszenierung darstellt, bei der Musik eine herausragende Rolle spielt. Diese nationale Territorialisierung mit Hilfe des Mediums Musik zeigt er an drei Beispielen: dem Theater, der Straße und der Schule. Am 17. März 1848 gerät die Aufführung von Carl Ferdinand Lickls Oper La Disfida di Barletta auf ein Libretto von Antonio Gazzoletti im Rahmen einer Feier im Teatro Grande aus Anlass der versprochenen Verfassung zu einer Demonstration nationalitalienischer Bestrebungen. Eindeutige Angebote nationaler Identität – wie das von Gazzoletti nach Arndts Vorbild verfasste Lied La patria dell’Italiano, das auch die noch unter österreichischer Herrschaft stehenden Gebiete Lombardei und Venetien nennt, oder diverse Lieder auf Papst Pius IX. (bezeichnend, dass man bei der genannten Verfassungsfeier die Kaiserhymne auf Wunsch des Publikums mit einem Inno Pio IX verband) – vermitteln politische Lieder, die auch auf der Straße gesungen wurden. Mitunter findet man unter ihnen aber ebenso verschiedene ethnische Gruppen aussöhnende Positionen, wie etwa die Hymne der Triestiner Nationalgarde, wiederum auf einen Text Gazzolettis. Eine solche vermittelnde Position nimmt in gleicher Weise die Lira del popolo ein, ein 1848 erstmals erscheinendes Schulliederbuch, das sowohl italienisch- als auch deutschsprachige Lieder enthält.
Wie Miroslava Pejović in ihrem Beitrag ausführt, gab es vermittelnde Tendenzen im Vorfeld der Revolution auch in Laibach (Ljubljana). So wurden bei Konzerten der „deutschen“ Philharmonischen Gesellschaft in den 1840er Jahren ebenso slowenisch-sprachige Lieder aufgeführt. Doch ließ das nationalistische Klima eine solche „Hybridisierung“ in der Programmgestaltung bald nicht mehr zu. Der 1848 gegründete „Slovenski zbor“ („Slowenischer Verein“) weckte mit seinen besede (politischkulturellen Veranstaltungen mit hohem Musikanteil) gezielt slowenisches Nationalbewusstsein. Slowenische Lieder wurden gesammelt bzw. in Auftrag gegeben. Im Austausch mit slowenischen Vereinen in Wien und Graz wurde das Repertoire erweitert; panslawistisches Liedgut spielte dabei eine große Rolle. Beliebt waren insbesondere die Lieder Hej, Sloveni (Hej, Slowenen), eine der zahlreichen Adaptierungen von Hej, Slováci (Hej, Slowaken) zur Melodie von Noch ist Polen nicht verloren, sowie Slovenca dom zur Melodie von Kde domov můj? (Wo ist mein Heim?), der 1834 von František Škroup komponierten, heutigen tschechischen Hymne. Konnte die Philharmonische Gesellschaft anfangs noch bei den besede mitwirken, so geriet sie – wie auch das Ständetheater – bald in ein Konkurrenzverhältnis zu slowenischen Einrichtungen. Während das Ständetheater mit der slowenischen „Dramatischen Gesellschaft“ („Dramatično društvo“) einen nationalen Wettkampf austrug, rivalisierte die Philharmonische Gesellschaft mit dem „Slowenischen Verein“ und später mit dem slowenischen Musikverein („Glasbena matica“), mit erheblichen Auswirkungen auch auf die Musikermigration: Von den slowenischen Vereinen wurden nämlich professionelle Musiker aus Böhmen bevorzugt.
Eine besonders nachhaltige Verankerung im kollektiven Gedächtnis zeitigten die Revolution und der sich an die Proklamation der Unabhängigkeit vom Habsburger Reich am 13. April 1849 anschließende Unabhängigkeitskrieg in Ungarn. Wie der Beitrag von Lujza Tari zeigt, griff die zunächst auch hier siegreiche Revolution einerseits auf bereits bekanntes und politisch konnotiertes Liedgut sowie Instrumentalrepertoire zurück ( Rákóczi Lied und Marsch, Martinovics Lied und Marsch, Marseillaise auf ungarischem Text), andererseits wurden neue Lieder (zum Teil auf älteren Melodien beruhend) und Märsche geschaffen: Spottlieder auf Österreich, vor allem aber Musik mit Bezug auf die ‚Helden‘ der Revolution, allen voran Lajos Kossuth, der schon vor 1848 – unter anderem mit einem Marsch von Franz (Ferenc) Doppler – musikalisch geehrt worden war, und Lajos Batthyány. Besondere Bedeutung hatte das Nationallied ( Nemzeti dal), von Sándor Petőfi bei Ausbruch der Revolution am 15. März 1848 gedichtet und von Béni Egressy noch am selben Tag in Musik gesetzt. Weitere Vertonungen des überaus populären, die Unabhängigkeit Ungarns beschwörenden Textes folgten rasch.
Nach etlichen Erfolgen siegten schließlich die konterrevolutionären Kräfte unter tatkräftiger Mithilfe von Josip Jelačić – des Bans von Kroatien und Kommandanten der kaiserlichen Armee –, Alfred I. Fürst zu Windischgrätz und des russischen Zaren Nikolaus I. Der Krieg endete mit der ungarischen Kapitulation am 13. August 1849 in Világos. Kossuth konnte fliehen, andere führende Vertreter des Unabhängigkeitskrieges wie Batthyány wurden hingerichtet. Auch der letztlich aussichtslose Kampf sowie die bittere Niederlage wurden musikalisch kommentiert, unter anderem von Franz Liszt in seinen Funérailles (Nr. 7 seines Klavierwerks Harmonies poétiques et religieuses) und in seiner Sinfonischen Dichtung Héroïde funébre (Heldenklage). Einige ungarische Freiheitskämpfer schlossen sich in der Folge der italienischen Unabhängigkeitsbewegung unter Giuseppe Garibaldi an, ihre Beteiligung erklärt die Existenz ungarischer Garibaldi-Lieder. Der vergeblichen Hoffnung auf eine Rückkehr Kossuths wurde ebenfalls musikalisch Ausdruck gegeben. Viele der 1848/49 gesungenen Lieder und gespielten Märsche waren nach der Revolution offiziell verboten und konnten nur im Geheimen gepflegt werden. Nicht wenige von ihnen fanden dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) Eingang in die mündliche Tradition und behaupten dort – im Unterschied etwa zur Wiener Revolutions-musik – bis heute ihren Platz.
Während Jelačić, neben Radetzky und Windischgrätz, von den Wiener und ungarischen Revolutionären als Garant des alten Regimes galt, wurde er, wie Vjera Katalinić ausführt, in Zagreb als Nationalheld gefeiert, der den ungarischen Hegemonialbestrebungen gegenüber Widerstand leistete. Sein Einzug in die Stadt nach Ernennung zum Banus geriet zum Volksfest, bei dem nationalpatriotische Lieder nicht fehlen durften. Jelačić wurden zahlreiche Gedichte – auch Franz Grillparzer stellte sich 1849 mit einer Ode ein – und Kompositionen gewidmet, darunter Märsche von Baron Carl Prandau, Aleksandar Morfidis-Nisis, Ferdo Wiesner-Livadić und, am bekanntesten, von Johann Strauss Vater. Katalinić geht unter anderem der Frage nach, wie Strauss das von ihm im Trio seines Jellacic-Marsches verwendete kroatische Weckruflied kennengelernt haben könnte (nämlich über einen Kolo von Vatroslav Lisinski, der bei einem Slawenball in Wien im Februar 1848 aufgeführt wurde). Stark eingeschränkt war – wie auch in Wien und anderswo – der Konzert-, Theater- und Opernbetrieb. Der 1827 gegründete Musikverein etwa verlor Mitglieder und hatte mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen.
Mit den musikalischen Symbolen der serbischen bzw. südslawischen Nationalbewegung in der freien Kaiserstadt Novi Sad in den 1840er Jahren beschäftigt sich der Beitrag von Marijana Kokanović Marković. Zu ihnen zählt insbesondere der Volkstanz Kolo, der bei den beliebten serbischen Bällen ebenso gerne aufgeführt wurde wie der Tanz Lepa Maca (Schöne Matza), den Johann Strauss Sohn in seinen Slawischen Potpourris verwendet hat. Volkslieder und -tänze wurden zunehmend auch bei Konzerten gespielt, um hier dem als „fremd“ empfundenen Repertoire ein eigenes gegenüberzustellen. Besonders beliebt waren die budnice genannten, patriotischen Kampflieder. Zu ihnen zählt das Lied Ustaj, ustaj Srbine (Serbe, steh auf, steh auf!), das 1848 zum Revolutionslied wurde. Im Jahr zuvor hatte Johann Strauss Sohn das Publikum insbesondere mit seiner (verschollenen) Fantasie Erinnerung an Neusatz begeistert. Novi Sad, das die Pester Serben in ihrer Forderung nach Gleichberechtigung gegenüber den Ungarn unterstützte und an der Niederschlagung der ungarischen Revolution beteiligt war, wurde im Juni 1849 von den Ungarn bombardiert und schwer zerstört.
In den Fürstentümern Walachei und Moldau zielten rumänisch-nationale Bestrebungen auf eine Schwächung des griechisch-osmanischen Einflusses. Wie der Beitrag von Haiganuş Preda-Schimek zeigt, kam in diesem Zusammenhang der nach französischem Vorbild errichteten Salonkultur der Bojaren große Bedeutung zu. Diese war auch für das Musikleben von entscheidender Bedeutung. In den Salons wurden nicht zuletzt Kampf- und Revolutionslieder gesungen, darunter Deşteaptă-te, Române! (Erwache, Rumäne!), die heutige rumänische Nationalhymne, aufgezeichnet bzw. komponiert von Anton Pann, die 1848 große Beliebtheit erlangte. Revolutionslieder schuf auch Alexandru Flechtenmacher. Die zunehmende, politisch motivierte Bedeutung volkstümlicher Melodien – entsprechende Bearbeitungen für den Salongebrauch lieferten unter anderem Carol Mikuli, Johann Andreas Wachmann und Heinrich Ehrlich – erkennt man auch an der Begeisterung, mit der die Aufnahme rumänischer Themen in Kompositionen internationaler Konzertgeber wie Liszt oder Johann Strauss Sohn registriert wurde.
Lieder, die in ihrer Wirkungsgeschichte meist zu eindeutigen Kennzeichen bestimmter (nationaler) Gruppierungen werden, sind im Entstehungsprozess erstaunlich oft das Ergebnis eines Kulturtransfers. Das trifft auch auf eine Reihe slowakischer Lieder zu, die 1848/49 die Revolution begleiteten und von Jana Lengová untersucht werden. Hej, Slováci (Hej, Slowaken), 1834 zur Melodie des Liedes der polnischen Legionen Noch ist Polen nicht verloren verfasst, war mit entsprechenden Textänderungen in slawischen Gebieten bald überaus beliebt und diente in der Fassung Hej, Slované (Hej, Slawe) während des Slawenkongresses im Juli 1848 in Prag als panslawistische Hymne. Im 20. Jahrhundert war sie die Nationalhymne Jugoslawiens. Als Protestlied gegen die Magyarisierung entstand 1844 das Lied Nad Tatrou sa blýska (Ob der Tatra blitzt es), das ebenfalls während der Revolution gesungen und 1993 zur slowakischen Nationalhymne wurde. Auch deutsche Lieder wurden vereinzelt herangezogen, so im Falle von Karol Kuzmánys Kto za pravdu horí (Wer für die Freiheit brennt), das man nach der Melodie von Karl Groos für Freiheit, die ich meine sang.
Eine besondere Symbolkraft entfaltete im Revolutionsjahr der Wenzel-Kult in Böhmen. Im Unterschied zu den Symbolfiguren Johann von Nepomuk, der habsburgisch, konservativ und deutsch, und Jan Hus, der tschechisch und fortschrittlich konnotiert war, besaß der bereits im Mittelalter heiliggesprochene Wenzel die Eignung zu einer verbindenden gesamtböhmischen Identifikationsfigur. Viktor Velek beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den musikalischen Erscheinungen dieser Tradition, insbesondere mit der Verwendung des Wenzel-Chorals. Er wurde etwa im März 1848 bei der Abfahrt und Rückkehr jener Deputierten gesungen, die dem Kaiser in Wien eine Petition überreichen wollten, ebenso zur Eröffnung des Slawenkongresses in Prag am 2. Juni. Als dieser in den Prager Pfingstaufstand mündete, bei dem es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen tschechischen Nationalisten und dem Militär unter Windischgrätz kam, stand den Aufständischen nicht nur die Prager Nationalgarde „Svornost“ (Eintracht) zur Seite – für sie hatte Václav Bohumil Michálek den Swato-Wácslawský pochod (St. Wenzel-Marsch) komponiert –, sondern es eilten auch Nationalgarden aus anderen Städten zu Hilfe. Jene aus Chrást bei Chrudim wurde vor ihrer Abreise nach Prag gesegnet, und bei dieser Gelegenheit erklang einmal mehr der Wenzel-Choral. Manchen Antiklerikalen galt der Wenzel-Stoff allerdings als zu katholisch, manchen Tschechen dagegen als zu deutsch, und so wurde öfter der Vers eingefügt: „Svatý Václave! vyžeň Němce, cizozemce!“ („Hl. Wenzel! Vertreibe die Deutschen, die Fremdländer!“) Auch die deutsche Oper Drahomíra von František Škroup, uraufgeführt am 28. Oktober 1848 am Ständetheater, ist der Wenzel-Legende gewidmet.
Eine weitere deutsche Oper, Jan Friedrich Kittls am 19. Februar 1848 ebenfalls am Ständetheater uraufgeführte Oper Bianca und Giuseppe auf ein Libretto von Richard Wagner aus dem Jahr 1836, traf mit ihrer zur Zeit der Französischen Revolution spielenden Handlung nicht nur die revolutionäre Stimmung, sondern war, wie Vlasta Reittererová ausführt, auch eines der letzten einheimischen Werke, das gleichermaßen vom deutsch- wie auch vom tschechischsprachigen Publikum begeistert aufgenommen wurde. Insbesondere der Marsch der Franzosen, die die Stadt Nizza belagern, mit dem Ça ira-Zitat wurde in der Folge zu einem weit verbreiteten Stück Revolutionsmusik. Kittl, der mit Wagner befreundet war – welcher übrigens nicht als Librettist genannt werden wollte –, war dann auch an der Prager Erstaufführung des Tannhäuser im Jahre 1854 beteiligt. Bianca und Giuseppe wurde Kittls größter kompositorischer Erfolg, auch wenn sich die Oper nicht im Repertoire halten konnte. Ein Anhang listet die deutsch- bzw. tschechischsprachigen Vorstellungen am Prager Ständetheater im Jahre 1848 auf.
So wie Kittl, der seit 1843 Direktor des Konservatoriums für Musik in Prag war, leitete auch Joseph Proksch hier eine Musiklehranstalt, und zwar ab 1831 eine für Klavierunterricht. Die Auswirkungen der Revolution auf ihn und seine Schule untersucht Björn Tammen unter Verwendung bisher unveröffentlichter Briefe Prokschs an seinen ehemaligen Schüler Pius Richter in Wien. Die Quellen lassen die Sorgen des politisch überaus konservativen Musiklehrers – in der Komposition unter anderem von Bedřich Smetana – erkennen, der den Forderungen der Revolution nichts abgewinnen konnte, überall Kommunismus und Anarchie witterte, zum Augenzeugen des Pfingstaufstandes wurde und um seinen Besitz bangte. Sie zeigen aber auch seinen aktiven, öffentlich ausgetragenen Kampf um den Fortbestand seiner Anstalt und geben überhaupt einen zwar einseitigen, aber umso lebhafteren Einblick in das Prager Musikleben der damaligen Zeit.
Wenig revolutionären Geist findet man aus begreiflichen Gründen auch bei den Mitgliedern der Wiener Hofmusikkapelle, wie die Ausführungen von Susanne Antonicek zeigen. Entsprechende Androhungen von Entlassungen verfehlten nicht ihre Wirkung, denn um das Auskommen von Musikern stand es im Revolutionsjahr wegen des Ausfalls von Nebeneinkünften ohnehin sehr schlecht, was vor allem die kein Gehalt beziehenden Exspektanten empfindlich treffen musste. Die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste wurde wegen der revolutionären Ereignisse, die unter anderem zu längeren Abwesenheiten des Hofes führten, häufig gekürzt, einzelne Ämter fielen zur Gänze aus. Eine späte Auswirkung der gescheiterten Revolution in Ungarn betraf den Geiger Leopold Jansa. Nachdem dieser sich im Juli 1851 in London bei einem Konzert zugunsten ungarischer Flüchtlinge beteiligt hatte, wurde er im August desselben Jahres aus der Hofmusikkapelle entlassen. Jansa sollte erst 1870 nach Wien zurückkehren.
Deutlich aufseiten des reaktionären Hofes stand die einst gefeierte Pianistin Katharina Cibbini-Koželuch, seit 1831 erste Hofdame von Maria Anna, der Gemahlin Kaiser Ferdinands. Ihre schroff ablehnende Haltung der Revolution gegenüber machte sie wiederholt zum Ziel von Flugblättern und Zeitungsartikeln, die von Michaela Krucsay analysiert werden.
Eine Annäherung an die „soldatische Alltagsgeschichte der Revolutionsjahre“ mit Hilfe von sechs ausgewählten Liedern des Altausseers Johann Kain unternimmt Gerlinde Haid. Kain, von 1840 bis 1850 Soldat, ab 1844 Grenadier im Infanterieregiment Nr. 49, machte unter anderem die Oktoberschlacht 1848 in Wien mit und war an den ungarischen Feldzügen 1849 beteiligt. Die zum Teil gesammelten, zum Teil selbst verfassten Lieder belegen Kaisertreue und Glauben des einfachen Soldaten, aber auch die kurze Aufbruchsstimmung in den Wochen nach dem März 1848, als Kain Des Deutschen Vaterland notiert und Flugblätter sammelt, sowie den spätestens im Oktober zu Grabe getragenen Freiheitstraum. Kain, der die von ihm gesungenen Lieder sorgfältig in acht handschriftlichen Büchern niedergelegt hat, hatte als späterer Wirt in Bad Aussee ausreichend Gelegenheit, sein Repertoire vor Gästen zu produzieren. Zu Recht hebt Haid hervor, dass sich die Bedeutung dieser Lieder nicht nur über eine textlich-musikalische Analyse erschließt, sondern auch durch die Aufführungssituation, über die wir in diesem Fall allerdings sehr wenig wissen.
Die Revolutionsmonate zeitigten also eine Fülle von Gebrauchsmusik, in erster Linie Marschmusik für die Nationalgarde und die Akademische Legion. In ihren Titeln beziehen sich diese Kompositionen nicht selten auf spezielle Ereignisse (so Anton Diabellis und Franz von Suppès Constitutions-Marsch auf das Versprechen einer Verfassung; Trauermärsche unter anderem von Alfred Julius Becher und Selmar Bagge auf die „Märzgefallenen“ etc.) und zeichnen so den Gang der Revolution nach. Ebenso greift die Tanz- und Ballmusik aktuelle Geschehnisse zumindest im Titel auf (z. B. die Constitutions-Jubelklänge von Leopold Gross) oder lässt sie in der Musik selbst anklingen (so die Katzenmusik-Walzer von Philipp Fahrbach sen.). Mit diesem Repertoire (insbesondere den einschlägigen Werken von Johann Strauss Vater und Sohn) beschäftigt sich der Beitrag von Thomas Aigner.
Mit der Wiener Revolutionsmusik setzt sich auch der Beitrag von Erich Wolfgang Partsch auseinander. Zu Vertonungen für Chorbesetzung reizte besonders Ludwig August Frankls Gedicht Die Universität, das über 20 Komponisten als Grundlage gedient haben soll, darunter auch dem Vizehofkapellmeister Benedict Randhartinger. Ähnliche Berühmtheit erlangte das Nationalgarden-Lied von Ignaz Franz Castelli, unter anderem vertont von Franz von Suppè. Zwangsläufig seltener, da öffentlich – und das heißt 1848 vor allem im Freien – weniger einsatzfähig, sind Sololieder mit Klavierbegleitung wie etwa das Lied der Todtenkopflegion vom Oberkantor der Wiener Synagoge Salomon Sulzer. Unter dem Titel Regina dichtete und komponierte Gustav Albert Lortzing eine regelrechte Revolutionsoper und setzte in der Figur des besonnenen und verantwortungsbewussten Arbeiterführers Richard seinem Freund Robert Blum ein Denkmal. Diese Oper konnte erst 1899 uraufgeführt werden. Zu den wenigen Beispielen für groß besetzte und für den Konzertsaal geschriebene Instrumentalmusik zählen der Trauermarschund Chor „Ueber den Gräbern der am 13. März Gefallenen“ von Alfred Julius Becher sowie die Grosse Fest-Ouverture von Georg Hellmesberger jun., beide die „Volkshymne“ als musikalisches Symbol unverbrüchlicher Kaisertreue aufgreifend. Dass die Revolution sogar vor der privaten musikalischen Geselligkeit nicht haltmachte, zeigen die Beispiele für Klaviermusik. Im Vergleich zu Suppès Humoristischen Variationen über das Fuchslied erscheint hier Das Fuchslied als Trauermarsch von Constanze Geiger als ungewöhnlich. Revolutionäre musikalische Symbole ( Rákóczi-Marsch, Des Deutschen Vaterland) verbindet Carl Haslinger in seinem Werk Die 3 März-Tage 1848. Characteristisches Tongemälde einmal mehr mit dem „Gott erhalte“. Nur wenige Komponisten – wie Johann Vesque von Püttlingen – lehnten es ab, die Revolution mit einschlägigen Werken zu unterstützen. Die meisten nutzten die Gelegenheit zu künstlerischer wie auch politischer Selbstrepräsentation, unter ihnen auch der spätere Kritiker dieser Art „Freiheitsmusik“, Eduard Hanslick, der sich im März ebenfalls – wenn auch vergeblich – beeilt hatte, dem Wiener Männergesang-Verein ein Werk anzubieten, um nur ja nicht, wie er selbst meinte, mit seinem Patriotismus zu spät zu kommen.
Auch das Repertoire von mechanischen Musikinstrumenten wie Kammspielwerken und Flötenuhren wurde um und nach 1848 vereinzelt um Stücke, die auf die Revolution Bezug nehmen, bereichert, wie der Beitrag von Helmut Kowar zeigt. Ist hier auch am häufigsten der Radetzkymarsch von Johann Strauss Vater (neben seinem Freiheits-Marsch und seiner Quadrille im militärischen Style) anzutreffen, so finden sich doch vereinzelt Stücke wie Prochs Nationalgarde-Marsch. Technisch bedingt, mussten die Stücke dafür zum Teil erheblich gekürzt bzw. in geringerem Umfang auch bearbeitet werden. Da Musikautomaten generell neue musikalische Trends aufgriffen, beweist das Vorhandensein von Walzen mit diesem Repertoire, dass es für politisch aktuelle Musik in privaten Haushalten nicht nur auf dem Notensektor einen entsprechenden Bedarf gab.
Zwei Beiträge sind Instrumentalwerken Alfred Julius Bechers gewidmet, einer der interessantesten künstlerischen und politischen Figuren im Wien der 1840er Jahre. Gernot Gruber beschäftigt sich mit dem 1841/42 komponierten A-Dur-Streichquartett und geht vorsichtig der Frage nach, ob Bechers 1848 sich radikalisierende politische Ansichten und Agitationen, die letztlich im November zu seiner standrechtlichen Erschießung führten, ein Pendant im Werk finden, das deutlich Züge einer Übersteigerung trägt (im Umfang, in den angewandten Mitteln wie der Ausweitung nicht-thematischer Passagen, in einer forcierten Kombinatorik und Harmonik sowie einer originellen Instrumentierung), Gewohntes auf die Spitze treibt und es dadurch einer Kritik unterzieht, andererseits bei aller Irritation, die Zeitgenossen wie Hanslick, Lenau oder Grillparzer einhellig bezeugen, in den groß angelegten und tonal sich klärenden Schlusspassagen der Außensätze doch auch ein utopisches „Tableau des ‚Positiven‘“ ausbreitet.
Bechers Streichquartette (neben jenem in A-Dur gibt es noch zwei in C- bzw. G-Dur) blieben in der Folge ebenso unbeachtet wie sein 1847 zum Teil aufgeführtes Sinfoniefragment in d-Moll, für das Dominik Šedivý ähnliche Prinzipien ausmacht (vor allem eine ungewöhnliche zeitliche Ausdehnung sowie mangelnde melodische Prägnanz des motivischen Materials, das im „Bausteinsystem“ zur Großstruktur wird). Unverkennbar ist ein Zug zur Übersteigerung, für den Becher, wie auch schriftliche Quellen nahelegen, ein Unverstanden-Bleiben selbst bei seinen Freunden in Kauf nahm.
Giuseppe Verdis keineswegs eindeutige Haltung zur Revolution und seine durchaus einseitige Aufnahme in den Risorgimento-Mythos sind das Thema von Antonio Baldassarres Beitrag. Verdis Stilwandel setzt mit La battaglia di Legnano ein, jenem patriotischen Werk aus dem Jahre 1848, das einerseits noch einen politisch aktualisierbaren Stoff hat, andererseits aber musikalisch auf die folgenden Werke verweist, die – beginnend mit Luisa Miller – mehr das individuelle als das kollektive Drama akzentuieren und im Aufbrechen traditioneller Formen, in der entwickelten Instrumentation sowie in der Zurücknahme der Chöre die Überwindung eines plakativen Nationalismus anzeigen und dem Komponisten prompt den Vorwurf mangelnder „italianità“ eintrugen.
Größte Vorsicht mahnt Frank Hentschel für Versuche ein, einen Kausalnexus zwischen politischen Ereignissen wie der Revolution 1848/49 und dem Musikschrifttum jener Zeit herzustellen. Am Beispiel der 1852 erstmals erschienenen Musikgeschichte von Franz Brendel weist Hentschel nach, dass gerade jene Stellen, bei denen Brendels Revolutionserfahrung eine Rolle gespielt haben könnte – etwa bei der Interpretation Beethovens –, älteren Deutungsmustern folgen, im konkreten Fall Gustav Schillings 1841 veröffentlichter Musikgeschichte. Insgesamt macht Hentschel für die Musikhistoriographie des 19. Jahrhunderts zwar eine „emanzipatorische Geschichtskonstruktion“ aus, diese speise sich aber nicht aus der Erfahrung einzelner revolutionärer Ereignisse. Indes komme sie bei allen Autoren unabhängig von ihrer politischen Haltung zum Tragen.
Auch viele der in den Musikrezensionen des Revolutionsjahres angesprochenen Themen – „Ausufern“ des Virtuosentums, der Unterhaltungsmusik und der italienischen Oper, Notwendigkeit einer „Kanonisierung“ des Repertoires und einer Professionalisierung der Musikausübenden – bewegten bereits die deutschsprachige Musikkritik im Vormärz. Wie mein Beitrag zu zeigen versucht, wurde in diesem Bereich die Katalysatorfunktion der Revolution allerdings sehr deutlich hervorgehoben, d. h. die Hoffnung auf politische Verbesserungen mit einer Hebung der Kunst direkt verbunden, für die man die durch aktuelle Ereignisse bedingten Unzulänglichkeiten (zeitweise Schließung der Theater, Absage von Konzerten) in Kauf nahm. Während der wohl beste Musikkritiker der 1840er Jahre in Wien, Alfred Julius Becher, wegen seines politischen Engagements für die Musikberichterstattung ausfiel, ging der Stern von Eduard Hanslick gerade auf, bezeichnender Weise keineswegs nur mit Musikkritiken, die den frühen Hanslick gar als Hegelianer ausweisen, sondern auch mit einer Reihe von politischen Kommentaren.
So wie in der Musik fand die Revolution naturgemäß auch in den anderen Künsten ihren Niederschlag. Die Darstellung von Barrikadenkämpfen und Schlachten, von Nationalgarden, Studenten und Arbeitern erforderte eine dynamische Bildgestaltung, hinter der auch die Gegenseite nicht zurückbleiben wollte, wie Werner Telesko vor allem am Beispiel von Anton Zieglers Vaterländischer Bilder-Chronik sowie entsprechenden monarchischen „Gegenbildern“ nachweist. War das Jahr 1848 aus Sicht der Revolutionäre weniger mit Gemälden, sondern vielmehr mit Graphiken vertreten, so war der öffentliche Raum in den folgenden Jahrzehnten fast ausschließlich dem Gedenken aus reaktionärer Sicht vorbehalten.
Mit den Auswirkungen des repressiven politischen Klimas im Vormärz auf die Literatur beschäftigt sich Hermann Blume. Das Verbot, Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen in adäquater sprachlicher Form auszudrücken, führte einerseits in der Lyrik zur Begünstigung antiker Mythen, deren Konflikte und Probleme zeitgenössische LeserInnen zu aktualisieren wussten, andererseits wurde der Musik die Rolle zugewiesen, dem Schmerz, der nicht ausgesprochen werden durfte, eine Stimme zu verleihen. Neben Beispielen von Franz Grillparzer und Adalbert Stifter wird insbesondere das Gedicht Memnon von Johann Mayrhofer als „Selbstdeutung des Schmerzes“ analysiert, der in der Vertonung durch Schubert sein Heil aber nicht in der Todessehnsucht erkennt, sondern in ruhiger Kontemplation.
Christoph Landerer beschäftigt sich abschließend mit den nach der Revolution in Angriff genommenen, längst überfälligen Schul- und Universitätsreformen in Österreich. Speziell die Universitäten, im Vormärz aus Kontrollgründen zu Anstalten degradiert, in denen vorgefertigtes und vom Staat zensuriertes Wissen auswendig reproduziert werden musste, nahmen einen derartigen Aufschwung, dass sie bis zur Jahrhundertwende zu den international führenden zählen konnten. Zu den Kernstücken der Reform gehörte die Verlagerung der ehemals an den Universitäten angesiedelten „philosophischen Studien“ an die um zwei Jahre verlängerten, nun achtklassigen Gymnasien. Hanslicks Freund Robert Zimmermann schrieb dafür das entsprechende, über Jahrzehnte verwendete Schulbuch. Mit Bezug auf den deutschen Philosophen Johann Friedrich Herbart erfolgte eine Konzentration auf Logik und Psychologie, die einerseits die mit dem Deutschnationalismus eng verknüpfte, für die multinationale Verfasstheit der Donaumonarchie daher ungeeignete hegelianische Geschichtsphilosophie vermied, andererseits eine Fokussierung auf ahistorisch-formale Argumentationslinien begünstigte, wie sie etwa auch in der Musikästhetik Hanslicks oder in der Wiener Schule der Kunstgeschichte anzutreffen sind.
ANMERKUNGEN
1CARL DAHLHAUS, „Über die musikgeschichtliche Bedeutung der Revolution von 1848“, in: Melos / Neue Zeitschrift für Musik 4/1 (1978), 15–19, wieder veröffentlicht in: DERS., 19. Jahrhundert III. Ludwig van Beethoven; Aufsätze zur Ideen- und Kompositionsgeschichte; Texte zur Instrumentalmusik (Gesammelte Schriften 6), hg. von HERMANN DANUSER et al., Laaber 2003, 504–510.
2Für eine genauere Beschreibung dieses und weiterer Projekte siehe www.oeaw.ac.at/ikm/, 7.3.2013. Ein von der Stadt Wien gefördertes Teilprojekt (LWI0201) unter meiner Leitung beschäftigt sich speziell mit der Wiener Revolutionsmusik und wird von Carolin Bahr bearbeitet. Ein kommentierter Notenband ist in Ausarbeitung.
3Zum kulturwissenschaftlichen Identitätsbegriff siehe ALEIDA ASSMANN, „Identität“, in: DIES., Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin 2006, 205–237; DIES. / HEIDRUN FRIESE (Hgg.), Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität 3. Frankfurt am Main 1998; ACHIM LANDWEHR / STEFANIE STOCKHORST, „Identität und Alterität“, in: DIES., Einführung in die Europäische Kulturgeschichte. Paderborn 2004, 193–214; LUTZ NIETHAMMER, KollektiveIdentität: Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur. Reinbek bei Hamburg 2000.
4ED.[UARD] H.[ANSLICK], „Wiener Freiheitsmusik“, in: Beilage zur Wiener Zeitung, Nr. 240 vom 3.9.1848, 80 f, wieder veröffentlicht in: DERS., Sämtliche Schriften. Historisch-kritische Ausgabe. Band I/1: Aufsätze und Rezensionen 1844–1848, hg. und kommentiert von DIETMAR STRAUSS, Wien-Köln-Weimar 1993, 176–181, 177.
5EDUARD HANSLICK, Geschichte des Concertwesens in Wien. Wien 1869 (Nachdruck Hildesheim-New York 1979), 377.
6EDUARD HANSLICK, Aus meinem Leben. Mit einem Nachwort hg. von PETER WAPNEWSKI, Kassel-Basel 1987, 92.
7Siehe den Bericht über das Konzert in der Wiener allgemeinen Musik-Zeitung, Nr. 44 vom 11.4.1848, 175.
8Siehe den Bericht über das Konzert in der Wiener allgemeinen Musik-Zeitung, Nr. 43 vom 8.4.1848, 170 f.
9Siehe den Bericht über das Konzert in der Wiener allgemeinen Musik-Zeitung, Nr. 37 vom 24.3.1848, 146.
10Siehe Notiz in der Wiener allgemeinen Musik-Zeitung, Nr. 40 vom 1.4.1848, 159. Es ist nicht uncharakteristisch für den Umgang mit der Revolution in Österreich, dass dieses Denkmal erst 1864 auf dem Schmelzer Friedhof errichtet werden konnte; nach dessen Auflassung 1888 wurde es mit den Gebeinen der Märzgefallenen schließlich auf den Zentralfriedhof überführt. Siehe SUSANNE BÖCK, „Radetzkymarsch und Demokratie. Zur politischen Rezeption der Revolution 1848“, in: 1848 „das tolle Jahr“. Chronologie einer Revolution (241. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien). Wien [1998], 140–147; WOLFGANG HÄUSLER, „Die Wiener ‚Märzgefallenen‘ und ihr Denkmal. Zur politischen Tradition der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848“, in: BARBARA HAIDER / HANS PETER HYE (Hgg.), 1848. Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas (Zentraleuropa-Studien 7). Wien 2003, 251–275.
11DAHLHAUS, „Über die musikgeschichtliche Bedeutung“ (wie Anm. 1), 506.
12ERIKA FISCHER-LICHTE, Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main 2004, 15.
13SYBILLE KRÄMER, „Sprache – Stimme – Schrift: Sieben Gedanken über Performativität als Medialität“, in: UWE WIRTH (Hg.), Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2002, 345.
14Vgl. HELMUT LETHEN, „Nichts dahinter. Auf der Suche nach dem Ereignis unter der Oberfläche der Medien“, in: MALTE HAGENER / JOHANN N. SCHMIDT / MICHAEL WEDEL (Hgg.), Die Spur durch den Spiegel. Berlin 2004, 64–78.
15FREDRIC JAMESON, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. London 1981, 9.
16Siehe etwa DORIS BACHMANN-MEDICK, „Spatial Turn“, in: DIES. (Hg.), Cultural Turns. Neuorientie-rungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2006, 284–328.
17MICHELDE CERTEAU, „Praktiken im Raum“, in: JÖRG DÜNNE / STEPHAN GÜNZEL (Hgg.), Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2006, 343–353, 345.
18NICHOLAS COOK, „Über jeden Verdacht erhaben: Musik, Räumlichkeiten, Sozialitäten“, in: MALIK SHARIF et al. (Hgg.), Umfang, Methoden und Ziele der Musikwissenschaften. Graz 2012, 16–37, 18.
19Vgl. dazu SVEN OLIVER MÜLLER / JÜRGEN OSTERHAMMEL, „Geschichtswissenschaft und Musik“, in: Geschichte und Gesellschaft 38 (2012), 5–20.
20Zum Zusammenhang von Musik und Raum in Alltagssituationen siehe: GEORGINA BORN (Hg.), Music, Sound and Space. Transformations of Public and Private Experience. Cambridge 2013.
21Zur spezifischen Situation Zentraleuropas bzw. zur für diese Region typischen Mehrfachkodierung von Gedächtnisorten vgl. MORITZ CSÁKY, Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle Verflechtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa. Wien-Köln-Weimar 2010; DERS., „Gedächtnis, Erinnerung und die Konstruktion von Identität. Das Beispiel Zentraleuropas“, in: CATHERINE BOSSHART-PFLUGER / JOSEPH JUNG / FRANZISKA M (Hgg.), Nation und Nationalismus in Europa. Kulturelle Konstruktion von Identitäten. Festschrift für Urs Altermatt. Frauenfeld 2002, 25–49.
22HEINRICH RESCHAUER / MORITZ SMETS,Das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. Bd. 2, Wien 1872, 464.
23„Politisch-musikalischer Horizont“, in: Wiener allgemeine Musik-Zeitung, Nr. 72 vom 15.6.1848, 281 f, 281. Der Artikel ist mit dem Kürzel „i. y.“ gekennzeichnet.
24Beilage zur Allgemeinen Österreichischen Zeitung vom 1.6.1848.
25Für seine Vorstellungen, die Theater in Dresden und Leipzig betreffend, siehe RICHARD WAGNER, „Entwurf zur Organisation eines deutschen National-Theaters für das Königreich Sachsen“, in: DERS., Sämtliche Schriften und Dichtungen. Volksausgabe. Bd. 2, 6. Aufl. Leipzig [1912], 233–273.
26MARTIN GREGOR-DELLIN, Richard Wagner. Sein Leben, sein Werk, sein Jahrhundert. 2. Aufl. München 1991, 242–244.
27Von vereinzelten Veröffentlichungen abgesehen, sei mit Bezug auf Wien auf zwei Ausstellungen des Jahres 1998 hingewiesen: Im Historischen Museum der Stadt Wien (heute Wien Museum) war vom 24. September bis 29. November die Ausstellung 1848 „das tolle Jahr“. Chronologie einer Revolution zu sehen. Der Katalog (wie Anm. 10) enthält auch einen musikwissenschaftlichen Beitrag: GERTRAUD PRESSLER, „‚Der Staat ist in Gefahr!‘ Lieder zur Revolution 1848“, 104–117. Ganz der Musik gewidmet war die unter dem Titel 1848. Von Katzen- und anderen Revolutionsmusiken vom Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien veranstaltete Ausstellung im Musikverein, die vom 9. Februar bis zum 28. März lief. Ein Katalog dazu ist nicht erschienen. Für die freundliche Mitteilung über diese Ausstellung danke ich herzlich dem Direktor des Archivs der Gesellschaft der Musikfreundet, Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Biba.
28Man könnte geradezu von einem „kollektiven Gedächtnisschwund“ sprechen. HANS PETER HYE, „Einleitung: Was blieb von 1848?“, in: HAIDER / DERS. (Hgg.), 1848 (wie Anm. 10), 9–29, hier 10. Siehe dazu auch HÄUSLER, „Die Wiener ‚Märzgefallenen‘ und ihr Denkmal“ (wie Anm. 10).
29BRIGITTE HAMANN, „Walzer und Bomben“, in: HAUGVON KUENHEIM (Hg.), Freiheit, schöner Götterfunken! Europa und die Revolution 1848/49 (Zeit Punkte 1/1998). Hamburg 1998, 38–43, hier 43.
I. TOPOGRAPHISCHE ASPEKTE
WOLFGANG HÄUSLER
MARSEILLAISE, KATZENMUSIK UND FUCHSLIED ALS MITTEL SOZIALEN UND POLITISCHEN PROTESTS IN DER WIENER REVOLUTION 1848
Carl Wilhelm Ritter von Borkowski, geboren 1829 in Czernowitz, 1848 Student am Wiener Polytechnikum und Mitglied der Akademischen Legion, 1905 als erfolgreicher Architekt des Döblinger Cottageviertels gestorben, hat in Briefen an seinen Vater seine Erlebnisse der Wiener Revolution in Wort, Zeichnung und Karikatur mit großer Eindringlichkeit beschrieben. Am Montag, dem 21. August 1848, patrouillierte Borkowski durch die Vorstädte, um die Unruhe unter den Arbeitern und Arbeiterinnen bei den öffentlichen Arbeiten unter Kontrolle zu halten.





























