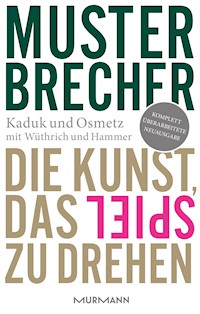
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch zeigt Ihnen, wie man mit herkömmlichen (Führungs-) Muster bricht, um Neues und Ungewöhnliches auszuprobieren – und damit erfolgreich zu sein. Die Musterbrecher und Autoren Stefan Kaduk und Dirk Osmetz kennen als Berater die Denk- und Verhaltensmuster in Organisationen, die trotz New-Work-Rhetorik immer noch den Alltag prägen: Mitarbeitende müssen entwickelt und bewertet werden, Fehler sind tabu, Pläne müssen wider besseres Wissen eingehalten werden. Spätestens hier sind Musterbrecherinnen und Musterbrecher gefragt, Mitarbeiter, die bereit und in der Lage sind, aus den gängigen Klischees auszubrechen, zu experimentieren und die scheinbar selbstverständlichen Dinge gründlich zu hinterfragen. Nicht die Perfektionierung des Vorhandenen (die sowieso nicht gelingt) ist die Devise. Was wirklich hilft, ist eine Änderung der Sichtweise. Die Autoren sind überzeugt: "Veränderung in Organisationen hat nur dann eine Chance, wenn Menschen mit neuen Mustern experimentieren." Jetzt als aktualisierte Neuausgabe mit neuen Beispielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
STEFAN KADUKDIRK OSMETZ
MIT HANS A. WÜTHRICH
DOMINIK HAMMER
MUSTERBRECHER
DIE KUNST DAS SPIELZU DREHEN
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage
Einleitung: Platzwahl. Rebellen, Querdenker, Fassaden, Bühnen: Wer kennt sich im Spiel noch aus – und kann es drehen?
Spielfeld 1 UNSICHERHEIT WILLKOMMENWarum sich ohne Experimente nichts verändert
Spielfeld 2 SCHWÄRMENDE GENIESWarum das Analoge eine Bühne braucht
Spielfeld 3 UNGEHINDERT NEUWarum Organisationen nicht innovativ sind
Spielfeld 4 GELEBTES PLASTIKWarum Begriffsarbeit nottut
Spielfeld 5 EFFIZIENT VERSCHWENDERISCHWeshalb Taylor nie Taylorist war
Spielfeld 6 BRILLANT SELBST ENTFALTETWarum Personalentwicklung nicht funktioniert
Spielfeld 7 GELASSEN KALKULIERTWarum man mit Zahlen nicht rechnen kann
Spielfeld 8 PRINZIPIELL UNVERFÜGBARWarum wir Resonanzachsen brauchen
Spielfeld 9 FAHRLÄSSIG ZUTRAUENWarum sich die Arbeit am Menschen lohnt
Spielfeld 10 EHRLICH VERBUNDENWarum Kunden sich nicht fesseln lassen
Spielfeld 11 GENIAL DANEBENWarum Optionen die besseren Ziele sind
Spielfeld 12 UNERSCHROCKEN ÄNGSTLICHWarum es keine angstfreien Räume gibt
PRESSEKONFERENZ12 Spielfelder – 60 Fragen
Interviewpartner
Über die Autoren
Vorwort zur Neuauflage
Die Überarbeitung eines Buches bietet immer eine gute Gelegenheit zur Überprüfung von Gedanken, die zumindest die Autoren zum Zeitpunkt des erstmaligen Erscheinens für schlüssig und sinnvoll hielten. Diese Überprüfung führte in der nun vorliegenden siebten, deutlich überarbeiteten Auflage nicht dazu, dass – mit einer Ausnahme – Kapitel gänzlich entfielen oder dass eine fundamentale Änderung der Argumentationslinie vorgenommen wurde. Allerdings sind insgesamt 14 neue Beispiele für Musterbrecher hinzugekommen, und die vorhandenen wurden durchgängig aktualisiert, sofern sie nicht für ein singuläres Experiment zu einer bestimmten Zeit standen. Zudem wurden einige konzeptionelle Überlegungen vertieft und weiter ausgearbeitet, andere noch differenzierter abgewogen, wieder andere angesichts neu gewonnener Erkenntnisse relativiert.
In den letzten sieben Jahren haben sich für uns Einsichten und Überzeugungen geschärft, die nun – in Zeiten der Corona-Krise – für jede und jeden deutlich spürbar werden. So dürfte es sich spätestens jetzt als fataler Irrweg erwiesen haben, in Gesellschaft und Wirtschaft einseitig oder gar ausschließlich auf Effizienz zu setzen, während Robustheit als wesentliches Fundament arbeitsteilig operierender Systeme sträflich vernachlässigt wird. Diese Unterlassung wird in seltenen Fällen auf die Unkenntnis der essenziellen Unterschiede dieser beiden Kategorien zurückzuführen sein. Doch offenbar hat sich angesichts einer über einen langen Zeitraum mehr oder weniger reibungslos funktionierenden und wachsenden Wirtschaft so etwas wie eine souverän aufgeklärte Ignoranz eingeschlichen. Die von uns untersuchten Musterbrecherinnen und Musterbrecher haben ihre Organisationen und Verantwortungsbereiche immer schon so gestaltet, dass Strategien, Strukturen, Prinzipien und Regeln genügend Raum für Robustheit ließen. Demzufolge vertreten wir mit ständig wachsender Überzeugung die These, dass Musterbrecher unter anderem deshalb erfolgreich sind, weil sie »verschwenderisch« im Umgang mit Menschen sind – und über diesen robusten Umweg zu einer neuen, anderen Qualität von Effizienz gelangen.
Zudem erweist sich in der aktuellen Krisenlage der Modus des klugen Experimentierens ganz offensichtlich als das Mittel der Wahl. In der Theorie war es schon immer klar: Komplexität lässt sich nicht mit konventionellen Planungsmethoden handhaben. Nun ist die Situation da, in der ein mutiges Experimentieren mit Augenmaß und Bedacht weiterhelfen kann – und von Politik, Wirtschaft und Medizin sogar offiziell eingefordert wird. In diesen Tagen heißt die Parole: »Fahren auf Sicht«. Musterbrecherinnen und Musterbrecher tun genau das in unterschiedlicher Weise schon immer, ohne dass dabei Experimentieren im Sinne eines exkulpierenden Euphemismus als ideenloses und undurchdachtes »Herumprobieren« zu verstehen ist. »Fahren auf Sicht« setzt ein klares Zukunftsbild voraus, immer in dem Wissen, dass dessen Konturen sich stetig verändern und auf diese Veränderungen immer wieder neue Antworten gefunden werden müssen.
Die vorliegende Neuauflage soll nun keineswegs – das Manuskript wurde im Februar vor der Zuspitzung der Corona-Pandemie fertiggestellt – zu einem »Krisennavigator« deklariert werden. Das wäre ein unredlicher Versuch des nachträglichen Hineininterpretierens. Freilich lässt sich bei der Lektüre das aktuelle Geschehen nicht ausblenden, und so mögen Sie vielleicht manche Gedanken oder Beispiele finden, die eine musterbrechende Inspiration auch für den Umgang mit solchen Überraschungen bereithalten, die wir derzeit tagtäglich erleben müssen.
München, im April 2020
Stefan Kaduk und Dirk Osmetz
EinleitungPlatzwahl. Rebellen, Querdenker, Fassaden, Bühnen: Wer kennt sich im Spiel noch aus – und kann es drehen?
»Ich bin eigentlich auch ein Musterbrecher – schon immer gewesen!« Diesen Satz hören wir nicht selten nach Vorträgen oder Workshops. Er wird von Menschen geäußert, die uns zuvor wohlwollend zugehört haben. Wir freuen uns darüber, vor vielen Jahren eher zufällig einen Begriff geprägt zu haben, der positive Assoziationen weckt und sich als Leitgedanke in Diskussionen festgesetzt hat. Ob letztlich jeder selbst ernannte Musterbrecher auch eine entsprechende Haltung an den Tag legt oder nur das Etikett attraktiv findet, spielt keine Rolle, zumal wir uns nicht anmaßen, darüber zu urteilen.
Von grundsätzlicher Bedeutung ist jedoch die Erfahrung, dass in der modernen Gesellschaft sehr viel über das Verlassen bekannter Pfade gesprochen wird. Vorbilder sind offensichtlich nicht mehr die Bewahrer, sondern die Andersmacher. Die Fortsetzung dessen, was bekannt ist, hat keinen guten Ruf mehr. Vielmehr ist der Rebell in fast allen gesellschaftlichen Bereichen zum verehrungswürdigen Vorbild geworden. So sind auch im Management die entsprechenden Vokabeln des Andersmachens zum Bestandteil des Grundwortschatzes geworden: keine Konferenz mehr ohne »Out-of-the-box-Vortrag«, und sowieso wird alles »neu gedacht« oder »revolutionär designt«. Konformität ist zu einem Schimpfwort geworden.
Auf der anderen Seite treffen wir unverändert auf Menschen, die über etwas ganz anderes berichten. Da ist von Erstarrung die Rede, überdies von Verhinderung jeglicher – angeblich von allen gewollter – Eigenverantwortung, gar von Entmündigung im großen Stil und vom Rückfall in alte Zeiten. Die Diagnosen sind jedem bekannt, der in einer oder für eine Organisation arbeitet: von Aufbruch zu neuen Ufern keine Spur!
Wir fragen uns deshalb: Wie passen diese beiden Bilder zusammen?
Auf der Hand liegt folgender Erklärungsversuch: »Andersmachen« ist bloße Rhetorik. Eingebettet in fröhliche Metaphern des Um- und Aufbrechens wird einfach so weitergemacht wie bisher. Die Fassade wird mit einem rebellisch anmutenden Graffito besprüht, während das Bestehende in aller Ruhe verschlimmert wird. Das Management trägt bei der Jahreskonferenz T-Shirts mit dem Aufdruck »Querdenker« – und macht einfach weiter wie bisher. Auf der Hinterbühne haben Theaterstück und Besetzung umso festeren Bestand, je mehr auf der Vorderbühne der Aufbruch inszeniert wird.
Dies entspräche dann ganz dem von Erving Goffman in seinem Klassiker Wir alle spielen Theater beschriebenen Phänomen der Doppelrealitäten. Auf der Oberfläche wird Einzigartigkeit propagiert, hinter den Kulissen findet Einebnung statt. In der Organisationssoziologie der späten 1970er-Jahre bezeichnete man diesen Prozess als Isomorphie: Organisationen gleichen sich einander immer mehr an, weil sie sich der Gesellschaft gegenüber legitimieren und den allgegenwärtigen Professionalitätserwartungen entsprechen müssen. Unternehmen müssen bestimmte Technologien und Prozesse nutzen, sie müssen zertifiziert sein, sie müssen Beauftragte für alle möglichen und unmöglichen Themen installieren. Andernfalls wird ihnen die Akzeptanz versagt, und sie gelten als unmodern. Im Grunde ist es noch drastischer, denn das Spiel endet abrupt, wenn die allgemein geltenden Regeln und Erwartungen verletzt werden. Ohne ISO-Zertifizierung ist die Teilnahme an vielen Ausschreibungen bereits zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hat. In diesem Sinne haben wir es in der Tat auch mit faktischen Zwängen zu tun, nicht nur mit impliziten und folgenlosen Erwartungen, die von außen herangetragen werden. Wer sich der Gleichförmigkeit entziehen will, muss damit rechnen, vom Feld verwiesen zu werden.
Es wundert uns nicht, wenn Führungskräfte sich mit dem Verweis auf Sachzwänge aus der Verantwortung stehlen. Ein Musterbruch sei angesichts des Korsetts der externen Verpflichtungen gar nicht möglich, so die Einschätzung vieler Entscheider. Zugleich erleben wir Organisationen, die im Sinne einer Übererfüllung zusätzliche interne Zwänge produzieren. Das Korsett wird sozusagen ohne Not noch enger geschnürt, sodass am Ende niemand mehr zwischen selbst verschuldeter und zugemuteter Unmündigkeit zu unterscheiden weiß.
Mit dem vorliegenden Buch wollen wir Führungs- und Organisationsfragen beleuchten, für die es keine einfachen Lösungen geben kann. Wir bewegen uns also in gewisser Weise entlang der Motivation, die den Literaturwissenschaftler Joseph Vogl bei seinen Gesprächen mit dem Juristen und Filmemacher Alexander Kluge leitete: »Wir hegen einen Komplexitätsverdacht, dem man nachgehen muss.« 1
Wir werden uns die Mühe machen, hinter die Bühne zu schauen und uns den Phänomenen aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Es ist eben nicht damit getan, das offensichtliche Theaterspiel als solches zu entlarven und den Akteuren die Maske vom Gesicht zu reißen. Schließlich liegt der Verdacht nahe, dass es nicht ohne Grund zwei Bühnen gibt. Wenn Erkenntnis und Umsetzung so deutlich auseinanderklaffen, wie wir das regelmäßig erleben, muss irgendwo Komplexität im Spiel sein, Komplexität, die sich mit trivialen Mitteln nicht beseitigen lässt.
Die Themen der folgenden Kapitel haben wir nicht zufällig ausgewählt. Es handelt sich um die Essenz sowohl unserer universitären Forschung als auch unserer beratenden Begleitung aus den letzten 15 Jahren. In diesem Zeitraum führten wir über 1000 narrative Interviews mit Menschen unterschiedlichster Positionen in unterschiedlichsten Organisationsformen und -größen.
Diese Gespräche zeigten einerseits, dass es dringend angesagt ist, Begriffsarbeit zu leisten. Damit meinen wir keine akademische Übung, sondern schlicht die Notwendigkeit, sich der Substanz hinter gebrauchten Schlagwörtern zu nähern. Was ist gemeint, wenn etwa von Angst in Organisationen die Rede ist? Wieso sind Menschen gerade in einem Umfeld ängstlich, das maximale Sicherheit gewährleistet? Oder was bedeutet es, wenn von kollektiver Intelligenz die Rede ist? Können viele Menschen wirklich gemeinsam schlau sein – und welche Rolle spielt dann noch der Einzelne?
Andererseits konnten wir aus den Interviews lernen, dass die weit fortgeschrittene Professionalisierung auf der Ebene der Instrumente und Methoden nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Ganz im Gegenteil: Man sehnt sich fast schon nach einer »De-Professionalisierung«, durch die unser Denken und unsere Verantwortung wieder gefordert wären. Anders ist es nicht zu erklären, dass Unternehmenslenker, Manager und Mitarbeiter zynisch von der »Perfektionierung des Falschen« sprechen, zu der sie permanent angehalten werden – und die sie letztlich selbst vorantreiben. Unsere Erfahrungen aus weit über 500 Workshops und Vorträgen zeigen, dass Manager 80 bis 90 Prozent ihrer Zeit damit zubringen, im System zu arbeiten, also das Bestehende nach konventioneller Logik zu verbessern. Dies geschieht gleichermaßen in der öffentlichen Verwaltung wie in globalen Handelskonzernen und mittelständischen Industrieunternehmen. Und genau das ist der Grund, weshalb wir die häufig gehörte Einschätzung »Das ist bei uns völlig anders!« nicht ganz teilen. Wenn man den Dingen auf den Grund geht, erweisen sich die Muster nämlich als erstaunlich ähnlich. Anders gesagt: Isomorphie lässt Branchenunterschiede verschwinden.
Oder noch anders betrachtet: Während man von außen gesehen eine kunterbunte Landschaft von Organisationen zu erkennen meint, zeigt sich bei der Betriebsbesichtigung vor Ort, dass es weltweit nur einen einzigen Organisationsdesigner gibt: überall dieselben Systeme, dieselben Instrumente, dieselben Prozesse, dieselben Strukturen. Und überall dieselben Sorgen aus denselben Gründen: Ein Krankenpfleger hat keine Zeit mehr für das Patientengespräch, weil er die Pflegequalität immer genauer dokumentieren muss. Eine Vertriebsleiterin kann keine neuen Absatzwege ausprobieren, weil sie ihre Energie für die Verbesserung des Prozesses zur Außendienststeuerung ver(sch)wenden muss.
Doch ab und zu wird man auf der mitunter ermüdenden Besichtigungstour auch überrascht und trifft auf mutige Menschen, die den Steuerungs- und Kontrollraum renoviert oder gar umgebaut haben. Manche haben den Systemen nur einen neuen Anstrich gegeben, andere trauten sich, vorgeschriebene System-Updates zu ignorieren, wiederum andere ließen vollkommen neue Komponenten bauen und versteckten sie geschickt in den alten grauen Gehäusen.
Um genau diese Renovierer, Umbauer, Update-Ignorierer und Komponentenauswechsler geht es in diesem Buch. Wir nennen sie Musterbrecherinnnen und Musterbrecher. Diese Menschen würden sich selbst nie als Rebellinnen oder Querdenker bezeichnen. Sie wissen, dass es letztlich albern ist, sich publikumswirksam als Nonkonformisten zu gerieren. Deshalb ziehen sie erst gar nicht in einen Wettstreit um die sichtbare Abweichung vom Üblichen, zumal dieser meist gegen die – wie Norbert Bolz es ausdrückt – »Konformisten des Andersseins« 2 geführt wird. Zudem agieren Musterbrecher nach wie vor in der klassischen Grundordnung der Märkte und des Wettbewerbs. Sie verlassen also nicht das Spielfeld als Aussteiger, machen aber auch nicht einfach weiter wie bisher. Wobei der eine oder andere sogar Ideen umgesetzt hat, die sich bewusst von der Wachstumslogik des »Höher, Schneller, Weiter« abgrenzen.
Wir haben uns lange überlegt, ob wir den Begriff des Spielens im Buchtitel wirklich verwenden sollen. Es könnte schließlich der Eindruck entstehen, wir sprächen mit spielerischer Leichtigkeit über Dinge, die für die betreffenden Organisationen und Menschen eine prinzipiell ernste Angelegenheit sind. Wir alle wissen ja aber, dass ein Spiel durchaus sehr ernsthaft betrieben werden kann – der Sport, insbesondere der Fußball, macht es vor. Doch sehen wir in Musterbrechern keineswegs die Helden, die in der Nachspielzeit den entscheidenden Siegtreffer erzielen. Sie machen ihre Arbeit im Gegenteil oft im Verborgenen und unterstützen eher andere dabei, Tore zu schießen. Wir sehen den Spielbegriff in enger Verbindung zum Experiment. Vor Augen haben wir einen klugen »Homo ludens«, der vorurteilsfrei und mutig, aber sehr reflektiert Neues ausprobiert. Er überwindet die Ängste nicht dadurch, dass er sie ausblendet, sondern indem er sie zum Thema macht.
Beim Lesen des Buches wird man früher oder später feststellen, dass sich manche Kapitel inhaltlich überschneiden, wechselseitig ergänzen, bisweilen aber Argumentationen oder Schlussfolgerungen vielleicht auch nur schwer miteinander in Einklang zu bringen sind. Diese Unschärfen liegen in der Komplexität der Sache. Das Herausschneiden einzelner Themen aus einer komplex gestalteten Themenlandschaft bleibt eine subjektive Setzung, die aber die Stringenz der zugrunde gelegten Struktur nicht tangiert.
Abschließend noch ein Hinweis: Wir haben uns nach langer Diskussion aus pragmatischen Gründen dazu entschlossen, mit den weiblichen und männlichen Formen von Substantiven uneinheitlich umzugehen. So wird, ohne dass irgendeine Absicht dahintersteht, in bunter Mischung von »Mitarbeitenden«, »Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern« und auch nur von »Mitarbeitern« die Rede sein. In allen Fällen sind Frauen und Männer gemeint.
München, im April 2020
Anmerkungen
1 Vogl, J.: »Das Loch in der Wirklichkeit – Gespräch mit Alexander Kluge«, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 17.05.2009, S. 23–24.
2 So der Titel seines Beitrags imMerkur-Sonderheft, 10/11-2011, »Sag die Wahrheit! – Warum jeder ein Nonkonformist sein will, aber nur wenige es sind«, S. 781 ff.
Spielfeld 1UNSICHERHEIT WILLKOMMENWarum sich ohne Experimente nichts verändert
Im Frühsommer 2006 werden wir vom Leiter des sogenannten »Thinktanks« eines großen deutschen Versicherungskonzerns mit einem Forschungsprojekt beauftragt. Zu dieser Zeit lautet das Wort der Stunde: Exzellenz. Der Begriff schlägt damals ähnlich hohe Wellen wie zehn Jahre später der der Agilität. Unsere Aufgabe ist es, eine Studie zu erstellen: Einerseits sollen wir den Begriff »Exzellenz« und seine gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz aus der Vogelperspektive betrachten, andererseits aber auch ganz konkrete Beispiele – Benchmarks – recherchieren. Es geht nicht nur um Begriffsarbeit. Man erwartet von uns auch konkrete Handlungsempfehlungen.
Das Thema ist interessant. Seit vielen Jahren schon wird viel von Exzellenz gesprochen, und dabei ist keineswegs sicher, was wirklich damit gemeint ist. Geht es um »intelligente« Zusammenschlüsse von Universitäten und Unternehmen? Sind Exzellenzcluster eine Verbindung von Forschungseinrichtungen – oder nur eine neue Bezeichnung für konsequente Interdisziplinarität mit Bezug zur Ökonomie? Heißt jetzt alles exzellent, was irgendwie über dem Durchschnitt liegt – vergleichbar mit der weichspülenden Formulierung von Arbeitszeugnissen? Nach einem halben Jahr der Recherche in einem insgesamt fünfköpfigen Forschungsteam und nach einer Reihe von Interviews mit Wissenschaftlern und Wirtschaftspraktikern, Medizinern, Sportlern und Geistlichen bleibt unser Bild von Exzellenz diffus. Organisationen können sowohl trotz als auch aufgrund hervorragender Strukturen und Prozesse exzellent (oder das Gegenteil) sein. Manche sind exzellente Nachahmer, andere exzellente Vorreiter. Einige zeichnen sich durch die Exzellenz der Teams aus, andere durch die von einzelnen Mitarbeitenden. Für uns wird klar, dass es kein einheitliches Exzellenzverständnis gibt. Und es ist keine Karte in Sicht, die den Weg zur Exzellenz beschreiben könnte. Das Problem ist nur: Wir können am Ende des Forschungsprojektes kein Rezept präsentieren, was – wie man sich vorstellen kann – beim Auftraggeber keine Begeisterungsstürme auslöst.
Unser schlechtes Gewissen beruhigt sich etwas, als uns Franz-Josef Radermacher, Professor für Informatik, Vorstand des Kuratoriums der Global-Marshall-Plan-Initiative und Mitglied des Club of Rome, in einem Interview seine Sicht auf die Dinge schildert: »Meine Wahrnehmung des in der Wirtschaft dominierenden Exzellenzverständnisses? Es ist oft lediglich dummes Gerede, Marketing. Für mich beginnt es beim Menschen als sozialem Wesen. Ein richtiger Exzellenzbegriff hat nur als soziales Konstrukt Sinn.«
Es ist nicht verwunderlich, dass es uns nicht gelang, einen Masterplan zur Exzellenz vorzulegen. Schließlich muss jedes System seine eigene Exzellenz (er)finden. Und dieses Finden und Erfinden geschieht naturgemäß nicht in einem bereits abgesteckten Gelände. Vielmehr muss man sich in einen unsicheren Suchprozess begeben, den wir als »Experiment« oder »Versuch« bezeichnen wollen. Wir meinen damit einen mehr oder weniger wagemutigen Schritt in die Ungewissheit, von dem man noch nicht weiß, ob er gut oder schlecht ausgehen wird. Später werden wir sehen, dass er in keinem Fall scheitern kann.
In der Technik und in der wissenschaftlichen Forschung ist das Experiment ein Standardverfahren zum Erkenntnisgewinn.
Experimente sind dazu da, deduktiv gewonnene Erkenntnisse zu verwerfen oder zu bestätigen, andererseits stellen sie eine Basis für die Abstraktion von Beobachtungen dar. In beiden Varianten ist der Kern das Infragestellen der Wirklichkeit. Es ist in unserem Sinne unerheblich, ob man eine Hypothese zugrunde legt, die dann überprüft wird, ober ob man eine bis dahin nicht beobachtete Situation erzeugt. Es geht in beiden Fällen darum, sich vom Ergebnis »überraschen zu lassen«.3 Ziel ist das Entdecken von etwas brauchbarem Neuen oder von etwas nicht mehr brauchbarem Alten.
Beau Lotto ist Künstler, Neurowissenschaftler, Spezialist auf dem Gebiet der Wahrnehmung und Gründer des Lab of Misfits, eines Instituts, dessen Website auf der Startseite mit zwei richtungsweisenden Aussagen aufwartet: »All the world is a lab« und »Every moment, an experiment.« Lotto konkretisiert in einem TED-Vortrag seine Überzeugung wie folgt: »Wahrnehmung (Denken, Fühlen, Erleben, Handeln, Träumen …) ist in unserer Erfahrung begründet und verankert. Diese Perzeptionen sind primär unbewusste Prozesse individueller Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung. Wir sehen nicht, was da ist, sondern wir sehen zuallererst einmal das, was in der Vergangenheit sinnvoll war. Unser Sehen entspricht Erfahrungen, die wir im Vorfeld machten.« 4 Folglich werden unsere Wahrnehmungen von Mustern geprägt, die uns einmal halfen, ein Problem zu bewältigen, oder die uns für ähnliche Situationen nützlich erscheinen. Ständig suchen wir, bewusst und unbewusst, nach Mustern, die uns Sicherheit versprechen. Denn stets wurde in unserer Entwicklungsgeschichte unsere Existenz bedroht: Ist das eine Schmusekatze oder ein Säbelzahntiger? Wer hier unsicher war, wurde gefressen.
Das Gehirn hasst Ungewissheit wie die Pest! 5
Ungewissheit erzeugt Unbehagen, oft auch Angst, denn sie ist bei Weitem unangenehmer als eine Risikosituation. In der Entscheidungstheorie zeichnet sich Risiko dadurch aus, dass die sogenannten »Eintrittswahrscheinlichkeiten« bekannt sind. Oder anders ausgedrückt: Wir wissen oder glauben zu wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Problem auf- oder ein Zustand eintritt. Kennen wir diese Wahrscheinlichkeiten nicht, wissen aber – vielleicht aus ähnlichen Situationen –, dass Wahrscheinlichkeiten vorliegen müssten, bezeichnen wir das als Unsicherheit. Richtig schwierig wird es jedoch, wenn wir es mit Ungewissheit zu tun haben. Von dieser sprechen wir dann, wenn die Art möglicher Ergebnisse und folglich auch deren Eintrittswahrscheinlichkeiten unbekannt sind.
Zu jeder Zeit war menschliches Zusammenleben von dem Bestreben geprägt, Unsicherheit und vor allem auch Ungewissheit durch Schaffung einer bestimmten Ordnung zu vermeiden. Zu diesem Zweck gab und gibt es Regeln, früher aufgestellt von Pharaonen, Königen oder Ständen, heute manchmal das Ergebnis demokratischer Willensbildung, bisweilen sogar das Produkt despotischer Machtausübung. Nach wie vor gibt es gesellschaftliche Hierarchien, die für Ordnung sorgen. In früheren Jahrhunderten wurde diese Ordnung mitunter radikal und menschenverachtend herbeigeführt. In der Antike etwa wurden Sklaven nur bedingt als Menschen angesehen. Durch diese Ausgrenzung erhielten jene, die als Freie den Status vollwertiger Menschen hatten, Sicherheit im Umgang mit den Sklaven. Im Mittelalter zeigte sich die gesellschaftliche Stellung durch die Art der Kleidung. Das Handwerk organisierte sich in Zünften und legte fest, was »unzünftiges« Verhalten war. Es galt als frevelhaft, nach Fortschritt zu streben.6 Heute suchen wir Sicherheit in der oft gescholtenen und dann doch immer wieder in Anspruch genommenen bürokratischen Ordnung. Im Grunde lieben wir den Zustand höchster Sicherheit, Beständigkeit und Kontinuität.
Trotz ihres Dauerbekenntnisses zum permanenten Wandel produziert die moderne Gesellschaft westlicher Prägung unablässig Institutionen, die der Sicherheit dienen sollen – im Gesundheitswesen, in der Justiz, in der Bildung und in Unternehmen.
Wir beklagen die selbst in großen Organisationen abnehmende Arbeitsplatzsicherheit und nähern uns eher halbherzig den neuen Chancen fluider und virtueller Beschäftigungsformen. Nach Dirk Baecker bestimmen Entscheidungsabläufe den Bauplan von Organisationen. Zu jeder Entscheidung bedarf es vorhandener Kompetenzen, Ressourcen und Fähigkeiten. Getroffene Entscheidungen vermitteln Klarheit und beseitigen Ungewissheit und Unsicherheit in der Kommunikation. Andere Stellen der Organisation bis hin zum Kunden werden damit nicht mehr belastet. Sie können mit der getroffenen Entscheidung weiterarbeiten.7
Es stellt sich sofort die Frage, wie wir trotz allen Sicherheitsstrebens jemals etwas Neues erkennen konnten. Wie kommt es dennoch zu Veränderung und Innovation? Warum »riskieren« es manche Unternehmer, Mitarbeitende am Band oder im Callcenter tatsächlich in die Selbstverantwortung zu entlassen? Wie kommt es, dass Firmen die Sicherheit eines geordneten Gehaltssystems bewusst zerstören, indem die Mitarbeitenden die Höhe ihres Gehalts selbst bestimmen dürfen?
Weil wir – oder zumindest einige von uns – damit begonnen haben, Fragen zu stellen. Es geht um bislang unbeantwortete, ja sogar um prinzipiell unbeantwortbare Fragen. Letztere sind nach Heinz von Foerster Fragen, für die noch kein Bezugssystem existiert, in dem sie eindeutig zu beantworten wären. Es sind genau diese Fragen, die uns auf die Stufe der Ungewissheit führen. Wer dennoch auf etwas Unbeantwortbares antwortet, exponiert sich, kann auf kein Sicherheit gebendes Faktum aus der Vergangenheit verweisen. Daraus entsteht wiederum eine sehr große Freiheit, so Heinz von Foerster. Denn wir können nahezu beliebig antworten, sofern wir den Preis der Verantwortung zu zahlen bereit sind.
Wenn wir also etwas Neues wollen, müssen wir uns ganz bewusst in die Ungewissheit begeben.
Darum sind im Sinne der Veränderung jene Fragen die besten, die Ungewissheit erzeugen. Es handelt sich um Fragen, bei deren Lösung weder irgendein Algorithmus noch die Erfahrung eines bereits erfolgreich beschrittenen Weges helfen können. Jedes Mal, wenn man sich mit diesen unangenehmen Fragen beschäftigt, erforscht und offenbart man seine individuellen Wertvorstellungen und Haltungen: »Liebe ich meinen Partner wirklich?«, »Kann ich meinem Nachbarn vertrauen?«, »Braucht Schule Noten?« oder »Müssen unsere Krankenhäuser nach Managementstandards geführt werden?«
Nach Beau Lotto haben Menschen ein »Verfahren« entwickelt, das es ihnen erlaubt, gefahrlos diese Fragen zu stellen: das Spielen.
Das Spiel ist eines der wenigen Dinge, in dem wir Ungewissheit zelebrieren. Es eröffnet Möglichkeiten.
Es ermöglicht, dass sich Menschen ausprobieren. Es basiert auf intrinsischer Motivation und Kooperation. Letztlich spricht Lotto damit die Vorstellung vom Homo ludens an. Damit ist jene Figur gemeint, die der Niederländer Johan Huizinga Ende der 1930er-Jahre beschrieb. Der spielende Mensch wächst in seinen individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten – vorausgesetzt, er bewegt sich in einem Feld, das ihm Handlungsfreiheit zugesteht.
Wenn wir uns diese Charakteristika des Spielens näher anschauen, wird deutlich, dass sie gleichzeitig die Voraussetzungen sind, die ein guter Wissenschaftler braucht, um zu neuer Erkenntnis zu gelangen. Was uns jedoch beim Spielen (englisch: play) noch fehlt, sind Regeln. Wenn wir dem Spielen Regeln geben, wird daraus das Spiel (englisch: game). Es entsteht so etwas wie Monopoly, Fußball oder Angry Birds. Das Spiel bietet den Rahmen, das Ergebnis bleibt offen. Experimentieren ist demnach ein Spiel mit offenem Ausgang.
Der Nobelpreisträger für Chemie von 1993, Kary Mullis, sagte in einem Vortrag, in dem er dem Experiment als der zentralen Basis moderner Wissenschaft huldigte,8 es entspreche seinem Selbstverständnis, dass man, wenn man etwas herausfinden wolle, ein Experiment mache. Diese Denkweise prägte die letzten 350 Jahre von dem Moment an, in dem die Mathematik und die Naturwissenschaften sich von der Philosophie trennten. Als man Ende des 16. Jahrhunderts zu experimentieren begann, bedrohte man die Autorität der Heiligen Schrift.9
Ohne den Mut, Fragen zu stellen, die bisher keiner zu stellen gewagt hatte, wären die innovatorischen Bewegungen bis heute vermutlich nicht möglich gewesen.
Erst ein neues wissenschaftliches Verständnis machte dies möglich. Nicht mehr der aus heutiger Sicht fast naive Umgang mit scheinbar gesichertem Wissen, das von Klerus und Adel »verwaltet« wurde, sondern die Evidenz durch das Experiment waren von diesem Zeitpunkt an ausschlaggebend.10
Doch wo finden wir diesen Mut zum Experimentieren im Management?
An erschreckend wenigen Orten. Und der Grund dafür ist schnell gefunden: Das Experimentieren ist weder Bestandteil der universitären Management-Curricula noch der Führungsausbildung. Man kennt den Begriff eventuell noch in der Marktforschung oder lernt in der Organisationspsychologie das eine oder andere Experiment kennen. Die Ausbildung und das Selbstverständnis von Management schließen das Experimentieren per definitionem aus. Management wird als die Planungsinstanz in der Organisation interpretiert. Es geht um die Leitung von Unternehmen nach allgemein anerkannten Prinzipien, die Effizienz sicherstellen sollen. Der Versuch ist hingegen geradezu verpönt. Ein Manager experimentiert nicht. Schließlich weiß er, was zu tun ist. Und man möchte sich schließlich nicht der Gefahr aussetzen, unangenehm überrascht zu werden.
Seit 1997 verfolgen wir die Entwicklung von Curitiba. Die in Deutschland eher unbekannte Hauptstadt des Bundesstaates Paraná im Süden Brasiliens könnte sich nach 2014 etwas mehr ins Blickfeld geschoben haben. In der Arena da Baixada von Curitiba gewann Spanien bei der Fußball-WM sein letztes Vorrundenspiel gegen Australien mit drei zu null (musste aber aufgrund der beiden anderen verlorenen Spiele dennoch die Heimreise antreten).
Doch hier soll es nicht um Fußball gehen, sondern um die Stadt Curitiba als Keimzelle für gesellschaftliche Neuerungen. Unter Experten gilt sie als eine der innovativsten Städte, wurde dafür bereits 1996 geehrt, von der Zeitschrift Forbes 2009 als smarteste Stadt des Planeten betitelt und 2016 für das bereits 1986 gestartete »Urban Agriculture Programme« als eine der nachhaltigsten Städte der Welt ausgezeichnet.11 Diese auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität ausgerichtete Metropole passt so gar nicht in unser Klischee einer brasilianischen Stadt.
In uns reifte der Wunsch, einmal selbst nach Curitiba zu reisen. Da kam uns ein Zufall zu Hilfe. Einer unserer Studenten lebte mit seinem Vater, einem Manager bei VW, für einige Jahre dort. Da er Portugiesisch spricht und die Stadt zum Gegenstand seiner Masterarbeit machen wollte, organisierte er unsere »Forschungsreise« und begleitete uns.
Schon beim Anflug auf Curitiba ist klar, dass diese Stadt eine besondere ist. Während São Paulo wie eine nicht enden wollende Betonwüste aus Häusern und Straßen wirkt, erscheint Curitiba als eher »grüne Stadt«. 1971 gab es pro Einwohner nur eine 0,5 Quadratmeter große »nutzbare« Grünfläche. Mittlerweile sind daraus 54 Quadratmeter geworden – und das bei inzwischen verdreifachter Einwohnerzahl. Das bedeutet eine dreihundertfache Vergrößerung der Grünflächen im Vergleich zu 1971. Die unzähligen Parks, Wiesen und Stadtwälder werden gleichzeitig als Ausgleichsflächen für Überschwemmungen genutzt. Von diesen war die Stadt oft betroffen, und gerade die arme Bevölkerung in hochwassergefährdeten Gebieten litt besonders darunter. Selbst für europäische Verhältnisse sind die Parks entlang der fünf Flüsse, die Curitiba durchschneiden, beeindruckend. Ihre Funktion als Ausgleichsflächen erfüllen sie hervorragend, obwohl bis in die Mitte der 1980er-Jahre Baufirmen und nicht ganz uneigennützige Städteplaner die Stadtverwaltung gedrängt hatten, alle Flüsse in unterirdische Kanäle umzuleiten – ein riesiges Projekt, an dem man gut hätte verdienen können.
Beim Verlassen des Flughafens sehen wir an jeder Ecke sechs verschiedenfarbige Mülleimer für die diversen Müllsorten stehen. Wir steigen in den Flughafenbus. Die Stadt ist unvorstellbar sauber. Keine Zigarettenkippen auf den Gehwegen, kein Müll in den Grünanlagen. Und sie wirkt sehr europäisch. Nur ab und zu sieht man Viertel, in die man sich nicht hineintrauen würde, die sogenannten »Favelas«. Je weiter wir in die Stadt hineinkommen, desto häufiger sehen wir röhrenförmige – fast futuristisch anmutende – Bushaltestellen. Auf einer gesonderten Spur kommt uns ein circa 25 Meter langer Doppelgelenkbus entgegen. Ähnlich einer U-Bahn halten diese Hochflurbusse, die bis zu 270 Passagiere transportieren können, an den Haltestellenröhren und klappen ihre Rampen aus, über die dann die Fahrgäste barrierefrei zusteigen können.
In den kommenden Tagen besichtigen wir alle bekannten Orte der Stadt: die Oper aus Stahl und Glas, die innerhalb von drei Monaten gebaut wurde, die aus alten hölzernen Laternenmasten erstellte Umweltuniversität, die erste Fußgängerzone Lateinamerikas, die dutzendfach über die Stadt verteilten Bibliotheken, die »Leuchttürme des Wissens« heißen und auch genau so aussehen. Wir besuchen das IPPUC, das Institut für Forschung und Stadtplanung. Es ist ein Lern- und Experimentiercenter für Ingenieure, Architekten und Stadtentwickler. Unabhängig vom städtischen Planungsamt, aber gebunden an die Direktiven des Bürgermeisters, entwickelt man die Stadt weiter. Die Bürger bringen sich in den Planungsprozess ebenso ein wie in die Umsetzung.
Das Highlight unserer Curitiba-Reise ist der Vorabend der Abreise. Wir treffen den damals 73-jährigen Architekten Jaime Lerner. Der ehemalige Bürgermeister und Gouverneur gilt als Visionär. In seinen drei Amtszeiten (1971, 1979 und 1989) haben er und sein Team die Entwicklung von Curitiba maßgeblich beeinflusst. Wir sitzen in einem offenen einstöckigen Gebäude, das irgendwie nicht zwischen die Hochhäuser passt, von denen es »eingeklemmt« wird. Früher war es das Wohnhaus von Lerner. Heute befindet sich darin sein Architekturbüro. Wir sprechen mit einer seiner Mitarbeiterinnen über die Stadtentwicklung. Man merkt sofort, dass sie ihre Stadt liebt. Diesen besonderen Stolz auf Curitiba hatten wir immer wieder gespürt, ob beim Taxifahrer oder beim Verkäufer. Dann betritt Jaime Lerner den Raum. Er ist schwarz gekleidet, atmet schwer, geht langsam. Er wirkt kränklich. Das ändert sich schlagartig, als er zu erzählen beginnt. Immer wieder funkeln seine Augen, und er wirkt fast spitzbübisch. Lerner wurde unzählige Male ausgezeichnet, unter anderem von UNICEF und der OECD. Wir fragen ihn, wie er 1971 seine Veränderung startete: »Zuerst einmal hatte ich ein gutes Team mit tollen Leuten. Wir alle folgten einer Vision. Wir liebten unsere Stadt und wollten sie lebenswerter machen. Dann machten wir uns auf den Weg. Wir probierten Schritt für Schritt immer neue Dinge aus. Dabei war das Anfangen das Wichtigste. Entscheidend war, dass wir Raum für Korrekturen ließen.« So sei zum Beispiel das Bus Rapid Transit System entstanden, erzählt Lerner. »Damals sagte jeder Städte- und Verkehrsplaner, dass eine Stadt, die auf eine Million Einwohner wächst, eine U-Bahn brauche. Eine solche konnten wir uns aber nicht leisten. Also planten und bauten wir eine ›überirdische U-Bahn‹ mit den U-Bahn-spezifischen Charakteristika: Die Verbindung sollte schnell sein, es sollte nur wenige Haltestellen geben, und die Taktung musste eng sein – in Stoßzeiten jede Minute ein Bus. Es begann mit wenigen Linien, auf denen 25 000 Menschen am Tag befördert wurden. Heute transportieren wir 2,4 Millionen Bürger im Großraum Curitiba und in angrenzenden Städten. London, um ein Vielfaches größer, mit der ältesten U-Bahn der Welt, schafft gerade drei Millionen Passagiere am Tag. Wichtig ist, dass das gesamte öffentliche Verkehrssystem von Curitiba ohne Subventionen funktioniert. Dafür hatten wir nie Geld, das brauchten wir für Bildung und medizinische Versorgung.« Wir erfahren außerdem, dass der Bau eines Kilometers dieses Bussystems circa eine Million US-Dollar kostet, der Bau der gleichen Stecke für eine U-Bahn dagegen hundert Millionen.
Was mit einem Experiment vor etwa 40 Jahren begann, ist heute ein Exportschlager, geliefert in fast hundert Städte weltweit. Darunter Metropolen wie Seoul, Los Angeles oder Montreal.
Der Vater eines weiteren Experiments in Curitiba ist Nicolau Klüppel. Er hatte im Team um Lerner eine Idee, wie man die Favelas – Slums, die durch das schnelle Wachstum der Stadt entstanden sind – von ihrem Müll befreien konnte. Da diese Gebiete häufig schwer zugänglich sind, hatte er die geniale Idee, dass die Menschen ihren Müll doch einfach zu Sammelstellen bringen könnten. Als Anreiz bekamen sie Busfahrscheine, später dann Lebensmittel. Innerhalb von Monaten wurden die Gebiete sauber. Klüppel erkannte, dass es besser ist, den Müll gleich zu trennen, da er so effizienter recycelt werden kann. Daraus entstand eine Kampagne, die gemeinsam mit Schülern begann und die Stadt zum Ort mit der höchsten Recyclingquote der Welt (um die 70 Prozent) machte. Für diesen Erfolg hatte man im Vorfeld viel Häme einstecken müssen, da Mülltrennung in Brasilien für unmöglich gehalten wurde.
Wir fragen Jaime Lerner zum Abschluss nach den größten Herausforderungen Curitibas. Er denkt kurz nach. »Erstens galt es immer wieder, die eigene Unsicherheit zu überwinden, eine gute Idee einfach auszuprobieren, nicht nach dem Haken zu suchen. Zweitens mussten wir schneller sein als die eigene Bürokratie. Und drittens war es extrem wichtig, wenn der Entscheid gefallen war, auch wirklich schnell zu beginnen.« Was er damit meint, macht er an folgendem Beispiel deutlich: »Anfang der 1970er-Jahre hatten wir uns überlegt, dass es nicht richtig sein kann, die Stadt nur für den Autoverkehr zu optimieren. Wir wollten die erste Fußgängerzone in Südamerika bauen, die ein paar Straßenblöcke umfassen sollte. Wir rechneten damit, dass es gerichtliche Einsprüche geben würde, die den Bau um Monate oder gar Jahre verzögert hätten. Deshalb beschlossen wir, die Fußgängerzone in 48 Stunden zu bauen. Das war für den zuständigen städtischen Baubeauftragten unvorstellbar. Er sagte, dass der Bau mindestens sechs Monate dauern würde. Ich bestand auf 48 Stunden. Wir diskutierten und diskutierten. Irgendwann sagte er: ›Gut, wenn ich alles Material im Vorfeld bereitstellen kann, dann schaffen wir es in ein paar Wochen.‹ Ich blieb hart. Am Ende begannen wir freitagabends und eröffneten die Fußgängerzone am Montagabend – nach 72 Stunden Bauzeit. Danach kam der Sprecher der Geschäftsleute auf mich zu und übergab mir eine vorbereitete Petition, die den Bau stoppen sollte. Ich könne sie als Souvenir haben. Jetzt wollten er und die anderen Ladeninhaber, dass die gesamte Straße in eine Fußgängerzone umgewandelt werde.« Lerner verabschiedet uns mit den Worten, dass es einerseits wichtig sei, Menschen, wann immer möglich, einzubeziehen, andererseits aber nicht immer nach dem »Was wollt Ihr?« zu fragen. Man solle einfach Dinge ausprobieren, einfach den Mut haben, zu starten. Nicht nach Perfektion streben. Die gebe es nicht, so der Altbürgermeister. »Andere werden es dann irgendwann besser machen.«
Nach diesem Gespräch war uns klar, warum Jaime Lerner 2010 vom Time Magazine als einer der 25 einflussreichsten Denker der Welt ausgezeichnet wurde.
Mit Sicherheit ist Curitiba kein Paradies, das betont auch Jaime Lerner immer wieder. Auch wenn die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt bei über 80 Prozent liegt, gibt es Probleme mit weiter ansteigendem Verkehr und dem Zuzug von immer mehr Menschen aus ländlichen Gebieten. Und natürlich war vieles, was Lerner und sein Team gestartet hatten, auch unbequem und wurde von den Bürgern oft nicht nur positiv bewertet. Das drückt sich auch darin aus, dass seine drei Amtszeiten nicht zusammenhängend waren, sondern dazwischen immer andere Bürgermeister gewählt wurden. Doch zum Glück waren Lerner und sein Team nicht bereit, sich nur als Erfüllungsgehilfen des vorhandenen städtischen Systems oder nur als Berufspolitiker zu begreifen, sondern als eine Gruppe, die das Bestehende immer wieder infrage stellte und ohne Anspruch auf Perfektion Experimente machte, die vor ihnen so noch keiner gewagt hatte.
Warum fehlt diese Experimentierfreude im Management, obwohl wir im Alltag dauernd experimentieren?
Ständig starten wir Versuche mit völlig unklarem Ende. Die Frage etwa, mit wem wir den Rest unseres Lebens verbringen möchten, bleibt ewig ein Versuch mit offenem Ausgang. Wir können nicht wissen, ob die Beziehung hält, auch wenn wir es uns noch so wünschen. Und der Versuch, die Partnerwahl durch Tools zur Risikovermeidung zu professionalisieren, erscheint uns mit Recht absurd. Oder kennen Sie jemanden, der seinen Partner oder seine Partnerin mithilfe einer Nutzwertanalyse ausgewählt hat? 12 Wir müssen uns hier auf ein Langzeitexperiment einlassen. Gleiches gilt für die Erziehung der Kinder, die Wahl einer weiterführenden Schule nach der vierten Klasse oder die Entscheidung für einen Ausbildungs- oder Studienplatz. Es hört nicht auf.
Letztlich ist unser Leben durch nie endende Episoden des Versuchens und Ausprobierens geprägt.
Wenn wir Unsicherheit oder Ungewissheit über den Ausgang einer in komplexem Umfeld zu treffenden Entscheidung als den Kern des Experimentierens ansehen, dann befinden wir uns eigentlich in einem permanenten Versuchsstadium. Auch in der Managementliteratur und in Sonntagsreden wird längst das Ende der stabilen und eindeutigen Welt betont.
Das Wissen, Komplexität im wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umfeld 13 niemals eindeutig und absolut sicher handhaben zu können, ist vorhanden. Doch mit den in den Fokus des Managements rückenden neuen Formen der Zusammenarbeit – häufig im Kontext der agilen Bewegung oder im Rahmen von New Work – bekommt dieses Bewusstsein zeitgleich einen wirkmächtigen »Antagonisten«: die künstliche Intelligenz (KI).
Ihr Versprechen ist, mit der Komplexität der Welt – neuerdings auch mit dem Akronym VUCA für die englischen Begriffe volatility, uncertainty, complexity und ambiguity gekennzeichnet – umgehen, sie sogar reduzieren zu können. Gerade im ökonomischen Umfeld trifft dieses Versprechen auf einen äußerst fruchtbaren Boden. Denn Lager- und Prozessoptimierung, Energieeinsparung oder auch die Vorhersagbarkeit von Konsumentenverhalten erzielen Effizienzgewinne von bisher nicht vorstellbarem Ausmaß. So hat Google die Kühlung des eigenen Rechenzentrums so optimieren können, dass eine Energieeinsparung von bis zu 40 Prozent möglich wurde.14 Und die US-amerikanische Bank J.P. Morgan Chase konnte sogar die Zeit, die Sachbearbeiter mit der Prüfung von Kreditverträgen verbrachten, von 360 000 Stunden auf wenige Sekunden reduzieren.15 All das gelingt mithilfe künstlicher Intelligenz oder kurz: KI.
Dieser etwas unklare, teilweise umstrittene, andererseits »hochgejazzte« Begriff »KI« ist bereits 1955 von dem Mathematikprofessor John McCarthy geprägt worden. Doch als die Visionen und Versprechen der damit aufkommenden Wissenschaft sich nicht erfüllten, fiel diese in einen Dornröschenschlaf, aus dem die KI aufgrund neuer computertechnischer Möglichkeiten erst Mitte der 1990er-Jahre wiedererweckt wurde. Es kam zu rasanten Entwicklungen, von denen wir alle mittlerweile betroffen sind, und nicht selten haben wir diese fest in unserem Alltag verankert: vom Navigationssystem mit Stauwarnung über die individuell optimierte Reiseplanung bis hin zu Sprachassistenzsystemen wie Siri, Alexa und Co. Überall stecken Algorithmen dahinter, die Problemlösungen liefern, die vor wenigen Jahrzehnten in ähnlicher Form nur von Menschen hätten geliefert werden können.
Es ist beeindruckend, wie die bisher realisierten KI-Systeme in großen Datenmengen (Big Data) Muster erkennen und Zusammenhänge herstellen. In manchen Ländern ist die Mustererkennung so weit im Einsatz, dass der biometrische Scan des Gesichts ausreicht, um eine Zahlung zu tätigen.
Ob diese Systeme wirklich mit Komplexität umgehen können, bleibt allerdings fraglich. Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass Machine Learning und Deep Learning sowie tiefe neuronale Netze Korrelationen in Daten erkennen und statistische Aussagen treffen können, zu denen Menschen nicht fähig sind. Zweifellos ist es beeindruckend, dass als AlphaGo den Weltmeister im chinesischen Strategiespiel Go schlug. Ein Sieg, den eine ganze Reihe von IT-Wissenschaftlern kurz davor noch für unmöglich gehalten hatte. Erreicht wurde dies, weil eine KI mit 30 Millionen Spielzügen trainiert worden war. Dieser Erfolg wurde im Jahr darauf noch gesteigert, als AlphaGo Zero sich selbst trainiert hatte, also nicht mehr von menschlichen Daten lernte, und gegen AlphaGo mit hundert zu null gewann.16
Doch diesem Hype sollte man durchaus mit einer gewissen Distanz begegnen – ohne damit die Möglichkeiten etwa in der medizinischen Diagnostik, der Spracherkennung oder in der Prozessoptimierung zu verteufeln. Denn solange wir noch keine starke KI entwickelt haben,17 also eine künstliche Intelligenz sozusagen auf Augenhöhe mit dem Menschen, solange ist sie dem Menschen in vielerlei Hinsicht unterlegen. Es kann im Umgang mit Komplexität hilfreich sein, auf der Basis von Statistik bisher unbeachtete Zusammenhänge zu erkennen.18 Doch Komplexität wird dadurch noch lange nicht reduziert. Vielmehr entstehen neue komplexe Fragestellungen: Wie entscheidet eine KI im Zweifelsfall? Wer haftet, wenn sie sich irrt? Welche Lösungen bietet die KI, wenn über viele Krankheiten wenig bis kaum Daten vorhanden sind? Ist es noch nachvollziehbar, wie die KI entschieden hat, oder war möglicherweise »maschinelle Willkür« im Spiel? Durch solche und ähnliche Fragen, die durch den Versuch der Komplexitätsreduzierung entstehen, wird das Gegenteil bewirkt: Komplexität wird (sogar noch) erhöht.
Noch muss in der Regel die vorhandene schwache künstliche Intelligenz auf wechselnde Situationen vorbereitet werden.19 Menschen können Inhalte in neue Kontexte übertragen. Sie können bisher ungestellte Fragen stellen, und sie können über den Status quo hinausblicken.20 Aus diesem Grund lassen wir uns nach heutigem Stand zu der Aussage hinreißen:
KI experimentiert nicht mit Ungewissheit.
Vielleicht wäre es besser zu sagen: noch nicht. Aber bisher ist nicht zu erkennen, wo und wie KI wirkliche Antworten auf Ungewissheit geben sollte. Denn es sind Entscheidungssituationen, in denen Momente von Überraschungen enthalten sind.
Gerhard Wohland bezeichnet Überraschungen als Ereignisse ohne erkennbaren Grund – als enttäuschte Erwartungen. Bezogen auf Organisationen lösen diese meist durch eigene oder fremde Ideen bewirkten Ereignisse Dynamik aus. Je enger Märkte sind, desto häufiger müssen wir davon ausgehen, dass fremde Ideen entstehen. Ein Kennzeichen einer globalisierten Welt ist Dynamik beziehungsweise sind Überraschungen – und das bedeutet, dass Probleme erzeugt werden.
Was folgt daraus? Man kann nicht nach Prozessen und Strukturen rufen, wie man es bisher immer dann tat, wenn ein Problem festgestellt wurde. Ließen sich nämlich geeignete Prozesse und Strukturen finden, dann läge keine Überraschung vor. Menschen müssen zusammenkommen und etwas tun, was nur sie können, und nach einer Antwort oder einer »Gegenüberraschung« suchen. Management und Führung – die wir im Weiteren nicht gedanklich trennen wollen – müssen somit eine andere Rolle als bisher einnehmen. Sie müssen bewusst zu einem Anwalt der Ungewissheit werden. Bewusst deshalb, weil sie schon längst unbewusste »Ambivalenzprofis« sind.
Führung und Management bringen in gleichem Maße Ungewissheit in die Organisation, wie sie Sicherheit versprechen.
Sie stören eingefahrene Abläufe, verkünden neue operative und strategische Ziele, verändern die Ressourcenzuteilung – in Zukunft immer mehr mithilfe künstlicher Intelligenz – oder setzen beispielsweise Projektteams neu zusammen. Dies alles sind Eingriffe, die die Sicherheit zerstören und Verwirrung stiften. Und dabei ist es egal, ob diese Handlungen auf einer gut begründeten Entscheidung fußen oder nicht. Interessanterweise werden diese Interventionen als logisch und objektiv geplant deklariert. Durch die Hintertür schleicht sich so das Argument der Sicherheit wieder ein. Obwohl von Sicherheit keine Rede sein kann.
Hier kann die Vorstellung von einem Experiment weiterhelfen. Das Experiment hat die Ungewissheit sozusagen automatisch im Gepäck und lässt Management und Führung die eigene Rolle wahren. Es kann aber im Grunde nicht scheitern, denn es ist darauf ausgelegt, aus Unerwartetem zu lernen. Und man lernt immer etwas. Bitte nicht falsch verstehen! Experimente in diesem Sinne animieren das Management nicht zu fahrlässigem Herumprobieren. Managementexperimente sind kein russisches Roulette. Sie gefährden nicht die Organisation als Ganzes.
Das Experiment ist die sichere Einführung der Ungewissheit in die Organisation.
Es kennzeichnet eine Haltung und keine Methode. Experimentieren gelingt nicht nur dann, wenn man in der Position des Bürgermeisters von Curitiba ist. Auch muss man dazu nicht den Mut haben, den das Team um Jaime Lerner hatte. Dinge auszuprobieren und daraus zu lernen, das kann jeder bewusst in seinen Alltag einbauen. Und auch wenn die Digitalisierung mehr und mehr in Unternehmen Einzug hält, so gilt es, den Mut zu haben, am Übergang zwischen Mensch und KI zu experimentieren. Wir brauchen gerade auch im Umgang mit lernenden Maschinen den Mut, »mit hohem Tempo zu experimentieren und zu lernen«, wie es die Digitalisierungsexperten Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee propagieren.
Vermutlich muss gerade dort experimentiert werden, wo Digitalisierung, Machine Learning und Big Data an ihre Grenzen stoßen: an der Schnittstelle zu Menschen und im Umgang mit Überraschungen.
Im Falle echter Auseinandersetzung mit dem einzelnen realen Menschen ist Führung mehr denn je gefragt.
Noch nie haben wir auf einem Firmenrundgang so vielen Menschen die Hände geschüttelt. Christoph Kraller, Chef der Südostbayernbahn – kurz SOB – hat uns über das Firmengelände geführt. Er zeigt uns vom Fahrkartenschalter über die Prozesse von Reinigung, Wartung und Instandhaltung der Lokomotiven bis hin zur Leitstelle alles, was man in Mühldorf über die Bahn erfahren kann. Jungenträume werden wahr, wir dürfen sogar den Führerstand einer Diesellok der Baureihe 218 betreten und sind dann doch im nächsten Moment ernüchtert: Was für ein enger, nicht klimatisierter, lauter und sehr abgewohnter Arbeitsplatz – nicht vergleichbar mit dem Cockpit, das man aus dem ICE der neuesten Generation kennt, und weit weg von den digitalen Möglichkeiten autonomer Fortbewegung!
Die Mitarbeitenden, denen wir auf unserem Rundgang begegnen, begrüßt der Chef mit Handschlag. Es wirkt alles angenehm unaufgeregt. Wer dem Chef etwas Dienstliches mitzuteilen hat, der sagt es ohne Umschweife. Wir gewinnen den Eindruck, dass Christoph Kraller ein sehr »nahbarer« Vorgesetzter ist.
Dieser Eindruck verstärkt sich, als wir an einem runden Tisch in seinem Büro sitzen. »Ich mag Menschen, und darum habe ich gerne Kontakt mit ihnen. Deshalb ist mir auch ein höflicher Umgang wichtig. Dadurch können viele Probleme gelöst werden, bevor sie entstehen.« Er wirkt absolut echt, seine verschmitzt humorvolle Art und sein sympathisch freches Lachen machen es dem rotblonden Bayern sicherlich leichter als anderen, auf Menschen zuzugehen. Im Gespräch merken wir dann gleich, dass er der geborene Experimentator ist. So hat er vor einigen Jahren ein Frühstück beim Chef eingeführt. Mitarbeitende aus unterschiedlichen Bereichen wurden auf eine Tasse Kaffee eingeladen, um offen mit ihm über Probleme und Anliegen zu reden. Leider folgte zunächst niemand seiner Einladung. Konsequenz? Er geht jetzt zu den Mitarbeitenden und nennt diese Treffen »SOB vor Ort«. Raus aus dem Verwaltungsgebäude, rein in die Bereiche! Und das wird an den unterschiedlichen Standorten von den jeweiligen Abteilungen sehr gut angenommen.
Kraller arbeitet – seit er Sprecher der Geschäftsleitung wurde – immer wieder in einzelnen Bereichen mit. Er erklärt uns: »Da ist immer eine Pause drin, und in der höre ich natürlich am meisten. Und auch hier musste ich einiges lernen. Zu Beginn habe ich einmal spontan im Kartenverkauf mitgearbeitet. Ich setzte mich einen Tag hinter die Kollegin am Schalter. Am nächsten Tag rief sie mich an und sagte, dass es der absolute Horror für sie war. Sie kam sich beaufsichtigt und kontrolliert vor. Daraus habe ich mitgenommen, dass es wichtig ist, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, warum man etwas macht. Und es ist ebenso wichtig, dass der Chef wieder geht.« Was auch hier als Experiment begann, wurde zur Routine. So zum Beispiel während des Münchner Oktoberfests. Die Züge sind hier besonders voll, und gerade am Abend macht der Alkoholpegel der Reisenden die Arbeit als Zugbegleiter nicht gerade einfacher. Und genau in dieser Zeit, am mittleren sogenannten »Italiener-Wochenende«, ist Kraller am Samstagabend im Zug an der Seite der Zugbegleiter. Er weiß natürlich nach so einer Schicht aus eigener Erfahrung, wie hart die Aufgaben seiner Kolleginnen und Kollegen sind.
Besonders beeindruckend war für uns, dass er mit seinem Führungsteam – noch bevor eine automatische Wagenreinigungshalle für über zwei Millionen Euro gebaut wurde – einmal jährlich Züge von Hand gereinigt hat. »Die Reiniger genießen leider kein hohes Ansehen. Sie machen aber einen extrem wichtigen Job. Wenn ein Zug nicht sauber ist, dann wirkt sich das schnell negativ auf die Zufriedenheit unserer Kunden aus. Sauberkeit ist neben Pünktlichkeit, Information und Freundlichkeit ganz entscheidend. Ich wollte zeigen, dass auch wir Führungskräfte uns nicht zu fein sind, eine Toilette zu reinigen. Wir merkten, was das für ein Knochenjob ist. Aber was noch viel wichtiger war: Durch dieses Experiment haben wir am eigenen Leib erfahren, unter welchen fast menschenunwürdigen Bedingungen sich die Reiniger umziehen mussten. Die hatten nur einen Gitterverschlag in der Ecke einer zugigen Werkhalle. Ich musste mich richtig schämen. Das haben wir sofort abgestellt und geeignete Umkleiden gebaut.« Wie Kraller uns weiter erzählt, spöttelten manche Kollegen, dass es wohl die teuerste Zugreinigung aller Zeiten gewesen sei. Er entgegnete nur, dass er sich das weiterhin leisten wolle und auch könne, da das Betriebsergebnis sowie die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit überdurchschnittlich gut seien. »Denn nur wenn man etwas selbst mitgemacht und ausprobiert hat, kann man authentisch mitreden.«
Der SOB-Chef hält aber nicht nur den Kontakt zu seinen Mitarbeitenden. Gemeinsam mit dem technischen Geschäftsleiter hat er mit der Initiative »SOB im Dialog« einen Versuch gestartet, der mit großem Erfolg alle Führungskräfte in Kontakt mit den Kunden brachte. So wird von jeder Führungskraft erwartet, dass sie einmal pro Jahr im Zug mitfährt und mit den Kunden spricht. Das ist eine Anforderung, die jede Führungskraft einhalten muss. Kraller selbst schließt sich hier nicht aus: »Ich gebe mich dann immer als Chef der SOB zu erkennen und frage den Kunden: ›Gibt es etwas, was Sie mir schon immer mal sagen wollten?‹ Und Sie glauben gar nicht, was man dann so alles erfährt und was der Fahrgast alles weiß – das sind Experten. Die meisten unserer Kunden sind Berufspendler. Die verbringen in zehn Arbeitsjahren fast ein Arbeitsjahr in unseren Zügen. Ein großes Problem, mit dem ich immer konfrontiert werde, ist die Klimatisierung der Wagen. Dem einen ist es zu kalt, dem anderen zu warm. Neulich hatte ich dann ein Gespräch mit einem Fahrgast, einem Klimatechniker. Als es in die Fachdiskussion mit ihm ging, musste ich leider sagen: ›Ich kann mit Ihnen darüber jetzt nicht weiter sprechen, ich kenne mich schlicht und einfach nicht so gut aus wie Sie.‹ Dann habe ich seine E-Mail-Adresse mitgenommen, und jetzt sind unsere Experten mit ihm im Austausch. Ich bin gespannt, ob wir Anregungen erhalten.«
Am Ende des Vormittags, den wir mit dem Geschäftsleiter der Südostbayernbahn verbracht haben, verstehen wir, dass er es ernst meint mit dem Plakat, das in seinem Büro über dem Besprechungstisch hängt: »Der Kunde ist unser Gast.« Kraller nahm und nimmt viele Anregungen aus seinen persönlichen Kundenkontakten mit, zum Beispiel die Empfehlung, auch im Regionalverkehr probeweise flexible Ruhezonen einzuführen. Oder es begleiten ihn Fachleute, die den Kunden erklären, welche technischen Probleme die Klimatisierung der Abteile mit sich bringt. Er erfährt aber auch, dass Pendler ihren Urlaub nach den Bauvorhaben der Bahn richten, weil sie keine Lust haben, bei unterbrochenem Schienenverkehr auf den Bus umzusteigen.





























