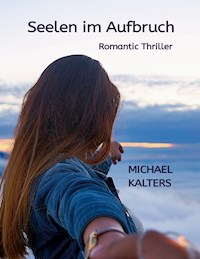Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor Marcel will sich in eine abgeschiedene Casa in Galizien zurückziehen und in Ruhe seinen nächsten Roman schreiben. Dazu verlässt er sein geordnetes, aber einsames und kommerziell erfolgloses Leben in Deutschland und lernt vorerst für ein Jahr die Landessprache in Bilbao. Als er dann in die Villa seines Freundes einziehen will, streikt sein Wagen während der langen Nachtfahrt durch unbekanntes Gelände. Er muss Zuflucht in einem einsamen Haus an der Steilküste suchen, ohne zu wissen, wer öffnet. Dort leben Sida und ihre stumme erwachsene Tochter Aina. Beide Frauen umgeben düstere Geheimnisse. Marcel ist immer mehr von der zunächst sehr abweisenden Sida fasziniert und verfängt sich in einer gefährlichen Liebesgeschichte. Als ihm Aina das wahre Geheimnis ihrer Stummheit anvertraut, entschließt sich Marcel, die Mysterien, die die beiden Frauen wie Ranken fesseln, auf eigene Faust aufzudecken. Seine psychische Labilität und seine bedingungslose Liebe zu Sida lassen ihn dabei oft zu weit gehen. Lässt sich die Bedrohung, die aus Marcels wohlmeinenden Handeln erwächst, nur noch durch ein persönlich weitreichendes Opfer einer befreundeten Psychiaterin abwehren? Die Abgeschiedenheit der galizischen Landschaft bildet den lokalen Hintergrund für ein fesselndes Liebesdrama, das so überall auf der Welt geschehen kann. "Mutter, Tochter, Tod" entführt dich in eine packende Geschichte. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Michael Kalters wurde 1960 in Thüringen geboren und schrieb bereits in jungen Jahren Gedichte und Kurzgeschichten. In seine Romanen konzentriert er sich darauf, wie seine oft psychisch belasteten Figuren über sich hinauswachsen, weil sie auf Menschen treffen, die ihnen etwas bedeuten. Dadurch kommt man den Akteuren emotional sehr nah.
Reale Schauplätze spielen oft den Hintergrund für die spannenden Geschichten. Vietnam, Mallorca, Galizien – fast könnte man sie als Reiseführer verwenden.
Wie in seinen Büchern »Seelen im Aufbruch«, »Das Geheimnis der Bildhauerin« und »Zwillingsbande - unschuldig gefangen« lässt der Autor auch in diesem spannenden Roman psychisch komplizierte Helden einen schweren Weg gehen. Nachvollziehbar und authentisch führen sie den Leser durch eine spannende Handlung mit unvorhergesehenem Ende.
Inhaltsverzeichnis
Gestrandet
Geheimnisvolle Sida
Die stumme Aina
Eine Entscheidung
Ankunft in der Casa
Der Zusammenbruch
Näherkommen
Brüderschaft
Verstörende Geheimnisse
Die Spannung wächst
Die Therapeutin
Ein neues Zuhause
Der Schock
Das Leid der neuen Stimme
Die Abgründe der zweiten Sitzung
Der Fund
Der neue Termin
Der Überfall
Neuer Gast, neue Geheimnisse
Gespräche in der Stadt
Gefühle wie der Atlantiksturm
Sidas Notizen
Schwere Entscheidungen
Endlich zu Hause
Gestrandet
Dienstag, 2. April, nachts
Schwarz und drohend umschloss dichter Wald die enge Fahrbahn. Goldene Augenpaare leuchteten aus dem Unterholz. Die Lichter des Berlingo fraßen sich durch die Nacht, ohne sie wirklich zu durchdringen.
»Biegen Sie links ab!« Es gab keinen Grund, den Anweisungen der Navi-App auf dem Handy zu misstrauen. Schließlich hatte ich das Kartenmaterial vor ein paar Tagen aktualisiert. Ein kleiner Flecken zog vorüber. Kein Mensch war zu sehen, nur altertümliche Straßenlaternen flackerten trostlos und überzogen verfallene Gärten mit einem fahlgelben Schein. Dann tauchte ich wieder ab in die Schwärze. Inständig hoffte ich, auf dem richtigen Weg zu sein. Laut dem Navi sollte ich in zwei Stunden die Casa am Meer erreichen. Hier im Westen Galiciens sagten sich Fuchs und Hase gute Nacht. Das gleichmäßige Tuckern des Diesels ermüdete mich.
Ich stoppte. Stieg nach draußen, um mich zu erleichtern. Das laute Zirpen der Zikaden vermischte sich mit dem Raunen der Baumwipfel im kühlen Atlantikwind. Schnell setzte ich mich wieder in den Wagen, genoss dessen Geborgenheit und fuhr weiter. Dabei stach mich etwas Hartes in den Oberschenkel. Der Schlüssel zum Haus! Es war ein außergewöhnlicher Glücksfall gewesen, dass ein Freund mir diese Casa zur Verfügung stellte, als er hörte, dass ich alle Brücken nach Deutschland abbrechen wollte.
Erleichtert atmete ich auf, als endlich das Schwarz des Waldes zurückwich und dem fahlen Gelb eines vom Mond beschienenen weiten Hügellandes Platz machte. Linker Hand spiegelte sich im Meer der glitzernde Sternenhimmel. Nicht ein einziger Wagen war mir bisher begegnet. Ich spürte, wie mich mein wahres Ich wieder einholte. Ohne erkenntliche Ursache packte mich tiefe Depression. Warum war ich hier? Ich konnte vor meiner Krankheit doch nicht davonlaufen.
Noch während ich in Selbstmitleid versank, wurde das gleichmäßige Tuckern des Motors durch schrilles Piepen aus dem Armaturenbrett unterbrochen. Hektisch blinkende rote Lichter blendeten mich. Der sonst so zuverlässige Diesel ächzte und stöhnte, bis er trotz instinktiv durchgedrückten Gaspedals verstummte.
Nacht.
Finsternis.
Kälte. Angst. Panik.
Ein unnatürliches Lachen gurgelte durch meine Kehle. Tränen der Wut stiegen in die Augen. »Das hast du davon, Marcel! Deine Träume. Auswandern. So naiv!« Instinktiv schaute ich aufs Handy. Zweiter April. Dienstag. 22:30 Uhr. Brummelnd gefiel ich mir in der Rolle des Gescheiterten. Genoss mein Elend. War verzweifelt. Traktierte das Lenkrad mit Schlägen.
Irgendwann stieg ich aus dem Wagen und sah mich um. Die Augen hatten sich auf die Dunkelheit eingestellt. Drüben sah ich das Meer. Rechter Hand lagen endlose einsame Hügelketten. Seufzend holte ich das Handy aus der Tasche. Suchte krampfhaft die eingespeicherte Nummer des Notdienstes. »Piep, Piep, Piep.«
Entsetzt starrte ich aufs Display. Kein Empfang! Die kühle Meeresluft kroch bis hier herauf. Nie und nimmer würde hier ein Wagen vorbeikommen! Ich war in einer entlegenen Einöde gelandet. Erneut rutschte ich zurück auf den Fahrersitz, versuchte, den Motor zu starten. Nichts.
Schweiß brach aus. Das Luftholen fiel plötzlich schwer. Mit aufrechtem Oberkörper zwang ich mich, tief durchzuatmen, die Luft anzuhalten, durch den Mund den Atem entweichen zu lassen. Die Panikattacken hatte ich mithilfe meiner Psychologin zwar zunehmend in den Griff bekommen, doch nicht völlig besiegt. Wie klein wurde ich in solchen Augenblicken! Verzweifelt lief ich ins Dunkel. Waren da vorne nicht schaukelnde Lampen zu erkennen, die als doppelter Strahl das Dunkel durchdrangen? Ein Wagen! Doch unversehens wendete er, drehte mir die roten Rücklichter zu. Mit dem außen angebrachten Ersatzrad musste es ein Geländewagen sein. Woher kam er so unerwartet? Da fiel mir ein Licht in den Hügeln vor dem Meer auf.
Ich zog die Sporttasche mit den persönlichen Sachen heraus, verschloss den Wagen und marschierte in Richtung des geheimnisvollen Lichtpunkts davon.
Ein unförmiger Schatten hob sich vom Meer ab. Ein Haus! Menschen!
Die Tasche schlug mir beim Laufen in die Seite. Mein Körper begann zu zittern. Ein zweirädriger Karren versperrte den Weg, brachte mich zu Fall. Im Aufstehen wischte ich den Sand von den Hosen, fluchte leise vor mich hin.
Ich hielt inne und starrte nach oben, wo unter der Dachrinne eine eiserne Laterne ihr fahles Licht spendete. Zweimal umrundete ich das Gebäude, bevor ich den Eingang entdeckte. Mithilfe der Handylampe stieg ich eine halb verfallene Treppe nach oben und stand endlich vor einer stabilen Holztür. Vergebens suchte ich eine Klingel. Zaghaft klopfte ich an den Verschlag und lauschte. Kein Geräusch drang aus dem Innern des Hauses. Ich sah auf das Display des Handys: 23:00 Uhr! Das Zirpen der Zikaden vermischte sich mit dem rhythmischen Schlagen der Wellen. Der Nachtwind kühlte mich aus. Ich war müde. Die lange Fahrt, die Einsamkeit. Verdrossen schaute ich nach oben.
War das nicht eine Satellitenschüssel, die da am oberen Türrahmen verschraubt war? Also wohnte doch jemand hier! Mutiger werdend, hieb ich mit der Faust gegen das verwitterte Holz.
»Hallo! Ist da irgendwer?« Ich lauschte. Plötzlich ein Lichtschein im Fenster über mir. Kettenrasseln wenig später. Die Brettertür vor mir öffnete sich einen Spalt breit. Eine Frauenstimme drang heraus.
»Wer sind Sie? Was wünschen Sie?«
»Mein Wagen ist defekt. Ich bin ein Deutscher auf der Durchreise.«
»Und?«
»Das Auto steht dort auf der Straße, es ist liegen geblieben. Haben Sie ein Telefon? Das Handy hat keinen Empfang.«
»Moment, warten Sie.«
Der Spalt zwischen Tür und Mauer schloss sich wieder. Dennoch fiel mir ein Stein vom Herzen. Ein Mensch, der mein dürftiges Spanisch verstand! Alles wendete sich zum Guten! Beruhigt trat ich einige Schritte zurück, genoss die klare Luft. Ich würde den Notdienst anrufen und bald in der Casa el Bosque ankommen. Dort konnte ich mich der Schriftstellerei widmen, regelmäßig meine Psychologin in Deutschland kontaktieren, gegen Panikattacken und Depressionen ankämpfen. Hoffnungsvoll schaute ich nach oben. Über mir nur ein schwarzes Samttuch mit goldenem Staub. Vor Unendlichkeiten hatte die Lichter ihre Strahlen losgeschickt, wer wusste schon, wo sich diese Himmelskörper heute befanden? Ob sie überhaupt noch existierten? Weit und breit war keine Siedlung zu sehen. Hügel, Meer und Himmel – das war alles.
Hinter mir klapperte es. Ich wandte mich um und lief misstrauisch auf den größer werdenden Lichtspalt zu. Die Tür drehte sich ächzend in den Angeln und gab einen menschlichen Schatten frei.
»Kommen Sie herein, bitte.«
»Gracias!« Mehr wusste ich nicht zu erwidern. Vorsichtig erklomm ich wieder die letzten Stufen der schiefen Treppe und stolperte ins Innere, vorbei an der dunklen Gestalt.
»Entschuldigung! Es ist ein Notfall.« Kaum waren mir die Worte entschlüpft, hätte ich mich am liebsten schon für die sinnlose Rechtfertigung geohrfeigt.
Ein einziger Deckenfluter erleuchtete das Zimmer. Das knallrote Sofa in der Mitte bildete einen Raumteiler. Zwei bis an die hohe Decke reichende Bücherregale und einige aus dunklem Holz gefertigte Kommoden verliehen dem Raum ein düsteres Ambiente.
Hinter mir knallte die Tür zu, erschrocken drehte ich mich um. Die Frau hängte die Sicherheitsketten ein. Bedächtig, wie eine Spinne ihr gefangenes Opfer beäugt, musterte sie mich. Ich erstarrte. Die umgehängte Sporttasche rutschte von der Schulter und polterte zu Boden.
»Ich bin Sida Gonzales. Und Sie?« Die Hausherrin schaute mich mit großen braunen Augen auffordernd an. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Mitte dreißig? Oder doch schon vierzig? Die dichten schwarzen Haare waren zu einem straffen Knoten gebunden, einige lose Haarsträhnen umrahmten das Gesicht. Graue Strähnen – ob gefärbt oder natürlich – lockerten die Haarpracht auf. Breite Perlmutt Ohrringe lugten darunter hervor. Sie trug eine karierte Bluse, der Reißverschluss war geöffnet und zeigte nicht nur ihr Dekolleté, sondern auch die prunkvolle Goldkette mit dem Anhänger, ebenfalls aus Gold. Ihre eingefallenen Wangen bildeten einen starken Kontrast zu den vollen Lippen und den tief liegenden, dunkelbraunen Augen.
»Ähm, ich bin Marcel.« Meine ausgestreckte Hand blieb unerwidert in der Luft hängen.
»Sie wollen telefonieren? Dort!« Sie deutete auf das Sideboard neben einem der Regale. Ihre geschminkten Augen schauten müde und traurig.
Ich wählte die Nummer des Notdienstes. Und legte sofort wieder auf. »Entschuldigen Sie, Frau Gonzales, Sie sprechen Spanisch besser als ich. Könnten Sie bitte das Telefonat führen? Hier ist das Kennzeichen des Wagens, hier die Versicherungsnummer. Ich stehe einen halben Kilometer entfernt, oben auf der Straße. Ich bin von der CP-2301 aus abgebogen.«
»Nein. Ich werde nicht telefonieren.« Ihre rauchige Stimme erschreckte mich.
»Aber …!«
»Vergessen Sie es. Um diese Zeit kommt niemand zu Hilfe.«
Verloren stand ich herum. Hob die Sporttasche hoch. Unsinnigerweise schoss es mir durch den Kopf, dass sie die Tür hinter mir geschlossen hatte. Was also?
»Haben Sie Hunger?« Ehe ich nicken konnte, fuhr die Frau fort: »Bleiben Sie. Essen Sie etwas.« Ihre braunen Augen musterten mich unverhohlen. »Sie sehen nicht aus wie ein Verbrecher. Ich glaube Ihnen. Wir haben ein Gästezimmer, Sie können übernachten. Morgen rufe ich den Notdienst an.« Sie machte eine unbestimmte Kopfbewegung in Richtung Treppe, die nach unten führte. »Ich bringe Ihnen ein paar Tapas.«
Verwirrt fiel ich in einen der Sessel, während die Frau verschwand. Ihr Argument leuchtete mir ein. Erschöpft schloss ich die Lider. Dämmerte vor mich hin. Fühlte plötzlich etwas. Wärme. Dunkelheit. Bedrohung. »Marcel, du spinnst!«, murmelte ich vor mir hin. Denn da war ein Duft, den es zuvor nicht gegeben hatte. Ich schlug die Augen auf. Erstarrte. Vor mir stand eine junge Frau in einem knallroten, schulterfreien Kleid. Es reichte bis zum Boden und umspannte ihren Körper wie eine zweite Haut. Ich schoss hoch.
»Hallo! Ich bin Marcel Wolf.«
Statt einem Gruß schnellte mir eine offene Hand entgegen. Ich ergriff sie instinktiv. Sie war trocken, weich und warm. Freundlich und vertrauenerweckend. Die Augen der Frau waren weit aufgerissen.
»Sie wohnen auch hier?« Etwas Sinnvolleres fiel mir nicht ein. Da fuhr sie mit ihrer Linken über ihre geschlossenen Lippen, schüttelte traurig den Kopf und zog die Hand zurück.
»Sie können nicht reden?«
Ihr stummes Nicken bedrückte mich unendlich. Da zog sie aus einer verborgenen Tasche ihres Kleides ein Tablet hervor, tippte etwas darauf und reichte es mir.
»Sie heißen Aina Gonzales?« Sie nickte, nahm das Gerät wieder an sich und steckte es schnell zurück.
»Meine Tochter Aina.« Sida kam mit einem riesigen Servierbrett herein und bedeutete mir, ihr zu folgen. Wir stiegen die Treppe hinunter, folgten einem schmalen Gang und fanden uns in einem Raum wieder, der sich als eine Art Wintergarten herausstellte. Während die zwei Frauen den Tisch deckten, Wasser und Wein holten und die Tapas positionierten, schaute ich mich unauffällig um. Die Natursteinmauer ringsherum reichte einen guten Meter hoch. Lampen waren in den Steinen eingelassen und spendeten diffuses Licht. Darüber gaben Glasfenster den Blick nach draußen frei. Ich erkannte das Funkeln des Meeres, drüben die Hügelkette.
»Señor, essen Sie etwas.«
Ich folgte dem Beispiel der Frauen und setzte mich an den Tisch. Dankbar griff ich zu. Sandwich mit gegrilltem Schweinebauch, Schinken und Käse. Lecker!
»Danke für Ihre Mühe!«
»Nicht der Rede wert. Wir trinken ein Glas mit Ihnen.«
Das Brausen der Meereswellen drang durch die Glasfront herein. Einige Holzscheite im Kamin spendeten behagliche Wärme. Niemand sprach ein Wort. Die Frauen aßen kaum etwas, genossen aber umso mehr den Wein. Ich griff zu, bis der Bauch spannte. Fasste wieder Mut. »Das hat geschmeckt! Seit heute Mittag war das die erste Mahlzeit. Vielen Dank!« Ich starrte Sida an. Wenn ich ihren Gesichtsausdruck richtig deutete, war sie ein Mensch, der vom Leben nichts mehr erhoffte, aber sich alles wünschte. Voller unerfüllter Träume und gepeinigt von seelischen Schmerzen.
Sie schenkte schweigend nach. Der dunkelkirschrote Cuvée Especial roch verführerisch. Während sie sich bückte, starrte ich automatisch auf die weiße Haut, die der Ausschnitt ihrer Bluse freigab. Ich war mir sicher, dass sie nichts darunter trug. Ungewöhnlich. Die Frauen hier waren meist konservativ gekleidet. Mein Blick wanderte schnell weiter. Die gepflegten Hände waren faltenlos. Ihr Kopf ruhte auf ihrem linken Arm, sie starrte ungeniert zu mir herüber. Die ausgeprägten Wangenknochen und dezent geschminkten Augen hypnotisierten mich.
»Wie kommen Sie in diese entlegene Ecke Spaniens? Hier ist keine Gegend für Touristen.« Der Text stand auf dem Tablet, welches mir Aina entgegenhielt. Dabei schaute sie ihre Mutter verstohlen an.
»Ich … Es ist eine lange Geschichte«, zögerte ich und trank einen Schluck Cuvée. »Es ist spät. Bestimmt möchten Sie schlafen gehen.« Mein Leben war unspektakulär, nicht wert, erzählt zu werden.
Unsicher löste ich den Blick von den Frauen und starrte hinaus in die Dunkelheit. Das Meer brauste unsichtbar in der Finsternis. Ich kämpfte mit sich widersprechenden Empfindungen. Da war ein Gefühl von Freiheit im Herzen – und starkes Misstrauen im Bauch.
»Wir hören gerne zu!«, forderte das Tablet der stummen Aina auf. Sida pflichtete ihrer Tochter mit ihrer rauchigen Stimme bei.
»Wir möchten gerne wissen, wen wir beherbergen. Also keine falsche Bescheidenheit, erzählen Sie etwas über sich.«
Die Unwirklichkeit der Situation machte mich gesprächig. Sida streifte sich die Schuhe ab, schob sich einen Hocker zurecht und streckte mir ungeniert die Beine entgegen. Dabei ließ sie mich keine Sekunde aus den Augen, analysierte jeden Ausdruck meines Gesichts.
Sicherlich träumte ich nur. Nichts war real. Nichts hatte Folgen. Was sollte schon sein? Morgen würde ich die Fremden wieder verlassen. Eine große Ruhe überkam mich, verjagte jegliche Vorsicht und alles Misstrauen. Mit gesenktem Kopf begann ich zu erzählen.
»Vor einem Jahr kam ich nach Spanien, suchte mir in Bilbao ein günstiges Apartment und lernte intensiv Spanisch.«
»Sie konnten ein Jahr ohne Arbeit leben? Beneidenswert.« Sidas heruntergezogene Mundwinkel machten mich nervös.
»Na ja, ich habe in Deutschland fast zwanzig Jahre als IT-Fachmann gearbeitet. Da konnte ich einiges sparen. Doch die Arbeit fraß mich auf. Immer auf den neuesten Stand zu sein, ständig am Ball zu bleiben – ich fühlte mich wie in einer Tretmühle. Zudem entdeckte ich meine Liebe zur Schriftstellerei. Davon leben kann ich nicht. Aber als Autor fühle ich mich wohl. Ich musste weg aus Deutschland.«
Ich griff zum Glas und genoss den rot funkelnden Wein. Die beiden Frauen hingen an meinem Mund.
»Haben Sie Freunde oder Familie verlassen?« Das Tablet leuchtete auf.
»Ich habe keine Familie mehr in Deutschland. Freunde?« Ich musste überlegen. »Gute Kollegen. Von denen ich aber nur Ablehnung erntete, als sie von meinem Vorhaben erfuhren. Immerhin verließ ich die vertraute Umgebung – und den gut bezahlten Job. Doch eine kleine Erbschaft machte mich unabhängig. Sie müssen wissen, dass ich sehr genügsam bin. Ich stelle keine großen Ansprüche.«
»Aber irgendetwas müssen Sie doch tun?« Sida nippte am Glas. Ihre hochgelegten Füße kreisten unruhig.
In meinen Vorstellungen sah ich mich bereits Abend für Abend schreibend am Laptop auf der Veranda sitzen. »Ein guter Bekannter erfuhr von meinem Vorhaben. Er stellt mir auf unbestimmte Zeit zu einem symbolischen Mietpreis eine Casa Rural zur Verfügung. Er selbst wird nie dort wohnen.«
»Kommen Sie denn mit der Einsamkeit klar? Sie kennen hier niemanden, und das Haus wird nicht in der Stadt liegen, oder?«
»Sicher verstehen Sie das nicht, doch ich muss mich unbedingt künstlerisch entfalten. Auch wenn ich nur wenige Leser habe.«
Wieder zog Sida die Mundwinkel auf seltsame Art herunter. Was sie damit ausdrücken wollte, konnte ich nicht durchschauen. Es war keine Verachtung. Etwa Bitterkeit? Zustimmung? Da schob sich erneut das Tablet heran.
»Was schreiben Sie?«
Immer wieder die gleiche Frage. Ich schrieb doch kein Genre, sondern das, was mir auf dem Herzen lag! »Ich schreibe Romane und Lyrik, jedoch unter dem Pseudonym Henry Kettler. Sie können ja gerne in Internet danach suchen.«
Aina erhob sich und brachte eine zweite Flasche Cuvée sowie Oliven mit Aioli. Die Nacht schritt voran. Die Frauen wurden mir sympathisch. Es war fast so, als säße ich meiner Psychologin Dr. Weidhaus gegenüber.
Am Ende wussten die beiden mehr über mich als die Kollegen in Deutschland. Nur von den Depressionen hatte ich nichts berichtet. Auch nicht von den Anfällen, die mich geißelten, seit ich fünfzehn Jahre alt war.
Ainas Augen, die mit einer Schicht Staub bestreut zu sein schienen, sahen die ganze Zeit mitfühlend herüber. Manchmal kam es mir vor, als wollten sie etwas mitteilen. Ich schob es auf die Müdigkeit und den reichlich genossenen Wein.
Sida hingegen saß unbeweglich da. Ihre Lippen einen Spalt breit geöffnet, lehnte ihr Kopf prüfend auf dem linken Arm. Ihre Lässigkeit, ihre Skepsis, ihr Kummer – sie verwirrten mich. Ich begann, den Tod zu fühlen. Oder war es Inspiration? Albträume griffen nach mir. Wenn ihr verwunschener Mund nicht wäre! Es war mir peinlich, denn ich konnte nicht anders, als diese Frau interessant zu finden.
Verirrung. Alkohol. Unsinn! Ich hielt inne und schüttelte heftig den Kopf. Scham. Zeit, mit dem Weintrinken aufzuhören.
»Danke, dass Sie so offen waren.« Endlich die tiefe Stimme der Gastgeberin.
»Verraten Sie mir, warum …« Verlegen sah ich zu Aina.
»Wieso meine Tochter stumm ist?«
Ich nickte heftig.
»Dazu ist es zu spät. Plaudern wir morgen zum Frühstück. Ich zeige Ihnen jetzt Bad und Gästezimmer.«
»Ich möchte nochmals kurz zum Strand runter, den Kopf freibekommen. Nur 10 Minuten?« Auffordernd sah ich Sida an.
Diese schaute zur Uhr. »Halb zwei Uhr nachts?« Dann wandte sie sich an ihre Tochter. »Ich begleite unseren Gast.«
Wenig später verschwand die Casa hinter uns im Dunkel. Sidas Stimme durchdrang den böigen Wind: »Vorsicht, dort unten am Strand ist es tückisch.«
Bald darauf stapfte ich barfuß durch feinen Sand. Sida stand reglos da, ihr Schatten fiel mit der Dunkelheit der Nacht zusammen. Sie hatte sich eine lange rote Strickjacke übergezogen und verschränkte die Arme über die Brust. Schweigend schlenderte ich den Strand entlang, watete durchs Wasser. Tausende feiner Tröpfchen, von der Gischt herübergetragen, benetzten meinen Körper. Erschöpft setzte ich mich auf einen der Felsbrocken. Der sternenübersäte Himmel legte sich als glitzernde Decke über mich, sog mich in einen Strudel aus Fantasie und Wirklichkeit. Natürlich hatte ich psychische Probleme! Tagträume entwurzelten mich. Sie glichen dem Genuss von Marihuana oder Alkohol. Möglicherweise von beidem gleichzeitig.
Umherirrende Möwen kreischten, die Wellen schlugen an die vorgelagerten Felsen. Ich drehte den Kopf. Die Gestalt der Frau war um Nuancen schwärzer als die umgebende Dunkelheit. Haare wehten, die lange Jacke flatterte. Etwas in mir drängte zum Reden. Aber die Resignation überwog. Sollte ich über meine Gefühle als Autor berichten? Von dem, was mich antrieb und inspirierte? Von den Depressionen und Enttäuschungen? Nie würde die einfache Frau, die hier in dieser Abgeschiedenheit lebte, Verständnis dafür aufbringen können. Kunst war ja doch nur ein Fremdwort für diese Leute. Beschäftigt, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, mussten sie täglich hart arbeiten. Theater oder Bibliotheken gab es hier nicht. Zudem würde ich das Haus bald wieder verlassen. Ich war verloren, allein, einsam. Verkannt. Eben mein Schicksal. Wohlige Schauer unendlichen Selbstmitleids wärmten die Seele.
Da traf mich ein Schuh am Unterschenkel. »Hey, sind Sie eingeschlafen? Kommen Sie ins Haus. Ich friere.«
Ehe ich etwas zu erwidern vermochte, eilte Sida davon. Mir war nicht kalt. Mir war auch nicht warm. Ich lebte nicht hier und nicht jetzt. War frei von jeder körperlichen Empfindung. Leer. Eine Hülle. Elendlich glücklich. Dass ich sterben würde, wurde mir so bewusst wie nie zuvor. Ich war gescheitert. Die Flucht aus Deutschland würde in diesem verlassenen Landstrich Spaniens enden. Hatte ich mir eingebildet, hier Fuß fassen zu können? Ein Jahr lang hatte ich in Bilbao überlebt, mich sogar dort wohlgefühlt! Welche Überheblichkeit, mir deswegen einzubilden, auch in der Einsamkeit zu überleben. Dr. Weidhaus hatte recht, wenn sie prognostizierte, mein Leben würde ohne festen Rhythmus im Chaos enden. Als Psychologin war sie eine Koryphäe. Sie irrte nie.
Nur wenige Leser kauften meine Bücher, zudem wurde ich ideenlos. Albträume bestimmten die Nächte. Ich aß wenig. Lachte jeden an, innerlich von Trauer zerfressen. Das geringste Problem warf mich aus der Bahn. Wusste das alles und konnte doch nichts dagegen unternehmen. Psychopharmaka zerfraßen die Leber, ohne zu helfen.
Wie ich es genoss, hier zu sitzen! Nur Schwärze, nur Dunkelheit – wie meine Seele. Umhüllend. Tröstend. Ich verlor jegliches Zeitgefühl. Auf einmal vernahm ich Schritte. Kam Sida zurück? Weshalb schlug das Herz schneller? Die Sterne am Himmel und das Rauschen des Meeres drangen erneut ins Bewusstsein, holten mich in die Gegenwart zurück. Ein Schatten tauchte auf und fiel neben mir auf den Felsen. Lange, schwarze Haare, grau blitzende Augen.
»Aina? Sind Sie das?«
Schweigen. Na klar, was sonst. Meinem Mund war nach Reden.
»Ich kenne Sie nicht. Bin fremd hier und habe keinen Bekannten. Schreibe nur Geschichten. Aber so, wie es aussieht, interessiert sich niemand dafür.« Was gab ich da von mir? »Lo siento. Verzeihung. Ich weiß nicht mehr, was ich spreche, bin ein wenig verrückt. Vergessen Sie, was ich da von mir gebe.«
Minutenlang keine Reaktion. Verloren saß ich neben der fremden Frau. Da blendete mich das helle Display des Tablets. »Ich vergesse nichts! Wenn Sie verrückt sind, bin ich es auch.«
Geheimnisvolle Sida
Mittwoch, 3. April
Wie so oft suchten mich entsetzliche Albträume heim. Es war mir nicht klar, dass ich träumte. Alles war Wirklichkeit, verletzte mich und zog mich herunter. Enttäuschte Freunde schleuderten mir ihre Verachtung entgegen, selbst Dr. Weidhaus lachte über mich. Unendlicher Jähzorn packte meinen Körper, ich schrie und tobte, fühlte mich dabei grenzenlos schlecht. Da flüsterte eine Stimme vorwurfsvoll: »Marcel, sei leise! Man hört dich!«
Das gab mir den Rest. Ich war ohne Niveau, ein miserabler Charakter, abgrundtief böse. Wieso durfte ich überhaupt noch am Leben sein?
Schweißgebadet wälzte ich mich aus einem fremden Bett und schaute verstört auf die Handyuhr: 5:30 Uhr. Gerade mal drei Stunden geschlafen!
Nur langsam kehrten die Erinnerungen zurück: der stehen gebliebene Wagen, die Frauen, das Abendbrot, der nächtliche Strand. Ich torkelte zum Stuhl, über dessen Lehne meine Kleidung hing, und angelte mir mit zitternder Hand zwei Diazepam aus der Hemdentasche. Den bitteren Geschmack auf der Zunge genoss ich wie ein Gourmet, wusste ich doch, dass der Wirkstoff bereits im Mund in den Blutkreislauf eindrang und seine beruhigende Wirkung entfaltete.
Gegenüber dem Gang lag das Bad. Leise schlich ich hinüber und ließ mir minutenlang kaltes Wasser übers Gesicht laufen. Aber es half nichts. Ich vermochte die Angstträume nicht zu verjagen. Wie immer hingen sie an mir wie Kletten und veränderten meine Wahrnehmung. Die Realität vermischte sich mit Fantasiegebilden, ich war entwurzelt, als hätte ich einen Joint geraucht. Warum lebte ich?
Existenzängste verweigerten mir die Rückkehr ins warme Bett. Dort lauerten erneut die Fesseln der Albträume.
Ich zog mir etwas über, schnappte das Handy und schlich die Treppe hinauf. Zum Glück gab es in diesem Haus nur Steinstufen, die nicht knarrten. Aber die Scharniere der Haustür im ersten Stock stöhnten und ächzten. Doch scheinbar weckte ich dadurch keine der Frauen, als ich die Casa verließ. Immer noch verfolgten mich die Eindrücke des Albtraumes. War ich schizophren? Wie konnten sich Wirklichkeit und Traum auf so absonderlicher Weise vermischen? Vorsichtig schlich ich um das Gebäude. Die Taschenlampe des Handys erfasste stählerne Haken, die in die Hauswand eingelassen waren. Welchem Zweck dienten sie? Hochgewachsene Stoppeln versperrten den Weg. Ich stapfte hindurch, stieß auf kleine Steinmauern. Düster und bedrohlich beäugte mich das misstrauische Haus. Schräge Steinstufen, ein Zaun, der Verschlag eines Kohlenkellers. Die schwache LED fraß sich in die Ritzen der Natursteine. Schatten geisterten umher. Ich stolperte. Verstauchte mir das rechte Handgelenk, als ich mich im Fallen abstützte.
Da lag ich, umgeben von Geäst und Gestrüpp, kaum mehr erreicht vom fahlen Licht der Laterne, die hoch oben am Haus verzweifelt ihren gelben Schein in die dichte Finsternis schickte. Einen Meter entfernt ein Lichtpunkt – mein Handy! Ich nahm es und leuchtete auf den Boden. Eine Mauer ragte vor mir in die Höhe. An ihrem Fuß führten verfallene Steinstufen nach unten. In mir erwachte der vierzehnjährige Cowboy, der sich durchs Land der Indianer schleicht. Gespannt stieg ich die Stufen hinunter. Bald schon verschwand ich in einem Erdloch. Es wurde feucht. Die verstauchte Hand hackte. Da verbarrikadierte eine verwitterte Holztür den Weg. Ein verrosteter Eisenriegel mit massivem Vorhängeschloss versperrte den Keller.
Mir gefiel es hier. Die LED schaltete ich aus. Der Sternenhimmel war längst nicht mehr zu sehen. Selbst das Geräusch der Brandung war verschwunden. Ich fiel auf eine der Steinstufen und geriet ins Träumen. Wieso war der sonst so zuverlässige Wagen gerade jetzt liegen geblieben? Warum lebte hier nicht eine normale Familie, sondern zwei alleinstehende Frauen? Das war doch kein Zufall! Sida hatte mich so traurig und gleichzeitig hoffnungsvoll angeschaut. Wer war sie? Aina erschien im Gegensatz zu ihr oberflächlich, trotz ihrer Stummheit. Sie war zu perfekt, ein Püppchen aus dem Bilderbuch, zu makellos und zu glatt.
Ach was! Unnütze Gedanken. In ein, zwei Tagen setzte ich die Fahrt fort und bezog die Villa meines Freundes. Umso dringender empfand ich es, hinter die verschlossene Kellertür zu schauen. Obwohl es mich nichts anging und ich gegen alle Regeln der Gastfreundschaft verstieß. In der Cargohose hatte ich stets ein Schweizer Messer stecken. Ich angelte es heraus, schaltete die Lampe des Handys wieder an und versuchte mich im Aufbrechen des antiken Vorhängeschlosses. Ich hatte einige Mühe. Endlich klickte es, der Bügel des Schlosses schnappte aus seiner Verriegelung. Das Eisen fiel herunter und ehrfürchtig drückte ich die Tür nach innen. Es knarrte abscheulich.
Ehe ich einen Blick in den geheimnisvollen Gang werfen konnte, stand ich im Dunkeln. Erschrocken tippte ich aufs Handydisplay. Schwärze. »Auch das noch!« Der Akku war leer. Die Exkursion musste verschoben werden. Das Schloss klickte, als ich die Tür wieder verriegelte. Langsam tastete ich mich nach oben.
Das Bett – mein Feind. Ich stand davor und wusste: Schlafen klappte nicht mehr. So schnappte ich mir das Netbook und schlich in den Wintergarten. Bevor ich den Lichtschalter erreichte, stolperte ich über einen Stuhl. »Verdammt!« Hoffentlich wachten die Frauen nicht auf! Endlich. Das gedämpfte Licht der künstlichen Fackeln tauchte den Raum in dunkles Gelb. Der Blick nach draußen in die Finsternis war versperrt. Lediglich ein Schatten huschte am Fenster vorbei. Einen Moment lang stutzte ich. Ein Mensch? In dieser Einsamkeit? War etwa dieser geheimnisvolle Geländewagen zurückgekehrt? Ach was, es würde einer jener riesigen Krähen sein.
Ich setzte mich an einen der Tische, klappte das Display auf und suchte eine Steckdose. Da gefror mir das Blut in den Adern. Das Netzteil fiel zu Boden.
»Was machen Sie denn hier!«, rief ich entsetzt, völlig vergessend, dass Sida ja hier wohnte und sich aufhalten durfte, wo sie wollte. »Warum sitzen Sie hier im Dunkeln? Sie haben mich erschreckt!«
Die Hausherrin zog die Mundwinkel verächtlich nach unten. Über ihren kurzärmligen Pyjama trug sie einen schwarzen Baumwollhausmantel mit weißen Applikationen. Ihre Beine hatte sie auf einen Hocker gelegt. Sie wirkte abwesend, sah durch mich hindurch. Ihr Blick starrte in die Dunkelheit nach draußen.
Endlich fasste ich mich. »Entschuldigung. Sie haben mir einen Schrecken eingejagt. Sie hätten das Licht einschalten sollen. Darf ich hier sitzen?«
Langsam drehte Sida ihr Gesicht zu mir. Ihre hochgelegten Füße begannen, hin und her zu wippen.
»Sie haben keine Ahnung, oder?«
»Wovon?«
»Von allem.« Voller Traurigkeit und tiefer Enttäuschung presste sie die Worte hervor.
Das Meeresrauschen vermischte sich mit dem Zirpen der Zikaden und betonte die eingetretene Stille im Innern des Wintergartens. Sida stand auf und kam herüber an den Tisch. Sie zog sich einen zweiten Stuhl als Fußschemel zurecht. Legte die unbedeckten Beine hoch. Stemmte die Ellbogen auf die Tischplatte. Versenkte ihr Gesicht in den Händen. Drang mit ihren tiefbraunen Augen in mich ein.
Eine Gänsehaut überzog meinen Rücken. Konnte ich nicht auf eine normale Familie stoßen? Vater, Mutter, Kind? Weshalb musste alles immer so verwirrend sein? So kompliziert? Da wurde mir bewusst, wie attraktiv die Frau mir gegenüber war. Was sollte das! Zu viel Gefühl. Zu sensibel. Zu sehr mein Innerstes nach außen gekehrt. Doch Sida hatte jenes Besonderes an sich, für das es keine Worte gab.
»Gestern hat sie zum ersten Mal gesprochen.« Von ihren sonst vollen Lippen blieben nur rote Striche.
Ging es um ihre Tochter? Sprechen? Ich verstand nichts. Aina hatte doch keinen einzigen Ton verlauten lassen!
Verbittert fuhr sie fort: »Und das mit einem Fremden. Nicht mal mit ihrer Mutter.«
Schamlos starrte ich auf ihre hochgelegten Beine, die nur halbherzig vom Hausmantel verdeckt wurden. Glatte Oberschenkel, runde Knie, gepflegten Füße – in Sekunden fraß sich das Bild in mich hinein. War es Realität, oder hatte mich erneut ein Albtraum umgarnt?
»Was erzählen Sie da? Aina ist stumm. Sie hat nicht mit mir gesprochen.«
Sida bemerkte meinen Blick und zog den Hausmantel über die Beine. »Natürlich! Mit dem Tablet.«
»Sie hat nur geschrieben, nichts gesagt!«, widersprach ich. Dabei glitt mein Blick von ihrem Gesicht hinunter in den großzügigen Ausschnitt ihres Pyjamaoberteils. Der dünne Stoff stachelte die Fantasie an.
»Begaffen Sie meine Brust oder bewundern Sie die Kette?« Sida lehnte sich zurück.
Ich konnte ebenso direkt sein wie sie. »Beides.«
Der Schmuck, den sie trug, war ein Hingucker. Ein großer, zehnzackiger Stern hing an einer goldenen Kette, die verspielt von einigen Herzen, Monden und Glöckchen umflochten war. Andererseits hätte sie auch den Reißverschluss ihrer Pyjamajacke nicht so weit nach unten ziehen müssen.
»Ich träume doch nur.« Hilfesuchend schaute ich in ihre fragenden braunen Augen. »Sie müssen mich nicht so ansehen, sie existieren nicht. Ich sitze auch nicht im Wintergarten einer alten Casa. Alles nur ein Albtraum.«
Die Intensität meiner Tagträume schien heute wieder enorm stark zu sein. Fast schon dachte ich, die Frau mir gegenüber gäbe es wirklich. Schade. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre echt und kein Gespinst meiner Fantasie. »Das ist nicht real. Wach endlich auf, Marcel!«, brabbelte ich ungehalten. Mir wurde schwindelig. Zu viele Ungereimtheiten folterten das Gehirn.
Plötzlich ein Schmerz im Gesicht. »Aua!«, entfuhr es mir.
Sidas Hand war vorgeschnellt und schlug mich auf die Wange. »Sieht so ein Traum aus?«
»Ähm … Entschuldigung. Ich gaffe Sie an wie ein frühreifer Teenie.«
Sidas Mundwinkel zogen sich nach unten, sie kaschierten ein zufriedenes Lächeln. So unangenehm waren ihr meine Blicke wohl doch nicht.
Schnell lenkte ich ab. »Wieso ärgern Sie sich so darüber, dass Ihre Tochter mittels des Tablets kommuniziert?«
»Sie hat das mir gegenüber bisher nie getan.«
Ich wurde neugierig. »Seit wann ist Aina stumm?«
»Wie ich schon sagte, erzähle ich das später einmal – vielleicht. So vertraut sind wir nicht.«
Ihre Traurigkeit war ansteckend. So sollte der neue Tag nicht beginnen! »Die Sonne geht gleich auf. Begleiten Sie mich zum Strand? Ein bisschen frische Luft atmen?«
Ein eindringlicher, prüfender Blick. Kurzes Zögern. »Eine Minute.«
Wenig später kam Sida in Jeans und roter Strickjacke zurück. »Gehen wir?«
Wir traten durch die seitliche Holztür des Wintergartens ins Freie. Die frische Meeresluft trug den Geruch von Fisch und Algen heran.
»Ihr Haus erscheint mir unheimlich. Der Eingang befindet sich in Hochparterre, der Flachbau im Untergeschoss, die alten Mauern um den Hof – so etwas Ungewöhnliches zieht mich an.«
Sie stellte sich vor mich auf. Viel zu nah. Ich war verwirrt. »Was …?«
»Wo liegt diese Casa el Bosque ihres Freundes?«
Eine innere Stimme mahnte zur Vorsicht. Ich hatte gelernt, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen, so unangebracht es zu sein schien.
Ich holte das Smartphone aus der Seitentasche der Cargohose. Die Koordinaten waren abgespeichert, ich tippte jedoch ein wenig neben den Standort der Finca.
»Hier, die Straße hat keinen Namen. Die Casa steht an der Steilküste, einige Kilometer von Nemiña entfernt.«
»Das sind zwei Stunden mit dem Auto. Gibt es Verträge, an die Sie gebunden sind?«
»Nein.« Ich wunderte mich über diese Frage. »Ich habe es weder eilig, noch habe ich die Casa gepachtet. Dem Freund ist es egal, wann ich dort einziehe und wie lange ich bleibe.«
Uns trennten nur wenige Zentimeter. Der warme Hauch ihres Atems schlug mir ins Gesicht. Schon bereute ich das Misstrauen ihr gegenüber.
»Heute rufe ich die Werkstatt an. Man wird Ihren Wagen nicht vor dem Wochenende reparieren. Es würde mich …« Sie stockte, sah zu Boden.
Empfand sie etwas? War es Einsamkeit? Nein, sie hatte ihre Tochter. Etwa Angst? Wovor? Oder … Ich wagte den Gedanken nicht zu Ende zu denken.
»Wir stellen Ihnen in der Zwischenzeit gerne weiterhin das Gästezimmer zur Verfügung. Bleiben Sie.« Schnell wandte sie sich ab und eilte Richtung Strand davon. Mich als Autor belog sie nicht! Mochte ich auch keine Bestseller schreiben, war ich dennoch empathisch genug, ihr in die Seele zu schauen. Es erschreckte mich, was ich dort sah. Ich holte sie ein, packte sie am Arm.
»Ich nehme die Einladung gerne an. Es ist mir eine Ehre.«
Sida riss sich los, stieß mich weg. »Loslassen! Es ist nicht, wie Sie denken. Sie sollen nicht meinetwegen bleiben!«
Ich war sauer. Gekränkt. Beleidigt. Als wolle ich ihr etwas antun! Tief einatmend, bemühte ich mich um Ruhe. Umsonst.
»Na ja, da haben Sie recht, wohin sollte ich auch gehen. Immerhin bin ich auf Ihre Gastfreundschaft angewiesen!« Scharf und ungerecht belferte ich in den sich leicht rötlich färbenden Morgenhimmel hinein.
»Setzen Sie sich!« Sida ließ sich im Schneidersitz nieder. Es blieb mir nichts weiter übrig, als ihrer Aufforderung nachzukommen.
»Ich mache mir Sorgen um meine Tochter. Verstehen Sie das? Sind Sie Vater?«
Es war unbequem. Das Sitzen, ihre Frage. Ich legte mich auf den Rücken, starrte nach oben. Hatte unendliche Schmerzen. Das Herz zog sich zusammen. Dr. Weidhaus! Sie war nicht da! Meine Notfallmedikamente in der Tasche!
Schnell presste ich mir eine weitere Diazepam heraus und schluckte sie ohne Wasser.
Bitter. Der Geschmack im Mund, das Leben. Alles bitter.
»Was ist los mit Ihnen?« Misstrauisch beugte sich Sida vor.
»Ja doch, ich verstehe Sie.« Mehr vermochte ich nicht zu sagen. Zu sehr hatten mich Erinnerungen eingeholt.
»Aina scheint Ihnen zu vertrauen. Mir gegenüber hat sie seit ihrem Trauma kein einziges Wort geredet. Ich meine geschrieben.«
»Sie wollen mir nicht erzählen, was sie erlebt hat, erhoffen aber Hilfe von mir?«
»Es ist besser, Sie sind unvoreingenommen.«
Ich fand langsam wieder zu mir, war Sida dankbar, dass sie mich nicht weiter ausgefragt hatte. Also respektierte ich auch ihre Zurückhaltung. Dennoch ließ mir etwas anderes keine Ruhe. Ich war eben ein Schwein. Ein Macho. Ein Mann.
»Ist es nur wegen Ihrer Tochter? Würden Sie mich sonst in eine Pension schicken?«
Die Frau erhob sich, stellte sich provozierend über mich. Der Wind zerzauste ihre Haare, das Rot der Wolken hüllte sie magisch ein.
»Ihre Frage ist nicht fair. Kommen Sie, die Sonne geht auf!«
Wir liefen an den Strand. Eine dunkelrote Lichterflut überzog das Meer. Manchmal musterte ich meine Begleiterin von der Seite. War mir sicher, nicht von Hormonen gesteuert zu werden. Weshalb dann das Kribbeln im Bauch, wenn ich sie ansah?
»Es war eine gute Idee, an die frische Luft zu gehen.« Aufgeräumt wie der inzwischen leuchtende Himmel setzte sie einen Schlussstrich unter allem Gesagten.
»Ich bleibe also auf unbestimmte Zeit Ihr Gast? Auch, wenn der Wagen repariert wurde?«
»So lange Sie möchten.«
Die stumme Aina
Donnerstag, 4. April
Ein Klopfen auf die Schulter weckte mich. Aina stand vor meinem Bett und schaufelte mit ihren Fingern unsichtbare Nahrung in ihren Mund.
»Was? Wo bin ich?« Erschrocken richtete ich mich auf. Sah in das lächelnde Gesicht der jungen Frau. Schaute aufs Handy: 12:30 Uhr!
»Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Es gibt Essen?«
Ihr Nicken in Richtung Treppe sagte genug. Sie ging, drehte sich an der Tür noch einmal um und warf mir ein frisches, unschuldiges Lächeln entgegen.
»Das Diazepam. Hätte nur eine Tablette nehmen sollen statt drei!«, murmelte ich. Das kalte Wasser im Bad erfrischte nicht. Benommen lief ich die Stufen hinunter. Stieß mit Sida zusammen.
»Entschuldigung, ich habe verschlafen.« Es war das erste Mal, dass ich das aufblitzende Leuchten in ihren Augen bemerkte. Jenes Strahlen, welches sie nicht verbergen konnte und ich umso heftiger in mich einsog.
»Fühlen Sie sich wie zu Hause, Herr Wolf. Sie können doch schlafen, solange Sie wollen. Aber wir dachten, Sie hätten Hunger. Kommen Sie mit in den Wintergarten.«
Sida setzte sich neben mich, Aina deckte den Tisch. Sie lächelte, während ich entsetzt in die Teller schaute. Was war das? In einer schwarzen Brühe schwammen Tentakeln von Tintenfischen!
»Unser Spezialgericht Chipirones en su tinta. Essen Sie!«
Vorsichtig löffelte ich etwas von dem Sud. Schnell nahm ich einen weiteren Löffel, diesmal mit einem Stück Kalmar. Ich war überrascht.
»Das schmeckt ja fantastisch!« Meine Begeisterung war nicht gespielt. Gerade wollte ich Sida nach dem Rezept fragen, da fiel mir unser Gespräch am morgen wieder ein. Ich wandte mich deshalb an Aina. Sollte sie doch antworten!
»Verraten Sie mir die Zutaten? Ich schmecke Tintenfisch und Knoblauch, dazu eine Menge von Gewürzen …«
Unter den erstaunten Augen ihrer Mutter holte Aina das Tablet hervor, tippte darauf herum und reichte es mir mit einem stolzen Lächeln. Ich las die Webseite von Chefkoch Martín Berasategui. Außer der den Calamares eigenen Tinte bestand das Gericht aus Fischbrühe, Weißwein, Zwiebeln, Tomaten, Olivenöl, Knoblauch und Salz. Dankend gab ich ihr das Tablet zurück. Warum mich ihre Augen dabei anstrahlten, blieb mir ein Rätsel.
Wenig später kredenzte sie drei Tonschälchen mit weißem Inhalt.‹
»Mamia«, meinte Sida. Auf meinen fragenden Blick hin erklärte sie: »Erhitzte Schafsmilch, abgekühlt und mit Honig serviert.«
Da musste ich nicht zögern. Käse, Joghurt, Milch – das war etwas für mich! Das Dessert schmeckte köstlich. Ich schlug die Hände demonstrativ vor den Bauch zusammen.
»Danke! Das war lecker!«
Aina strahlte, Sida jedoch musterte mich mit traurigen und prüfenden Augen.
»Ihr Wagen wurde abgeschleppt. Den Schlüssel habe ich aus Ihrer Tasche genommen. Ist doch in Ordnung?« Ich nickte, und sie fuhr fort: »Ich muss einige Wege erledigen. Kann ich Sie mit meiner Tochter alleine lassen?«
»Hören Sie, was …?« Ehe ich meiner Entrüstung Ausdruck verleihen konnte, unterbrach sie mich.
»Sie lassen keinen Menschen ins Haus! Ist das klar?«
»Natürlich nicht.« Da fiel mir der Wagen ein, der am Tag meiner Panne vom Haus weggefahren war. Und jener Schatten, der um den Wintergarten schlich und einem Mann mit Hut nicht unähnlich sah.
»Niemanden, okay?«
Ihre Hartnäckigkeit war beunruhigend. Hatte sie etwas zu verbergen? Egal. Ich half, den Tisch aufzuräumen. »Darf ich wenigstens an den Strand gehen?«
Hätten Blicke töten können, wäre ich sofort zusammengebrochen. Sida giftete: »Zwei Stunden werden Sie es im Haus wohl aushalten, oder?«
»Warten Sie bitte einen Moment!« Ich eilte hinauf ins Gästezimmer, riss die Sporttasche auf und kramte darin herum, bis ich fand, was ich suchte. Schnell rannte ich wieder hinunter und drückte der überraschten Hausherrin ein paar Geldscheine in die Hand. »Ich beteilige mich logischerweise an den Einkäufen! Schließlich wohne und esse ich hier.«
Sida steckte das Geld wortlos ein und verließ das Haus. Ich war mit der stummen Aina alleine. Überflüssigerweise fragte ich sie: »Was unternehmen wir?«
Sie lächelte, tippte ihre Antwort: »Sie lesen mir etwas vor. Aus einem Ihrer Bücher.«
Ich schnappte nach Luft. Dass ich eine Vorlesephobie hatte, war ihr nicht bekannt. Mir zog sich der Hals zu. »Lyrik? Oder lieber aus einem Roman?«, fragte ich. Das Zittern meiner Knie versuchte ich zu ignorieren.
»Kurzgeschichte?«, leuchteten mir die Buchstaben entgegen.
»Okay. Moment, ich hole mein Tablet.« Wieder stürmte ich hoch. Als ich zurückkam, standen eine Flasche Txakoli und zwei Gläser auf dem Tisch. Aina goss nach baltischer Sitte aus großer Höhe ein. Wie ihre Mutter legte sie entspannt die Beine hoch.
»Warum darf ich niemanden hereinlassen? Gibt es Feinde?«, fragte ich, während ich die E-Book-App öffnete.
»Lies!«, leuchtete mir Ainas Tablet entgegen. Es war eine Novelle, die ich ihr vortrug. Eigenartigerweise hatte ich keine Schwierigkeiten beim Lesen. Lag es daran, dass meine Zuhörerin stumm war? Oder mich mit ihren grauen Augen verschlang? Ich mir überlegen vorkam? Der Txakoli seine Wirkung entfaltete? Egal – ich beendete die Vorlesung ohne Stocken. Die Geschichte einer geheimnisvollen Liebe und der unerwartete Tod des Paares berührten die stumme Frau auf tragische Weise. Ich begriff nicht, warum sie völlig fassungslos aufstand, sich ein Taschentuch vors Gesicht hielt und hin und her lief wie ein Löwe im Käfig. Ich tröstete mich mit dem Wein, versank in Erinnerungen. War allein. Schmerzhaft, wohltuend, abenteuerlich. Nicht ahnend, was ich bei Aina an Gefühlen hervorgerufen hatte.
»Ich habe meinen Verlobten durch ein Unglück verloren.« Das Tablet zitterte.
Ohne zu wissen warum, packten mich aggressive Gefühle. Aina hatte nichts damit zu tun. Doch ihre Mitteilung brachte das Fass zum Überlaufen. Unglücke passierten täglich und überall. Mein Wagen war in irgendeiner Werkstatt, ich saß fest, allein und verlassen. Nach einem Jahr Aufenthalt in Spanien hatte ich immer noch keinerlei Ideen, die Schreibblockade machte mich depressiv. Der Verkauf der bisher veröffentlichten Bücher stockte. Ich benötigte unbedingt einen Manager, hatte aber keine finanziellen Mittel, diesen zu bezahlen. Ihr Verlobter war mir echt egal. Ich hatte ihn nicht gekannt.
Die junge Frau hatte Tränen in den Augen. Freund gestorben. Na ja. »Wie ist das passiert?« Eine Frage aus Höflichkeit.
Aina tippte etwas ins Tablet. Ich packte ihre Hand. »Nein, nicht schreiben. Erzähle es mir!« Sie war jünger als ich, also bot ich ihr das Du an. Eine Stumme zum Reden aufzufordern erschien mir in der momentanen Situation absolut normal. Sollte sie sich nicht so haben! Irgendwann musste sie ihre psychische Hemmschwelle überwinden. Warum nicht hier und jetzt?
Ihre Lippen zuckten krampfhaft. Ihrem Hals entschlüpfte ein stockendes Brabbeln. Erbärmlich! Ungeduldig stand ich auf und verließ den Wintergarten. Hatte genug. Von mir und vom Leben. Von Frauen und deren Problemen. Stapfte hinunter zur Küste. Wollte allein sein. Und bleiben. Für immer. Nur vage schlummerte die Einsicht in mir, jemanden völlig unrecht zu tun. Ich fand keine Kraft mehr, meine Emotionen zu beherrschen. Mir war diese Art Anfälle bekannt. Hinterher würde ich mich elend fühlen und starke Migräne haben.
Als ich zu mir kam, kühlte Gischt den heißen Körper. Die aufschlagenden Wellen versprühten ihr kühles Nass. Stolpernd lief ich am Strand entlang und kletterte über Felsen. Vor mir tauchte eine Höhle auf. Das Meer hatte die Steilküste im Laufe Tausender Jahren ausgespült. Der Boden hier war trocken, lud zum Verweilen ein. Die Konturen an der Decke zeigten mir Sidas Gesicht, wie es vorwurfsvoll auf mich herunterschaute.
Sehnsucht. Scham.
Ich besaß keinerlei Rechte an dieser Frau!
Und doch wünschte ich sie mir herbei. Sie war unheimlich, sinnlich. Dominant. Wusste, was zu tun war.
Der Sand im Rücken tat gut. Die kreischenden Möwen und das gleichmäßige Wellenklatschen entführten mich in einen Tagtraum.
Eine Chance, zu mir zu finden?
Nur Trauer blieb. Ich war nichts wert. Hatte keinen mich liebenden Menschen. War unfähig zu einer festen Bindung. Wäre ich tot – wer würde mich schon vermissen? Das Sterben nahm Formen an, war nichts Undenkbares, Unaussprechliches mehr. Das ekelhafte Leben aus dem Körper zu vertreiben war schwierig. Niemand sollte den leblosen Leib finden. Ich wollte einfach nur verschwinden. Restlos. Gründlich. Unauffindbar.
Salzige Tränen des Selbstmitleides rannen mir in den hechelnden Mund. Das Herz wurde zu groß für den Brustkorb, beanspruchte zu viel Platz. Meine Hände schlugen dagegen, so durfte das Sterben nicht aussehen.
Als die Wut sich legte, kam die Reue. Wie konnte ich Aina so grausam behandeln? »Mein Verlobter ist gestorben.« Mit welchem Recht erlaubte ich mir ein Urteil über sie? Wie unaussprechlich arrogant! Sie hatte sich mir anvertraut. Ekel vor mir selbst erfasste mich. Wo war Dr. Weidhaus? Sie allein hätte mir in dieser Phase tiefster Depression und Fehlorientierung helfen können. Aber – einsam in einem fremden Land … Weit weg von ihr? Welche Chance hatte ich da?
Verwundert vernahm ich eine leise Melodie. Sie drang aus meinen eigenen Lippen. Summte mich in den Schlaf. Eine diffuse Dunkelheit beendete alle Qual.
»Hey! Sie sollten das Haus nicht verlassen! Warum sind sie hier?« Wütende Stimme, große braune Augen. Sida!
»Ähm …«
Wie ein eingefangenes Schaf dem Hirten folgt, rannte ich hinter ihr her, als sie zurück zum Haus eilte.
»Was haben Sie meiner Tochter angetan? Sie ist oben in ihrem Zimmer, hat sich eingeschlossen. Kommt nicht mehr heraus!«
Mir ging alles zu schnell. Aina. Ein Mann verstorben. Beleidigt. Geflüchtet.
»Warten Sie hier, ich gehe hoch.« Die Festigkeit in meiner Stimme überraschte mich selbst. War sie doch eine Illusion. Oben angekommen, klopfte ich energisch an die Tür.
»Ich bin’s. Marcel. Bitte, mach auf!« Wenigstens diesen Fehler musste ich gutmachen. »Aina, bitte, lass mich rein!«
Ein Schnappen an der Tür, mehr nicht.
Weshalb kam Aina der Aufforderung nach? Ein ahnendes Gefühl erfasste mich. ›Diese Frau verehrt dich!‹ Die Erkenntnis darüber schmerzte. Mein Leben entglitt mir, ich war ein psychisches Wrack. Konnte keine Stütze für irgendjemanden auf der Welt sein. War schlecht und egoistisch. Dem selbst angestrebten Tod nah.
Ich drehte den Knauf, die schwere Holztür gab nach. Zögernd trat ich ein. Eine Hand schnellte mir entgegen, abwehrend, ängstlich, endgültig. Dahinter ein Gesicht, in dem feuchte Augen Bände sprachen. Das Display des Tablets blitzte: »Sie Monster!«
Nichts Neues. Nervös sah ich mich um. Der Raum beherbergte einen Schreibtisch, ein Sofa, ein Bücherregal. Am Fenster drängte sich ein kleiner Tisch mit drei Stühlen an den schweren Vorhang. Die expressiven Gemälde an den Wänden jagten mir Schauer über den Rücken.
Ich drückte das massive Holz hinter mir zu und setzte mich ungefragt aufs rote Sofa in der Mitte des Raums.
»Aina, du weißt nicht, dass ich ebenfalls tiefe psychische Probleme habe. Bin manchmal zerfressen von Emotionen, dann wieder eiskalt. Zu fixiert auf die eigene Person. Ich war grausam zu dir. Entschuldige!« Die junge Frau starrte herüber. Ungläubig. Verletzt. Staunend.
»Sie haben mich gedemütigt. Ungeheuerlich verächtlich behandelt!« Unbarmherzig leuchtete mir das Tablet entgegen.
»Sag Marcel zu mir. Lassen wir das Siezen.« Wollte ich nur ablenken? »Du hast recht. Eine Entschuldigung gibt es nicht.«
Einer plötzlichen Eingebung folgend, kramte ich das Handy hervor. »Setz dich bitte. Mir fehlen die Worte. Vielleicht kann das hier mein Gefühl ausdrücken.«
Widerwillig setzte sich Aina neben mich. Wie ein Kind, das Prügel erwartet, wenn es nicht gehorcht.
Ich drückte die Play-Taste. Soko mit ›We might be dead by tomorrow‹ brachte die Verzweiflung zum Ausdruck, die ich empfand. Wir schwiegen. Dann tippte sie einen endlosen Satz ins Tablet.