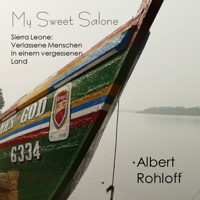
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und dennoch - oder gerade deswegen - muss man die Menschen des Landes gernhaben. Ich war vor einigen Jahren dort, und seither geht mir diese Reise nicht mehr aus dem Sinn. Die Menschen dort und die Umstände, mit denen sie leben, haben mich tief beeindruckt. Ich bin damals quer durch das Land gefahren, war in den kleinsten Dörfern ebenso wie in der Hauptstadt Freetown und Städten wie Bo und Kabala. Dabei habe ich viele Menschen getroffen und gelernt, dass es bei allen Unterschieden auch einen Konsens gibt. Mitgebracht habe ich meine Erinnerungen und viele Fotos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 – Start
2 – Der Geruch Afrikas
3 – Ich hatte ein Leben
4 – Plan B
5 – Konsens
6 – OP
7 –Religion
8 – This is not a joke!
9 – Betty Tucker
10 – Ten Minutes to Kabala
11 – Damokles-Schwert
12 – Handicapped House
1 – Start
Ja, ja – es ist umweltschädlich! Dabei behaupte ich von mir, eine grüne Grundeinstellung zu haben, die allerdings nicht zwingend parteipolitisch verstanden werden soll. Dessen ungeachtet: Ich liebe fliegen! Ich komme mir dann immer wie ein Jet-Setter vor und ach so poly-glott! Und vor allem: Ich genieße jedes Mal den Start. Allein deshalb versuche ich immer, einen Fensterplatz zu ergattern. Herrlich, wenn sich der Flieger am Anfang der Startbahn ausrichtet und kurz zur Ruhe kommt.
Dann legt der Pilot einen Hebel um, die Turbinen springen an, und die Tragflächen beginnen zu vibrieren. Jetzt setzt sich der tonnenschwere Koloss in Bewegung, presst mich in den Sitz und beschleunigt schneller als so mancher Sportwagen von null auf hundert. Den Moment des Abhebens bemerkt man eigentlich gar nicht. Man sieht nur, wie das Flughafengelände sich langsam und dann immer schneller entfernt. Sekunden später taucht man in den Nebel der Wolken ein. Und dann wird’s ruhig.
Nun hatte ich Zeit, mich zu wundern darüber, dass ich überhaupt in diesem Flugzeug saß. Das Ziel war Free-town. Wo um alles in der Welt liegt Freetown? Nun, es handelt sich um die an der Atlantikküste gelegene Hauptstadt von Sierra Leone, einem kleinen, bettelarmen Land an der Westküste Afrikas. Etwa so groß wie Bayern ist es, hat aber nur halb so viele Einwohner. Und das Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 2014 – das war das Jahr, in dem ich dort war – ungefähr ein Hundertstel des süddeutschen Bundeslandes. Das machte Sierra Leone zu einem der ärmsten Länder der Welt. Das war es im Großen und Ganzen auch schon, was ich von meinem Reiseziel wusste. Zahlen, unter denen zumindest ich mir nicht viel vorstellen konnte. Das wollte ich ändern.
Warum eigentlich? Was hatte ich mit diesem gottverlassenen Flecken zu tun? So gefragt, fiel mir die Antwort nie schwer: Abenteuerlust. Ich wollte etwas von dieser Welt ken-nenlernen, das den mir bekannten Rahmen sprengte. Sierra Leone war schlicht eine Gelegenheit, die sich mir bot, als ich etwa ein Jahr zuvor einen Termin über-nahm. Ich war freier Mitarbeiter eines kleinen Lokalblattes in Delmenhorst, das über meine Stadt Oldenburg täglich eine Seite herausbrachte. Dafür war ich gemeinsam mit einem Kollegen zuständig, der - ebenso wie ich - nichts anderes tun wollte, als journalistisch zu schreiben und sich deshalb für ein pauschales Honorar verdingte, das ihm - ebenso wie mir - nichts anderes als das nackte Prekariat bescherte. Selbst schuld.
Der Termin für den Platz war auf der täglichen Oldenburg-Seite des Del-menhorster Blattes, war der Besuch eines Mannes, der in Bo, einer Kleinstadt in zentraler Lage Sierra Leones, ein Krankenhaus leitete. Und dieses Krankenhaus war von den Kliniken Oldenburgs initiiert worden und durch Spenden finanziert. Der Oldenburger Verein „Hilfe direkt“ kümmerte sich inzwischen um weitere Spenden und die Vermittlung deutscher, zumeist Oldenburger Ärzte, die bereit waren, sich ihren Jahresurlaub um die Ohren zu schlagen und für einige Wochen unter vergleichsweise erbärmlichen Ver-hält-nissen zu praktizieren. Da hatten wir den lokalen Bezug.
Bei dem Empfang hatte ich brav mitgeschrieben und herzhaft in die Canapés gebissen, die das Pius Krankenhaus serviert hatte. Es folgte das obligate, fotografisch nicht sonderlich herausfordernde Gruppenfoto mit dem exotischen Gast in der Mitte. Rechts und links Beteiligte wie auch unbeteiligte, aber überaus wichtige Personen, wie zum Beispiel der Oberbürgermeister.
Schließlich wurde mir sogar der Gast höchstselbst vorgestellt: Musa Bainda. Ein untersetzter Mann in der zweiten Hälfte der Fünfziger, so tief schwarz, wie man sich im provinziellen Oldenburg einen Afrikaner vorstellte und auf der Stelle ungemein sympathisch. Das war meine Gelegenheit, „auf den Busch zu klopfen“ (oder ist die Formulierung in diesem Zusammenhang unpassend?). Also hörte ich mich sagen: „Auf eine Tour nach Sierra Leone hätte ich auch mal Bock.“ Genauer: „I would like to visit Sierra Leone sometimes.“ Und Musa lächelte mich warm an und antwortete: „You’re heartly wel-come!“ Diese Quasi-Einladung ging mir fortan nicht mehr aus dem Kopf. Nicht eine Sekunde habe ich an ihrer Ernsthaftigkeit gezweifelt.
Einige Wochen und eine Reihe von Diskussionen mit meiner Frau, die sich sehr um Verständnis bemühen musste, später nahm ich Kontakt auf mit Gisela Bednarek, der Vorsitzenden von „Hilfe direkt“ und – wie ich später erfuhr – Frau von Musa Bainda. Die Rahmenbedingungen waren schnell geklärt. Unterkunft und Verpflegung würde das Krankenhaus in Bo übernehmen, der Flug würde dann mein Ding sein. Also habe ich die Zeitung um einen Vorschuss auf mein zu erwartendes Honorar gebeten. Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, die Zeitung hätte den Flug bezahlt! Sowas kommt vor, wenn auch seltener, als ein Leser oder TV-Konsument das vermutlich annimmt. Nicht aber bei einem kleinen Lokalreporter wie mir. Ich musste sogar auf das Honorar verzichten, das ich in der Zeit meiner „Tour“ hätte verdienen können. Mir war es das wert. Das und den Kredit der Zeitung mit meiner Frau zu erörtern, muss ich irgendwie vergessen haben.
Vor den Abflug hatten die Behörden dann noch eine Unmenge an Impf-spritzen gesetzt, von denen ich mich in den vorgegebenen zeitlichen Abständen durchlöchern ließ.
Jetzt saß ich im Flieger und war immer noch dabei, mich über mich selbst zu wundern. Heute weiß ich, dass diese Reise zu unternehmen zu den besten Entscheidungen und prägendsten Ereignisse meines Lebens gehören sollte.
2 – Der Geruch Afrikas
Als der vierstrahlige Airbus A 340 aufsetzte, war es nach Mitternacht. Der Landeanflug, auf den ich ebenfalls regelmäßig gespannt bin, entging mir. Ich konnte in der Dunkelheit nicht einmal feststellen, ob die Landebahn asphaltiert war. ‚Immerhin,‘, dachte ich mir ‚sie ist mit elektrischem Licht markiert.‘ Aber womit auch sonst? Mit Leuchtfeuer? ‚Aha!‘, ermahnte ich mich selbst, ‚da sind sie schon, die überheblichen Gedanken eines Mitteleuro-päers!‘. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich mit der Erwartung von Leuchtfeuern gar nicht so falsch lag. Der Strom für den Flughafen kam aus Generatoren. Ich nahm mir vor, meinen unvoreingenommenen Blick auf die Gegebenheiten zu bewahren: ohne Nase-rümpfen oder Kopfschütteln.
Das Vorhaben, nicht den verwöhnten Mitteleuropäer heraushängen zu lassen, erfuhr recht bald seine erste Herausforderung. Vom Flieger aus ging es zu Fuß über die Rollbahn in einen Abfertigungsraum, der von Neonröhren beleuchtet und mit Klapp-stühlen bestückt war. Die Wände zwischen den matten Fenstern waren mit muffig-braunen, fur-nierten Sperrholzplatten getäfelt. An der Kopfseite des Raums setzte sich nach einiger Zeit ein Förderband in Gang, auf das am Ende starke Arme die Gepäckstücke des Flugs warfen. Was nicht geworfen wurde, war mein Koffer. Der war in Paris liegen geblieben. Das war also wohlgemerkt nicht die Schuld afrikanischen Schlendrians, sondern die der Logistik am Aeroport Charles de Gaulle. Am Informationsstand vor der Ausgangstür nahm man sorgfältig meine Personalien auf, um mir dann mitzuteilen, dass der nächste Flug aus Paris in vier Tagen erwartet werde. Vier Tage lagen also vor mir, bei über 30 Grad und Sonne im selben Hemd und derselben Unterhose. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich die Hilfsbereitschaft der Menschen in Sierra Leone noch nicht.
An der Ausgangstür des Flughafengebäudes empfing mich herzlich ein junger, athletisch gebauter Mann. Ich sollte noch lernen, dass in Sierra Leone und vermutlich in ganz Afrika alle jungen Männer athletisch gebaut sind, sowie alle jungen Frauen eine fantastische Figur haben.
„Du musst Albert sein! Ich bin Brima, der Sohn von Musa.“
Wie hatte er mich bloß erkannt? Okay – die Frage konnte ich mir mit Blick auf die übrigen Fluggäste rasch selbst beantworten.
„Wo ist Dein Gepäck?“
Meine Antwort überraschte Brima nicht wirklich, geschweige denn, dass sie ihn aus der Ruhe gebracht hätte.
„Das haben wir hier öfter. Ich habe das schon befürchtet, als ich hörte, dass Du über Charles-de-Gaulle kommst.“
Auf dem Parkplatz neben einem SUV stand Musa und strahlte mich an. Wir hatten uns vor rund einem Jahr einmal gesehen und nur ein paar Worte gewechselt. Und doch war es absolut unumgänglich, sich herzlich zu umarmen. Auch jetzt die Frage nach meinem Gepäck und abermals eine gelassene Reaktion.
Im Wagen erklärte mir Musa den Plan.
„Wir fahren jetzt erst mal nach Lakka in ein Hotel. Es wird Dir dort gefallen. Es liegt direkt am Strand. Da schläfst Du Dich erst mal aus, und morgen geht es zur ‚Grassfield-Schule‘, einem Projekt von ‚Hilfe direkt‘.“
Ich habe das kaum zur Kenntnis genommen. Noch war ich zu überwältigt von der Tatsache, in Afrika zu sein. Dabei sah ich so gut wie nichts davon. Die Benennung „finstere Nacht“ erhielt hier eine vertiefte Bedeutung, Keine Straßenlaternen, keine Fahrbahn-markierung, nur das Mondlicht. Immerhin war gerade Vollmond.
Vom Flughafen, der etwas außerhalb Freetowns auf der Halbinsel Lungi liegt, ging es durch die Dunkelheit zunächst einige Zeit über Land.
Es war auch nachts um 1:30 Uhr noch immer angenehm warm. Das Fenster war weit geöffnet während der Fahrt. Das erste, das ich trotz Dunkelheit von Afrika wahrnahm, war tatsächlich der Geruch. Es roch hier anders als in Europa. Es roch nach der Erde, die den ganzen
Tag von der sengenden Sonne erhitzt worden war und nun ausdünstete. Es roch nach vermodernden Pflanzen und nicht nach Nadelhölzern. Ein anderer Kontinent, eine andere Flora.





























