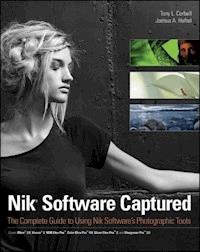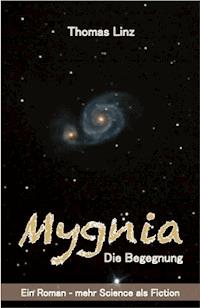
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In Berlin taucht plötzlich ein unbekanntes Lebewesen auf. Gleichzeitig finden am CERN in Genf neue Experimente am LHC statt. Gibt es einen Zusammenhang? Ein neues Material mit ungewöhnlichen Eigenschaften spielt offenbar eine entscheidende Rolle. Julia Marquardt, eine angehende Wissenschaftlerin, will der Sache auf den Grund gehen. Zusammen mit Ihrer Freundin Renate erlebt sie das Abenteuer ihres Lebens. Gleichzeitig gibt es aber ungewollte Mitspieler, die aus dem ominösen Material Kapital schlagen wollen. Ein unbeabsichtigter Wettlauf beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mygnia - Die Begegnung
Titel SeiteTitelBerlinBerlin - 1KölnBerlin - 2Berlin - 3GenfMygniaBerlin - 4Genf - 1Mygnia - 1Berlin - 5Genf - 2Berlin - 6Genf - 3Mygnia - 2Genf - 4Köln - 1Berlin - 7Genf - 5Berlin - 8Mygnia - 3Genf - 6Berlin - 9Mygnia - 4Genf - 7Berlin - 10Mygnia - 5Genf - 8Berlin - 11Mygnia - 6Genf - 9Berlin - 12Mygnia - 7Genf - 10Mygnia - 8BernGenf - 11Mygnia - 9Genf - 12Mygnia - 10Bern - 1Mygnia - 11Genf - 13Mygnia - 12Genf - 14Mygnia - 13Genf - 15Berlin - 13Mygnia - 14Genf - 16Titel - 1Mygnia
Die Begegnung
Vorwort
Ich bin zu diesem Buch von Karl Olsberg inspiriert worden, der „Mygnia“ geschrieben hat und auf seiner Internetseite andere Autoren motiviert hat,seineWelt mitzugestalten, und etwas zu erschaffen, was einst J.J. Tolkien mit der „Herr der Ringe“-Saga getan hat. Ich habe diese Gelegenheit genutzt, um endlich einmal eine komplexe Geschichte zu schreiben, mit den zugehörigen Recherchen, damit es halbwegs reell wird.
Dabei war mir wichtig, dass ich aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit einer erfundenen Geschichte verknüpfe, die sich aber möglichst nahe an der Realität bewegen soll. Das fasziniert mich an Büchern wie zum Beispiel „Der Schwarm“ von Frank Schätzing. Gibt es plausible Gründe, warum so etwas nicht passieren kann? Ist es eine Frage des OB oder vielmehr die Frage nach dem WANN?
Damit bin ich beim Buch. Was ist Realität und was ist meiner Fantasie entsprungen? Einige Orte, so zum Beispiel der Flughafensee in Tegel, sind naturgetreu beschrieben. Ebenso habe ich für einige wissenschaftliche Erklärungen entweder mein eigenes Fachwissen oder das des Internets herangezogen.
Aber alles andere entspringt den Bildern in meinem Kopf, den Gedanken, die ich seit meiner Kindheit mit mir herumtrage. Die ich sicherlich mit vielen anderen Menschen überall auf der Welt teile. Angefangen mit der Frage, ob wir allein sind im Weltall oder ob es doch andere Zivilisationen gibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sie gibt. Wann wir allerdings die berühmte Begegnung der dritten Art haben werden, ist ungewiss. Es kann morgen sein, oder erst in tausenden von Jahren. Falls es uns Menschen dann noch gibt.
Aber zurück zu unserer eigenen Entwicklung und den vielfältigen Möglichkeiten, die wir noch vor uns haben. Wenn ich nur hundert Jahre zurück gehe und mir die wissenschaftliche oder technische Entwicklung seit dem ansehe, muss ich mir wegen meiner, aus heutiger Sicht vielleicht absurder, Fantasie keine Gedanken mehr machen. Wie viele Dinge, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts für unmöglich gehalten wurden, sind heute selbstverständlich? Nehmen Sie das berühmte Zitat, angeblich von Thomas Watson, Vorsitzender von IBM, aus dem Jahre 1943: "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt." Wie viele gibt es heute? Das war einfach unvorstellbar, aus damaliger Sicht, gerade einmal gut siebzig Jahre her.
Und so geht es uns mit vielen Dingen.
Also, was kann uns wirklich noch überraschen?
Titel
Prolog
Es war eine trostlose Landschaft, hier am Rande der Berge. Der staubige Boden und die Felsen hatten eine einheitliche gelbbraune Färbung, nur hin und wieder schimmerten einzelne Flecken, in denen sich Mineralien angesammelt hatten, in leicht bläulichen Tönen. Die Vegetation in diesem kargen Gebiet war spärlich, und nur die anpassungsfähigsten Pflanzen konnten hier ihr Dasein fristen. Es gab eine dünne Schicht anspruchsloser Flechten und niedrige, blütenlose Sträucher, die zwischen den Felsen Halt suchten. Selbst die sonst weit verbreiteten und sehr robusten Ramsfarne kamen hier nur in kleinen Gruppen vor, und nur dank ihrer überlangen Wurzeln konnten sie sich halbwegs mit dem tief gelegenen Grundwasser versorgen.
Die beiden Sonnen brannten erbarmungslos von dem blauvioletten Himmel. Das Wesen saß im Schatten einer Gruppe der halb vertrockneten Farne. Es war etwa einen Meter groß und besaß zwei Arme und Beine, die jeweils drei Zehen und Finger nach vorn und zwei nach hinten gerichtet hatten. Der Kopf wurde von zwei großen, dunklen Augen dominiert, die auf ein Leben überwiegend in der Dämmerung schließen ließen. Wie alle seine männlichen Artgenossen hatte es zudem auf dem Kopf zwei nach hinten gebogene Hörner, die allerdings keinen praktischen Zweck hatten. Um den Hals trug er eine Kette mit einem länglichen Stein, sonst war weder Schmuck noch Kleidung zu sehen.
Er hatte in letzter Zeit viel durchgemacht auf seinem Weg, ein vollwertiges Mitglied im Clan zu werden und den Status des Jünglings endgültig abzulegen. Aber wie viele andere vor ihm hatte er bislang alle Prüfungen bestanden, und er war sehr stolz darauf. Die größte stand ihm nun bevor. Er war aufgebrochen, um einige von den heiligen und sehr seltenen Larynxbeeren zu finden, was bei weitem nicht allen gelang. Aus diesen Beeren wurde zu ganz besonderen Anlässen ein berauschender und die Sinne erweiternder Trank gebraut.
Er erinnerte sich noch genau daran, wie Rasa, die Älteste im Clan und Heilige Frau, die außergewöhnliche Leistung eines seiner älteren Brüder besonders hervorgehoben hatte, als sie ihn offiziell in den Kreis der Ausgewachsenen aufnahmen: „Hier seht ihr Gord. Er hat es als einer von wenigen in seinem Alter geschafft, die heiligen Beeren zu finden und zu uns zu bringen. Dabei hat er viele gefährliche Abenteuer überstanden, ist aber unverletzt zu uns zurück gekehrt.“ So war Gord´s Ansehen im Clan von einem auf den anderen Tag schlagartig gewachsen. Und auch ein weibliches Clanmitglied folgte endlich seinen bis dahin verborgenen Sehnsüchten und blieb fortan an seiner Seite.
Ja, sein Bruder Gord hatte es geschafft. Jetzt war es an ihm, es ihm gleich zu tun und sich den anstehenden Herausforderungen zu stellen. Wie vorher Gord hatte er von Rasa den heiligen Stein bekommen, den er wie seinen Augapfel hütete. Sie hatte ihm auch erklärt, was er damit tun musste, wenn er in ausweglose Gefahr geriet. „Harf, du wirst dich in sehr gefährlichen Gegenden bewegen müssen, um die Beeren zu finden. Nutze das Amulett nur, wenn du wirklich keine andere Möglichkeit siehst, dein Leben zu retten. Aber denke auch daran, was es mit dir macht. Vergiss das nie!“
Er hatte es hoch und heilig versprochen und seitdem einen noch viel größeren Respekt vor diesem immens schweren Stein.
Er erinnerte sich daran, dass Gord ihm einmal erzählt hatte, dass er in einer Situation, die ihn sicherlich das Leben gekostet hätte, den Anweisungen von Rasa, der weisen Frau in seinem Clan, gefolgt war und den Stein einfach in den Mund genommen hatte. Er hatte ein gleißendes Licht gesehen und hatte das Gefühl, in einen bodenlosen Schacht zu fallen. Als er erwachte, fand er sich in einer fremden Umgebung wieder, und ein merkwürdiges Wesen auf zwei Beinen war auf ihn zugekommen. Wieder rettete ihn der Stein, aber dieses fremde Wesen war mit hierher gekommen. Die beiden freundeten sich an, und irgendwann war das Wesen wieder verschwunden. Harf hatte das Ganze nur vage in Erinnerung, er war zu der Zeit noch zu jung gewesen, um alles zu verstehen.
Nun saß er hier. Die mittägliche Hitze wurde durch den starken Wind, der ihm ins Gesicht blies, erträglich. Er spielte gedankenverloren mit dem Stein, den er an einer Kette um den Hals trug. Er sah äußerlich fast aus wie jeder andere Stein hier, aber er wusste, dass er aus einem bestimmten Material war und ganz besondere Kräfte hatte.
Das Rauschen des Windes war das einzige Geräusch, was er hörte. Er schloss die Augen und gab sich seinen Gedanken hin. Würde er die Beeren finden? Was würde ihn dann in seinem Leben noch alles erwarten? Würde er Nachkommen haben? Wenn ja, wie viele und was wäre das für ein Gefühl? Welchen Status würde er im Clan einnehmen? So viele Fragen, aber auch so viele Träume, für die es sich sicherlich lohnte, hart daran zu arbeiten und nun auch diese schwerste aller Prüfungen zu bestehen. So wie es alle anderen auch machen mussten, weil ihnen einfach nichts anderes übrig blieb. Die Welt um ihn herum war voller Gefahren und Herausforderungen, denen man sich stellen musste, wollte man überleben und sich weiter entwickeln. Wie viele verschiedene Raubtiere gab es hier, vor denen man sich sehr in Acht nehmen musste. Und dann waren diese silbern geflügelten Wesen, die seinesgleichen zu tiefst hassten. Er hatte aus verschiedenen Erzählungen gehört, dass diese Lichtwesen schon öfter Mitglieder aus seinem Clan entführt hatten und sie zu ihren Dienern gemacht hatten. Bis auf einen, der fliehen konnte und alles erzählte, war bislang nie jemand zurück gekommen.
Er verscheuchte diese düsteren Gedanken und dachte an ein weibliches Mitglied im Clan, zu dem er sich hingezogen fühlte, und ein wohliges Gefühl machte sich in ihm breit. Er fühlte förmlich noch einmal die erste versehentliche Berührung und das Glücksgefühl, das sich dabei einstellte. Er gab sich ganz diesem Gefühl hin und wäre fast eingenickt.
Plötzlich spürte er hinter sich eine leise Bewegung. So wie ein Schleifgeräusch, aber von etwas sehr großem verursacht. Eine furchtbare Ahnung stieg in ihm auf. Er sprang auf und drehte sich um, nur um sich dem schrecklichsten Feind gegenüber zu sehen, den er sich vorstellen konnte. Ein blaugrüner, wurmartiger Körper, der in einem zähnestarrenden Maul endete. Der Kopf war von Sinnesbüscheln gesäumt, die sich erregt bewegten. Oberhalb der Augen besaßen diese Kreaturen Drüsen, aus denen sie ein wirksames Nervengift versprühen konnten. Harf spürte tatsächlich einen leichten Flüssigkeitsstrahl auf seinem Körper. Dieses teuflische Gift drang in die Haut jedes Lebewesens ein und verurteilte es unweigerlich zum Tode. Es gab zwar ein Gegengift, aber das kannte nur Rasa, und die war weit weg.
Wie kam ein Felswurm hierher? Die lebten doch sonst nur hoch in den Bergen. Ihm blieb keine Zeit für weitere Gedanken. Er wendete sich zur Flucht, und seine schnelle Bewegung rettete ihm das Leben, zumindest für den Moment. Wäre er dort geblieben, hätte das Monster seinen Kopf erwischt, aber so erwischte es nur seinen Arm. Er schrie auf, aber niemand konnte ihn hören. Ein beißender Gestank machte sich breit, der ihn aufgrund des starken Windes vorher nicht aufgefallen war. Die Zeit dehnte sich zu einer Ewigkeit. Das Gift wirkte, und er konnte seine Bewegungen immer weniger kontrollieren.
Da half nur eins. Das war die von ihm so gefürchtete Situation, in der er das, was ihm Rasa erklärt hatte, anwenden musste. Er riss sich mit dem unverletzten Arm mit letzter Kraft den Stein vom Hals und steckte ihn in den Mund. Augenblicklich erschien die Welt um ihn herum in allen Farben des Regenbogens gleißend zu erstrahlen. Das erschreckte das Monster, und es machte eine heftige ruckartige Bewegung, bei der es Harf den Arm heraus riss. Er schrie in wilder Panik und vor Schmerzen auf, und der Stein flog aus seinem Mund, die Kette riss und landete ein paar Meter entfernt in den Flechten. Die Lichtsäule hatte mittlerweile ihre volle Stärke erreicht und schien in den Himmel zu wachsen. Dann fiel er, zusammen mit dem Monster, ins Bodenlose.
Er spürte noch, wie er ins Wasser fiel, bevor er erneut von dem Ungeheuer gepackt und alles endgültig dunkel wurde.
Berlin
„Boarding completed.“ Im Cockpit des Air Berlin-Fluges AB352 um 17.55 Uhr von Tegel nach Köln schloss Heiner Marquardt gerade die letzten Checks ab, bevor es losgehen sollte. Seine imposante Erscheinung entsprach ziemlich genau dem Klischee eines Flugkapitäns. Etwas über einsneunzig groß, durchtrainiert, kurze blonde Haare, gebräunte Haut, tiefblaue Augen und ein riesiger Schnurrbart führten regelmäßig dazu, dass er die Blicke der Leute um sich herum auf sich zog. Er lebte mit seiner Frau in Köln. Heute freute sich ganz besonders auf den Flug, denn es war an diesem Freitag der letzte auf dieser Pendelstrecke, und abends würde er nach längerer Zeit seine Tochter Julia wiedersehen.
Aus diesem Grund wollte er den Abend zu etwas besonderem machen und hatte einen Tisch in einem kleinen Restaurant in der Kölner Altstadt reserviert. Es würde bestimmt ein sehr schöner und langer Erzählabend mit Julia und seiner Frau Simone werden.
Mit dieser guten Laune begann er dann mit seiner sonoren Bassstimme die übliche Ansage an die Passagiere: „Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie aus dem Cockpit auf unserem Air Berlin-Flug nach Köln. Mein Name ist Heiner Marquardt und ich bin Ihr Kapitän auf diesem kurzen Flug. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns an Bord. Machen Sie es sich bequem und genießen Sie sowohl den Flug als auch das anschließende Wochenende. Meines wird sicherlich schön, und daher habe ich ein doppelt so großes Interesse wie sonst, uns alle heile nach Köln zubringen.“ Ein leises, entspanntes Lachen aus der Kabine, das durch die angelehnte Tür zu ihm herein drang, ließ ihn schmunzeln. „Ich werde Ihnen im Verlauf des Fluges weitere Informationen geben. Good evening, ladies and gentlemen,....“
Nach zwei Minuten kam die Starterlaubnis vom Tower. Langsam wurde der Airbus zurückgeschoben, bevor er begann, von Gate 2 nach rechts Richtung Startbahn zu rollen. Aus dem Augenwinkel sah er gegenüber am Wald einen Lichtschein. So, als ob jemand mit einer riesigen Taschenlampe nachts in den Himmel leuchtet, oder wie die Lichtfinger, die bei Konzerten oder anderen Veranstaltungen über Städten zu sehen sind. Aber er gab dem keine Bedeutung. Seine jahrelange Routine und die ungezählten Flugstunden ließen ihn sich auf die Instrumente und die letzten Startvorbereitungen konzentrieren.
In der letzten Linkskurve, die seine Maschine in die Startposition Richtung Westen brachte, sah er kurz zu seinem Copiloten herüber, um ihm ein „alles klar“ zu signalisieren. In derselben Blickrichtung bemerkte er wieder den Lichtstrahl über dem Wald, nur diesmal deutlich intensiver, in der Mitte gleißend hell, in allen Farben schillernd und an den Rändern wabernd, so dass er den Durchmesser kaum abschätzen konnte. Der Strahl schien aus dem Wald zu wachsen und verschwand nach oben in der tief liegenden dünnen Wolkendecke.
Er versuchte, Details zu erkennen, aber er konnte nicht einmal wage Konturen erkennen. Es war einfach nur grell und bunt. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte er an das Beamen aus den alten Raumschiff Enterprise-Filmen. Nur dass dies nicht der Fantasie eines Schriftstellers oder Filmproduzenten entsprang, sondern absolut real war.
Faszinierend und erschreckend zugleich. Der Strahl schien ihn regelrecht in seinen Bann zu ziehen. Er konnte den Blick nicht abwenden und bemerkte weder den besorgten Ausdruck auf dem Gesicht seines Copiloten noch das Gemurmel hinten bei den Passagieren. Eigentlich hätte er nun zum Starten beschleunigen müssen. Aber er fühlte sich wie in einer tiefen Trance. Als ob die Welt nur aus dieser Lichtsäule bestünde.
Die Zeit schien stehen zu bleiben. Er spürte, wie ihm kalter Schweiß den Rücken hinunter lief. Ihm wurde schwindelig, und er schloss für einen kurzen Moment die Augen.
Gerade in dem Moment, in dem er sie wieder öffnete, sackte die Lichtsäule in sich zusammen, und er fühlte sich, als ob er aus einem langen Schlaf erwachte.
Wie durch Watte hörte er die Anfrage des Towers: „AB352, was ist los?“
„Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwas ist nicht, wie es sein sollte“, war seine Antwort. „Ich habe ein komisches Gefühl“.
Er konnte und wollte das Phänomen nicht beschreiben. Möglicherweise zweifelten Sie dann an seinen Fähigkeiten oder seinem Zustand, und Unannehmlichkeiten oder gar schlimmeres wollte er nicht riskieren. Vielleicht waren auch die langen Arbeitszeiten in den letzten Wochen doch zuviel gewesen. Dann kam die Anweisung vom Tower: „Verlassen Sie die Startbahn und folgen sie den weiteren Anweisungen. Wir geben Ihnen ein neues Startfenster.“
Mittlerweile war er wieder ganz bei sich und fragte sich, was das eben war. So etwas hatte er in den vielen Jahren seiner Berufspraxis noch nicht erlebt, obwohl er schon viele Flughäfen auf der ganzen Welt angeflogen hatte. Hatte ihm seine Fantasie einen Streich gespielt? Oder waren das wirklich nur ein paar Spinner, die auf sich aufmerksam machen wollten? Er wusste es einfach nicht.
Von dem Licht war nun absolut nichts mehr zu sehen, der Wald sah so friedlich aus wie immer. Er bewegte mittlerweile den Airbus weg von der Startbahn auf die ihm zugewiesene Warteposition.
Dann meldete sich der Tower wieder: „AB352, alles in Ordnung bei Ihnen?“
„Ja, mit mir ist alles ok. Ich habe mich nur eben über das Licht über dem Wald gewundert. Das haben Sie doch sicherlich auch gesehen.“
„Ja. Uns war zwar nichts gemeldet worden, aber wir gehen zur Zeit davon aus, dass eine Veranstaltung ist, bei der die mit diesen großen Scheinwerfern arbeiten. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. So etwas darf so nahe an einem Flughafen nicht genehmigt werden.“
„Verstehe. Ich warte nun auf weitere Instruktionen.“
„Ok. In voraussichtlich zehn Minuten können Sie los.“
Mit einem Hinweis auf die offensichtlich nicht genehmigte Lightshow im Wald informierte er die beunruhigten Passagiere. Mit dann doch einer halben Stunde Verspätung hob die Maschine in die Richtung der untergehenden Sonne ab.
Berlin
Sie winkte ihren beiden Enkeln und ihrer Tochter noch lange hinterher. Renate Obermeier hatte an diesem Samstag ihren 67. Geburtstag gefeiert, und war bis jetzt mit dem Tag rundherum zufrieden.
Das Wetter war warm, für Anfang April eigentlich zu warm. Aber das hatte den eindeutigen Vorteil, dass sie auf der Terrasse sitzen und den Blick auf den langsam grün werdenden Wald am Flughafensee genießen konnten. Sie räumte das Geschirr in die Küche und stellte die Kuchenreste in den Kühlschrank. Anders als viele andere Leute in ihrem Alter empfand sie einen Geburtstag nicht als Schritt zum Altwerden, sondern war dankbar, dass sie wieder ein Jahr bei bester Gesundheit erleben durfte. Ihre kurzen Haare hatten zwar die schwarze Farbe längste gegen eine Mischung aus diversen Grautönen eingetauscht, aber ihre wachen Augen, die glatte Haut und ihre sportliche Figur ließen sie jünger erscheinen als sie war. Und so fühlte sie sich auch.
Dennoch hatte sie sich wegen der Erkrankung ihres Mannes vor vier Jahren entschieden, vorzeitig in Rente zu gehen. Sie hatte seinerzeit nach ihrem Biologiestudium im Bereich Exobiologie promoviert, sich also mit möglichen außerirdischen Lebensformen beschäftigt. Auf welcher Grundlage sie entstanden sein könnten, was grundlegende Eigenschaften wären. Wie vielfältig und anpassungsfähig das Leben sein kann. Das Wunder der Evolution hat allein auf der Erde einen unüberschaubaren Artenreichtum hervorgebracht, von dem sicherlich bis heute nur ein Bruchteil bekannt ist. Es werden immer wieder neue, völlig ungewöhnliche Organismen entdeckt. Beispielsweise in der Tiefsee, unmittelbar neben den so genannten schwarzen Rauchern, das sind Hydrothermalquellen vulkanischen Ursprungs, bei denen das Wasser aufgrund des herrschenden enormen Drucks deutlich mehr als 100°C heiß ist, ohne zu verdampfen. Hier gibt es überraschenderweise vielfältiges Leben, und das nicht nur in Form von Bakterien, sondern auch zahlreichen Arten von Krabben, Würmern und Muscheln.
Nachdem sie ihre Doktorarbeit abgeschlossen hatte, arbeitete sie etliche Jahre am Institut für vergleichende Zoologie der Berliner Humboldt Universität. Ihre Begeisterung für ungewöhnliche Spezies ließ sie nicht mehr los. Neben ihren umfangreichen Forschungen übertrug sich das auch auf ihre Lehrtätigkeit, bei der sie in außergewöhnlich anschaulichen Vorlesungen den Studenten die Faszination der vielfältigen Lebensformen auf der Erde nahe brachte.
Ein attraktives Angebot führte dazu, dass sie die letzten Jahre ihres Berufslebens als wissenschaftliche Leiterin des Naturkundemuseums verbrachte und so auch mit den Spuren von Lebewesen vertraut wurde, die lange vor unserer Zeit gelebt haben. Damit wurde ihr Spektrum an Erfahrung noch einmal um ein nennenswertes Ausmaß erweitert.
Diese Vielfältigkeit faszinierte sie zunehmend, und sie hätte wohl noch mehrere Jahre weiter gemacht, aber ihr Mann bedeutete ihr weitaus mehr. Vor gut zwanzig Jahren hatte sie eine Krebsdiagnose bekommen, und die Chancen standen nicht gut. Durch seine unermüdlichen guten Zusprüche, seine rührende Fürsorge und den unerschütterlichen und ansteckenden Optimismus hatte sie es aber geschafft. Diese Phase ihres gemeinsamen Lebens hatte sie unzertrennlich gemacht.
So entschied sie sich, während seiner Krankheit voll für ihn da zu sein. Leider konnte er trotz seiner positiven Einstellung den sehr bösartigen Krebs nicht besiegen und verstarb vor eineinhalb Jahren.
Nun war Alfi, ein dunkelbraun gescheckter mittelgroßer Mischlingsrüde, den sie im letzten Jahr als acht Wochen altes Welpen zum Geburtstag bekommen hatte, ihr größter Liebling. Er war voller ungestümer Energie, gehorchte aber normalerweise aufs Wort. Sie ging mit ihm jeden Morgen und Abend für eine Stunde hinaus und ließ ihn dabei oft frei laufen. Bis heute war er auf ihren Ruf hin immer wieder sofort zu ihr zurückgekehrt.
Als Alfi merkte, dass sie sich die Schuhe und Jacke anzog, wusste er, dass es nun losging, und gebärdete sich wie wild. Schwanzwedelnd und bellend sprang er um sie herum und konnte es nicht abwarten, bis endlich die Tür aufging und er losspurten konnte.
Sie hatte immer einen wachsamen Blick auf ihn. Nicht nur der anderen Hunde wegen, sondern es gab hier auch etliche Wildschweine, die um diese Jahreszeit ihre Jungen hatten.
Heute wollte sie in Richtung See mit ihm, damit er bei dem warmen Wetter auch endlich mal wieder ins Wasser gehen konnte. Seinen Lieblingsball, den er schon im letzten Sommer mit wachsender Begeisterung immer wieder aus dem Wasser geholt hatte, hatte sie auch eingesteckt.
Der kleine Strand war um diese Uhrzeit menschenleer. Vom gegenüberliegenden Flughafen drang das Geräusch einer startenden Maschine herüber. Einige Meter vom Strand entfernt zog einen Gruppe Enten ihre Runden, weiter rechts wartete ein Reiher, unbewegt wie eine Statue, auf Beute.
Ohne abzubremsen rannte Alfi ins Wasser, in der Hoffnung, vielleicht doch eine von den Enten zu erwischen. Es war einfach zuviel von einem Jagdhund in ihm, als dass er ihnen nur zusehen könnte. Aber die Vögel waren viel zu erfahren und ließen ihn auf zwei, drei Meter heran, bevor sie davonflogen. Also kehrte er enttäuscht um und schwamm zum Strand zurück.
Renate wartete, bis er an Land war, und warf dann den Ball ins Wasser. Alfi schaute kurz und sprang dann hinterher. Der Wind trieb den Ball weiter auf den See hinaus, und Alfi hatte Mühe, hinterher zu kommen. Er war ganz auf den Ball konzentriert, so dass er selbst die andere Gruppe Enten neben ihm nicht bemerkte.
Renate feuerte ihn an: „Alfi, los! Hol den Ball! Fein machst Du das!“
Plötzlich platschte es neben den Enten mächtig, und aus den Augenwinkeln sah Renate etwas aus dem Wasser kommen, eine von den völlig überraschten Enten packen und wieder verschwinden. Es dauerte einen Moment, bis sie die Situation realisierte
„Alfi, Alfiiiii!!“ Voller Angst rief sie ihren Hund zurück. Er hatte den Ball gerade geschnappt und kehrte um. Es waren aber noch gut 20 Meter zum Ufer. Hinter ihm kam das Wasser in Bewegung, und ein großes Ding, fast wie die Rückenflosse eines Hais, tauchte kurz auf und verschwand wieder. Alfi spürte ebenfalls die Gefahr und paddelte mit seinen kurzen Beinen, so schnell er konnte. Aber es half nichts. Sie sah die Welle hinter dem Hund, und er wurde kurz unter Wasser gezogen. Dann tauchte er wieder auf, jaulte laut auf und strampelte um sein Leben. Vergeblich! Ein großer Kopf tauchte in einem Wasserschwall auf, aber Renate konnte in ihrem Schrecken kaum etwas erkennen. Ein großes Maul, darüber ein paar kleine Augen, die nach vorn blickten, und das Ganze umgeben von einer Art Federkranz. Die gesamte Größe des Monsters konnte sie nicht erfassen, aber es musste riesig sein. So ein Tier gab es doch gar nicht!
Renate konnte nicht glauben, was passierte. Das letzte, was sie von Alfi hörte, war ein letztes Aufjaulen, bevor er von dem Maul voller langer, spitzer Zähne von oben gepackt und endgültig unter Wasser gedrückt wurde. Ein paar Blasen, dann wurde es still.
Renate starrte auf die Stelle, wo eben noch ihr Liebling schwamm, als sie plötzlich mit Erschrecken feststellte, dass sie viel zu nahe am Wasser stand. Panikartig rannte sie den schmalen Strand hinauf, stolperte über eine Wurzel, raffte sich wieder auf und rannte weiter. Völlig außer Atem drehte sie sich vorsichtig um und blickte zurück auf den See, der nun wieder so ruhig und friedlich aussah, wie sie ihn schon so oft erlebt hatte. Als ob nie etwas gewesen wäre.
Sie fühlte sich wie in einem bösen Traum, als sie mit schleppenden Schritten zurück zu ihrem Haus ging. Ihre Nachbarin Christel stand zufällig im Garten und blickte erschrocken auf.
„Was ist denn mit Dir los? Ist Dir nicht gut? Wo ist denn Alfi?“
Bei der letzten Frage brach Renate in Tränen aus. „Alfi ist weg. Von einem Tier gefressen. Er hatte doch nur ....“ Die weiteren Worte gingen in ihrem Schluchzen unter. Christel sah sie ungläubig an. „Von einem Tier gefressen? Hier gibt es doch keine Raubtiere!“
„Ich ... ich weiß nicht. Aber Du musst mir glauben. Es kam aus dem Wasser und hat ihn mitgezogen. Einfach so.“
„War es ein Fisch? Aber so große gibt es doch hier nicht. Komm her. Setz Dich erstmal und erzähl in Ruhe.“
Köln
Heiner Marquardt saß an demselben Samstagabend mit seiner Tochter und seiner Frau in der Kölner Altstadt in einem kleinen, aber feinen Restaurant. Die Lammkeule war hervorragend gewesen, und sie hatten ihr Besteck nach dem letzten Bissen abgelegt. Nun erzählten sie sich bei der zweiten Flasche Tempranillo, was sie in der letzten Zeit erlebt hatten.
Julia war sein einziges Kind. Sie war schon immer an Physik und Astronomie, ja eigentlich an allen Naturwissenschaften interessiert und hatte ihn so manches Mal mit ihren bohrenden Fragen in Verlegenheit gebracht. Er war froh, wenn er sich dann zumindest ein wenig bei Wikipedia oder auf anderen Internetseiten kundig machen konnte. Aber irgendwann musste er sich und auch ihr eingestehen, dass das nicht mehr reichte. Mit ihren kurzen blonden Haaren, der schlanken Figur, den Sommersprossen rund um die Nase und vor allem ihrer Spontaneität und Ungezwungenheit machte sie alles andere als einen streberhaften Eindruck, aber mit ihrem hervorragenden Abitur konnte sie sich quasi einen Platz für ihr Physikstudium aussuchen. Zusammen mit einer Freundin zog es sie daher vor ein paar Jahren nach Freiburg und sah ihre Eltern nur noch alle paar Monate.
Nun war sie seit einer Woche in Genf und machte ein Praktikum in der wohl berühmtesten Kernforschungsanlage der Welt, dem Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, der Europäischen Organisation für Kernforschung, kurz CERN. Sie war durch ihren Professor an die Stelle gekommen und sollte ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Elementarteilchen vertiefen. Mit ihren 23 Jahren hatte sie ihr Physikstudium in Rekordzeit und sehr guten Noten bereits fast hinter sich. Für ihre Promotion, die sie beabsichtigte wieder in Freiburg zu machen, wollte und durfte sie die Ergebnisse der Arbeit im CERN verwenden.
„Los Julia. Nun erzähl doch mal vom CERN. Ich habe zwar schon ein bißchen davon gehört und gelesen, aber du hast doch bestimmt schon Insiderwissen. Was sind denn da so für Leute? Was musst du denn machen? Läuft da wirklich so ein gruseliges Experiment, bei dem schwarze Löcher erzeugt werden?“
„Nun mach mal langsam,“ lachte Julia. „So viele Fragen kann ich mir doch gar nicht merken. Ich fang mal hinten an. Also, zu diesem Experiment kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass sie am LHC versuchen, neue Teilchen zu entdecken. Und dafür werden nun Protonen mit besonders hohen Energien aufeinander geschossen.“
„Moment. Ich habe zwar davon schon gelesen, aber erklär doch nochmal, was ein LHC ist.“
„Sorry, ich war wieder in meinem Element. LHC steht für ´Large Hadron Collider´, das ist ein unterirdischer Ringtunnel von 26,7 km Länge, in dem durch Magnetfelder Teilchen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und dann aufeinander prallen. Durch den Zusammenstoß entstehen neue Teilchen, die über komplizierte Detektoren analysiert werden. Schonmal davon gehört?“
„Es wird wohl seinen tieferen Sinn haben, dass man so viel Geld für diese Experimente ausgibt.“
„Naja, es ist halt Grundlagenforschung. Irgendwann haben wir so viel Verständnis von der Welt um uns herum, dass wir Dinge tun können, von denen wir heute nur in Science-Fiction-Romanen lesen können.“
Nun schaltete sich Simone, Heiners Frau ein. „Was wäre das denn zum Beispiel? Ich meine, wir haben doch alles zum Leben. Und uns geht es wahrlich gut.“
„Es geht auch nicht um die Lebensgrundlage für heute. Sondern für die Zukunft. Irgendwann müssen wir uns vielleicht nach neuen Lebensräumen umsehen, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Oder sich einfach zu viele Menschen um die knappen Ressourcen streiten. Daher auch die Suche nach anderen Planeten, die der Erde ähnlich sind und vielleicht eines fernen Tages von uns besiedelt werden könnten. Die heißen übrigens Exoplaneten“
„Aber die Entfernung ist doch viel zu groß. Das ist doch alles reine Fantasie.“
„Pass auf. Ein Vergleich. Hol mal dein Telefon raus.“
Sie legte ihr Smartphone auf den Tisch. „Was hat das denn damit zu tun?“
„Ganz einfach. Was wäre, wenn du Deinem Opa gesagt hättest: in 40 Jahren gibt es Telefone, die kein Kabel mehr haben. Es sind mehr oder weniger Glasscheiben mit etwas Elektronik, die in jede Tasche passen. Und zudem gibt es einen weltumspannenden Computer, so möchte ich mal das Internet nennen, der unbegrenzt alle möglichen Informationen zur Verfügung stellt. Und mit dieser Glasscheibe kannst du nicht nur in alle Ecken dieser Welt telefonieren, sondern du kannst auch nachsehen, ob dein Zug Verspätung hat oder wie das Wetter in drei Tagen wird. Was meinst du, hätte er gesagt?“
„Tja, so gesehen hast du allerdings Recht. Er hätte mich für eine Spinnerin gehalten. Aber was hat das nun mit deinen Planeten zu tun?“
„du hast eben selber gesagt, dass diese Welten viel zu weit weg sind. Das stimmt, von unserem jetzigen Standpunkt aus gesehen. Ich erklär´s dir mit einem kleinen Versuch. Nimm mal deine Serviette. Breite sie aus und mach auf die gegenüberliegenden Ecken einen Punkt. Einfach mit dem Rest Sauce. Was ist jetzt die kürzeste Entfernung zwischen den beiden Punkten?“
„Ha, das weiß ich noch. Immer die Gerade. Und da kann ich machen, was ich will. Das wird sich nicht ändern.
„Doch. Und damit sind wir beim Kern der Sache. In der Ebene der Serviette hast du Recht. Aber nun falte sie mal so, dass die beiden Punkte übereinander liegen. Wie groß ist die Entfernung jetzt?“
Schweigen. Simone sah sie lange an. „Du meinst wirklich, dass diese Experimente dazu dienen können, irgendwann sowas mit dem Raum zu machen? Um so diese immensen Entfernungen zu überbrücken?“
Heiner meldete sich zu Wort: „Ich kann mir das schon vorstellen. Überleg doch mal, wie rasant sich die Wissenschaft und unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.“
„Das genau ist es, was ich meine. Aber wiegesagt, davon sind wir noch weit entfernt. Vorstellen können wir uns das mit unseren Sinnen nicht, aber Albert Einstein, Steven Hawking und einige andere sind fest davon überzeugt, dass es irgendwann funktionieren wird. Die theoretische Physik mit ihren mathematischen Modellen beweist uns schon heute, dass es mehr als nur die drei Dimensionen gibt. Oder besser gesagt, die vier, wenn ihr die Zeit mitrechnet.“
Simone war nachdenklich geworden. „Das klingt sehr überzeugend. Und ich habe das letztens irgendwo gelesen. War da nicht ein Artikel in der ZeitschriftAbenteuer Universum?“
„Stimmt,“ pflichtete Julia ihr bei. „Aber ich bin mir nicht sicher, was davon wirkliche Wissenschaft war und inwieweit der Autor seine Fantasie hat mitspielen lassen. Diesen Journalisten kommt es doch ohnehin nur auf die Anzahl der potentiellen Leser an und erst in zweiter Linie auf richtigen Inhalt“, schimpfte sie merklich lauter. Erschrocken blickte sie sich um, aber von den anderen Gästen nahm keiner Notiz davon.
„Das klingt, als ob du schlechte Erfahrung gemacht hast“, forschte Heiner.
„Es wurde zwischendurch doch ziemlich lästig durch diese verdammten Demonstranten, die uns ständig belagern und mit ihrem nicht mal Halbwissen auf die Nerven gehen. Das CERN steht ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit. Aber die Risikobewertung für diese Experimente ist extrem umfangreich und mit den Behörden bis ins Kleinste abgestimmt. Da passiert nichts, was wir nicht ruhigen Gewissens vertreten können. Schließlich sind wir diejenigen, die am nächsten dran sind und die Konsequenzen als erste zu spüren bekommen.“
Ihre Mutter schaltete sich wieder ein: „Die haben da von Parallelwelten geschrieben in dem Artikel. Wobei eine Art Tor sich durch diese Experimente öffnen soll, durch das Menschen verschwinden oder Wesen aus anderen Welten auf die Erde kommen können. Also für mich klingt das wirklich wie Spinnerei.“
„Da wäre ich vorsichtig“, widersprach Julia. „Denk an den Vergleich mit dem Handy. Nicht alles, was du heute für Spinnerei hälst, ist auch wirklich unmöglich.“
Heiner wurde plötzlich heiß. Er sank in seinen Stuhl zurück. Ihm kam ein furchtbarer Gedanke. Sollte er sein Erlebnis von gestern erzählen? Wie würden Julia und Simone reagieren? Hielten sie ihn dann auch für einen Spinner? Aber die Antwort wurde ihm mehr oder weniger abgenommen.
„Was ist mit dir, Schatz“, fragte Simone. „Ist dir nicht gut?“
„Doch doch, alles ok. Ich habe nur gerade überlegt, ob ich euch erzählen soll, was ich gestern vor dem Rückflug in Tegel gesehen habe.“
„Wieso? Was war denn? Nun zier dich nicht. Jetzt hast du uns neugierig gemacht, also raus mit der Sprache“, forderte ihn Julia auf. „Das klingt ziemlich spannend, so wie du gerade aussiehst.“
Heiner war gedanklich aber schon wieder beim letzten Abend. Wie in einem Zeitlupenfilm liefen die Bilder vor seinem inneren Auge ab. Er versuchte, sich an Einzelheiten zu erinnern, aber je angestrengter er nachdachte, desto verschwommener wurde die Erinnerung. War es wirklich keine Spiegelung im Cockpitfenster? Nein, das konnte nicht sein, denn die Maschine war ja in Bewegung, das Licht verharrte aber an einer festen Stelle über dem See. Und die anderen, einschließlich der Kollegen im Tower, hatten es auch gesehen. Die Worte von Julia hallten noch in seinem Kopf:nicht alles, was du heute für Spinnerei hälst, ist auch wirklich unmöglich. Es konnte also gut sein, dass er Zeuge von etwas geworden war, von dem andere Menschen nur träumten.
„Also, ähm, ich war gerade auf dem Weg zur Startbahn, da habe ich über dem Wald am Flughafensee eine Art Lichtsäule bemerkt. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen, aber ihr kennt doch den FilmThor, die Szene, in der er das erste Mal auf die Erde kommt. So ähnlich sah das aus. Nur dass das hier wirklich da war und nicht aus dem Computer kam wie im Film.“
Julia und Simone sahen ihn erschrocken an. Julia fixierte ihn regelrecht und wartete, ob noch mehr kam. „Wem hast du sonst noch davon erzählt?“ fragte sie.
„Erzählt? Alle Passagiere und er Tower haben es auch gesehen. Die offizielle Erklärung war eine nicht genehmigte Lightshow im Wald. Aber ich habe etwas gespürt. Das hat etwas mit mir gemacht. Haltet mich jetzt bitte nicht für verrückt. Es ist wirklich so gewesen. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich daran denke.“ Seinem Gesichtsausdruck nach schien er wirklich sehr mitgenommen zu sein von der Sache.
„Verrückt bist du sicherlich nicht“. Julia blickte gedankenverloren auf ihr fast leeres Glas. „Du warst vielleicht Zeuge eines ganz besonderen Fluges. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Ich frage mich gerade, warum ausgerechnet du etwas gespürt hast und die anderen nicht. Vielleicht war es deine Position im Cockpit und das elektromagnetische Umfeld, was dieses Gefühl bei dir so deutlich hat hervortreten lassen. Aber bitte, das ist eine sehr vage Vermutung.“
Heiner sah sie verunsichert an. „Und was soll ich jetzt machen?“ Was ist, wenn das wieder passiert?“
„Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sich das so schnell und genauso wiederholen wird. Aber eines: wenn ich dich jemals um etwas gebeten haben sollte, vergiss es. Nur lass es allen anderen gegenüber bei der offiziellen Erklärung bewenden.“
Berlin
Marie, Leon und Jonas hatten sich schon lange auf die ersten halbwegs warmen Tage gefreut. Sie hatten gerade ihre Abiturprüfungen hinter sich und hatten allen Grund zum feiern. Sie kannten sich schon seit dem ersten Schuljahr, und alle drei waren so etwas wie Kumpels, die sich alles erzählen konnten. Seit einiger Zeit jedoch entwickelte sich zwischen Marie und Leon etwas mehr als bislang, und Jonas war davon überhaupt nicht begeistert. Dennoch hielten sie zusammen.
An dem heutigen Samstag wollten sie abends am Flughafensee ein Lagerfeuer machen, ein paar leckere Steaks grillen und dann dort übernachten. Warme Schlafsäcke und reichlich Essen und Trinken sollten dafür sorgen, dass ihnen die noch immer empfindlich kühlen Nachte nicht die Laune verdarben.
Am Grillplatz war in dieser Jahreszeit nichts los, und so konnten sie sich die beste Stelle aussuchen. Während die beiden Jungen Holz zusammen trugen, packte Marie das Essen aus. Bald brannte ein kleines Feuer, und auf dem mitgebrachten Grillrost brutzelte das Fleisch. Der Duft ließ ihnen schnell das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Zeit wurde mit ein paar Bier verkürzt, und dann ließen sie es sich schmecken. Allmählich wurde es kühl, und sie holten die Schlafsäcke hervor, um sich warm zu halten. Leon und Jonas erzählten sich Gruselgeschichten, bis es Marie zu viel wurde.
„Hört endlich auf damit. Ich kriege sonst heute Nacht kein Auge zu,“ rief sie. „Mir reicht es schon, wenn ein paar Wildschweine in unsere Nähe kommen.“
Leon und Jonas grinsten sich an. „Keine Sorge“, meinte Leon, rückte näher an sie heran und legte den Arm um sie. „Wir sind doch bei Dir. Wir beschützen Dich. Und außerdem sind diese Viecher doch viel zu scheu. Wenn sie das Feuer sehen, trauen die sich doch eh nicht an uns ran.“
„Ja, und wenn, dann haben wir eben einen leckeren Nachtisch, genau wie Obelix.“ Jonas meinte, damit einen besonders guten Witz gemacht zu haben, aber sie verzog nur abfällig den Mund. Diese Art Humor konnte sie nicht teilen. Mit einem Mal zogen die bis dahin dichten Wolken ab, und der fast volle Mond warf durch die Zweige der Bäume gespenstische Schatten auf den Boden. Die drei betrachteten stumm das Schauspiel.
In diesem Moment raschelte es laut in den Büschen, die zwischen ihnen und dem See lagen. Marie dachte sofort an die Wildschweine.
„Siehste, da sind sie schon. Lasst uns nach Hause fahren“, bat sie. „Ich weiß nicht, ob die schon Junge haben. Und dann sind die doch auch aggressiv.“
„Mädel, nun krieg Dich ein“, versuchte Leon sie zu beruhigen. „Wir rücken denen doch nicht auf die Pelle. Wir lassen die in Ruhe, und die uns. So einfach ist das. Also nimm dir noch ein Bier und gib endlich ....“
Er wurde durch ein lautes Platschen und Rascheln, gefolgt von einem schrillen Quieken, das ihnen allen unter die Haut ging, unterbrochen. Sie hörten ein schleifendes Geräusch, Zweige brechen, als ob etwas Schweres durch die Büsche gezogen wurde, und dann ein leises Knurren. Plötzlich brach eine Rotte Wildschweine aus dem Gebüsch und rannte geradewegs auf sie zu. Die Tiere schienen wie von Sinnen, achteten nicht auf die Umgebung. In kaum zwei Metern Abstand rasten sie am Feuer vorbei.
Bevor die drei es realisierten konnten, war der Spuk vorbei. Sie starrten auf die Stelle, an der sie die Geräusche gehört hatten, konnten aber im flackernden Licht des Feuers nichts erkennen. Vor Angst wagten sie kaum zu atmen, aber es blieb ruhig. Außer dem leisen Rauschen des Windes in den noch kahlen Zweigen der Bäume war nichts zu hören.
Für Marie war das nun endgültig genug. „Lasst uns verschwinden. Sofort!“, flüsterte sie. Sie zitterte, und ihre Stimme versagte fast. „Ich hab Angst. Da ist was im Gebüsch. Die sind ja gerannt, als ob der Teufel hinter ihnen her wäre.“ Sie sah von einem zum anderen, die Augen weit aufgerissen. „Nun sagt doch endlich was!“ Ihre Panik war fast greifbar.
Leon und Jonas sahen sich an. „Ich glaube, Du hast Recht. Aber erst, wenn das Feuer ausgeht“, meinte Leon. Sein Versuch, den Coolen zu spielen, scheiterte kläglich. Das Zittern in seiner Stimme zeigte den anderen beiden nur allzu deutlich, dass auch er sich alles andere als wohl fühlte.
„Nein, jetzt sofort.“ Marie war bereits aufgestanden und packte hektisch ihre Sachen zusammen. Einen Augenblick später saßen sie und Leon auf ihren Fahrrädern und fuhren davon.
„He, wartet auf mich!“ Jonas wollte nicht allein in dieser unheimlichen Umgebung bleiben. Ein leises Rascheln, das sich Richtung See näherte, ließ ihn herumfahren. Er versuchte, neben den flackernden Schatten, die das Feuer warf, etwas zu erkennen. Er sagte sich zu seiner eigenen Beruhigung, dass es wohl nur eine Maus sei, glaubte letztendlich aber doch nicht daran. Das Geräusch wiederholte sich, diesmal aber lauter und ganz offenbar viel näher. Das war ihm nun doch zu viel. In einer aufkommenden Panik schwang sich ebenfalls auf sein Rad und fuhr den anderen beiden hastig hinterher. Das Feuer war ihm total egal.
Berlin
„Und so was am Sonntag morgen. Wir waren gerade so schön beim Frühstücken“. Hauptkommissar Rainer Michels war stinksauer und machte daraus keinen Hehl. Sein Mitarbeiter Dietmar Junghans kannte ihn schon lange genug und wusste mit seinen Launen umzugehen. „Ach komm. Das wird bestimmt nicht lange dauern. Danach kannst Du in Ruhe weiteressen,“ meinte er mit einem Seitenblick auf seinen Chef. Dass dieser ungern eine Mahlzeit ausließ, stand nicht unbedingt im Widerspruch zu seiner Figur. Ansonsten war Rainer schon allein aufgrund seiner Größe von fast zwei Metern eine imposante und Respekt einflößende Persönlichkeit. Fachlich war er unerreichbar, was sicherlich auch seiner fast dreißigjährigen Berufserfahrung zu verdanken war. Aber er hatte wie alle anderen auch seine Macken, und wenn ihm jemand sein Essen streitig machte, sank seine Laune um etliche Zehnerpotenzen ab.
Er parkte den Wagen unmittelbar vor der Schranke am Ende der Straße und achtete nicht auf das Parkverbotsschild. Um diese Zeit waren ohnehin kaum Leute unterwegs, und sie wären ja auch in ein paar Minuten zurück. Rainer zwängte seinen fülligen Körper aus dem Auto und folgte seinem wesentlich sportlicheren Kollegen. Als sie in Richtung See gingen, kam ihnen bereits eine Streifenpolizistin entgegen.
„Guten Morgen, die Herren. Kommen Sie bitte, ich zeige Ihnen, warum wir von dem zuständigen Förster hergerufen wurden.“
Vor den Büschen, die das Seeufer an dieser Stelle säumten, stand ein älterer Herr mit Hund und unterhielt sich mit dem anderen Streifenpolizisten. Als Rainer näher kam, hörte er gerade, wie er zu Protokoll gab: „… wie immer morgens meine Runde mit dem Hund. Sie wissen ja, er braucht seinen Auslauf. Normalerweise ist er ruhig und geht nie weiter als fünf, sechs Meter weit weg. Aber vorhin war das anders. Er blieb erst stehen und rannte dann wie besessen da rein. Und fing an zu bellen. Er ließ sich nicht beruhigen. Naja, und als ich nachgesehen habe, fand ich es.“
Es. Es? Rainer sollte sofort erfahren, was damit gemeint war. Etwa zwei Meter vom Wasser entfernt lag ein Wildschein. Oder vielmehr das, was man mit viel Fantasie einem Wildschwein zuordnen könnte. Der total zerfetzte Kadaver war offenbar auch ein paar Meter weit gezogen worden, wie er an dem rundherum blutverschmierten Gras und den tiefen Spuren auf dem sandigen Boden feststellen konnte.
Zögernd ging er näher heran. Er musste nicht so aufpassen wie bei einem Verbrechen, bei dem Menschen zu Schaden kamen, war aber doch vorsichtig genug, um keine Spuren zu verwischen. Direkt an der Wasserlinie sah er einen Abdruck, einen weiteren, etwas verschwommen, im seichten Wasser. Er stutzte, denn offenbar hatte das Tier drei Zehen, die nach vorne zeigten, und zwei, die nach hinten wiesen. Er kramte in seinen bescheidenen Biologiekenntnissen, welche Art von Tier das gewesen sein könnte, aber ihm fiel nichts Vergleichbares ein. Die ihm bekannten hatten doch alle drei oder vier Finger und nur einen Daumen. Aber so ganz sicher war er sich dann doch nicht.
In dem Moment kam Dietmar triumphierend auf ihn zu und zeigte ihm etwas in einer Tüte.
„Sieh mal. Ich glaube, unser Wildschweinmörder hat uns einen Teil von sich dagelassen.“
Es war ein Zahn. Rainer sah ihn sich genau an. Er war sechs bis sieben Zentimeter lang, leicht gebogen und hatte in der Innenseite des Bogens eine Einkerbung, die längs fast über den ganzen Zahn verlief. Er schien sehr scharf zu sein und gehörte definitiv einem Raubtier, einem großen Raubtier. An der Zahnwurzel waren kleine Reste Zahnfleisch und getrocknetes Blut zu sehen.
„Was war das für ein Vieh?“, fragte er. „Hier, sieh Dir mal diese Spuren an. Hast Du so etwas schon mal gesehen?“
Dietmar folgte mit seinem Blick der Richtung, in die Rainer zeigte. „Er zögerte erst, ging dann aber näher und betrachtete den Abdruck eine ganze Weile. „Nein. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das war. Das ist wirklich komisch. Ich fürchte, da kommen wir allein nicht weiter. Aber geht uns das überhaupt was an?“
„Sag mal, wie lange bist du schon bei der Polizei?“, brauste Rainer auf. „Wir haben es hier mit etwas zu tun, was sich offenbar frei bewegt und verdammt gefährlich ist. Diesmal war es ein Schwein, aber was ist mit den Spaziergängern? Gerade heute am Sonntag. Willst du nachher zurückkommen müssen und eine menschliche Leiche untersuchen? Wir sperren den Bereich ab, bis wir eine Idee haben, was hier los ist. Sag den Kollegen Bescheid. Und ich werde mal rumtelefonieren, wer uns hier weiterhelfen kann.“
Ärgerlich stapfte er in Richtung Auto davon. Das war´s also erstmal mit der Fortsetzung des Frühstücks. Er wollte gerade einsteigen, als ihn jemand ansprach.
„Sind Sie von der Polizei?“, wollte eine ältere Frau wissen. „Vielleicht können Sie mir sagen, was hier los ist.“
Rainer hatte keine Lust, sich mit den Problemchen alter, vereinsamter Leute zu beschäftigen. Die ganze Sache wurmte ihn ohnehin, zumal er keine Idee hatte, wie er schnell aus der Sache heraus kommen konnte.
„Wissen Sie,“ fuhr die Frau fort, „gestern nachmittag ist mein Hund von einem Tier im See gefressen worden. Und nun überlege ich die ganze Zeit, was das sein kann.“
Rainer stutze und drehte sich zu der Frau um. „Was sagen Sie da? Ein Tier hat Ihren Hund gefressen? Hier im See?“
„Ja. Wenn ich es Ihnen doch sage. Ach ja, Entschuldigung. Obermeier ist mein Name, Renate Obermeier. Ich wohne hier gleich ein paar Häuser weiter. Wenn ich Ihnen helfen kann, würde es mir helfen. Ich habe doch so an Alfi, meinem Hund, gehangen.“
„Vielen Dank.“ Rainer bemühte sich, freundlich zu sein. „Aber wir kommen schon klar. Das ist alles nur Routine.“
„Routine? Entschuldigen Sie, aber das glaube ich nicht. Ich kenne mich mit Tieren sehr gut aus, ich bin Biologin. Allerdings seit zwei Jahren im Ruhestand. Wissen Sie, mein Hund ist von einem monströsen Tier gefressen worden. Ich habe es mit ansehen müssen.“ Sie schloss die Augen, um ihre Tränen zu unterdrücken. „Ich habe gestern Abend lange gegrübelt, um herauszufinden, was das gewesen sein könnte. Aber ich bin ziemlich ratlos. Sowas habe ich noch nie gesehen.“
Rainers Interesse stieg schlagartig an. „Sie sind Biologin?“ Er blickte zurück zum See und sah dann eine ganze Weile auf seine Schuhe, die schon lange eine gründliche Reinigung verdient hätten. „Vielleicht können Sie uns doch helfen.“
In dem Moment kam Dietmar zu den beiden. „Guten Tag“, grüßte er höflich. Dann, an Rainer gewandt: „so, wir können jetzt. Ich habe alles veranlasst.“
„Hast Du die Tüte noch?“, fragte ihn Rainer. „Hier ist jemand, der uns vielleicht einen Tipp geben kann. Frau Obermann ist Biologin.“
„Obermeier“, korrigierte sie ihn. „Ja, das stimmt. Und wenn ich das noch erwähnen darf: ich habe noch Beziehungen zur Humboldt Uni.“
Dietmar gab ihr die Tüte mit dem Zahn. Sie betrachtete ihn lange, schüttelte dann langsam den Kopf und sagte: „Tut mir leid. Das kann ich auf die Schnelle nicht zuordnen. Könnte von einem Krokodil sein. Vielleicht hat ein Hobby-Terrarienfreund seinen Liebling nicht mehr unter Kontrolle gehabt und ihn ausgesetzt.“ Sie drehte den Zahn hin und her. Es war ihr regelrecht anzusehen, dass sie in diesen Sekunden ihr gesamtes Wissen durchforstete. „Nein, doch nicht. Dafür ist er zu groß. Und diese Biegung und die Kerbe passen auch nicht.“
„Kennen Sie jemanden, den wir noch fragen könnten?“, wollte Dietmar wissen.
„Nein, so spontan fällt mir niemand ein. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag. Kommen Sie morgen um neun in die Humboldt-Universität. In das Institut für vergleichende Zoologie. Das ist in der Philippstraße. Ich warte dort auf Sie. Heute ist da keiner, aber glauben Sie mir, morgen ist da jemand, den das genauso brennend interessieren wird wie uns.“
„Gut. Dann bis morgen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Drücken Sie uns die Daumen, dass wir herauskriegen, was das war.“
* * *
Kurz vor neun Uhr sah Rainer auf seine Uhr. Er hatte schlecht geschlafen, und der leichte Nieselregen führte auch nicht gerade dazu, dass sich seine Laune merklich besserte. Aber seine Neugier war doch stärker. Was war das für ein Monster? Den ganzen Sonntag musste er daran denken, malte sich alle möglichen Tiere und Untiere aus, die so etwas anrichten konnten. Vielleicht gab es doch eine Art übrig gebliebene Dinosaurier, die im Verborgenen lebten, wie er es schon einmal in schlecht gemachten Filmen gesehen hatte. Aber er verwarf diesen absurden Gedanken schnell wieder, denn wo sollte sich ein solch großes Tier mitten in der Stadt so lange versteckt halten? Außerdem hätte man sicherlich schon viel früher Spuren entdeckt oder ähnliche Situationen wie vorletzte Nacht erlebt. Wie also kommt es, dass dies so plötzlich auftritt? Und dann gleich zwei Mal. Einmal der Hund von Frau Oberdingsda und dann das Wildschwein. Er würde auf jeden Fall seine Kollegen in den benachbarten Bezirken ansprechen, ob sie dazu etwas sagen können.
Er machte die Autotür auf. „Mann, pass doch auf!“, rief ein Radfahrer, den er nicht gesehen hatte, und der sich nur mit einem gekonnten Schlenker vor einer Kollision mit der Tür rettete. Zu Glück war nichts passiert. Was hatte der auch auf der Straße zu fahren, wo es doch mittlerweile so viele Radwege in der Stadt gab, dachte Rainer. Er schloss den Wagen ab und ging zum Eingang. Er war heute allein, Dietmar musste sich noch um einen anderen Fall kümmern. Die Tüte mit dem Zahn hatte er in der Manteltasche. Es fühlte sich komisch an. So ein Ding, so fremdartig, dass bislang keiner eine Antwort darauf wusste, von was für einem Tier das war. Die einzige Expertin bis jetzt war eine pensionierte Biologin, die früher wahrscheinlich nur Kaninchen und Erbsen untersucht hatte. Heute würde er bestimmt jemanden treffen, der wirklich etwas davon verstand.
Renate Obermeier wartete im Eingangsbereich. „Pünktlich wie die Maurer,“ begrüßte sie ihn. „Kommen Sie, wir müssen in die erste Etage. Dort wartet mein ehemaliger Mitarbeiter Dr. Tamm auf uns. Er leitet jetzt das Institut und wird uns so gut es geht helfen. Wir haben hier viele Möglichkeiten und sind technisch auf dem neuesten Stand.“
Rainer sah sie skeptisch von der Seite an. Mitarbeiter, Institutsleiter? Was ist das für eine Frau? Ihn beschlich das Gefühl, dass er sie trotz seiner Menschenkenntnis, die er sich selber zugestand, wohl doch mächtig unterschätzt hatte. Sie strahlte in dieser Umgebung eine gewisse Autorität aus, die für ihn nicht greifbar war. Und er konnte sich mit einem Mal gut vorstellen, dass es sehr unklug wäre, sich bei diesem Thema mit ihr auf eine Meinungsverschiedenheit einzulassen.
Er hatte sichtbar Mühe, der agilen Frau die Treppe hinauf zu folgen. Durch eine Glastür ging es in einen endlos erscheinenden Flur. Aber bereits an der zweiten Tür links hielt sie an. „Dr. Andreas Tamm. Institutsleitung“ stand auf dem Türschild. Sie klopfte und trat ohne abzuwarten ein.
„Hallo Andreas. Hier sind wir. Das ist übrigens ... ach, ich weiß ja noch gar nicht, wie Sie heißen“, sagte sie zu Rainer gewandt.
„Hauptkommissar Rainer Michels“, stellte er sich vor. Er versuchte, eine gewisse Autorität auszustrahlen, indem er seinen Ausweis vorzeigte. Aber so richtig gelang ihm das nicht. Andreas beachtete die Marke nicht einmal und fragte stattdessen: „tja, ich habe gehört, dass ich Ihnen eventuell helfen kann. Ist schon eine merkwürdige Geschichte, die mir Frau Dr. Obermeier vorhin am Telefon erzählt hat. Ich habe auch erfahren, dass Sie etwas gefunden haben. Nun, wenn ich etwas untersuchen soll, müssten Sie mir es schon geben.“
Rainer passte seine Art überhaupt nicht. Was bildete sich dieser Halbgott im weißen Kittel ein? Aber vielleicht waren die alle so, und er musste es einfach akzeptieren. Also kramte er die Tüte aus seiner Tasche. „Hier, das haben wir am, jetzt hätte ich fast Tatort gesagt, gefunden. Offenbar ist das ein großes Tier, das ...“
„Ich weiß“, unterbrach ihn Andreas. „Renate, also Frau Dr. Obermeier, hat es mir bereits gesagt. Zeigen Sie mal her.“ Er griff nach der Tüte, die ihm Rainer herüber reichte. „Hhmm. Ich fürchte, das müssen wir uns genauer ansehen. Darf ich den Zahn hier behalten?“
Die Frage war eigentlich überflüssig, aber Andreas war in dieser Hinsicht Profi genug, um sich ausreichend abzusichern. Er hatte schon in einigen Fällen mit der Polizei zusammengearbeitet. Nur waren das bislang immer nur Kollegen der Mordkommission gewesen. Mit Rainer Michels hatte er bis heute nichts zu tun gehabt.
„Ja, wenn Sie mir das bitte hier quittieren. Sorry für die Formalität, aber Sie kennen das ja vielleicht.“
„Klar. Was sein muss, muss sein“, murmelte Andreas, während er unterschrieb. Er gab Rainer die Quittung und nahm die Tüte. „Wollen Sie mich begleiten oder reicht es Ihnen, wenn wir Sie anrufen, sobald wir etwas herausgefunden haben?“
Rainer hatte vormittags nichts weiter zu tun als langweilige Büroarbeit. Er ließ sich diese willkommene Abwechslung nicht entgehen. „Ich komme mit. Ich habe zwar keine Ahnung von alldem hier, aber ich möchte schon gern wissen, was Sie vorhaben.“
Renate hatte bisher nur zugehört. „Wie willst du anfangen, Andreas?“, fragte sie.
„Am einfachsten ist, erstmal einen Scan zu machen und damit unsere Datenbank zu fragen. Das geht relativ schnell, und wir haben dann zumindest eine grobe Idee, vielleicht aber auch schon die Lösung. Wenn das nichts hilft. machen wir eine Genanalyse. Das wird sicher zu einem Treffer führen.“ Und zu Rainer gewandt: „ist aber deutlich aufwändiger, deshalb fangen wir mit der einfachen Methode an.“
Diese Logik konnte Rainer nachvollziehen. Die Art, wie dieser Doktor ihn behandelte, passte ihm zwar überhaupt nicht. Aber schließlich wollte er etwas von ihm, und so schluckte er seinen Ärger hinunter. Wenn er hier raus war, würde er sich erstmal in Form eines ordentlichen zweiten Frühstücks entschädigen.
Renate nickte. „Ich lass euch dann mal allein. Ich will die Gelegenheit nutzen, den alten Kollegen guten Tag zu sagen. Ich komme nach. Bis später.“
„Kommen Sie.“ Andreas war schon ein paar Meter entfernt auf dem Weg ins Labor. Rainer fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Allein mit diesem arroganten Schnösel. Diese ungewohnte Umgebung, alles sah so modern aus und roch irgendwie nach Wissenschaft. Er wusste zwar nicht, wie Wissenschaft eigentlich riecht, aber in seiner Vorstellung war das eben so.
„So, bitte hier hinein.“ Andreas ging vor und setzte sich vor einen kompliziert aussehenden Apparat. Rainer schlurfte hinterher und sah sich staunend um. Bis auf ein paar Notebooks kannte er keines der vielen Geräte auch nur annähernd. Ein leises Summen und Rauschen war zu hören. Das kommt bestimmt von den Lüftern, sagte sich Rainer. Aber das war auch schon alles, was er sich erklären konnte.
„Ich vermute, hier machen Sie jetzt Ihren Scan“, meinte er.
„Stimmt. Das ist nichts weiter als eine 3D-Aufnahme. Wir tasten das Objekt, also in diesem Fall den Zahn, mit einem Laser ab. Der Computer errechnet ein dreidimensionales Bild, welches wir mit den anderen in unserer Datenbank vergleichen können. Früher musste man das mühsam mit Fotos oder sogar Zeichnungen machen.“
„Nur aus Neugier: wie viele Bilder haben Sie denn hier gespeichert?“
„Genau kann ich es Ihnen nicht sagen, da es täglich mehr werden. Aber es sind wohl einige Zehntausend. Da haben wir guten Chancen, was zu finden.“
Er hatte den Zahn mittlerweile mit einer Pinzette vorsichtig auf einen speziellen Halter, der sich in einem grauen Kasten befand, gesteckt. Dann schloss er den Deckel und tippte einige Informationen in den Computer ein. Schließlich drückte er die Return-Taste. „So, jetzt dauert das eine Weile“, meinte er.
„Und was passiert da jetzt?“, wollte Rainer wissen. Ihn hatte nun die Neugier richtig gepackt.
„Im ersten Schritt wird der Zahn, wie eben schon gesagt, mit einem Laserstrahl abgetastet. Das reflektierte Licht wird über Sensoren erfasst, und am Ende erhält man von dem Punkt die genauen Koordinaten im Raum, also beispielsweise wie weit vorn, rechts und oben er ist. Auf diese Weise errechnet der Computer eine so genannte Punktwolke, die die Oberfläche des Objektes darstellen. Damit wir das dann besser sehen können, folgt dann die Triangulierung, das heißt, die Punkte werden mit Linien verbunden, so dass lauter kleinste Dreiecke entstehen. Für uns sieht das dann wie eine glatte Oberfläche aus.“
„Ah ja.“ Rainer versuchte den Eindruck zu vermitteln, als ob er alles verstanden hätte. „Aber wie der Zahn aussieht, wissen wir doch schon“, meinte er.
„Wir schon, aber nicht der Computer. Er braucht die Daten, um sie mit den anderen in der Datenbank zu vergleichen. Hier.“ Er deutete auf den Bildschirm. „Sehen Sie, wie das Bild entsteht? Es ist gleich fertig.“
Rainer betrachtete stumm, wie rasend schnell ein Punkt nach dem anderen erschien. Dann erstarb das Geräusch aus dem Kasten, und aus den vielen Punkten entstand plötzlich das Bild des Zahns.
Andreas nahm die Maus und bewegte sie hin und her. In gleichem Maß drehte sich das Bild in jede beliebige Richtung. „So, dann wollten wir mal sehen.“
Er rief ein anderes Menü auf und startete die Suche. Bereits nach zwei Sekunden tauchte die Meldung auf: „no match found“.
„So schnell geht das?“ wunderte Rainer sich.
„Ja, mit den neuen Prozessoren kein Problem“, sagte Andreas geistesabwesend. Er war erstaunt, dass es keine Übereinstimmung gab. Das war früher oft so, weil einfach noch nicht so viele Einträge verfügbar waren, mit denen man hätte vergleichen können. Aber das letzte Mal hatte er einen solchen Fall vor fast einem Jahr. Er rief das Menü noch einmal auf, änderte eine Zahl und startete die Suche erneut. Wieder mit dem selben Ergebnis:no match found.
„Das ist sehr merkwürdig. Sind Sie sicher, dass er wirklich vom Flughafensee in Tegel stammt?“ fragte er Rainer.
„Ja, definitiv. Er lag neben einem völlig zerfetzen Wildschwein.“ Bei dem Gedanken daran wurde ihm mulmig. Er sah den Kadaver wieder vor sich liegen. Nach Frühstück war ihm nun nicht mehr zumute.
„Tja, dann bleibt wohl doch nur die Genanalyse. Aber da wollen Sie sicherlich nicht warten, denn das dauert ein paar Tage“, meine Andreas.
Rainer war enttäuscht. Er hatte sich eine schnelle Antwort erhofft und keinen ratlosen Wissenschaftler. Aber zumindest hatten sie hier ja noch ein paar Methoden zur Verfügung, um das Rätsel doch noch zu lösen. Missmutig meinte er zu Andreas: „Sie werden schon wissen, was zu tun ist. Hier ist meine Karte. Wenn Sie etwas herausgefunden haben, Sie wissen schon. Auf Wiedersehen.“ Mit diesen Worten verließ er das Labor.
In diesem Moment kam ihm Renate entgegen. „Und, was gefunden?“ rief sie schon von weitem.
„Nein, nichts vergleichbares. Ihre Datenbank ist wohl doch nicht so vollständig.“ Er wunderte sich über seinen eigenen Sarkasmus und entschuldigte sich dann. „Ähm, ich meine, Ihr Kollege hat auf jeden Fall sein Möglichstes getan. Vielleicht ist es ja doch eine neue Art, die Sie noch nicht registriert haben.“
„Wir werden sehen“, antwortete Renate knapp. „Ich rufe Sie an, wenn wir mehr wissen.“
Genf
Am Sonntag Nachmittag war Julia mit dem Zug zurück nach Genf gefahren. Sie hatte dort für die Zeit ihres Praktikums eine kleine Ferienwohnung in der Avenue de Vaudagne gemietet, knapp zwei Kilometer vom CERN entfernt. Während der gesamten Fahrt ging ihr die Geschichte, die ihr Vater ihr erzählt hatte, nicht aus dem Kopf. Ihre fast unnormale Neugier war geweckt und ließ sie nicht mehr los. Sie beschloss, der Sache nachzugehen, um herauszufinden, wer oder was dahinter steckt.
Früh am Montag verließ sie ihre Wohnung und schwang sich auf ihr Fahrrad. Trotz des Regens letzte Nacht war es recht mild. Alles duftete nach Frühling. Die frische Luft half ihr, nach einer unruhigen Nacht einen klaren Kopf zu bekommen. Nach nicht einmal zehn Minuten erreichte sie gut gelaunt das Gelände des CERN. Mittlerweile fand sie sich in dem Labyrinth von Gebäuden gut zurecht und saß kurz darauf in ihrem Büro, das sie sich mit zwei anderen Praktikanten teilte. Sie nahm sich die Unterlagen von letzter Woche hervor und begann dort weiterzulesen, wo sie aufgehört hatte. Es war ein interner Bericht über die neuesten Versuche am LHC, dem großen Teilchenbeschleuniger. Sie hatte sich mittlerweile einige Fragen dazu notiert und wollte am späten Vormittag Dr. Rolf Bartels, der die Versuche dort leitete und ihr als Ansprechpartner genannt wurde, treffen. Sie kannte ihn bislang nur von ihrem Vorstellungsgespräch und freute sich auf das Treffen, denn er war sehr aufgeschlossen und hilfsbereit, wenn es darum ging, sein Wissen anderen Interessierten weiterzugeben.
Die Zeit verging wie im Flug, und erschrocken blickte sie auf die Uhr. Es war bereits kurz nach elf, und sie musste einmal quer über das Gelände laufen. Kurzentschlossen griff sie zum Telefon. „Hallo Herr Dr. Bartels. Hier ist Julia Marquardt. Wir waren für elf Uhr verabredet.“
„Hallo Frau Marquardt. Ja, das stimmt. Was ist, passt es Ihnen nicht?“, fragte er.
„Doch, schon. Ich habe nur die Zeit vergessen und mache mich jetzt auf den Weg. Ich bin in circa zehn Minuten bei Ihnen. Es dauert auch nicht lange“, versprach sie.
„Kein Problem. Machen Sie ganz in Ruhe. Mir ist hier nicht langweilig, und ich habe mir für Sie Zeit genommen. Mein nächster Termin ist auch erst um drei. Was meinen Sie, sollen wir dann vielleicht noch gemeinsam Mittag essen?“
„Ja, sehr gern. Bis gleich.“ Sie fühlte sich geschmeichelt, denn Dr. Bartels war einer der angesehensten Wissenschaftler beim CERN. Er hatte schon etliche Veröffentlichungen geschrieben und war in allen einschlägigen Fachkreisen bekannt. Sein Spezialgebiet befasste sich mit Parallelwelten und schwarzen Löchern als möglichen Übergängen dazwischen. Durch seine Theorie, die er stückweise immer wieder mit neuen experimentellen Ergebnissen untermauern konnte, sorgte er dafür, dass die Diskussionen um dieses Thema nicht endeten.
Julia packte ihre Unterlagen in eine Mappe, fischte ihre Jacke von der Garderobe und verließ das Büro. Auf den Aufzug wollte sie nicht warten und rannte statt dessen die Treppe hinunter. Es war ihr peinlich, zu spät zu kommen. Sie wusste genau, wohin sie gehen musste. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte sie endlich das Gebäude. Er hatte sein Büro im dritten Stock, aber dummerweise hatte sie vergessen, sich die Raumnummer zu merken. „Egal“, dachte sie. „So groß wird das schon nicht sein.“
Diesmal nahm sie den Fahrstuhl, um nicht völlig außer Atem anzukommen. Oben angekommen wandte sie sich nach rechts und ging in den langen Flur. Ihr Blick wanderte von einem Türschild zum nächsten, aber ein Dr. Bartels war hier nicht zu finden.
Plötzlich öffnete sich die Tür direkt neben ihr. Ein Mann mittleren Alters kam heraus. Er trug einen eleganten dunkelblauen Anzug, sein leicht gewelltes Haar mit den schon ergrauten Schläfen gaben ihm den Eindruck eines erfahrenen Mannes, und seine stahlblauen Augen konnten einen wirklich durchdringen. Julia blieb stehen. Sie blickte kurz an ihm vorbei auf das Namensschild. „Dr. Francois Delandre, Pressesprecher“ stand darauf.
„Kann ich Ihnen weiterhelfen?“ fragte er mit einer angenehmen sonoren Stimme. „Sie sehen so aus, als ob Sie jemanden suchen würden.“
„Äh, ja.“ Sie war sofort fasziniert von diesem Mann. Er hatte etwas, das sie zwar nicht erfassen konnte, das sie aber auf eine unerklärliche Weise anzog. „Ich suche Dr. Bartels. Er betreut mein Praktikum hier, und wir sind verabredet.“
Er musterte sie einen Moment. Vielleicht einen Moment zu lange? „Sie müssen in den anderen Flügel des Gebäudes. Raum 3.12 auf der rechten Seite hinter den Fahrstühlen.“
„Ja, danke vielmals. Das werde ich wohl finden.“ Sie drehte sich um und ging den Gang entlang, ohne sich noch einmal umzusehen. Er sah ihr hinterher. Sie war nur eine von den vielen Praktikantinnen, die hier kurzzeitig arbeiteten, aber irgendetwas sagte ihm, dass sie anders ist als alle anderen. Merkwürdigerweise half ihm sein Bauchgefühl, auf das er sich immer verlassen konnte, diesmal nicht weiter. Einerseits fand er sie ausgesprochen attraktiv, und er vermutete, dass sie auch fachlich einiges auf dem Kasten hatte. Genau das führte jedoch dazu, dass bei ihm eine Warnlampe anging. Ohne genau zu wissen warum, nahm er sich vor, mehr über sie zu erfahren. Gedankenverloren machte er sich auf den Weg zu seinem nächsten Termin.
Auch Julia hatte Mühe, sich zu sortieren und nun auf das Fachgespräch mit Dr. Bartels zu konzentrieren. Dieser Delandre hatte etwas. Aber bevor sie zu sehr ins Grübeln kam, stand sie dann doch vor der richtigen Tür. Sie klopfte und trat nach einem leisen „ja bitte“ ein.
Dr. Bartels saß hinter seinem Schreibtisch. Auf dessen Tischplatte waren nur wenige Quadratzentimeter frei, der Rest war unter Stapeln von Papieren verschwunden. Auf den beiden Monitoren waren komplizierte Grafiken zu sehen. Die Wände waren mit Regalen vollgestellt, die unter der Last der Bücher und Ordner jeden Moment zusammenzubrechen drohten. Julia fragte sich, warum in Zeiten von Laptops und Internet noch so viel Papier notwendig war. Aber sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, denn Dr. Bartels stand auf und bahnte sich einen Weg zu ihr, um ihr die Hand zu schütteln. Er war etwas kleiner als sie und wirkte wegen seiner schmächtigen Figur, der zu groß geratenen Brille und einem einfachen T-Shirt über einer verwaschenen Jeans eher wie ein Musterschüler als ein hochkarätiger Wissenschaftler. Aber Julia wusste, dass Äußerlichkeiten trügerisch sind. Anders als am Telefon war seine Stimme war überraschend kräftig, als er sie mit einem „herzlich willkommen, Frau Marquardt“ begrüßte. „Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten?“
„Ja, gern.“ Julia fragte sich, woher er nun den Kaffee zaubern würde, denn so etwas wie eine Kaffeemaschine konnte sie nirgendwo entdecken. Aber ganz hinten am Fenster hinter einem Topf mit einer halbverwelkten Pflanze hatte er eine kleine Espressomaschine versteckt, und kurze Zeit später roch es in dem kleinen Raum herrlich nach frischem Kaffee.
„Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für mich“, begann Julia. „Ich habe schon einiges über den LHC gelesen und bin gespannt, was ….“
„Wir fangen am besten von vorn an“, unterbrach sie Dr. Bartels. „Und bevor wir in das Thema einsteigen, sollten wir zum Du übergehen. Wir haben hier einen lockeren Umgangston. Ich heiße Rolf.“
„Ok, ich bin Julia. Aber das wissen Sie, äh, weißt du ja schon.“ Es fühlte sich komisch an, diesen Mann zu duzen. Sie wusste aber auch, dass er es absolut ehrlich meinte, und so legte sich das Gefühl recht schnell.
„Also“, begann er, „erzähl mir mal, was du schon von uns und dem LHC weißt. Und dann natürlich, was du eben noch nicht weißt, dich aber besonders interessiert.“ Und nach einer kurzen Pause: „Aber ich muss dir gleich sagen, dass ich nicht alles erzählen kann und darf. Noch nicht.Ita est.“
Julia überlegte einen Moment und kramte in ihren Lateinkenntnissen. Dann fiel es ihr ein:so ist es. Das klang ziemlich unmissverständlich so, dass dazu kein Widerspruch oder jegliche Diskussion geduldet wurde. Später stellte sich dieser Spruch aber nur als eine sehr spezielle Eigenschaft von Rolf heraus.