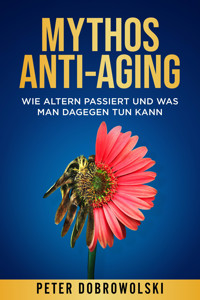
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch beschreibt ausführlich Mechanismen, die mit dem Alterungsprozess in Verbindung stehen. Dabei werden wissenschaftliche Daten präsentiert, die bislang in keinem Sachbuch über Langlebigkeit und Gesundes Altern erwähnt wurden. In der Summe ergibt sich eine völlig neue Sicht auf die primären Ursachen für das Entstehen von Alterskrankheiten, von denen die meisten vermieden werden könnten. Gibt es Langlebigkeitsgene und Langlebigkeitsvitamine? Durch welche vermeidbaren Fehler werden diese Gene ausgeschaltet und wie kann man sie wieder aktivieren? Welche Rolle spielen dabei Mikronährstoffe? Wie lassen sich Reparatur- und Verjüngungsprozesse gezielt einleiten? Was bewirkt in diesem Zusammenhang sportliche Aktivität in unseren Zellen …? Die Antworten auf solche Fragen gibt es in einer allgemein verständlichen Sprache, für jedermann nachvollziehbar und gleichzeitig bei einem Minimum an Fachtermini (welche zudem im Glossar ausführlich erläutert werden).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über den Autor
Peter Dobrowolski ist promovierter Biologe mit der Spezialisierung Genetik und Molekularbiologie. Er ist Mitautor mehrerer Veröffentlichungen in renommierten Fachzeitschriften, darunter einer Publikation im Jahr 2022 in „Nature“, dem weltweit angesehensten wissenschaftlichen Journal.
Beginnend mit der Bakteriengenetik, gefolgt von forensischer DNA-Analytik bis hin zur Genetik von Labortieren für die moderne Grundlagenforschung war das Fachgebiet Genetik ein ständiger Begleiter in seinem gesamten Berufsleben. Vor allem die fast 20-jährige Erfahrung als DNA-Gutachter vor Gericht hat ihm eine ausgezeichnete Ausbildung darin geboten, komplexe Sachverhalte verständlich und anschaulich für fachfremde Personen zu erklären. All diese Kenntnisse ermöglichten es ihm, dieses Buch über den Mythos Anti-Aging und die Wege zum „Gesunden Altern“ für eine breite Leserschaft zu Papier zu bringen.
Gewidmet meinen
Töchtern,
Maria und Anna
Peter Dobrowolski
Mythos Anti-Aging
Wie Altern passiert und was man dagegen tun kann
© 2025 Dr. Peter Dobrowolski
Lektorat von: Susan Naumann
Coverdesign von: Sam via 99designs
Satz & Layout von: Matthias Zabel|Lektorat Freiburg
Covergrafik von: Shutterstock
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“,
Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Inhalt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Das Ticken der Altersuhr
Was ist Altern?
Besser spät als gar nicht
Anders essen
Intuitiver Hunger
Wir sind Gastgeber
Sport hält jung
Stress und Entspannung
Sozialleben
Kapitel 2: Oszillierende Ereignisse
Unser Körper – ein Oszillator
Gesunder Schlaf
Kaffee am Morgen …
… Essen am Abend
Kapitel 3: Das Symphonieorchester
Kapitel 4: Die Kennzeichen des Alterns
Genomische Alterung
Nichtgenomische Alterung
Kommunikationsprobleme
Kapitel 5: Biologisches Alter
„-omics“
Die biologische Uhrmacherwerkstatt
Im Uhrenladen
Kapitel 6: Die Spielregeln kennen
Zuckerspitzen
Ping-Pong der Energielieferanten
Die Schaltzentrale
Die Reparaturprofis
Kapitel 7: Stolperfallen erkennen
Die Gene unserer Vorfahren
Die Triage-Theorie
Die Tücken der Unterversorgung
Fasten, nicht hungern
Was lehrt uns der Seniorenteller?
Altersdefizite
Kapitel 8: Die Spielregeln nutzen
Die Zeitschiene
Theorie trifft Praxis
Der Einstieg
Optimierungspotenzial
Die Steigerung
Frauen und Männer
Kapitel 9: Zellstress in Maßen
Verblüffende Ergebnisse
Neutralisierung von Zellstress
Der Kipppunkt
Regeneration
Fasten im Kontext der Kipppunkte
Ursachenforschung
Kapitel 10: Wie viel ist genug?
Makronährstoffe
Unser Energiemix
Versteckte Reserven
Im Aufbaumodus
Der Seniorenteller, Teil 2
Der alternative Richtwert für gesundes Altern
Kapitel 11: Vortäuschen falscher Tatsachen
Mimetika
Das „Eine Million Moleküle“-Projekt
Kapitel 12: Sternstunden
In der Erklärungskrise
Die Überfunktionstheorie
Prä-Prä-Prä
mTOR und das Mikroskop
Anti-Aging-Medizin
Der „persönliche Lebensbaum“
Ausblick
Kapitel 13: Schlussbetrachtung
Kapitel 14: Interessante Fakten für Wissbegierige
Kapitel 15: Kleines Glossar
Haftungsausschluss
Danksagung
Quellenverzeichnis
Mythos Anti-Aging
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Abbildungsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Mythos Anti-Aging
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Der Einfluss von primärem und sekundärem Altern auf unsere Gesamtlebensspanne
Abbildung 2: Rhythmische, wiederkehrende Abläufe mit unterschiedlicher Schwingungsdauer
Abbildung 3: Bildhafte Darstellung der „Lockenwickler-Technik“ zum Stummschalten von Genen
Abbildung 4: Der Wechsel vom Glycogen- in den Keto-Modus
Abbildung 5: Die Signalkaskade der Aktivierung und Hemmung von mTOR
Abbildung 6: Der Signalweg von der Protein- und Glucosezufuhr zu mTOR
Abbildung 7: U-förmiger Anstieg des Sterblichkeits- und des Krebsrisikos
Abbildung 8: Zusammenfassende Darstellung verschiedener Mechanismen des Entstehens von Alterskrankheiten
Vorwort
„Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden.“ Jonathan Swift
Seit vielen Jahren lasse ich mir zu Weihnachten von meinen Kindern ein Achtsamkeitstagebuch schenken. Das Besondere daran: Zu Beginn eines jeden Jahres fordert es dazu auf, sich über spezielle Fragen intensiv Gedanken zu machen. So fragt es kurzfristige (1 bis 12 Monate), mittelfristige (1 bis 4 Jahre), langfristige (5 bis 10 Jahre) sowie Lebensziele ab und bietet ausreichend Platz, diese schriftlich festzuhalten.
Darüber hinaus möchte das Tagebuch zu Beginn jedes Monats wissen, was die Ziele für den anstehenden Monat sind – unterteilt in die vier Themengruppen Arbeit, Gesundheit, Kontakte, Freizeit; welche besondere Herausforderung erwartet wird und worauf man sich freut. Zum Monatsende gilt es, das in die Tat Umgesetzte und nicht Realisierte zu erfassen.
Mit den anstehenden neuen Monatszielen ist das eigene Leben immer ein wenig nachjustierbar. Für mich persönlich ist es sehr hilfreich, nicht nur zufällig von Zeit zu Zeit, sondern Monat für Monat regelmäßig innezuhalten, mein Leben zu reflektieren und gegebenenfalls Dinge zu korrigieren.
Vor einigen Jahren hatte ich als langfristiges Ziel und auch als Lebensziel notiert, dass ich gesund bleiben und möglichst ohne nennenswerte altersbedingte Gebrechen so fit wie möglich ins Rentnerleben starten möchte. Das ist mir gelungen. Ich bin mittlerweile im Fitnessclub der älteste Squashspieler, wedele immer noch leidenschaftlich gern in den Alpen die winterlichen Berge herunter, und im Sommer gibt es regelmäßig Tagestouren in der Sächsischen Schweiz von bis zu 30 km Länge.
Ich kann mich also in keiner Weise beklagen. Immer mal wieder habe ich mich im Achtsamkeitstagebuch gefragt, womit ich das verdient habe. Ist das einer guten genetischen Konstitution zu verdanken?
Berufsbedingt weiß ich natürlich, dass die Genetik höchstens zu einem Viertel an dieser für mich erfreulichen Situation beteiligt sein dürfte. Den weitaus größeren Anteil daran haben verschiedene Lebensstilfaktoren.
Als Naturwissenschaftler, Biologe und speziell als Genetiker interessiert mich seit dem Studium, wie das alles zusammenhängen könnte – Gesundheit, Genetik und der Einfluss von Faktoren, die auf dem persönlichen Lebensstil basieren. Bei meinen Recherchen bin ich auf eine kurze Liste von Regeln gestoßen, welche mit gesundem Altern und Langlebigkeit zusammenhängen. Damit war der perfekte Ausgangspunkt gefunden, um sich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Anhand von Originalliteratur aus wissenschaftlichen Fachjournalen vervollständigte sich nach und nach das Puzzle rund um das spannende Thema „Gesundes Altern und Langlebigkeit“. Es gibt plausible Erklärungen dafür, auf welche Weise der gesamte menschliche Organismus durch seine Gene reguliert wird, und ebenso, wie man diese Mechanismen gezielt nutzen kann.
Mit der Zeit reifte in mir der Gedanke, diese auch für mich neuen Erkenntnisse in einer populärwissenschaftlichen Form zu Papier zu bringen, um es meinen Kindern, Verwandten und Freunden weiterzugeben. Damit das Verstehen des Fachwissens leichter fällt, habe ich am Ende dieses Buches im Kapitel 15 wichtige Fachbegriffe in Form eines kleinen Glossars zusammengefasst und erläutert.
Ausgehend von dem Gedanken, mein Wissen zu teilen, war es dann nur noch ein kleiner Schritt, darüber nachzudenken, dieses auch einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Für besonders Wissbegierige gibt es ein umfangreiches Literaturverzeichnis, welches zu jedem Themenkomplex einen guten Startpunkt für eigene weiterführende Recherchen liefert.
So ist dieses Buch entstanden …
Kapitel 1 Das Ticken der Altersuhr
Was ist Altern?
Altern – der ultimative Tauschhandel: Man verzichtet auf Spannkraft und ein lückenloses Gedächtnis, bekommt dafür Gelassenheit, Weisheit und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen.
Jeder Mensch besteht aus etwa 30 Billionen Zellen. In jeder dieser Zellen treten Tag für Tag Tausende unterschiedlicher Schäden auf, die von verschiedenen, von der Evolution ins Rennen geschickten Reparaturtrupps wieder beseitigt werden. Leider sind solche Reparaturen auch fehleranfällig, und die Effizienz der Arbeit solcher Reparaturprozesse nimmt mit den Lebensjahrzehnten ab. Die Konsequenz davon ist der unvermeidliche Alterungsprozess, der mit einer kontinuierlichen Anhäufung von Schäden auf zellulärer Ebene einhergeht. Dieser unvermeidliche, genetisch bedingte Mechanismus wird als primäres Altern bezeichnet (1.1).
Die maximale Lebensdauer eines Menschen wird auf etwa 120 Jahre geschätzt. Das primäre Altern führt dazu, dass sich diese Lebensspanne verkürzt. Bei gesunden Menschen durchschnittlich auf 85 bis 95 Jahre, einige Wenige erreichen auch die 100. Die Unterschiede hängen von der genetischen Ausstattung eines jeden Menschen ab, vor allem aber davon, wie robust notwendige Reparaturprozesse im Körper auch noch im fortgeschrittenen Alter funktionieren. Über verschiedene gezielte Maßnahmen zur langfristigen Aufrechterhaltung dieser Robustheit für Reparaturen und zur Minimierung der Fehleranfälligkeit könnte sich ein durchaus praktikabler Weg eröffnen, um beim primären Altern mehrere zusätzliche und zugleich gesunde Lebensjahre „herauszuholen“.
Alterungsprozesse und die damit einhergehende steigende Anfälligkeit für Krankheiten sind hochkomplexe Vorgänge. Um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, nutzt man Zwillingsstudien. Eineiige Zwillinge besitzen identische Gene, da sie aus ein und derselben befruchteten Eizelle hervorgegangen sind.
Sollte einzig und allein die Genetik die treibende Kraft für Gesundheit und Altern darstellen, müssten die Lebenskurven eineiiger Zwillinge ziemlich identisch verlaufen. Ob und in welcher Größenordnung das tatsächlich der Fall ist, kann idealerweise vor allem bei solchen Zwillingspaaren überprüft werden, die sich irgendwann für völlig unterschiedliche Lebensstile entschieden haben. Dabei zeigt sich immer wieder, dass sie im Laufe der Lebensjahrzehnte durchaus verschiedene Gesundheitsmuster entwickeln können. Diese Unterschiede sind dann logischerweise nicht genetisch bedingt, sondern spiegeln vielmehr das Ergebnis der konkreten Lebensweise wider.
Mit solchen Zwillingspaaren wurden verschiedene Studien durchgeführt und ausgewertet. Die daraus gewonnenen Daten weisen darauf hin, dass unsere Gene höchstens zu einem Viertel zur Langlebigkeit beitragen.
Die tatsächlich entscheidenden drei Viertel fußen folglich auf Umweltfaktoren, zu denen ganz allgemein die persönlichen Lebensbedingungen zählen. So kann ein ungesunder Lebensstil die Anfälligkeit für Krankheiten fördern und die jeweilige Lebensuhr erheblich schneller ticken lassen. Ein optimaler Lebensstil dagegen zögert Alterungsprozesse hinaus. Die Gesamtheit all dieser Lebensstilfaktoren stellt die von der Umwelt geprägte Komponente der Lebensdauer eines Menschen dar. Diese wird als sekundäres Altern bezeichnet.
Der mit dem Alterungsprozess einhergehende letzte Lebensabschnitt eines Menschen zeichnet sich durch eine zunehmende Gebrechlichkeit aus. Betrug dieser Zeitraum in den 60er Jahren noch durchschnittlich 5,3 Jahre (1.2), zeigen neuere Berechnungen, dass die Dauer von schlechter Gesundheit verbunden mit funktionellen Beeinträchtigungen in den Jahren von 1990 bis 2017 von 8,9 auf 10,2 Jahre weiter angestiegen ist (1.3).
Nüchtern betrachtet bedeutet das nichts anderes, als dass wir uns die in den vergangenen Jahrzehnten gestiegene Lebenserwartung in unserer Gesellschaft überwiegend durch zusätzliche Jahre voll mit altersbedingten Krankheiten erkauft haben. Die wenigen Glücklichen unter uns sind dagegen bis kurz vor ihrem Tod fit und fidel. Letzteres ist genau das, was sich jeder wünscht: Alt zu werden, ohne alt zu sein. Das ist der Inbegriff für „gesundes Altern“.
Die nachfolgende Grafik stellt den Zusammenhang zwischen der Lebensspanne und dem primären und sekundären Altern bildhaft dar. Sie zeigt gleichfalls, an welchen Stellen sich Möglichkeiten ergeben, positive Veränderungen im Hinblick auf ein gesundes Altern zu bewirken.
Dargestellt ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei einem ungesunden („A“) und einem gesunden Lebensstil („B“). „E“ zeigt die maximale Lebensdauer eines Menschen an. Die waagerechte gestrichelte Linie stellt den Beginn des Lebensabschnitts dar, ab welchem altersbedingte Krankheiten zu einem stetigen körperlichen Verfall führen. Der Wechsel von der Kurve „B“ auf „C“ zeigt das Potenzial zur Verlängerung der gesunden Lebensspanne bei einem gesunden Lebensstil, wenn dieser mit einer optimalen Versorgung an Vitaminen und anderen Mikronährstoffen kombiniert wird. Der Übergang von „C“ zu „D“ ergibt sich über das zielgerichtete Aktivieren von Reparaturprozessen im Körper bis ins hohe Alter hinein, was zu einer Reduzierung der Spanne des primären Alterns führen kann.
Abbildung 1: Der Einfluss von primärem und sekundärem Altern auf unsere Gesamtlebensspanne sowie die erwartbaren Effekte hinsichtlich des Hinauszögerns von altersbedingten Krankheiten und die Minimierung der Zeit der Gebrechlichkeit. (Abbildung nach 1.1 und 1.4)
Besser spät als gar nicht
Welche Erkenntnis haben wir den Veteranen der US-Armee zu verdanken?
Wer hätte vermutet, dass uns Daten von Veteranen der US-Armee tiefgreifende Einsichten in den Zusammenhang zwischen Lebensstil und Lebenserwartung liefern können?
Eine im Jahr 2024 im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichte Studie mit Daten aus dem US-Veteranen-Programm belegt, dass im Wesentlichen acht vom Menschen beeinflussbare Faktoren des Lebensstils dafür verantwortlich sind, gesund alt zu werden und zumindest die in der Abbildung 1 dargestellte Kurve „B“ zu erreichen (1.5).
Diese Faktoren, die „geltenden Spielregeln“ für einen positiven Lebensstil, wurden wie folgt zusammengefasst:
– Reduzierung der täglichen Kalorienzufuhr
– ausgewogene Ernährung mit ausreichend vielen Ballaststoffen
– mäßiger Alkoholkonsum
– Verzicht auf Drogen, Verzicht auf das Rauchen
– gesunder Schlaf
– regelmäßige sportliche Aktivität
– Vermeidung von chronischem Stress sowie eine gute Stressbewältigung
– intensive Pflege von Sozialkontakten
Diese Liste sollte aus meiner Sicht neben der Wahrnehmung regelmäßiger medizinischer Vorsorgeuntersuchungen noch um einen weiteren Faktor ergänzt werden, der mir sehr wichtig erscheint: Es geht darum, ein Leben möglichst im Einklang mit seinem zirkadianen Rhythmus zu führen. Mehr dazu kann man im Kapitel 2 erfahren.
Die Studie mit den Daten von Armeeveteranen ergab, dass die Vernachlässigung eines gesunden Lebenswandels für 90 Prozent der Diabetesfälle verantwortlich ist, 80 Prozent der koronaren Herzkrankheiten, 70 Prozent der kardiovaskulären Todesfälle und 50 Prozent der Todesraten bei Krebs. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jemand mit einem gesunden Lebensstil eine deutlich größere Chance hat, lange und gesund zu leben.
Die Studie bestätigt diese Annahme: Basierend auf den Daten würden 40-jährige Männer, die alle acht dieser Lebensstilfaktoren erfolgreich umsetzen, im Vergleich zu einem absoluten Gesundheitsmuffel ohne eine einzige dieser positiven Angewohnheiten durchschnittlich 24 Jahre länger leben. Das wären 87 Jahre im Vergleich zu 63 Jahren! Bei Frauen lag der Zugewinn an Lebensspanne bei 21 Jahren, ein Lebensalter von 87,5 Jahren verglichen mit 67 Jahren.
Die Studie wies gleichzeitig nach, dass die einzelnen Lebensstilfaktoren nicht in gleichem Ausmaß das biologische Alter eines Körpers beeinflussen. Die größten negativen Auswirkungen hatten eine geringe körperliche Aktivität, Rauchen und Drogenkonsum. Sie sind mit einem um 30 bis 45 Prozent höheren Sterblichkeitsrisiko verbunden.
Mit einem um 20 Prozent erhöhten Sterblichkeitsrisiko wurden schlechte Ernährung, übermäßiger Alkoholkonsum, Stress und eine schlechte Schlafqualität in Verbindung gebracht. Erstaunlicherweise bewirkte schon allein der Mangel an positiven sozialen Beziehungen ein um etwa 5 Prozent erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.
Wohlgemerkt, diese Studie basiert auf der Auswertung von Daten zu den Lebensgewohnheiten bei 276.132 Personen im Alter von 40 bis 99 Jahren im Zeitraum von 2011 bis 2019, von denen 34.247 in diesem Zeitraum verstorben waren. Dank dieser enormen Datenmenge und angesichts der Tatsache, dass nicht nur kranke und alte Personen, sondern durchaus gesunde, fitte junge Menschen in die Studie einbezogen wurden, gelten die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen als durchaus solide.
Die Kernaussage der Studie ist, dass der Mensch für eine optimale Gesundheit nur wenige einflussreiche Parameter im Griff haben sollte, solche, die einen gesunden Lebensstil und Langlebigkeit ausmachen.
Das sind die Spielregeln! Und sie gelten für alle Altersgruppen gleichermaßen.
Man sollte sich vor Augen führen, dass diese wenigen Faktoren einen wesentlich größeren Einfluss auf das vorzeitige Altern oder das „Lange-jung-Bleiben“ haben, als dass man es bei einer suboptimalen Lebensweise über die Zuführung von Medikamenten und irgendwelchen ausgefeilten Zusammensetzungen von Nahrungsergänzungsmitteln jemals wieder wettmachen könnte.
Anders essen
„Du bist, was du isst.“ (Ludwig Feuerbach, deutscher Philosoph)
Die Reduzierung der täglichen Kalorienzufuhr bei einer gleichzeitigen Aufrechterhaltung der benötigten Menge an Mikronährstoffen ist der einzige bislang überzeugende und wissenschaftlich anerkannte Ernährungsansatz mit dem Potenzial, das Altern abzuschwächen und sogar das Leben zu verlängern.
Hierfür gibt es zwei beeindruckende „unfreiwillige Studien“ an großen Bevölkerungsgruppen aus dem letzten Jahrhundert in Europa.
So mussten dänische Männer und Frauen während des Ersten Weltkriegs ihren Lebensmittelkonsum für zwei Jahre reduzieren. Sie konnten diesen aber glücklicherweise mit einem ausgewogenen und ausreichenden Konsum von Vollkorngetreide, Gemüse und Milch umsetzen. Das Ergebnis war ein Absinken der Sterblichkeitsrate um 34 Prozent im Vergleich zur Vorkriegszeit (1.6).
Die Einwohner von Oslo waren während des Zweiten Weltkriegs für etwa vier Jahre gezwungen, ihre Nahrungszufuhr um ca. 20 Prozent zu reduzieren, ohne dass es dabei zu einer Mangelernährung gekommen wäre. Sie konsumierten während dieser Zeit ausreichende Mengen an frischem Gemüse, Kartoffeln, Fisch und Vollkorngetreide. Das Ergebnis war eine beeindruckende, um 30 Prozent niedrigere Sterblichkeitsrate bei Männern und bei Frauen, verglichen mit dem Vorkriegsniveau (1.7).
Da man zu dieser Zeit noch nicht über die erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse und Nachweismöglichkeiten verfügte, konnten die molekularen Ursachen für diese erstaunlichen Effekte nicht näher untersucht werden. Vermutet wurde jedoch, dass die reduzierte Kalorienzufuhr zu einer geringeren Häufigkeit von Krebsdiagnosen geführt hatte.
Ein drittes Langzeitexperiment praktizierten die Einwohner der Insel Okinawa im Süden Japans. Im Vergleich zur japanischen Gesamtbevölkerung gibt es dort einen fünfmal höheren Anteil an Hundertjährigen und ebenso ein geringeres Aufkommen an altersbedingten Krankheiten.
Zurückgeführt wird das vor allem auf die Okinawa-Diät, welche die traditionellen Mahlzeiten in dieser Region beschreibt: Sie ist kalorien- und fettarm, mit einem hohen Anteil an Kohlenhydraten im Vergleich zur Aufnahme von Proteinen. Hinzu kommen große Mengen an Polyphenolen und anderen pflanzlichen Nährstoffen. Die Okinawa-Diät beinhaltet Süßkartoffeln als Hauptquelle für Kohlenhydrate, Miso-Suppe, Algen, Tofu, viel Gemüse und Hülsenfrüchte, grünen Tee, ebenso geringe Mengen an rotem Fleisch, Fisch, Nudeln, gelegentlich auch Alkohol.
In den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg, mit der immer stärkeren Zuwendung zum westlichen Ernährungsstil, vorgelebt durch die dort stationierten US-Soldaten und die neu entstandenen Fast-Food-Ketten, verschwindet dieser Effekt jedoch allmählich.
Wie kann man eine ausgewogene, lebensverlängernde, gesunde Ernährung auf den Punkt bringen?
Dazu muss man nicht unbedingt zurück in die Steinzeit und auf „Paläo“ setzen.
Es reicht schon völlig aus, sich an der Ernährung unserer Vorfahren vor 80 bis 100 Jahren zu orientieren: Sie kannten keine hochverarbeiteten Fertiggerichte, kaum chemisch hergestellte Konservierungs- und Zusatzstoffe. Das Essen aus saisonal verfügbaren Originalprodukten wurde selbst zubereitet. Da Fleisch meist nur am Sonntag auf den Tisch kam, wurde neben Kartoffeln viel Obst und Gemüse gegessen, damals noch flächendeckend in Bio-Qualität, regional erzeugt und an die Jahreszeit angepasst. Also eine saisonal bedingt abwechslungsreiche Küche, viele Ballaststoffe und wenig rotes Fleisch. Weizen war im Unterschied zu Roggen und Hafer für viele unerschwinglich. Es gab regelmäßige, feste Essenszeiten und zwischendurch eher selten kleine Snacks.
Selbst mit dem Wissen um solche Zusammenhänge ist eine dauerhafte Kalorienreduzierung in unserer Zeit schwierig umsetzbar und durchaus auch mit gewissen gesundheitlichen Risiken verbunden. Es besteht die reale Gefahr für eine geringere Ernährungsvielfalt, was wiederum ein höheres Risiko für einen Mangel an Vitaminen und anderen essenziellen Nährstoffen zur Folge haben kann.
Aus diesem Grund hat man in den vergangenen Jahren verschiedene Alternativen ausgiebig erforscht. Diese sollen im Vergleich zur dauerhaften Kalorienreduzierung nach Möglichkeit ähnliche gesundheitliche Vorteile aufweisen, gleichzeitig aber viele der potenziellen Nebenwirkungen vermeiden helfen.
Dabei muss an dieser Stelle ausdrücklich darauf verwiesen werden, dass solche Ernährungsalternativen keine Abnehmdiät im eigentlichen Sinne darstellen. Es geht vordergründig um gesundes Altern. Allerdings ist die in diesem Zusammenhang häufig beobachtete Gewichtsreduzierung ein durchaus erfreulicher Nebeneffekt, der sich sozusagen ganz nebenbei mit einstellt.
Von welchen Formen der Nahrungsaufnahme sprechen wir?
Erfolg versprechen alle Formen des intermittierenden Fastens, bei denen man seine Nahrung nur in einem vorgegebenen Zeitfenster zu sich nimmt. Was man isst, spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Hauptsächlich gesund, vielfältig und ausgewogen. Aber es darf durchaus ab und zu auch mal ein Stück Kuchen oder Schokolade mit dabei sein.
Die größte Herausforderung bei einer Ernährungsmethode als Strategie für gesundes Altern besteht tatsächlich darin, einen solchen Stil nach Möglichkeit über viele Jahre hinweg kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Das Essen möchte und sollte man schließlich als solches auch genießen dürfen. Langfristig fährt man daher mit einem Ernährungsstil am besten, den man nicht nur zeitlich gut mit Beruf und Familie vereinbaren kann, sondern der einem vor allem genussmäßig liegt. Das ist die beste Voraussetzung dafür, dass man diesen persönlich lange beibehalten kann. Der Vorteil: Es ist dabei völlig unerheblich, ob man eine gemischte, vegetarische, vegane oder doch eine eher fleischlastige Ernährung bevorzugt.
Intuitiver Hunger
Heißhungerattacken während der Schwangerschaft sind intuitives Essen.
Während einer Schwangerschaft passieren manchmal seltsame Dinge. Zum Beispiel Heißhungerattacken! Diese zielen häufig auf Nahrungsmittel ab, welche die Schwangere vorher eher gemieden hat, und das auch noch in teilweise ungewöhnlichen Kombinationen: saurer Hering mit Marmelade oder saure Gurken mit Nutella.
Wieso passiert so etwas ausgerechnet während der Schwangerschaft?
Die Hauptursache dafür ist natürlich die hormonelle Umstellung, die mit einer Schwangerschaft einhergeht. Es wird mehr Insulin produziert als vorher, der Blutzuckerspiegel fällt schneller ab, Hungerattacken nehmen daher zu, der Geruchs- und Geschmackssinn verändert sich ebenfalls.
Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt: Der Körper einer Schwangeren ist bestrebt, den neuen Erdenbürger bestmöglich mit allen benötigten Substanzen und Nährstoffen zu versorgen. Dafür opfert die Frau unter Umständen ihre eigenen Reserven, bis hin zu einer zeitweiligen Unterversorgung. Alles für das Wohl des Ungeborenen. Damit es gesund zur Welt kommen möge.
Was aber, wenn der Körper der Schwangeren gar nicht mehr über die dringend benötigten Reserven verfügt? Beispielsweise, weil sie vor der Schwangerschaft bestimmte Lebensmittel nicht besonders mochte?
Dann macht sich eine Form des „intuitiven Essens“ mit einer teilweise aus dem Rahmen fallenden Kombination von Lebensmitteln bemerkbar.
Der Körper kommuniziert mit uns. Eine Vegetarierin verspürt plötzlich Appetit auf Fleisch. Damit wird signalisiert: Es fehlt Eisen. Schokolade enthält neben den Kalorien auch viel Magnesium, sauer eingelegte Lebensmittel besitzen viel Vitamin C, Hering wiederum viel Omega-3-Fettsäuren.
Natürlich wissen schwangere Frauen nicht bewusst, welche wichtige Substanz konkret fehlt. Folglich können sie ebenso wenig wissen, welches Nahrungsmittel für sie im Moment besonders geeignet sein könnte. Aber der Körper scheint das intuitiv zu wissen! Er startet entsprechend eine Heißhungerattacke mit originellen Lebensmittelkombinationen.
Man könnte dieses Phänomen des Heißhungers als „intuitives Hungersignal“ nach einer ganz bestimmten lebensnotwendigen Substanz beschreiben. Es weist darauf hin: Hier wird aktuell etwas Spezielles benötigt.
Offenbar gibt es in uns ein genetisches Programm, welches eine Mangelsituation erkennen kann, noch bevor eine für die Gesundheit kritische Stufe erreicht wird. Intuitiv werden dann Lebensmittel ausgewählt, die dieses Problem effektiv lösen.
Woher wir so eine ererbte Fähigkeit haben, bleibt ein großes Mysterium.
Dieses genetische Programm des „intuitiven Hungers“ scheint aber nicht nur während der Schwangerschaft zu funktionieren. Unterschwellig ist es möglicherweise immer in uns aktiv. Wir bemerken es jedoch nicht bewusst, da dieses Phänomen im Normalfall vielleicht weniger stark ausgeprägt ist als während einer Schwangerschaft.
Die Existenz eines solchen intuitiven Hungersignals in Bezug auf bestimmte fehlende Mikronährstoffe, kombiniert mit unserem westlich geprägten Ernährungsstil, könnte vielleicht eine schlüssige Erklärung für den stetig steigenden Anteil an übergewichtigen Personen, an Typ-II-Diabetes und anderen metabolischen Krankheiten in unserer Gesellschaft liefern. Am Gesundheitswesen kann es schließlich nicht liegen. Denn diesbezüglich sind unsere jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben, gleich nach den USA, weltweit mit am höchsten. Ärmere Länder dagegen haben oftmals eine gesündere Bevölkerung.
Man stelle sich folgende hypothetische Situation vor: Unser Körper erkennt intuitiv eine problematische Situation, die zum Beispiel mit 100 g Haselnüssen gelöst werden könnte. Nun hat man verschiedene Möglichkeiten, diese zu konsumieren. Entweder in Form von Nüssen pur, oder aber zum Beispiel mit Schokolade. Aber um dabei auf die erforderliche Menge an Haselnüssen zu kommen, müsste man 10 Tafeln Vollmilch-Nuss-Schokolade essen.
Natürlich wäre man theoretisch im Hinblick auf die verkonsumierten Kalorien schon nach 5 bis 6 Tafeln Schokolade satt. Aber der „intuitive Hunger nach Haselnüssen“ ist damit eben noch nicht befriedigt. Er fordert kategorisch, die anvisierte Gesamtmenge abzuliefern. Was man dann auch tut. Man isst also weiter. Im Ergebnis hat der Körper dann endlich die 100 g Nüsse erhalten, jedoch parallel dazu eine viel zu große Menge an überschüssigen Kalorien.
Was ist die Moral dieser Geschichte?
Die Vollmilch-Nuss-Schokolade, das sind unsere hochverarbeiteten Lebensmittel, Junk-Food, von denen jeder weiß, dass ihr übermäßiger Konsum nicht gut für unsere Gesundheit ist. Viel ungesundes Fett, viel Zucker, viel Salz, dafür umso weniger Ballaststoffe, Vitamine und Mikronährstoffe. Diese für uns wichtigen Substanzen werden während der vielen Verarbeitungsschritte bis hin zum fertigen Produkt oftmals entweder zerstört oder stark ausgedünnt.
Bei solchen hochverarbeiteten Lebensmitteln muss man logischerweise große Mengen an überzähligen Kalorien konsumieren, um den unterschwellig agierenden „intuitiven Hunger“ nach Mikronährstoffen zu besänftigen. Das ist auch der Grund, weshalb man von Junk-Food nicht so schnell satt wird, obwohl man mehr als ausreichend Kalorien zugeführt hat.
Völlig anders stellt sich das bei gesunden, nährstoff- und ballaststoffreichen Nahrungsmitteln dar. Hier kommen die vom Körper angeforderten Substanzen in einer wesentlich höheren Konzentration vor, 10-fach, manchmal sogar bis zu 100-fach. Um satt zu werden, benötigt man daher entsprechend weniger! Das ist der einfachste Weg, um dauerhaft die Menge an aufgenommenen Kalorien zu reduzieren.
Der Verzehr von Burgern, fettigen Pommes, Ketchup mit erstaunlichen Mengen an verstecktem Zucker, Snacks mit hohem Salz- und Fettgehalt, Kekse – all das in Kombination mit zu geringer körperlicher Aktivität: Hier erkennen wir die Treiber für Übergewicht, Typ-II-Diabetes und andere stoffwechselbedingte Erkrankungen. Diese wurden ursprünglich dem Alterungsprozess zugeschriebenen, sind allerdings heutzutage zunehmend auch bereits bei jüngeren Personen zu beobachten. Lieferdienste, welche auf Bestellung Fertigprodukte bis vor die Wohnungstür bringen, befeuern zusätzlich einen Trend nach Bequemlichkeit, die man sich als reiches Land leistet. Mit den entsprechenden negativen Konsequenzen.
Nährstoffdichte: Das ist der Fachbegriff, der den dargestellten Sachverhalt beschreibt. Sie ist niedrig bei hochverarbeiteten Produkten, wesentlich günstiger bei gesunden Lebensmitteln, optimal bei solchen in Bio-Qualität. Es ist zum Verzweifeln: Man hat sich monatelang durch eine entbehrungsreiche Diät gequält und erlebt anschließend immer wieder einen Jo-Jo-Effekt. Das passiert definitiv immer dann, wenn man zu den alten, ungesunden Essgewohnheiten zurückkehrt, also zu hochverarbeiteten Lebensmitteln. Dann tritt die primäre Ursache des Übergewichts wieder auf den Essensplan – Nahrungsmittel mit viel Kohlenhydraten, Zucker und Fett, dafür aber relativ wenig Ballaststoffe, Vitamine und Nährstoffe. Die Chance auf ein Ausbleiben eines solchen Jo-Jo-Effekts ist dann gegeben, wenn man im Ergebnis einer Diät seine Ernährung auf Lebensmittel mit hoher Nährstoffdichte umstellt.
Sein Gewicht zu halten und den unterschwellig aktiven „intuitiven Hunger“ erfolgreich zu bedienen, das funktioniert langfristig nur in Kombination mit „Anders essen“! So, wie es im vorherigen Abschnitt des Buches angeklungen ist. Das bedeutet auf keinen Fall, dass man sich damit zukünftig mit einem permanenten Hungergefühl anfreunden muss. Im Gegenteil, erstaunlicherweise wird man mit weniger genauso satt. Seine Ernährung bewusst auf Produkte mit hoher Nährstoffdichte umstellen, das allein dürfte schon bei den meisten Menschen ausreichen.
Wir sind Gastgeber
Unser privates Ökosystem
Würde sich der Mensch ausschließlich über die Anzahl seiner Zellen definieren, dann wären wir eine Minderheit im eigenen Körper. Denn relativ zur Anzahl an eigenen Körperzellen sind wir gleichzeitig auch Gastgeber für ungefähr die 1,3-fache Anzahl an Bakterien! Wir werden von fünfhundert bis eintausend unterschiedlichen Bakterienarten bewohnt. Hinzu kommen die als Bakteriophagen bezeichneten Bakterien fressenden Viren und Mikropilze. Schätzungen gehen davon aus, dass wir ungefähr 400 Billionen Phagenpartikel in uns beherbergen, was angesichts der 30 Billionen Körperzellen eine beachtliche Größenordnung darstellt.
Das bedeutet nichts anderes, als dass wir in uns und auf uns ein gewaltiges Ökosystem beheimaten, mit den vielfältigsten Verflechtungen der einzelnen Arten untereinander. Dieses wird gemeinhin als Mikrobiom bezeichnet. Und jeder einzelne Mensch auf unserem Planeten besitzt sein individuelles, einmaliges Ökosystem!
Hierbei steht das Darm-Mikrobiom im direkten Zusammenhang mit unserer Nahrung und den aufgenommenen Nähr- und Ballaststoffen.
Sind diese Bakterien für uns gefährlich?
Nein, normalerweise nicht. Im Gegenteil. Sie sind absolut unerlässlich für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit. Denn für beide Seiten ergibt sich eine erfreuliche Win-win-Situation. Wir stellen dem Darm-Mikrobiom eine konstante Umgebungstemperatur zur Verfügung, mit dem Ausblick auf einen ziemlich kontinuierlichen Nachschub an Nahrung.
Sie bedanken sich im Gegenzug auf vielfältige Art und Weise. Die Mikroben liefern wichtige Nährstoffe und Vitamine, die sie aus unserer Nahrung aufnehmen und solcherart umwandeln, dass sie dadurch erst für uns verfügbar werden.
Es ist unsere körpereigene Pharmafabrik mit Milliarden von Mitarbeitern. Man nimmt an, dass die Darmflora für die Produktion oder Modifikation von bis zu 100 Metaboliten verantwortlich ist, die im Blutplasma des Menschen zirkulieren. Darüber hinaus hält das Mikrobiom schlechte Bakterien und Krankheitserreger in Schach.
Die Forschung hat in den letzten Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass unser Mikrobiom im Darm intensiv mit dem Körper des Wirtes kommuniziert, also mit uns. Wir nehmen das nur nicht bewusst zur Kenntnis. Diese Kommunikation stellt einen überaus wichtigen Schlüsselfaktor für zahlreiche physiologische Prozesse dar. Dabei werden immer neue erstaunliche Effekte aufgedeckt, wie der Mensch von seinen winzigen Mitbewohnern profitiert.
Dabei ist unser Darm nicht nur für die Aufnahme und Umwandlung von Nährstoffen zuständig, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen. Er ist ebenso für etwa 80 Prozent unserer Immunreaktionen verantwortlich. Das Mikrobiom sendet Signale an das periphere und zentrale Nervensystem, ebenso an andere Organe, und spielt für uns Menschen eine zentrale Rolle bei der generellen Aufrechterhaltung unserer Gesundheit. So konnte eine Verbindung zwischen Mikrobiom und unserem Gehirn nachgewiesen werden, die Kommunikation über die sogenannte Darm-Hirn-Achse.
Man kann unser Darm-Mikrobiom also durchaus als eine Art zusätzliches „Hilfsorgan“ betrachten. Und dieses soll natürlich nach Möglichkeit lange gesund bleiben.
Äußere Einflüsse wie Stress, bestimmte Medikamente oder eine unausgewogene Ernährung beeinflussen die Zusammensetzung unserer Darmflora in negativer Weise, mit entsprechenden Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Wer kennt nicht den Spruch, wonach schlechte Nachrichten auf den Magen schlagen oder extreme Prüfungsangst manchmal mit einem häufigen Gang zur Toilette verbunden ist? Das ist die Art und Weise, wie unser Mikrobiom auf solche akuten Stressfaktoren reagiert.
Ein gestörtes Mikrobiom-Ökosystem steht im Verdacht, der Auslöser für verschiedene Krankheiten zu sein. Dazu gehören Diabetes, Fettsucht, psychische Erkrankungen, Allergien, Autoimmun- sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese Liste wird von Jahr zu Jahr immer länger (1.8).
Wir sollten folglich diese für uns so nützlichen Bakterien bestmöglich und liebevoll umsorgen. Wie kann man das bewerkstelligen? Am liebsten mögen sie Ballaststoffe! Wenn man also eine ballaststoffreiche Ernährung predigt, so hat das weniger mit einem geschmeidigen Stuhlgang zu tun als mit der Hege und Pflege unseres riesigen Ökosystems im Darm, damit dieses möglichst lange im optimalen Gleichgewicht verbleiben kann.
Wer sich unausgewogen und ungesund ernährt, mit vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln, und gleichzeitig wenig Ballaststoffe in Form von Obst und Gemüse zu sich nimmt, stört die Zusammensetzung dieses Ökosystem empfindlich. Mit Junk-Food sorgt man also für eine Art Monokultur im Darm. Das Mikrobiom ist dann einfach nicht mehr ausreichend anpassungsfähig. Das erhöht letztendlich die Anfälligkeit für Krankheiten und beschleunigt zudem das biologische Altern.
Übrigens: Der Einsatz von Antibiotika ist eine Art Supergau für unser Darm-Mikrobiom, da diese Wirkstoffe ziemlich wahllos töten. Natürlich die anvisierten Krankheitserreger. Aber auch alle anderen, für uns nützlichen Bakterien.
Umso mehr sollte man sich anschließend bewusst und zielgerichtet um die Wiederansiedlung unserer gesunden Untermieter kümmern. So wie ein umsichtiger Gärtner, der im Frühling seine Beete neu bepflanzt. Das gelingt am besten mit fermentierten Lebensmitteln, die Lebendkulturen enthalten. Dazu zählen beispielsweise Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kombucha oder Kimchi. Hierbei sind Eltern in einer besonderen Pflicht, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder nach jeder Antibiotikabehandlung schnellstmöglich wieder ein gesundes Mikrobiom aufbauen können!
Sport hält jung
An dem Tag, an dem du läufst, wirst du nicht älter. (Sprichwort aus Deutschland)
Innerhalb des ganzheitlichen Konzepts des gesunden Alterns ist die körperliche Aktivität unter den Verhaltens- und Lebensstilfaktoren der mit großem Abstand wichtigste. Genau deshalb sollte uns Sorge bereiten, dass bereits unsere Jugend zunehmend inaktiver wird. Einer Studie der WHO aus 2016 zufolge wird der Anteil unter Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren mit unzureichender körperlicher Aktivität für beide Geschlechter zusammen auf 82 Prozent geschätzt, bei Männern auf 77,5 Prozent, bei Frauen sogar auf 87 Prozent (1.9). Dieser Anteil dürfte sich seither nicht wesentlich verändert haben.
Dabei gilt die körperliche Betätigung als zuverlässiger Schutzfaktor vor vielen altersbedingten Krankheiten, wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Problemen, Schlaganfall, Typ-II-Diabetes, Adipositas und Übergewicht. Ja, selbst das Risiko des Auftretens von Brust- und Dickdarmkrebs kann dadurch merklich verringert werden.
Weshalb hat körperliche Aktivität so einen hohen Stellenwert?
Damit sich eine Muskelfaser zusammenziehen kann, benötigt sie einen Nervenimpuls, der das entsprechende Kommando dafür gibt. Sportliche Aktivität ist damit zunächst einmal nichts anderes als das Synchronisieren von Signalen aus unserem Gehirn mit den betreffenden Muskeln. Je abwechslungsreicher die körperliche Betätigung ist, desto mehr verschiedene Muskelpartien werden trainiert und mit den dort befindlichen Nervenenden harmonisiert. Je schneller und intensiver wir dabei agieren, desto mehr wird auch unser Gehirn gefordert. Während wir trainieren, strapazieren wir also nicht nur unsere Muskulatur, es erfolgt gleichzeitig ein permanentes Gehirnjogging! Das ist die eigentliche wichtige Botschaft und der optimale Weg, um unser Gehirn möglichst lange leistungsfähig zu halten. Das angestrebte Muskelwachstum erfolgt nämlich erst nach dem Sport, während der Erholungs- und Regenerationsphase. Dazu gibt es im Kapitel 9 „Zellstress in Maßen“ noch einige weitergehende Ausführungen.
Man hat also recht gute Chancen, dank regelmäßiger Bewegung und sportlicher Betätigung auch noch im hohen Alter körperlich und geistig fit zu sein.
Eine britische Studie aus dem Jahr 2019 mit 475.000 Teilnehmern hat gezeigt, dass die normale Gehgeschwindigkeit, mit der sich ein Mensch bewegt, mit seinem biologischen Alter und seiner erwarteten Restlebensspanne deutlich korreliert. Je schneller man unbewusst in seiner Wohlfühlgeschwindigkeit unterwegs ist, desto besser (1.10).
Das Erfreuliche dabei: Die Forscher fanden heraus, dass das Körpergewicht bei diesem Effekt überhaupt keine Rolle spielt! Es geht schließlich zunächst erst einmal vor allem um Gehirnjogging. Personen, die zügig unterwegs waren, hatten eine längere Lebenserwartung über alle BMI-Kategorien hinweg (BMI – Body-Mass-Index) (1.10).
Die Autoren glauben, dass die selbst eingeschätzte Gehgeschwindigkeit – langsam, durchschnittlich, zügig – in Kombination mit Angaben zur Muskelkraft die Lebenserwartung genauer vorhersagen kann als so manche teure Messmethode. Eine weitere gute Nachricht ist: Diese Dinge können von jeder Person in jeder Altersgruppe durch regelmäßige körperliche Betätigung aufrechterhalten und sogar nach und nach gesteigert werden. Irgendwann wird man erstaunt feststellen, dass wie von selbst das persönliche Tempo beim Spazierengehen ein wenig zugenommen hat.
Die britische Studie ist vor allem auch deshalb bemerkenswert, weil sie zeigt, dass das einfache Zufußgehen eine durchaus praktikable Maßnahme zur Verlängerung der gesunden Lebensspanne darstellt. Das ist vor allem für übergewichtige Personen interessant, die ein intensives Training nicht gut vertragen. Damit werden andere Risikofaktoren für kardiovaskuläre Krankheiten in gewisser Weise ausgeglichen.
„Mollig, dafür aber mobil“, könnte die selbstbewusst geäußerte Devise von Betroffenen lauten.
Die regelmäßige körperliche Aktivität sollte sich aber nach Möglichkeit nicht nur auf das Spazierengehen beschränken. Zwei unterschiedliche Faktoren spielen für die körperliche Fitness eine Rolle – die Ausdauer und eine gewisse Muskelmasse.
Einerseits geht es um die Steigerung der Ausdauer durch Laufen, Nordic Walking oder schnelles Gehen. Und zwar mit einer Intensität, die zu einem erhöhten Puls und einer beschleunigten Atmung führt. Andererseits ist auch gelegentliche intensive körperliche Anstrengung erforderlich, ein Work-out, ein Krafttraining oder etwa Liegestütze, damit Muskeln aufgebaut werden. Letzteres sollte idealerweise bereits in jungen Jahren geschehen, denn eine gesunde, strapazierfähige Muskulatur ist essenziell für das gesunde Altern. Welche molekularen Mechanismen durch den Wechsel zwischen Ausdauer- und intensivem Training in unseren Zellen aktiviert werden und worauf man dabei achten sollte, das wird in den Kapiteln 9 und 10 ausführlicher beleuchtet.
Die altersbedingte Abnahme der Muskelmasse und Muskelkraft ist mit einem Rückgang der körperlichen Fitness verbunden. Das führt zu den bekannten Folgen, wie eingeschränkter Mobilität oder erhöhtem Sturzrisiko, und letztendlich zu einer verminderten Lebensqualität. Es gibt Hinweise darauf, dass ungefähr ab dem vierzigsten Lebensjahr die Muskulatur abzunehmen beginnt, jährlich um ungefähr ein Prozent. Das wird schließlich ab dem sechsten Lebensjahrzehnt zunehmend sichtbar. Ab diesem Alter ist es extrem schwierig, noch Muskelmasse aufzubauen. Man zehrt von den Reserven aus jungen Jahren. Das Niveau der körperlichen Fitness im mittleren Alter kann also die körperliche Leistungsfähigkeit im späteren Leben recht gut vorhersagen. Daher wird der vor allem bei unseren jungen Erwachsenen so populäre Besuch von Fitnessstudios zweifellos zu positiven Langzeiteffekten ab 50 führen, sofern sie es nicht übertreiben.
Die Ergebnisse verschiedener Studien deuten zudem darauf hin, dass körperliche Aktivität mit einem geringeren Risiko für 13 verschiedene Arten von Krebs einhergeht (1.11). Darüber hinaus soll Bewegung das Risiko für das erneute Auftreten und Fortschreiten von Krebs bei bestimmten Tumoren verringern (1.12).
Aber damit nicht genug: Einige wissenschaftliche Daten weisen darauf hin, dass körperliche Aktivität über bislang noch nicht ganz erforschte Mechanismen offenbar auch direkt positiv in die Regulation von solchen Genen eingreift, die mit Alterungsprozessen in Zusammenhang gebracht werden.
Stress und Entspannung
Die Licht- und Schattenseiten von Cortisol
Die Ausschüttung von Cortisol steht im direkten Zusammenhang mit einer Reihe körperlicher und psychischer Gesundheitsparameter.
Cortisol ist ein wichtiges Hormon mit vielen positive Wirkungen. Es ist unser Aufwachhormon. In den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwachen am Morgen kommt es zu einer erhöhten Ausschüttung dieser Substanz in unserem Körper. Danach sinkt der Cortisol-Spiegel normalerweise im Verlauf des Tages wieder und erreicht seinen niedrigsten Wert in der ersten Nachthälfte.
Das hat die Natur für uns Menschen entsprechend eingerichtet. Wir gehören schließlich zu den tagaktiven Lebewesen. Cortisol am Morgen macht uns kurzfristig belastbar und leistungsfähig. Es bereitet uns damit auf den neuen Tag vor. Das ist genau das, was wir nach dem Aufstehen brauchen, um „in die Gänge“ zu kommen: Dieses Hormon erhöht den Blutzuckerspiegel. Damit wird sichergestellt, dass die über den Nachtschlaf erholten Körperzellen direkt nach dem Aufwachen mehr Energie in Form von Glucose nutzen können – damit beispielsweise unsere Muskeln für die anstehenden Aktivitäten gut gerüstet sind.
Cortisol ist aber auch eines unserer Stresshormone. Bei einem hohen Pegel schützt es unseren Organismus vor Überlastung. Das passiert, indem es zu einer Angstreaktion kommt und innere Abwehrkräfte mobilisiert werden.
Es ist unbestritten, dass Stress in unserer modernen und schnelllebigen Gesellschaft allgegenwärtig ist. Wesentliche Erkenntnisse darüber, wie das biologische Alterungsprozesse beeinflusst, zeigen gleichzeitig Möglichkeiten auf, wie man vorbeugend agieren und stressbedingte gesundheitliche Probleme zielgerichtet behandeln kann.
Dauerstress führt zu einem permanent erhöhten Cortisol-Spiegel, der auch nachts nicht im geforderten Maße abgebaut werden kann. Das wiederum ist schlecht für unsere Gesundheit. Wer ständig „unter Strom“ steht und keine Zeit zur Entspannung findet, lässt seine biologische Uhr schneller ticken. Permanenter Stress begünstigt beispielsweise Konzentrationsstörungen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- und psychische Erkrankungen. Der erhöhte Blutzuckerwert kann dann nicht mehr im erforderlichen Maße abgesenkt werden.
Der damit verbundene dauerhaft erhöhte Insulinspiegel zählt zu den charakteristischen Vorerkrankungen, die zu Typ-II-Diabetes, dem Altersdiabetes führen. Diabetes durch Dauerstress!
Zu typischen Risikogruppen für Dauerstress gehören beispielsweise einkommensschwache Personen, die sich Sorgen darüber machen, wie sie mit ihrem Geld bis zum Monatsende auskommen sollen. Aber auch Krebspatienten und -überlebende, Pflegekräfte, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Menschen mit länger anhaltendem körperlichen und seelischen Stress gehören zu typischen Risikogruppen für Dauerstress.
So wie unser Körper ein Immunsystem zur Abwehr schädlicher Keime besitzt, benötigt unser Geist eine Art psychologischer Immunkompetenz, welche ein gewisses Maß an Stressresistenz gewährleistet. Das ist die sogenannte Resilienz. Darunter versteht man die Fähigkeit, bei Bedarf alle erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren, um eine möglichst positive psychische Gesundheit auch in Momenten höchster seelischer Anspannung aufrechtzuerhalten. Vor allem, wenn wir mit unerwarteten, stressigen Situationen konfrontiert werden. Ganz allgemein geht es dabei um die Nutzung von Stressbewältigungsstrategien.
Solche psychologischen Kompetenzen und Fähigkeiten werden im Laufe der Zeit erworben und können trainiert werden. Sie sind langlebig und auf vielfältige Weise tief verdrahtet. Die Auswirkungen von Stressfaktoren auf unser sekundäres Altern hängen daher entscheidend davon ab, über welchen Umfang an psychologischen Ressourcen wir verfügen und wie gut wir in der Lage sind, diese dann tatsächlich auch bestmöglich abzurufen.
Welche Strategien könnten das sein? Wie kann man seine psychische Resilienz steigern?
Studien haben gezeigt, dass Achtsamkeitspraktiken den negativen Auswirkungen von Stress erfolgreich entgegenwirken können, da sie entspannend wirken und auf diese Weise einen positiven Einfluss auf das Glücksempfinden sowie auf die psychische Resilienz haben können (1.13).





























