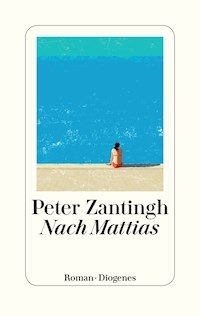
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amber singt bei einem Konzert gegen ihren Schmerz an; Quentin läuft Kilometer um Kilometer und Kristianne möchte die wahre Geschichte ihres Sohnes erzählen. Die Leben acht verschiedener Menschen überkreuzen sich durch Mattias’ unerwartetes Verschwinden auf schicksalhafte Weise. Wie Puzzlesteine fügen sich ihre Geschichten zu einem Abbild von Mattias und werden trotz aller Trauer zu Zeugen seiner Begeisterungsfähigkeit und seines unbeugsamen Lebensmutes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Zantingh
Nach Mattias
Roman
Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers
Diogenes
Ultimately, when it comes down to it, in my life, I like to think that I’ll do more good than I’ll do bad. That’s essentially what I’d like to leave the planet. Whether I’m hit by a truck, or a plane crash, or lying on my death bed as an old man, I’d like to know that I imparted a little bit of positivity. ’cause we do take up space, and we do consume. We sin against the earth by being alive.
Glen Hansard
Amber
Eine Woche nach Mattias wurde sein Fahrrad geliefert. Der Bote war ein ganz Aufgeweckter, der schon losredete, als ich noch gar nicht alle Türschlösser geöffnet hatte. Vor dem Eingang schlitzte er den Pappkarton an den Rändern auf und bimmelte zweimal mit der Klingel.
Ich stellte das Fahrrad in den Flur und ließ die Türschlösser wieder zuschnappen.
In den Tagen darauf musste ich mich an dem Fahrrad vorbeizwängen, wenn ich nach draußen wollte. Auf die Frage von Besuchern, Leuten, die meine Sachen gewaschen hatten oder wieder mal eine Topfpflanze mitnahmen, antwortete ich, das sei Mattias’ neues Fahrrad. Da fragte dann keiner weiter.
Konnte ich sie bitten, gar nichts mehr zu fragen?
Trauer ist wie ein Schatten. Der richtet sich nach dem Stand der Sonne, fällt morgens anders als abends. Der lehnt dunkel und geduldig an der Wand, streckt sich in voller Länge über den Asphalt aus oder zeichnet hinter deinem Rücken die Silhouette einer graziös drohenden Schlange auf den zu lange nicht gemähten Rasen. In diesen ersten Wochen wusste ich manchmal nicht, ob ich meinen eigenen Schatten sah oder den von jemandem, der sich mit den besten Absichten dicht neben mich gestellt hatte.
Ich brachte das Fahrrad ins Wohnzimmer.
Was ich all die Jahre gemeint hatte, wenn ich sagte, dass ich gut allein sein könne, war, dass ich gut allein sein konnte, solange das mit einer annehmbaren Endlichkeit verknüpft war. Solange das Alleinsein durch sein Kommen wieder aufgehoben werden konnte, er mit seiner ewig hastigen Fröhlichkeit »Hi« rufen würde. Aber das begriff ich erst, als ich das Ticken eines sich drehenden Rads in einer ansonsten totenstillen Wohnung vernahm. Da wurde mir klar, dass nicht nur er selbst ein für alle Mal nicht mehr da sein würde, sondern auch die Geräuschkulisse, mit der er mich jahrelang umgeben hatte: sein Sein in einem anderen Zimmer, seine fieberhafte Suche nach einem Kleidungsstück, das unauffindbar war und doch irgendwo sein musste, und vor allem die Songs, von denen er ganz erfüllt sein konnte und die er in allen Räumen hörte, als lockte er sie mit; auch, dass er mitsang und ich nicht bat, ob es vielleicht etwas leiser ginge, und ich nicht sagte, wenn sie mir nicht gefielen, weil ich wusste, dass ich ihm damit alles vermiesen konnte, und da war ich sehr vorsichtig.
Beim Saubermachen stieß ich ein Buch, in dem er gelesen hatte, von der Fensterbank. Auf dem Fußboden fiel das Lesezeichen heraus. Darüber habe ich eine Stunde lang geheult. Weil ich nun nicht mehr wusste, auf welcher Seite er gewesen war.
Im Bett horchte ich auf den leckenden Heizkörper, wie das Wasser in den Behälter tropfte, den ich daruntergestellt hatte.
Sara kam vorbei, wir ließen uns was zu essen bringen und guckten uns mit hochgezogenen Knien Filme an, die sie vorab sorgfältig gescreent hatte.
Regelmäßig ließ ich seine Mutter herein, wenn sie im Regen vor der Tür stand. Wir redeten über Mattias. Sie erzählte von der Freiwilligenarbeit, mit der sie angefangen hatte, und gebrauchte Wörter wie Trost und Befriedigung, Wörter aus Selbsthilfebüchern, Wörter, die, wenn sie ganz aufrichtig gemeint sein müssten, selten bedeuten, was sie bedeuten sollten.
Und dann war es heute Morgen plötzlich komisch: ein Fahrrad im Wohnzimmer. Reglose Pedale, warme Speichen, Reifen auf Laminat.
Das Fahrrad musste vor die Tür, und ich auch. Ich ließ es in einem Ständer zurück und löste mich aus dem Knäuel von Häuserblocks in Richtung Park.
Vielleicht zog mich die Erinnerung an einen Abend vor ein paar Jahren dorthin, als wir sahen, wie auf dem freien Feld in der Mitte vom Park ein Fesselballon aufstieg. Eltern mit Kind auf dem Arm standen darum herum. Die Sonne ging unter, der Ballon dagegen stieg mit drei Leuten an Bord auf: Sie zogen sich an den letzten Bahnen Sonnenlicht hoch, während sich unten auf der Erde die kleinen Kinder schier die Arme auswinkten, und kurz darauf war es schon fast unmöglich, in den Silhouetten im Korb noch normale Menschen zu erkennen, die auch in Sandalen auf der Wiese gestanden hatten.
Doch jetzt war alles anders. Der Himmel war grau, und Regenschleier hingen zwischen den Bäumen. Die Laute erreichten mich eher als die Bilder: ein schriller Schrei, der aufbrandete, erstarb und sich wiederholte.
Ich sehe zuerst den Pitbull. Wie er Anlauf nimmt und an einer älteren Frau hochspringt, die ein kleines weißes Hündchen im Arm hält.
Der Pitbull kommt am Boden auf und springt noch einmal. Senkrecht in die Höhe. Er schlägt die Zähne in das Handgelenk der Frau, direkt unterhalb vom Ärmel ihrer grünen Windjacke, und bleibt einen Augenblick daran hängen. Mit Erfolg: Die Frau lässt das Hündchen fallen. Es stürzt und wird, kaum unten aufgeschlagen, sofort von dem Viech geschnappt. Das wirft den Kopf hin und her. Und sein Schwanz peitscht wie ein Gummiknüppel.
Die Frau tritt nach dem straff gespannten Rücken des Pitbulls, tritt und kreischt, aber ihre nassen Wanderschuhe richten nichts aus. Ihre Brille fällt zu Boden.
Ich renne jetzt. Bin fast da.
Sie schreit und schreit. Wortlose Laute in einem weitgehend leeren Park. Es drückt mir auf die Schläfen. Sie sieht nun erschöpft und hilflos zu, beißt sich auf die Unterlippe und weint.
Ihr Hündchen rührt sich nicht mehr.
Und dann ist Schluss. Kurz bevor ich nahe genug bin, um etwas tun zu können, greift eine große Hand nach dem Halsband des Pitbulls. Der hängt mit den Vorderpfoten in der Luft, den Kopf zwar immer noch nach unten gerichtet, aber nicht mehr mit dem Hündchen im Maul, das erst noch ein paar Sekunden lang totenstill liegen bleibt und dann auf zerschrammten Pfoten außer Reichweite seines Angreifers kriecht.
Es dauert lange, bis ich sehe, wessen Hand das ist. Quentin trägt eine schwarze Laufhose und einen blauen Sweater, mit einer Halterung fürs Handy am rechten Oberarm, dessen Display aufleuchtet, als er mit der freien Hand auf die Fernbedienung auf halber Höhe der weißen Strippe drückt. Er zieht die Ohrstöpsel raus. Sie hängen aus seinem Kragen und hüpfen bei jedem wütenden Versuch des Hundes, sich loszureißen, unter seinem Kinn hin und her.
Quentin beugt sich über das Viech, fasst das Halsband noch fester und schaut auf. Sieht mich an.
»He«, sage ich.
Er scheint auch eine Weile zu brauchen. Dann sagt er kühl und gelassen: »He, Amber.«
Ein paar Monate vor seinem Tod kam Mattias einmal erst spätabends nach Hause. Ich lag schon im Bett. Er kam ins Schlafzimmer, zog sich ungelenk den rotweiß gestreiften Pullover über den Kopf und erzählte laut. Er habe eine Idee: Er werde ein Café aufmachen, mit Quentin zusammen. Im Zentrum oder irgendwo in Strandnähe. Sie hätten den ganzen Nachmittag und Abend darüber geredet. Das würde was werden. Das sei genau das, was er wirklich echt wolle.
Ich hörte mir an, wie ein Wort das andere zu überholen versuchte, und fragte mich, was denn an all den Sachen, die er schon machte, auszusetzen war. Er konnte sich immer noch für die gerade gehörten Newcomerbands begeistern, die er auf eine Popbühne bringen würde, und genauso sehr auch für die Schüler, denen er während des Rests der Woche Nachhilfeunterricht gab, weil sie zu ihm aufschauten und seinen Erzählungen lauschten und weil er auf die Weise wenigstens noch etwas damit anfing, dass er vier Jahre Geschichte studiert hatte. Das lief alles gut. Natürlich lief das alles gut, denn es war Mattias.
»Muss das denn auch noch sein?«, fragte ich.
»Wieso auch noch?« Er zog seine Socken aus, machte ein Knäuel daraus und beförderte sie mit Überkopfwurf zum weiter entfernten Wäschekorb. Auf der Schwelle zwischen Flur und Schlafzimmer blieb er an den Türrahmen gelehnt stehen.
»Neben allem, was du jetzt schon machst«, sagte ich.
»Jetzt tust du wieder so, als sei es schlecht, dass ich was Neues ausprobiere.«
»Aber vielleicht solltest du dich für eine Sache entscheiden.«
»Ich entscheide mich hierfür«, sagte er. »Quent und ich ziehen einen Laden auf.« Er machte einen Sprung rückwärts, trabte ins Wohnzimmer und holte seinen Laptop. Ich richtete mich auf und sah, dass er sich im Flur auf die Waschmaschine gesetzt hatte. Er hatte die Trommeltür geöffnet, um die Füße darauf abzustützen. Die Augen aufs Display gerichtet, sagte er: »Das wird voll cool.«
Was sollte ich davon halten? Im Gaststättengewerbe überlebte die Hälfte der Betriebe keine drei Jahre, hatte ich irgendwo gelesen, und die Wahrscheinlichkeit pleitezugehen war bei unerfahrenen Abenteurern, die nach zehn, zwölf Bierchen beschlossen hatten, dass es »voll cool« werden würde, mit Sicherheit noch viel größer.
Andererseits: Es war Mattias.
Da spielte noch was anderes mit. In letzter Zeit verstummte er manchmal plötzlich, wenn wir zusammen waren. Wenn ich nachhakte, kam nichts, als verlasse ihn schon beim Gedanken daran, etwas formulieren zu müssen, der Mut. Mir war manchmal bange vor diesem Winkel seiner Gedanken, aus dem er zwar immer zurückkehrte, jedoch in einer anderen Stimmung, mit anderen Worten für dieselben Dinge. Und was ich auch tat: Es half nichts.
Ich stieg aus dem Bett und zog ein T-Shirt über. Der Fußboden war kalt.
»Mattias?«
»Ja.« Er schaute nicht von seinem Bildschirm auf.
»Ist zwischen uns noch alles in Ordnung?«
Jetzt schaute er doch auf. »Wie meinst du das?«
Ich schloss die Augen und stieß einen Seufzer aus. Ein Zittern schwang darin mit.
»Was meinst du?«, fragte er noch einmal.
»Du siehst mich nicht mal an.«
Er seufzte. »Was willst du denn sagen?«
»Darum geht es jetzt nicht.«
»Doch. Darum geht es sehr wohl. Du willst sagen, dass das nicht drin ist.«
»Es geht nicht … es geht nicht um die Idee mit dem Café.«
»Um was dann?«
»Um …« Ich verstummte. Das ging zu schnell. Ich kam aus dem Bett, er aus der Stadt. Wir sprachen nicht die gleiche Sprache.
»Du willst mich davon abhalten«, sagte er, die Augen jetzt starr auf mich gerichtet.
Ich stand eine halbe Minute lang vor ihm, sagte aber nichts mehr, sondern ging dann auf die Toilette. Als ich zurückkam, galt seine Aufmerksamkeit wieder dem Laptop. Ich ging an ihm vorbei, schlüpfte unter die Bettdecke, ohne noch etwas zu sagen, und wartete, bis er sich neben mich legte und einschlief.
Das Hündchen ist zu der Frau gekrochen. Es liegt jetzt in ihren Armen und rührt sich praktisch nicht mehr. Die Frau drückt das Gesicht tief in das schmutzigweiße Fell. Dann schlägt ihre Haltung plötzlich völlig um, und sie fängt an zu keifen.
»Herrgott noch mal!«, blafft sie Quentin an. »Nimm deinen Scheißköter an die Leine, verdammt!«
An der Art, wie die Worte herauskommen, höre ich, dass sie solche Ausdrücke sonst nie benutzt.
Der Pitbull schnappt nach der Hand an seinem Halsband, verfehlt sie aber jedes Mal. Er hechelt mit aufgerissenem Maul.
Quentins Blick schießt umher, und am Ende sieht er mich an. »Der Köter gehört mir nicht. Ich hab die verfickte Töle noch nie gesehen.«
Die Frau keift noch etwas weiter und gibt sich dann geschlagen.
»Hier«, sage ich zu Quentin. Ich halte ihm die Rolle Schnur hin, auf die ich in der tiefen Tasche meines Wintermantels gestoßen bin. Da habe ich sie ein paar Wochen vor Mattias reingesteckt, als ich versuchte, unsere Gartenmöbel am Zaun festzubinden, die von heftigen Windstößen hin- und hergeschoben wurden. Mattias hockte drinnen. Ihn kratzte das nicht. Genauso hatte ich auch die Duschkabine gekittet, als wir das Haus gerade gekauft hatten, das Laminat verlegt und Tür- und Fensterrahmen gestrichen. Er steuerte seine Ideen bei – eine große Weltkarte im Schlafzimmer, Malkreide in der Küche, damit man an die Wand schreiben konnte, was eingekauft werden musste: Wär doch geil, Am! –, und ich wusste, dass irgendwer das schließlich umsetzen musste und dass auch die Gartenmöbel weiter hin- und hergeworfen würden, solange ich mich nicht mit dieser Schnur an die Arbeit machte. Und das war okay, denn danach setzte er sich neben mich, nahm meine Füße auf den Schoß, zupfte an meiner Socke und fragte, was ich essen wollte.
Ich zeige zu einem Baum ein Stück weiter weg. Es ist ein noch junger Baum, der rechts und links angepflockt ist. Quentin schleift den Pitbull über den Kiesweg und den Rasen. Das Viech stemmt sich dagegen, ist aber jetzt der Schwächere. Ich gehe mit. Bei dem Baum ziehe ich die Schnur durch das Halsband, während Quentin es eisern im Griff behält. Dann binde ich sie an einem der Pflöcke fest, mache einen doppelten Knoten rein und dann sicherheitshalber noch einen. Quentin sagt währenddessen kein Wort. Der Besitzer des Hundes ist nirgends zu sehen.
Ich drehe mich um. Die Frau hält das Hündchen immer noch hoch in den Armen. Sie neigt den Kopf und birgt das Gesicht wieder in seinem Fell. Ein Fiepen ist zu hören, aber von wem der beiden, lässt sich nicht sagen.
Als wir von dem Pitbull weggehen, fragt Quentin zögernd, wie es mir jetzt gehe.
»Jetzt? Heute?«
»Jetzt, in letzter Zeit.«
Danach ist alles kurz still, und niemand ist da. Ich sage nichts, und er murmelt noch: »Du weißt schon, neues Jahr. Glückliches neues Jahr. Neuanfang.«
Glückliches neues Jahr. Was für ein nichtssagendes Allerweltswort: Glück. Ich wusste, auch als wir zusammen waren, als alles zum Greifen nahe hätte sein müssen, nie genau, was das ist, Glück, außer einer Anwandlung, die ich manchmal verspüren konnte und die, eh ich mich’s versah, verflogen war, weil ich immer alles zu analysieren und zu ergründen versuchte, reifen lassen wollte, aber wenn ich das tat, war es schon eine Kopie von diesem kurzlebigen, puren Gefühl, mit dem es angefangen hatte und das sich nun mal selten greifen lässt.
Die Empfindung, wie ein Flugzeug vom Boden abzuheben, weil du nach Hause gehst. Wenn du eine morsche Pergola abreißt und eine neue errichtest. Die eine Minute zwanzig von Bookends von Simon & Garfunkel. Den, den du liebst, einen Augenblick in der Menge verloren haben, den Kopf ein paarmal drehen und ihn dann wiederfinden: Da, da ist er ja.
Wenn du Glück hast, steckt es da drin.
Oder darin, dass auf einer kleinen Insel an der malaiischen Ostküste ein Adler dreißig Zentimeter über dem klaren Wasser segelt, das sich unter ihm in ruhigen kleinen Wellen den Strand hinaufkräuselt, und dass sich dieser Vogel auf einen Felsen setzt, nachdem er perfekt seine Geschwindigkeit gedrosselt und die Beine ausgestreckt hat, genau so, genau da, ohne je sein Ziel zu verfehlen oder die Landung falsch zu timen, und dass ich von einer Sonnenliege mit blauem Polster aus zuschaue, zur Seite schaue und sehe, dass er es auch gesehen hat.
Wir waren Kinder der neunziger Jahre. Wir saßen auf der äußersten Spitze der Maslow’schen Pyramide und hatten trotzdem noch die Stirn, die Fotos von der Aussicht mit einem Instagram-Filter aufzuhübschen. Unsere Eltern waren zusammengeblieben und wohnten in Häusern, die wie selbstverständlich von Jahr zu Jahr mehr wert wurden.
Zu uns sagten sie: Du kannst werden, was du willst, Hauptsache, du wirst glücklich.
Mattias schien sich vor allem das Versprechen aus der ersten Hälfte gemerkt zu haben, ich den zwingenden Unterton vom Darauffolgenden.
Während ich im Wartezimmer der Tierarztpraxis sitze, werden sechs andere Haustiere hereingebracht. Zwei ängstlich durch das Gitter ihres nassgeregneten Transportkorbs herausspähende Katzen, die geimpft werden sollen. Ein unwahrscheinlich großes Kaninchen, das nicht mehr fressen will. Ein Hund, dessen Zähne nachgesehen werden sollen, und ein anderer, dessen Besitzer, ein Mann und eine Frau, die Arzthelferin schon fast bedrohen, weil sie nicht schnell genug drankommen. In zwei Stunden lasse es sich einrichten. »Es ist Ihre Schuld, wenn er dann schon tot ist«, sagt der Mann. Das Glöckchen über der Tür bimmelt, als sie hinausmarschieren. Der hereinfahrende Windstoß fegt ein paar Prospekte von dem Tischchen neben mir.
Nach fünfunddreißig Minuten kommt die Frau wieder heraus. Sie setzt sich neben mich. Ich sehe ihr an, dass sie auch im Behandlungsraum geweint hat.
»Und?«, frage ich.
»Kira bleibt eine Nacht hier«, flüstert sie.
Wir gehen nach draußen, das Glöckchen erschreckt uns doch noch kurz, und sie schnürt ihre Windjacke mit der Kordel am unteren Rand zu.
Im Gehen beginnt sie zu reden. Ihre Stimme ist schmal, aber freundlich, und mit jedem ausgesprochenen Satz scheint sie sich mehr an meiner Gesellschaft zu erwärmen. Sie erzählt, der Tierarzt habe einen Druckverband angelegt und ein Schmerzmittel und ein Antibiotikum verabreicht, aber er habe ein besorgtes Gesicht gemacht und gesagt, er könne nicht versprechen, dass es wieder gut werde. Sie schreitet zügig aus, scheint plötzlich einem Ziel entgegenzustreben und murmelt: »Oh, hoffentlich wird es wieder gut. Oh, hoffentlich wird es wieder gut.« Dann richtet sie mit einem Seufzen den Oberkörper auf, sieht mich an und sagt: »Wir geben die Hoffnung nicht auf.«
Wir überqueren den Zebrastreifen und biegen links ab. Ein Müllwagen fährt an uns vorbei und würde jedes Wort übertönen. Als ich kurz darauf denke, jetzt sei der richtige Moment, sage ich: »Ich kannte ihn. Den Typen im Park. Aber es war nicht sein Hund.«
Quentin war gleich nachdem wir den Pitbull angebunden hatten weitergerannt. Er wandte nichts gegen die Beschimpfungen der Frau ein. Verabschiedete sich auch nicht von mir. Ich hatte meine Aufmerksamkeit kurz auf die Frau und das Hündchen verschoben, und da war er schon hundert Meter weiter.
Sie blickt vor sich hin und sagt: »Und ich bin so gemein zu ihm gewesen.«
Wir gehen beharrlich weiter. Ich weiß nicht, wo sie hinmuss, doch wir gehen immer geradeaus.
»Auch wenn ich schon etwas älter bin«, sagt sie nach einiger Zeit, »unternehme ich noch alles Mögliche. Wir legen ganz schöne Strecken zurück, meine kleine Maus und ich.«
Als wir auf einem Pfad am Wasser entlanggehen, kommt ein fröhlicher Golden Retriever auf uns zugestürmt. Sein Herrchen ist mit Stock in der Hand ein ganzes Stück hinter ihm zurückgeblieben.
»Hallo, Lobbes«, sagt die Frau. Sie krault den Hund hinter seinem rechten Ohr, und ich fahre mit der Hand über sein goldfarbenes Fell. Sie hebt grüßend die Hand, als der Mann näher kommt.
»Kira ist alles, was ich noch habe«, sagt sie, als der Mann und sein Retriever wieder weg sind, und die Worte sprudeln jetzt heraus, als hätte sie den Hahn weiter aufgedreht. »Als die Kinder groß waren, wollten wir noch schöne Sachen zusammen machen. Mein Mann und ich, meine ich. Aber dann hat es ihn erwischt. Krebs. Und nie ein Wort der Klage. Nie. Nicht über die Schmerzen oder das Pech, dass er ihn kriegte und nicht ein anderer. Keinen Mucks hat er von sich gegeben. Kein böses Wort.«
Ich würde gern etwas sagen oder etwas tun, aber ich weiß nicht, was. Ich schaue zur Seite und verlangsame meine Schritte, denn vielleicht möchte sie ja stehen bleiben, aber sie hält an ihrem Tempo fest. Wir sind wieder zwischen den Häusern.
»Ich habe ihn verfallen sehen. Wie wahnsinnig schnell die Kilos schwanden. Von Tag zu Tag sah ich ihn weiter abbauen. Ihm hat nichts mehr geschmeckt. Alles Schöne wird mir genommen, sagte er eines Morgens, als er sein Frühstücksei von sich schob. Das war vielleicht der einzige Misston, den ich je von ihm hörte. Er sagte: ›Sogar wenn du die Todesstrafe kriegst, steht dir eine letzte Mahlzeit zu. Etwas, was du besonders gern magst. Aber mir schmeckt jetzt schon nichts mehr.‹ Damals saß er in seinem Pyjama am Tisch. In den letzten Wochen hatte er nur noch seinen Pyjama an.«
Sie senkt den Blick. »Aber wir schlagen uns schon durch.«
Ich sehe, dass sie wieder feuchte Augen hat, sie schaut geradeaus in den stark auffrischenden Wind, und eine Träne kriecht horizontal von einem Streifen verlaufener Wimperntusche weg über ihre Schläfe. Und als bedenke sie erst jetzt, dass es auch anders kommen könnte und sie nachher sowieso allein nach Hause zurückkehren wird, warten muss auf den Anruf vom Tierarzt morgen früh, und als wolle sie auf einmal furchtbar gern über etwas anderes reden, sagt sie: »Darf ich fragen, wie du heißt?«
»Amber.«
Das wiederholt sie: »Amber.«
»Ja.«
Ich sage: »Ich verstehe Sie, glaube ich.«
Und dann fange ich an zu erzählen.
Es war am Ende meines dritten Tags. Ich hatte das Konservatorium einen Monat davor endgültig aufgegeben und dachte an Musikwissenschaft, hatte mich aber noch nicht eingeschrieben. Dies war meine Zwischenstation: PR für eine kleine Bookingagentur für Folk, Jazz und Weltmusik. Sara hatte mir dazu verholfen.
Und da arbeitete er also auch.
Er hatte an diesem Nachmittag, als er mich fragte, ob wir draußen was zusammen trinken wollten, ein graues Shirt an, und wir unterhielten uns über Musik, über Pixar-Filme, darüber, wie lange es Hyves wohl noch geben würde und ob wir nun Atheisten oder Agnostiker waren. Ich erzählte ihm zögernd, dass ich Cello spielte, ein Überbleibsel vom abgebrochenen Studium am Konservatorium, und ich sah die unendliche Verblüffung in seinen Augen. Als hätte ich gesagt, dass ich Banksy sei, dass ich das Guggenheim entworfen hätte, dass ich jeden Dienstagabend zwischen sieben und acht mit Delphinen baden ginge.
Am gleichen Abend nahm er mich hinten auf seinem Fahrrad mit zur Präsentation des Albums einer flämischen Newcomerband. Ich musste mich damals noch an die Spontaneität gewöhnen, die ihm eigen zu sein schien. Einfach aufzustehen und zu etwas aufzubrechen, das nicht schon seit Wochen in meinem Terminkalender stand. Mit Mattias war es, als könnten Tage und Stunden ausgedehnt werden, so dass immer noch etwas anderes hineinpasste, selbst wenn oder gerade wenn man erst im letzten Moment darauf gekommen war.
Auf dem Heimweg fragten wir einander an jeder Straßenecke, ob wir immer noch in die gleiche Richtung mussten.
Er ließ oft eine Karte für mich zurücklegen, wenn ich mir noch nicht sicher war, ob ich auch noch zu einem Konzert kommen würde, bei dem er schon war. Wir gingen mit Freunden auf Festivals. Er hatte auf Spotify eine lange Playlist angelegt, die man als Wecker benutzen konnte. Der bekannte Hit von James Brown war auch darunter, denn wir stellten es uns witzig vor, eines Morgens mit »Wooo! I feel good, tanananananana« geweckt zu werden, aber die Shuffle-Funktion setzte ihn nie an den Anfang.
Er spielte »Football Manager« und hatte sich schon fünfzig Jahre oder so in die Zukunft simuliert. Irgendwann kriegt man in diesem Spiel einen Sohn, sagte er mal. Dann gibt es plötzlich einen mit deinem Nachnamen in der Jugendmannschaft. Aber ich habe ihn nie sagen hören, dass er Vater geworden sei, denn wenn es so gewesen wäre, hätte er es mir erzählt. Solche Sachen hätte er mir gern erzählt.
Ich erzähle der Frau auch, dass wir am Ende des Sommers auf dem Parade, dem großen Theaterfestival, waren. Da gab es Stände, wo man etwas essen und trinken konnte, Jahrmarktswagen, Picknicktische, und auf Schultafeln stand angeschrieben, in welchen Zelten welche Vorstellungen stattfanden. An einer zwischen den Bäumen gespannten Leine hingen Lampions, die angingen, als es dunkel wurde. Wir dachten voraus. Wir machten Pläne. Wir buchten dort an Ort und Stelle einen Wochenendtrip. Wir dachten uns Vorstellungen aus, mit denen wir selbst eines der Zelte füllen würden. Und um kurz vor zehn stellten wir uns beim Kettenkarussell an. Zufällig war es die letzte Runde, bevor sie in eine andere Stadt weiterziehen würden. Wir schwebten eine Ewigkeit darin herum, während sich das Personal unter uns bei allen bedankte.
Und an jenem Tag, ausgerechnet jenem letzten Tag, stritten wir uns.
Es war vielleicht die ganze Zeit schlicht der leichteste Weg gewesen, zu glauben, dass alles, was er wollte, gelingen würde. Dem war aber nicht so. Natürlich war dem nicht so. Bands konnten für mehr Geld und vor einem größeren Publikum auf Festivals auftreten, und davon gab es immer mehr, so dass für die kleineren Popbühnen so gut wie nichts mehr übrig blieb. Ich hatte ihn schon seit ein paar Wochen nicht mehr von dem Café reden hören. Er redete überhaupt weniger. Ich sah manchmal den Pessimisten in ihm hervorkommen, und das durfte nicht sein. Pessimisten gab es mehr als genug, damals schon. Es wurde normal, jemanden, der anderen helfen möchte, Gutmensch zu nennen, während sich eine immer größer werdende Gruppe ängstlicher Menschen hinter die schimpfenden Schwarzseher scharte, weil die am Ende nur recht haben können: Denn eines Tages muss ja etwas schiefgehen, und bis dahin können sie sagen: »Warte mal ab!«, und das ist dann nicht zu widerlegen.
Wir vergessen die Flasche, wenn Wein drin war, und sie geht uns nicht mehr aus dem Kopf, wenn ein mit Benzin getränkter Lappen hineingestopft worden ist.





























