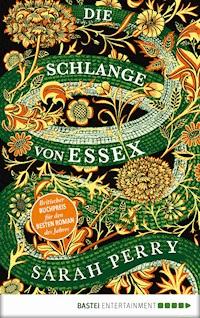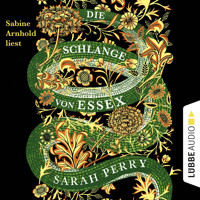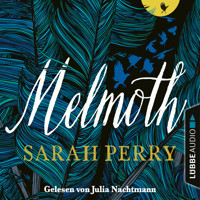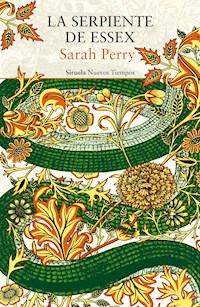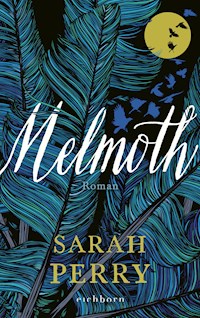9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der lang erwartete Debütroman von Sarah Perry, Autorin des Bestsellers DIE SCHLANGE VON ESSEX
An einem heißen Sommertag beschließt John Cole sein Leben hinter sich zu lassen.
Er sperrt seinen Buchladen zu, den nie jemand besuchte, und verlässt London. Nach einer Autopanne sucht er Hilfe, verirrt sich und gelangt zu einem herrschaftlichen, aber heruntergekommenen Anwesen.
Dessen Bewohner empfangen ihn mit offenen Armen - aber hinter der seltsamen Wohngemeinschaft steckt ein Geheimnis. Sie alle kennen seinen Namen, haben ein Zimmer für ihn vorbereitet und beteuern, schon die ganze Zeit auf ihn gewartet zu haben.
Wer sind diese Menschen?
Und was haben sie mit John vor?
NACH MIR DIE FLUT ist der eindringliche Debütroman von Sarah Perry. Betörend schön, unheimlich und psychologisch raffiniert. Ein elegant-düsteres Kammerspiel
"Sarah Perry schafft eine Atmosphäre, die den Leser noch lange nach der letzten Seite im Bann hält." John Burnside
"Eine wunderbare, traumähnliche Erzählung. Selten begegnen uns solch eindrucksvolle Debütromane." Sarah Waters
"Nur selten greift man zu einem Roman, der einen von der ersten Seite an in den Bann schlägt. Perrys Debüt ist einer dieser Romane." Phil Barker, SUNDAY TIMES
"Die kunstvollen und komplexen Charaktere machen diesen Roman wirklich außergewöhnlich." John Burnside, GUARDIAN
"Ein dunkler, erstaunlicher Roman, der an W. G. Sebald mit einem Schuss Gothic erinnert."
Catherine Blyth, SUNDAY TELEGRAPH
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Der lang erwartete Debütroman von Sarah Perry, Autorin des Bestsellers Die Schlange von Essex An einem heißen Sommertag beschließt John Cole sein Leben hinter sich zu lassen. Er sperrt seinen Buchladen zu, den nie jemand besuchte, und verlässt London. Nach einer Autopanne sucht er Hilfe, verirrt sich und gelangt zu einem herrschaftlichen, aber heruntergekommenen Anwesen. Dessen Bewohner empfangen ihn mit offenen Armen - aber hinter der seltsamen Wohngemeinschaft steckt ein Geheimnis. Sie alle kennen seinen Namen, haben ein Zimmer für ihn vorbereitet und beteuern, schon die ganze Zeit auf ihn gewartet zu haben. Wer sind diese Menschen? Und was haben sie mit John vor? Nach mir die Flut ist der eindringliche Debütroman von Sarah Perry. Betörend schön, unheimlich und psychologisch raffiniert. Ein elegant-düsteres Kammerspiel.
»Sarah Perry schafft eine Atmosphäre, die den Leser noch lange nach der letzten Seite im Bann hält.« John Burnside
»Eine wunderbare, traumähnliche Erzählung. Selten begegnen uns solch eindrucksvolle Debütromane.« Sarah Waters
»Nur selten greift man zu einem Roman, der einen von der ersten Seite an in den Bann schlägt. Perrys Debüt ist einer dieser Romane.« Phil Barker, SUNDAY TIMES
»Die kunstvollen und komplexen Charaktere machen diesen Roman wirklich außergewöhnlich.« John Burnside, GUARDIAN
»Ein dunkler, erstaunlicher Roman, der an W. G. Sebald mit einem Schuss Gothic erinnert.« Catherine Blyth, SUNDAY TELEGRAPH
Über die Autorin
Sarah Perry wurde 1979 in Essex geboren und lebt heute in Norwich. Ihr Roman Die Schlange von Essex war einer der größten Überraschungserfolge der letzten Jahre in England. Ausgezeichnet als Buch des Jahres 2016 der Buchhandelskette Waterstones, Gewinner des britischen Buchpreises 2017 für den besten Roman sowie für das beste Buch insgesamt. Der Roman war nominiert für den Costa Novel Award, den Dylan Thomas Prize, den Walter Scott, den Baileys und den Wellcome Book Prize.
SARAH PERRY
NACH MIR DIE FLUT
Übersetzung aus dem Englischen von Eva Bonné
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»After me comes the flood«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2014, 2017 by Sarah Perry
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Friederike Achilles, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Umschlagmotiv: Image © Victoria and Albert Museum, London and iStockDesign: Peter Dyer
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6044-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für RDP,
der aus einem kleinen Raum ein Überall macht
Und für Jenny,
die immer auf meiner Seite war
Mittwoch
I
Ich schreibe diese Zeilen an einem alten Schulpult, in einem fremden Zimmer. Ich sitze auf einem kaputten Stuhl, der bei jeder Bewegung knarzt, deswegen halte ich möglichst still. In den Deckel des Pults haben Kinderhände – oder waren es die eines Mannes? – Symbole eingeritzt, am Grund des leeren Tintenfasses liegt ein Käfer auf dem Rücken. Eben noch meinte ich zu sehen, wie er sich bewegt, aber er ist staubtrocken und wahrscheinlich schon lange vor meiner Ankunft gestorben.
Der Papierschirm der Lampe, die zu meinen Füßen steht, ist mit Nachtfaltern bemalt und die Staubschicht auf der Glühbirne so dick wie Filz. Ich wage nicht, sie einzuschalten, aus Angst, die anderen könnten es sehen und zurückkommen. Zu meiner Seite befinden sich zwei Fenster, und ein helles Licht vom Ende des Gartens wirft zwei abgeschrägte Flächen an die Wand und lässt das Schreibpapier gelb erscheinen, ebenso wie meine Hände, die aussehen, als gehörten sie nicht zu mir; ich muss mich fragen, wo meine geblieben sind und was sie gerade tun. Ich lausche auf Schritte im Flur oder Stimmen im Garten, aber es ist nichts zu hören als das stille Haus. Man hat mir zu viel zu trinken gegeben, ich habe ein Dröhnen in den Ohren, und meine Augen brennen, sobald ich versuche, sie zu schließen …
Ich habe noch nie Tagebuch geführt. Nichts, was mir je passiert ist, war es wert, aufgeschrieben zu werden. Doch was sich heute ereignet hat – was ich heute getan habe –, ist so unglaublich, dass ich fürchte, ich könnte es in einem Monat für einen grotesken Roman halten, gelesen vor vielen Jahren, als ich noch jung war und es nicht besser wusste. Ich trage nichts bei mir, das Schreibheft habe ich in dem Pult gefunden, an dem ich sitze. Es lag ganz hinten in der Schublade, unter von Feuchtigkeit gewellten Zeitungen. Das Papier riecht modrig, und die Seiten sind leer, alle bis auf die letzte, auf die jemand immer wieder denselben Namen geschrieben hat, Zeile für Zeile, als hätte er eine Unterschrift geübt. Der Name ist fremdartig, kommt mir aber seltsam bekannt vor, ich weiß bloß nicht mehr, woher: EADWACER, EADWACER, EADWACER.
Ich habe meinen daruntergesetzt, denn falls ich jemals wieder einen Blick in dieses Heft werfe, soll meine Handschrift mich daran erinnern, dass ich derjenige war, der all diese Ereignisse aufgeschrieben hat; dass ich all das getan habe und niemanden die Schuld trifft als mich. Ich schreibe meinen Namen noch einmal, in mutigeren, größeren Buchstaben, als er es verdient hat, JOHN COLE, dreifach unterstrichen.
Ich wünschte, ich könnte meine Geschichte in der Stimme eines anderen erzählen. Ich wünschte, ich könnte all meine Lieblingsbücher nehmen und mir Worte leihen, die besser sind als diese; aber ich muss mich wohl mit einem leeren Heft und mir selbst begnügen, einem Mann, der noch nie eine Geschichte zu erzählen hatte und nicht weiß, wo er anfangen soll, außer ganz am Anfang …
Letzte Nacht habe ich tief und zu lange geschlafen; beim Aufwachen hatte sich das Laken so fest um meine Beine gewickelt wie ein Seil. Meine Kehle war wund und trocken, als wäre ich gerannt. Ich zog den am Vorabend herausgehängten grauen Anzug und eine graue Krawatte an, und beide saßen so schlecht, als gehörten sie einem Fremden.
Auf der Straße war es unheimlich still, seit dreißig Tagen hatte es nicht mehr geregnet. Viele Leute hatten inzwischen die Stadt verlassen, um sich anderswo vor der Sonne zu verstecken, und ich fragte mich, ob ich eines Morgens vor die Tür treten und feststellen würde, dass ich als Einziger noch hier bin. Auf dem Weg zur Arbeit begegnete ich keinem einzigen Nachbarn, und in allen Schaufenstern waren die Jalousien heruntergelassen. Ich stellte mir vor, dass die Kunden schon vor dem Buchladen standen, durchs Fenster spähten und sich fragten, wo ich denn bliebe, schließlich komme ich nie zu spät – aber natürlich wartete niemand. Noch nie hat jemand gewartet.
Ich schloss das Geschäft auf und merkte schon nach kurzer Zeit, dass mir die trockene, kühle Luft nicht bekam. Ich fühlte mich schwach, mir war übel. Neben der Kasse steht ein Lehnstuhl (er hat meinem Vater gehört, und wann immer ich darin sitze, glaube ich, seine Stimme zu hören: »Raus mit dir, Junge!«), zu dem ich mich hinschleppte. Meine Knie gaben nach, und ich sank hinein. Der Schweiß durchnässte mein Hemd und brannte mir in den Augen, außerdem bekam ich starke Kopfschmerzen. Ich habe nie verstanden, wie manche Leute es fertigbringen, tagsüber zu schlafen, aber nun lehnte ich mich zurück und döste ein.
Mein Bruder behauptet immer, ich gehöre in das Antiquariat wie eine Schnecke in ihr Haus. Wenn er das sagt, spiele ich ihm zuliebe den Empörten, doch er hat recht. Noch nie habe ich mich, wenn ich in dem alten Sessel sitze oder an der Kasse stehe, deplatziert gefühlt. Aber als ich um die Mittagszeit wieder aufwachte, hatte alles sich verändert, und nichts war mehr so wie vorher. Die Standuhr in der Ecke tickte missmutig und viel zu langsam vor sich hin, und im Muster des Teppichs sah ich seltsame Vögel, die nach mir zu hacken schienen. Immerhin hatte der Kopfschmerz ein wenig nachgelassen, und so war ich in der Lage, aufzustehen und dies und das zu erledigen. Obwohl ich ahnte, dass niemand kommen würde, wartete ich auf Kundschaft. Ich sehne mich nur selten nach Gesellschaft, außerdem wäre ich bei den meisten Menschen wohl ohnehin nicht willkommen; doch als ich da vor den Regalen stand und Bücher einsortierte, hoffte ich inständig, die Glocke über der Tür würde klingeln und ein Kunde hereinkommen, den ich mit den Worten »Kann ich Ihnen helfen?« begrüßen könnte.
Ich trat ans Fenster und schaute auf die Straße hinaus. Jemand rief nach seinem Hund, dann war es noch stiller als zuvor. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber mein Herz sank; es war eine körperliche Empfindung, so real wie Hunger oder Schmerz, und wie ein Schmerz löste sie kalten Schweiß aus. Auf der Suche nach einem Taschentuch, mit dem ich mir die Stirn trocknen könnte, schob ich eine Hand in meine Hosentasche und fand eine alte Postkarte, die ich vor Wochen zusammengefaltet, eingesteckt und dann vergessen hatte.
Die Karte zeigte ein auf dem Trockenen liegendes Boot bei Sonnenaufgang. Die Marschlandschaft sah so klamm und trostlos aus, als hätte es in der Absicht des Fotografen gelegen, etwaige Besucher abzuschrecken. Jemand hatte ein Strichmännchen hineingemalt, es stand im flachen Wasser und winkte mir zu. Ich drehte die Karte um und sah ein mit grünem Buntstift gemaltes Fragezeichen und darunter den Namen CHRISTOPHER in riesigen Lettern. Mein Bruder hält in seinem Haus an der Küste von Norfolk ein Gästezimmer für mich bereit, eingerichtet mit einem schmalen Bett und einem Regal voller Romane, die einen Menschen wie mich möglicherweise interessieren könnten. Er sagt oft: »Komm uns besuchen; wirklich, du kannst jederzeit kommen«, aber ich besuche ihn nie, außer zu Weihnachten, wenn es sich so gehört.
Ich wendete die Karte hin und her und hielt sie mir unter die Nase, als könnte ich so das Salz der Marschen riechen. Im Haus meines Bruders würde mich eine Schar fröhlicher Jungen erwarten, meine gut gelaunte Schwägerin und natürlich mein Bruder selbst, der gern bis spät in die Nacht aufbleibt, um Whisky zu trinken und zu plaudern. Ich könnte es aushalten, dachte ich plötzlich, dort gäbe es wenigstens frische Luft und eine kühle Brise am Nachmittag. Schnell holte ich ein Stück Pappe aus dem Schreibtisch, schrieb so ordentlich wie möglich BIS AUF WEITERES GESCHLOSSEN darauf und stellte es ins Fenster. Dann löschte ich die Lichter, schloss den Laden ab und ging nach Hause.
Ich hatte auf einen Wetterumschwung gehofft, doch der Himmel blieb leer und hell, und auf dem Heimweg kehrte der Kopfschmerz zurück. Ich packte eine kleine Reisetasche und schlich mich so verstohlen wie ein Schulschwänzer aus der Wohnung. Ich musste einmal bis ans Ende der Straße laufen und wieder zurück, bevor ich mein Auto fand. Die Hitze hämmerte auf den Gehweg, und es war fast unmöglich, die eine Straßenseite von der anderen zu unterscheiden. Schließlich entdeckte ich meinen Wagen, der von einer feinen, rötlichen Staubschicht bedeckt war. Jemand hatte ein Pentagramm auf die Windschutzscheibe gemalt.
Hätte ich besser umkehren sollen? Ein klügerer Mann hätte sofort erkannt, dass die Reise unter keinem guten Stern stand – hoch oben auf einem der Balkone sang ein Kind (ausgerechnet »We all fall down«!), und unten im Rinnstein lag eine tote Taube auf dem Rücken, aber als ich zu den Fenstern der Wohnung hinaufschaute, waren sie so leer, als wohnte dort schon seit Jahren keiner mehr.
Erst nachdem ich London verlassen hatte und eine gute Stunde gefahren war, fiel mir auf, dass ich weder eine Straßenkarte noch den kleinen Zettel dabeihatte, auf dem mein Bruder mir einmal die kürzeste Strecke notiert hatte. Ich war überzeugt, den Weg zu kennen, doch wie immer spielte meine Erinnerung mir einen Streich; keine zwei Stunden später hatte ich mich gründlich verirrt. Auf den schwarzen Tafeln am Straßenrand stand LANGSAM FAHREN, die Sonne fiel zum Seitenfenster herein und versengte mir den Unterarm. Ich öffnete das Fenster, aber die Luft, die von draußen einströmte, stank nach fauligen Abgasen. Ein Hustenanfall schüttelte mich.
Ich bekam Panik. Mein Magen krampfte sich zusammen wie eine Faust, und ein säuerlicher Geschmack breitete sich in meinem Mund aus, als hätte ich mich schon übergeben. Mein Herz schlug mit einer wilden Wucht, die als frischer Schmerz im Schädel widerhallte, und meine Hände schienen am Lenkrad festzukleben. Mein Körper gehorchte mir nicht mehr, ich fürchtete, auseinanderzufallen. Ganz kurz glaubte ich, erblindet zu sein, aber dann war es nur Dampf, der von der Motorhaube aufstieg. Ich brüllte – was oder warum, weiß ich nicht mehr –, knirschte mit den Zähnen und bog auf eine Nebenstraße mit weniger Verkehr ab. Als die ersten dunklen Ausläufer des vertrauten Waldes in Sichtweite kamen, hätte ich vor Erleichterung fast geweint.
Ich fuhr noch eine Weile weiter, hielt an einer schattigen Stelle am Straßenrand, stieg aus und stellte mich an die mit Farnkraut überwucherte Böschung. Die Kiefern schienen sich herunterzuneigen, während ich ein wenig Tee auswürgte, in die Hocke ging und den Kopf zwischen den Händen vergrub. Als ich mich wieder aufrichten konnte, schämte ich mich sehr, obwohl niemand den peinlichen Vorfall beobachtet hatte. Der Schmerz hinter meinen Augen verebbte, und dann war nichts mehr zu hören als das leise Ticken des abkühlenden Motors. Ich wagte es nicht, mich gleich wieder ans Steuer zu setzen, und beschloss, mich kurz auszuruhen. Obwohl ich nicht mit der Technik meines oder irgendeines anderen Autos vertraut war, nahm ich an, Wasser in den Kühler nachfüllen zu müssen, und beschloss, Hilfe zu holen.
Anscheinend hatte ich den Forst fast schon durchquert. Ich entdeckte einen breiten Trampelpfad, der so zugewuchert war, dass er an einen dunkelgrünen Tunnel erinnerte. Er zog mich magisch an, und ich folgte seinem Verlauf wie in Trance. Ich hörte leise, hektische Bewegungen im Unterholz und aufgeregtes Grillenzirpen. Rechts und links des Pfades wucherten dichte Winden mit weißen Blüten empor. Nach einer Weile, ich weiß nicht mehr, wie lange ich gegangen war, verwandelte der Pfad sich in einen staubigen Feldweg, und der Wald teilte sich und gab den Blick auf eine verdorrte Rasenfläche frei, die sich bis zu einem Haus hinaufzog.
Wie kann ich meine Gefühle beim Anblick dieses Hauses beschreiben? Es stand hoch oben auf einem Hügel, das helle Sonnenlicht funkelte in allen Fensterscheiben und blitzte vom Pfeil der Wetterfahne. Ich sah nichts als leuchtende Farben und klare Konturen – die Schieferschindeln strahlten in einem lebhaften Blau, die Schornsteine hoben sich schwarz vom Himmel ab, und hohe, weiße Säulen ragten rechts und links der grünen Eingangstür auf, von der Treppenstufen auf den Rasen hinunterführten und auf den Weg, an dessen Ende ich nun stand.
Ich glaubte, nie etwas Realeres und Greifbareres gesehen zu haben, gleichzeitig schien alles nur eine Luftspiegelung zu sein. Erst als ich näher kam, ließ der traumgleiche Eindruck nach. Da waren Flecken an den Mauern, wo früher Efeu gewachsen war, und die Vorhänge in den Fenstern passten nicht zueinander. Jemand hatte ein Buch mit gebrochenem Rücken im Gras liegen lassen, die Rosenbüsche unter den Fenstern waren zu Stümpfen verkümmert. Im Schatten der Büsche lag eine rote Katze mit tränenden Augen und hechelte gegen die Hitze an. Die Farbe an der Tür schlug Blasen und splitterte ab, und vom Fuß der Treppe aus konnte ich einen Türklopfer in der Form einer erhobenen Männerfaust erkennen, die einen eisernen Stein gegen eine Eisenplatte schlug.
Ich hielt unschlüssig inne, als plötzlich die Tür geöffnet wurde und eine Kinderstimme etwas rief. Ich dachte, dass vielleicht ein anderer gemeint war, der mir unbemerkt gefolgt war und nun hinter mir stand, doch als ich einen Blick über die Schulter warf, konnte ich sehen, dass der Weg leer und ich allein war. Das Kind lachte und rief erneut, und ich verstand einen Namen, der mir vage bekannt vorkam, zu dem mir aber kein Gesicht einfallen wollte. Dann auf einmal merkte ich, dass es mein Name war, den das Kind wieder und wieder rief, und obwohl ich schon einen Fuß auf die unterste Treppenstufe gesetzt hatte, erstarrte ich vor Schreck. Ich dachte: Das ist nur die Hitze, die in deinen Ohren klingelt. Niemand kann wissen, dass du hier bist.
Die Kinderstimme kam näher, und gegen das gleißende Licht erkannte ich schließlich die Gestalt eines Mädchens. Es war älter, als seine Stimme vermuten ließ, und sprang mit ausgebreiteten Armen die Treppe hinunter. »John Cole! Sind Sie es? Sie sind es, nicht wahr, es kann nicht anders sein. Ich bin ja so froh! Ich habe den ganzen Tag auf Sie gewartet!« Ich wollte ihr erklären, dass sie sich irrte, aber in meiner Verwirrung fehlten mir die Worte, und schon im nächsten Augenblick stand das Mädchen neben mir und hakte sich unter. Sie fragte: »Sie kennen sich aus? Ich werde Ihnen den Weg zeigen«, und zog mich die Treppe hoch. Das Mädchen plapperte immer weiter – alle könnten es kaum erwarten, mich kennenzulernen, ich hätte mich sehr verspätet, sie sei ja so froh, mich endlich zu sehen – und führte mich in eine mit Steinen gepflasterte Eingangshalle, so kalt und dunkel, dass ich zu zittern anfing, sobald die Tür hinter uns ins Schloss gefallen war.
Sie musste mein bleiches Gesicht und meine bebenden Hände bemerkt haben, denn auf einmal behandelte sie mich wie den alten Mann, der ich in ihren Augen wohl war. »Keine Sorge, wir sind gleich da«, sagte sie, als hätte sie irgendwo gehört, dass man so mit älteren Menschen spricht, und beschlossen, dass es folglich auch für mich das Richtige sein müsse, und während der ganzen Zeit stammelte ich immer wieder: »Mach dir bitte keine Umstände, mir fehlt nichts, alles ist in Ordnung«, und keiner von uns hörte dem anderen zu.
Am Ende der Halle ging es über eine Steintreppe mit in der Mitte abgewetzten Stufen hinunter in eine große Küche mit hoher, gewölbter Decke. Aus dem Augenwinkel sah ich ein Dutzend Fleischerhaken an Ketten herunterhängen. Das Mädchen schob einen Hocker vor mich hin, fast wäre ich darüber gestolpert. Das Pochen hinter meinen Augen setzte so abrupt aus wie eine Uhr, die abgelaufen ist, und an seiner Stelle machte sich eine wohltuende Leere breit. Mir war, als hätte mein Kopf sich vom Körper gelöst, um davonzuschweben. Als ich die Augen wieder öffnete, war offenbar etwas Zeit vergangen; ich sah das Mädchen mir gegenübersitzen, ihre Hände ruhten auf dem Tisch zwischen uns. Sie runzelte die Stirn, musterte mich ebenso aufmerksam wie gelassen und fragte, ob ich einen Schluck Wasser wolle. Ohne die Antwort abzuwarten, trat sie an ein steinernes Becken, und da erst sah ich, wie sehr ich mich geirrt hatte – sie war eine junge Frau, kein Mädchen, obwohl sie wie eines klang und ihre dünne, hohe Stimme ohne Denk- und Atempausen dahinplätscherte. Sie war ziemlich groß, und ihre schlanken Arme und Beine wirkten so weich wie die eines Kindes. Sie trug ein weißes T-Shirt mit eingerissener Tasche auf der Brust, ihre nackten Füße waren nicht gerade sauber. Ihr Gesicht war so fein geschnitten, als wäre es nicht wie bei gewöhnlichen Menschen aus einem Klumpen Fleisch gewachsen, sondern aus Marmor herausgemeißelt worden. Sie kehrte an den Tisch zurück und reichte mir lauwarmes Wasser in einem Becher mit angeschlagenem Rand. Ihr Haar leuchtete in der Farbe von Bernstein, ihre Augen ebenfalls, und ihre Lippen waren fast so blass wie ihre Wangen. Mir kam der Verdacht, dass nichts an ihr real war.
Das Wasser hier auf dem Land schmeckte scheußlich, aber sie befahl mir, auszutrinken. Möglicherweise verzog ich das Gesicht, denn sie sagte: »Ich weiß … Soll ich uns lieber einen Tee kochen?«, und drehte erneut den Wasserhahn auf. Das Plätschern in dem Steinbecken erinnerte mich an den Grund meines Besuches. Ich versuchte noch einmal, ihr meine Lage zu erklären, doch sie hörte gar nicht zu. Genauso gut hätte ich ein Tier sein können, das sie auf der Treppe gefunden hatte. »Wissen Sie, ich soll mich um Sie kümmern«, sagte sie. »Achte darauf, dass er alles bekommt, was er braucht, haben die anderen zu mir gesagt, und ich habe geantwortet: Wisst ihr, ich kann das, ich bin nicht dumm.« Mir war immer noch schwindlig, und das Klingeln in meinen Ohren hatte auch noch nicht aufgehört, aber ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass das Mädchen, das Steinbecken und der Kessel in ihrer Hand nicht real waren, besser noch, sie hatten überhaupt nichts mit mir zu tun. Auf einmal saß die Katze, die ich draußen unter den Büschen gesehen hatte, vor mir auf dem Tisch. Sie bewegte den Schwanz hin und her wie ein Hypnotiseur seine Taschenuhr, und ich saß da und verfolgte das Pendeln. Die Tischplatte war von scharfen Messern zerkratzt und von heißen Töpfen versengt worden, außerdem hatte jemand die Worte DIESMAL NICHT ins Holz geschnitzt.
Das Mädchen sagte: »Alles ist für Sie bereit – Ihre Sachen sind schon da. Ich habe Ihr Zimmer persönlich vorbereitet. Ich habe Ärger bekommen, weil ich die letzten Blumen im Garten gepflückt habe, aber ich dachte, sie würden Ihnen gefallen, außerdem wären sie morgen sowieso abgestorben.«
Sie schob eine Streichholzschachtel auf und machte sich daran, den Gasherd zu entfachen, doch weil sie mit zu viel Druck rieb, zerbrach das erste Hölzchen. Es fiel zu Boden, die Luft roch nach Schwefel. Die Katze schaute mich an, legte die zerfransten Ohren an und schoss davon. Ich hätte mich vor der befremdlichen Situation, dem Halbdunkel, dem zudringlichen Mädchen und den widerlichen Fleischhaken unter der Decke fürchten sollen, aber stattdessen erschien mir alles so absurd und wie ausgedacht, dass ich lachen musste. Ich versuchte es zu unterdrücken, doch das Lachen bahnte sich seinen Weg und platzte heraus. Als das Mädchen sich wieder zu mir umdrehte, dachte sie wohl, ich würde weinen, denn sie eilte an den Tisch, tätschelte meinen Rücken und sagte: »Oje, oje, dazu gibt es doch keinen Grund!«, woraufhin ich nur noch lauter lachen musste. »Ich habe ihnen doch versprochen, mich um Sie zu kümmern, ja?«, fragte sie händeringend.
Das Gelächter befeuerte den Kopfschmerz, und bald verschwanden die Küche und das Gesicht des Mädchens hinter grellen Lichtblitzen. Ich verstummte, legte mir eine Hand über die Augen und sagte leise: »Weißt du, es ist so, der Kopf tut mir weh, und irgendetwas stimmt mit meinem Herzen nicht …« – wie um mein Herz mit Gewalt in den richtigen Rhythmus zurückzuzwingen, schlug ich mir mit der flachen Hand auf die Brust und sprach dann zu laut weiter –, »… und eigentlich brauche ich nur etwas Wasser für mein Auto …« Ich stand mühsam auf, das Klingeln in meinen Ohren wurde lauter und schien gleichzeitig aus großer Ferne zu kommen, oder aus einem anderen Zimmer. Das Mädchen sprang an meine Seite, schob eine Schulter unter meine Achsel und sagte: »Dann bringe ich Sie jetzt lieber nach oben, ja?« Ich weiß noch, dass ich auf ihren Scheitel hinunterschaute und das Licht auf ihrem bernsteinfarbenen Haar lag wie ein heller Kranz. Es sah aus, als hätte ihr jemand einen strahlenden Heiligenschein auf den Kopf gesetzt, und wieder musste ich lachen, was bedeutete, dass ich sie nicht auf ihren Irrtum hinweisen konnte: Sie erwartete einen anderen, vielleicht stand er längst vor der Tür und wunderte sich, dass niemand ihm aufmachte.
Stattdessen ließ ich mich über eine Treppe in einen langgezogenen Korridor mit abgetretenen Läufern führen. Es kam mir vor, als müssten wir erst einmal an einem Dutzend Türen vorbei, bevor sie stehen blieb und eine von ihnen mit einem beherzten Tritt öffnete. »Da sind wir, so ist es gut – jetzt können Sie sich ausruhen.« Sie schob mich ins Zimmer und machte sofort die Tür hinter mir zu, als wäre sie froh, die unliebsame Aufgabe endlich los zu sein. Ich hörte ihre schnellen Schritte im Flur verhallen.
Als ich schwankend am Türrahmen stand, fiel mein Blick auf ein schmales Bett mit Patchworkdecke und weißem Metallgestell, von dem der Lack abplatzte, und ein leeres Bücherregal. Die zwei Fensternischen liefen nach oben hin spitz zu. In der einen Ecke befand sich eine schmale, halb geöffnete Tür, hinter der ein blau gefliestes Badezimmer zu erkennen war, in der anderen lehnte ein Gemälde in einem schlichten Eichenholzrahmen. Es zeigte einen Puritaner mit weißem Kragen, der mich über seine Bibel hinweg beäugte. Gleich daneben stand ein Pult mit Holzstuhl, und auf dem Hocker am Bett eine Vase mit Blumen, die alles Wasser aufgesogen hatten und schlaff über den Rand hingen; noch während ich hinsah, löste sich eine Blüte und fiel raschelnd zu Boden. Am Fußende des Betts stapelten sich mehrere mit braunem Paketband verschlossene Kisten. Auf jedem Deckel klebte ein großes, weißes Etikett, und alle Etiketten trugen denselben Namen, und der Name war meiner.
Ich weiß nicht mehr, was ich als Nächstes tat. Ich erinnere mich nur an den Anblick der Namensschilder und dass ich mir die Daumen auf die geschlossenen Augen presste, um den Schmerz wegzudrücken. Wahrscheinlich habe ich mich auf das Bett gelegt und bin sofort in einen tiefen Schlaf gefallen.
Viel später wurde ich von einem neuerlichen Klingeln geweckt. Je angestrengter ich lauschte, desto ferner klang es, aber nach einer Weile war ich mir sicher, dass es vom Erdgeschoss heraufkam. Es erinnerte an ein Glöckchen, das monoton geschlagen wurde, lauter zunächst und dann so leise, dass ich es kaum noch hören konnte. Aus den einzelnen Tönen wurde eine Tonleiter und aus der Tonleiter eine Melodie, die mir vage bekannt vorkam, und da wusste ich, ich hörte kein Glöckchen, sondern ein Klavier, auf dem jemand gekonnt und geduldig spielte. Ich stand auf und spürte, wie das Blut mir aus dem Kopf in die Fingerspitzen strömte. Ich trat ans Fenster, um nachzusehen, wo ich war. Direkt unterhalb meines Zimmers befand sich eine steinerne Terrasse, die von weiteren Rosenbüschen gesäumt wurde, wobei diese hier offenbar gewässert worden waren, denn an manchen Zweigen hing noch eine welke Blüte. Die Terrasse war von einer Steinbalustrade umgeben, aus der hier und da ein Stück herausgebrochen war, sodass man direkt auf den Rasen hätte treten können. In der Mitte der Terrasse stand ein steinerner Pfeiler mit einer Sonnenuhr darauf. Ich beugte mich vor, um zu sehen, wie lange ich geschlafen hatte, aber der Zeiger war verbogen und gab zwei Zeiten auf einmal an.
Von diesem Zimmer geht der Blick auf die hinter dem Haus liegende Fläche; der Wald und der Weg, auf dem ich hergekommen bin, sind nicht zu sehen. Neben der Terrasse steht ein Gewächshaus, und der verdorrte Rasen zieht sich etwa hundert Meter weit einen Hügel hinab, bevor Brombeergestrüpp und Nesseln überhandnehmen. Jenseits davon, und nie habe ich etwas Vergleichbares gesehen, erhebt sich ein steiler, etwa fünf Meter hoher Graswall. Obwohl der Hügel und der Rasen ausgetrocknet sind, leuchtet das Gras an diesem Wall in einem so lebhaften Grün, als hätte es eine Wasserquelle gefunden, die es aus reinem Egoismus mit niemandem teilen will. Mit etwas Mühe, dachte ich, könnte man den Wall wohl erklimmen; was dahinterlag, konnte ich nicht sehen. Zur Rechten, am äußersten Rand meines Blickfeldes, entdeckte ich ein verrücktes Gebäude, einen roten Backsteinturm mit einem gelben Licht oben auf dem Zinndach. In diesem Licht sitze ich nun; es scheint so hell, als stünde jemand hinter mir und hielte mir eine Laterne über die Schulter. Der Turm wirkt seltsam deplatziert, und es würde mich nicht wundern, wenn ein paar Ritter in Rüstung heraustorkeln würden und das gelbe Licht auf ihren Lanzen funkelte.
Als ich da am Fenster stand und mich fragte, wie weit ich von meinem Weg abgekommen war und wie lange es wohl dauern würde, zum Auto zurückzulaufen, klopfte es an die Tür. Ich zuckte zusammen wie ein schuldbewusstes Kind. Es klopfte wieder, und dann streckte das Mädchen, das mich heraufbegleitet hatte, langsam den Kopf herein. Sie hatte sich die Haare hochgesteckt, und der Anblick ihres wunderschönen Gesichts, das neben der Tür im Dunkeln schwebte, verschlug mir die Sprache. Sie lächelte und sagte: »Oh, sehr gut, Sie sind wach. Das Abendessen ist fertig. Geht es Ihnen besser? Sie sehen besser aus. Kommen Sie, ich habe Ihnen einen Platz freigehalten. Alle warten auf Sie.«
Dreißig Jahre lang hatte ich nicht mehr gestottert, aber nun war es so weit; meine Zunge war wie gelähmt, und keines der Worte, die ich mir zurechtgelegt hatte, kam heraus (etwas in der Art von: Du bist wirklich sehr freundlich, doch ich fürchte, es liegt eine Verwechslung vor). Noch während ich dastand und stumm die Lippen bewegte, hob das Mädchen den Zeigefinger, richtete sich auf und lauschte; jemand rief nach ihr. Sie verdrehte die Augen und sagte: »Ich muss gehen. Wir sehen uns unten – Sie wissen ja, wo wir zu finden sind.« Damit schlug sie die Tür zu, und ich war wieder allein.
Ich weiß nicht, wann ich zuletzt wütend geworden bin; eigentlich verachte ich Wut, denn sie ist eine bemitleidenswerte Schwäche. Aber mit einem Mal waren die Verwirrung und die Orientierungslosigkeit, die mich den ganzen Tag über geplagt hatten, wie verflogen, und an ihre Stelle trat ein reiner Zorn. Endlich hatte ich meine Lage durchschaut: Ich war einem üblen Scherz zum Opfer gefallen. Ich stellte mir meine Peiniger vor, wie sie unten saßen, über mich lachten und sich von meinem Bruder Wein nachschenken ließen; aber dann fielen mir die mit meinem Namen versehenen Kisten wieder ein, und mein Zorn verwandelte sich in Unbehagen. Meine Erinnerung war nie besonders verlässlich gewesen. Hatte ich etwa eine Verabredung vergessen? Konnte es sein, dass diese Leute mich tatsächlich kannten? Ich kniete vor dem Bett nieder, zog eine große Ledertasche hervor und öffnete die Schnallen, während der Puritaner, der anscheinend eine Sünde witterte, eine Augenbraue hochzog.
Was erwartete ich zu finden – meine gebügelten, gefalteten Kleider? Die Bücher, die ich zuletzt gelesen hatte? Mein Herz klopfte, und ich zuckte zusammen, als hätte etwas nach meiner Hand geschnappt – aber in der Tasche waren nur Kleidungsstücke, die nach fremdem Schweiß rochen, und einige in Tüten verpackte Gegenstände. Vom Ledergriff der Tasche baumelte ein weißes Etikett. Ich hielt es ins Licht und sah, dass es, anders als vermutet, nicht meinen Namen trug, sondern einen, der ebenso anders wie gleich war: JON COULES, stand da in dickem Filzstift geschrieben. Der Name wiederholte sich auf allen Kisten, die sich am Fußende des Bettes auftürmten, und in dem Moment schien die Welt ringsum zum Stillstand zu kommen; ich fühlte mich wie ein Seemann, der nach langer Reise endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Ich sollte hier nicht sein, natürlich nicht – niemand wollte mich hier, und es gab keinen Grund zu bleiben.
Ich strich mir das Haar glatt, band mir die Krawatte neu und ging hinunter. Das Klavier war verstummt, stattdessen hörte ich die entspannten Stimmen von Menschen, die so oft miteinander geredet haben, dass sie ihre Manieren vergessen können. Ich hörte, wie Bestecke fallen gelassen und Teller herumgereicht wurden, und das Geräusch eines Flaschenhalses, der an einen Glasrand schlägt. Hin und wieder lachte jemand auf eine Art, die mir nicht ganz aufrichtig erschien; es war das Lachen des höflichen Zuhörers. Ich folgte den Geräuschen durch die Eingangshalle, an deren hinterem, dunklerem Ende eine Tür leicht offen stand. Heraus drangen Licht und Bratengeruch, und noch etwas anderes nahm ich wahr, meinen eigenen Schweiß. Auf einmal wurde mir klar, wie zerzaust und ungepflegt ich aussehen musste. Ich wollte aber kein Feigling sein, der sich ohne einen Abschiedsgruß davonmacht; ich musste das Mädchen über das Missverständnis aufklären. Also holte ich tief Luft, was meinen Magen kein bisschen besänftigte, und öffnete die Tür.
An einer langen Tafel saßen fünf Personen. Sie redeten und aßen weiter, als hätten sie mich nicht bemerkt. Das weiße Tischtuch reflektierte das Blaugrau der Tapete. Die schummrige Deckenleuchte und alle Lampen im Raum trugen Schirme aus blauem Glas, deswegen wirkte es, als fände die Abendgesellschaft unter Wasser statt. Hinter dem Tisch sah ich eine gläserne Doppelflügeltür, die von der Körperwärme der Anwesenden beschlagen war und auf die Terrasse mit der Steinbalustrade hinausging. Ich konnte den verbogenen Zeiger der Sonnenuhr erkennen, die von dem gelben Licht am Ende des Gartens angestrahlt wurde. Ein riesiger Falter stieß immer wieder gegen einen der blauen Lampenschirme und warf weiche, flirrende Schatten an die Wände. Ein Gemälde mit dunkler, rissiger Patina zeigte einen Mann mit Vollbart und schlauem, aber schüchternem Gesichtsausdruck. Er saß an einem Tisch und hielt ein Metalllineal und einen Zirkel in die Höhe, beide so groß wie Waffen, und auf seiner Hand hatte sich ein zweiter Falter niedergelassen. Am Kopf der Tafel saß ein Mann, kaum älter als ich, in einem mächtigen Eichenstuhl, der an einen Bischofsthron erinnerte. Aus der hohen Lehne ragte ein Kerzenständer mit vielen Armen, und weil irgendjemand gerade die Kerzen ausgeblasen hatte, war der Kopf des Mannes von bläulichem Rauch umkränzt. Er schien es nicht zu bemerken, schaute auf seinen Teller und trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Auch er trug einen Vollbart, überhaupt ähnelte er dem Mann auf dem Gemälde so sehr, dass ich zwischen den beiden hin und her schauen musste und mich nicht gewundert hätte, von demjenigen auf dem Bild angesprochen zu werden.
Die Plätze unmittelbar neben ihm waren leer, und zu seiner Linken saß das Mädchen und bestrich ein Brötchen dick mit Butter. Das Brötchen war warm, die Butter schmolz und lief ihr über das Handgelenk bis in die Ellenbeuge, was sie aber, falls sie es überhaupt bemerkte, nicht zu stören schien; sie plauderte in ihrem höflichen, unverbindlichen Tonfall daher, den zu hören mich so freute, als wären wir gute Freunde. Am anderen Ende der Tafel saß eine Frau mit dem Rücken zu mir. Ihr dickes, graues Haar hatte sie sich zu einem hohen Dutt aufgedreht, der von einem abgebrochenen Bleistift gehalten wurde. Auf der rechten Seite des Mannes im Bischofsthron sah ich einen schlanken Jungen mit schwarz glänzenden Locken, in denen sich das blaue Licht der Lampen spiegelte. Er hielt das Gesicht abgewandt, und ich weiß noch, wie zart und weiß sein Hals mir erschien und dass die Wirbel in seinem Nacken bläuliche Schatten warfen. Er schenkte seine ganze Aufmerksamkeit einem grauhaarigen Mann neben sich, der bequem zurückgelehnt saß und dessen demonstrativ lässige Art mir auf Anhieb unsympathisch war. Sein weißes Hemd war nicht ganz zugeknöpft, er musterte die Fingernägel seiner linken Hand und murmelte leise vor sich hin. Auf dem Tisch befanden sich mehr Speisen, als diese Leute hätten essen können. Das Blumenmuster der angestoßenen Porzellanschüsseln verschwamm zu dunklen Flecken, und überall standen geöffnete Weinflaschen herum.
Ich ließ eine Hand auf der Klinke liegen und wartete darauf, entdeckt und angesprochen zu werden. Das Warten zog sich immer weiter hin, bis ich es nicht mehr aushielt und die Tür so weit aufstieß, dass sie gegen einen an die Wand gerückten Stuhl schlug. Alle verstummten; ein Messer wurde fallen gelassen und hastig wieder ergriffen, und sogar der Falter, der sich ans Lampenglas geworfen hatte, hielt inne und drehte sich zu mir um. Das Mädchen mit dem bernsteinfarbenen Haar stand auf und sagte: »Seht mal, da ist John! Alle mal herschauen, da ist er!« Sie eilte um den Tisch herum, nahm mich bei der Hand und zog mich ins Zimmer. Und natürlich konnte ich nicht widerstehen – sie lächelte mich an, als hätte sie den ganzen Tag auf mich gewartet, und wollte nun endlich mit mir prahlen. »Ich habe euch doch gesagt, dass ich mich um ihn kümmern würde«, sagte sie. »Tja, habe ich, und jetzt ist er hier!«
Ich glaube, ich sagte so etwas wie »hallo« oder »guten Abend«, und noch bevor ich mich losmachen und alles erklären konnte, erhob sich die ältere Frau und drehte sich zu mir um. Sie war sehr groß, ihre Augen befanden sich fast auf derselben Höhe wie meine. Sie kam mir mit ausgebreiteten Armen entgegen. Ich streckte die Hände aus, nicht, weil ich es wollte, sondern, zumindest kam es mir so vor, weil sie es befahl. Sie ergriff meine Finger und sagte in einem herzlichen und gleichzeitig leicht vorwurfsvollen Ton: »Endlich! Sie sehen blass aus – haben Sie geschlafen? Ach, ich bin natürlich Hester.«
»Natürlich«, sagte ich, weil sie es offenbar von mir erwartete, und weil sie mich überrumpelt hatte. Ihre schwarzen Augen blitzten; ich konnte nicht erkennen, wo die Iris endete und die Pupille begann. Ich fühlte mich, als hätte sie mich unter eine Lupe gelegt, um all meine Fehler und meine Tugenden zu sehen, und ich errötete wie nie zuvor im Leben. Gleichzeitig dachte ich bei mir, dass diese klaren, edlen Augen so gar nicht zu ihrer übrigen Erscheinung passten. Ich mache mir praktisch nie Gedanken über das Aussehen der Leute, weder über meins noch über das der anderen, und ich glaube, dass ich noch keinen Menschen hässlich fand. Aber in ihrem Fall fiel mir kein anderes Wort ein als hässlich: Alles an ihr schien schlecht aufeinander abgestimmt, als hätte man sie aus unpassenden Teilen zusammengefügt. Über den Augen wölbte sich eine faltige Stirn, ihre Nase war so krumm wie die einer Hexe im Märchenbuch, die Haut dick und grob. Es war, als hätte sie ihre zauberhaften Augen einer anderen Frau gestohlen. Auf ihren Körper achtete ich nicht weiter, aber jetzt fällt mir wieder ein, wie träge sie die Weinflaschen weiterreichte und wie schwerfällig sie aufgestanden war. Sie war überall mit Speck gepolstert, der Übergang vom Ober- in den Unterkörper praktisch nicht zu sehen, und das Ganze versteckte sie unter einem schäbigen, dunkelblauen Kleid. Sie trug hässliche Ledersandalen mit gerissenen Riemen, ihre Knöchel waren in der Wärme angeschwollen.
»Natürlich, natürlich«, sagte ich und zog die Hände nicht weg. Sie betrachtete mich, als hätte sie meine Gedanken gelesen, wäre darüber allerdings kein bisschen gekränkt, sondern höchstens amüsiert. Sie schob mich zu einem freien Platz und ließ den Arm schweifen: »Clare haben Sie ja schon getroffen. Das ist Elijah …« – der Mann auf dem Bischofsthron nickte ernst und trommelte dann weiter auf die Tischplatte –, »… und kennen Sie Walker? Noch nicht? Walker, schenken Sie unserem Gast ein Glas Wein ein. Weiß, nicht wahr, John?« Ich nickte. Der grauhaarige Mann beugte sich langsam vor und überreichte mir ein viel zu volles Glas. Er sah mich flüchtig und gleichgültig an, zuckte kurz mit den Schultern und wandte sich dann wieder dem Jungen neben sich zu. Hester fuchtelte mit einer Hand in Richtung des Jungen und sagte: »Eve, meine Liebe, wo sind deine Manieren geblieben?« Sie sah mich an und flüsterte: »Ich gebe mir ja wirklich Mühe mit allen, aber ganz ehrlich, manchmal …« Ich nippte an meinem Glas, der schwarzhaarige Junge drehte sich widerwillig zu mir um, und ich verschüttete den Wein. Der nasse Hemdstoff fühlte sich so kalt an, dass ich augenblicklich zu zittern anfing. Der Junge war gar kein Junge, sondern eine Frau, die sich – vermutlich aus Trotz oder Langeweile – selbst die Haare geschnitten hatte. Sie standen ihr in wilden, ungleichmäßigen Locken vom Kopf ab und klebten an ihrer verschwitzten Stirn.
Sie erhob sich und reichte mir über die Tafel hinweg die Hand, klein wie die eines Kindes und mit Dreck unter den Nägeln. Sie war überhaupt sehr schlank und hatte lange Glieder und spitze Knochen, über die sich zarte, weiße, in der feuchten Wärme leicht schimmernde Haut spannte. In einer Art Singsang sagte sie: »Sie müssen hungrig sein, John. Warum setzen Sie sich nicht? Und lassen Sie sich nicht von Walker einschüchtern – denn Sie müssen wissen, er wird es versuchen.« Sie zeigte auf den Mann neben sich, der ein Lächeln verbarg, an der Tischkante ein Streichholz anstrich und sich eine Zigarette anzündete.
Ich glaube, ich sagte, dass ich in der Tat sehr hungrig sei; dann richtete ich mich auf, räusperte mich und setzte zu einer Erklärung an, um endlich das Missverständnis auszuräumen. Aber da näherten sich Hände von allen Seiten, man reichte mir eine Platte mit Lammbraten und geschnittenen Tomaten, schenkte mir Wein nach und gab mir heiße, vom Laib abgerissene Brotstücke, an denen ich mir die Finger verbrannte. Ich fühlte das Stottern auf der Zunge und hielt den Mund. Clare, das Mädchen, das mir die Tür geöffnet hatte, lächelte triumphierend, als wäre ich ein guter Freund, an dessen Existenz die anderen nicht ernsthaft geglaubt hatten; ich wusste nicht, wie ich mich verabschieden könnte, ohne sie zu blamieren. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen schmalen Bachlauf zu überqueren versucht – überzeugt, mit einem einzigen Schritt das andere Ufer zu erreichen –, aber dann war der Bach plötzlich zu einem reißenden Fluss angeschwollen, und jetzt wurde ich aufs offene Meer hinausgetragen.
Gelegentlich wurde ich angesprochen: »Ist es nicht viel angenehmer so, ohne die Sonne, und wäre es nicht wunderbar, sie würde nie wieder aufgehen?«, oder: »John, würden Sie mir bitte das Salz reichen?«, und dann wurde meine Anwesenheit gleich wieder vergessen. Ich kann mich nur bruchstückhaft erinnern: Die junge Frau mit den schwarzen Locken zieht an der Zigarette ihres Tischnachbarn, bis ihr Tränen in die Augen steigen, aber sie weigert sich tapfer zu husten; Clare mit den bernsteinfarbenen Haaren lehnt den Kopf an Hesters Schulter und döst ein; die Finger des alten Mannes trommeln auf die Armlehne des Throns. Nach einer Weile machte sich eine gewisse Unruhe breit, als warteten die anderen auf etwas. Die ältere Frau schaute immer wieder auf die Terrasse hinaus und betrachtete dann stirnrunzelnd ihren Teller. Einmal bemerkte sie, dass ich ihren nervösen Blicken folgte; eine Sekunde lang wirkte sie schuldbewusst, dann reichte sie mir hastig eine Platte mit kalt gewordenem Fleisch.