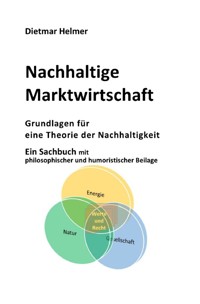
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Warum fällt es uns Menschen so schwer, unsere Lebensgrundlagen zu bewahren und nachhaltiger zu handeln? Warum akzeptieren wir Nicht-Nachhaltigkeit als gegeben und sprechen bei Lösungen wie erneuerbaren Energien, Energiespeicherung und ökologischer Landwirtschaft von Ängsten vor Wohlstands- und Arbeitsplatzverlust? Warum reagieren viele mit Angst auf Veränderung statt motiviert und offen zu sein? Nachhaltigkeit kann nur wirken, wenn wir sie in allen Dimensionen – wirtschaftlich, sozial, ökologisch und rechtlich – umsetzen. Ein Buch über Klimawandel und Nachhaltigkeit sollte eine gewisse Haltung zu einer heiteren Ernsthaftigkeit beinhalten. Zentral sind vier Kernkompetenzen: Staunen, Humor, Mut und Skepsis. Diese führen zu den Handlungen: Wahrnehmung, Haltung, Entscheidungen und Prüfung. Erst im Rückblick bekommt man genügend Einblick, um den Ausblick zu verstehen. Wir sollten daher einen Rundblick zulassen. Mehr dazu in meinem Buch Nachhaltige Marktwirtschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietmar Helmer
Nachhaltige Marktwirtschaft
Reihe 1, Band 1
Nachhaltige Marktwirtschaft
Grundlagen für
eine Theorie der Nachhaltigkeit
Ein Sachbuch mit
philosophischer und humoristischer Beilage
Impressum
Texte: © 2024 Copyright Dietmar Helmer
Umschlag: © 2024 Copyright Dietmar Helmer
Auflage November 2024
Verantwortlich
für den Inhalt: Dietmar Helmer
Washingtonring 119
71686 Remseck-Pattonville
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Danksagung
Im Gedenken an meine erstgeborene Tochter Sophia, die viel zu früh in die Geborgenheit unseres Schöpfers aufgenommen wurde.
In Dankbarkeit an meine zweitgeborene Tochter Tabitha, die bereits als Frühchen einen starken Start ins Leben hatte. Die das Schöne im Leben sieht und wahrnimmt und sich den Widrigkeiten stellt.
In Tapferkeit an meine Lebenspartnerin Brigitte, die nicht verzweifelt ist an den Ihr überantworteten Lebensumständen und mit viel Kraft, Dynamik und Lebensmut ihr Leben meistert. Und die es geduldig mitträgt, dass ich mich auch den Dingen widme, die ich in diesem Buch und auf meiner Website beschreibe.
In Treue zu meinen Eltern Günter und Christa, die mir die Freiräume und Möglichkeiten für ein vielfältiges und gestaltendes Leben gegeben haben.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung2
Inhaltsverzeichnis3
Vorwort11
Aphorismen und Prognosen11
Prolog14
Barometer der Angst14
Angst und Furcht14
Klimawandel – Realität und Wirklichkeit16
Was ist Nachhaltigkeit?17
Wirtschaftswachstum18
Ein erster Gedankengang vorweg19
Ein zweiter Gedankengang vorweg21
Kapitel 124
Narrative – Begriffe – Worte24
Wir wollen Begriffe fassen26
Wort und Begriff26
Suchen – Lernen – Denken28
Schuld und Verantwortung – erster Teil29
Humor: Witz, Pointe, Ironie, Satire30
Schuld und Verantwortung – zweiter Teil32
Realität und Wirklichkeit33
Meinung, Wissen, Wahrheit35
Wissen37
Wahrheit und Wahrnehmung39
Kapitel 240
Wahr oder falsch? Richtig oder falsch?40
Wortbedeutung, ist das wichtig?40
DIE Wahrheit kennen?41
WER sagt die Wahrheit?42
Glauben und Wissen43
Gibt es einen menschengemachten Klimawandel?44
Die Relativitätstheorie und deren Beweisführung45
Quanten und Relativität46
Müssen wir alles verstehen, um etwas zu erkennen?47
Warum wird gebremst, wenn Vollgas auch geht?48
Grenzen und Wahrscheinlichkeiten49
Das Hindernis – Gegenwartspräferenz50
Denken in Alternativen51
Wahr oder falsch? Ist das die richtige Frage?53
Fakten und alternative Fakten54
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung55
VGR und Wohlstand57
Regressives Wachstum59
Verantwortung60
Naturgefahren und Versicherungen61
Adipositas in Gesellschaft und Wirtschaft62
Kapitel 365
Ambiguität, Konvergenz, Emergenz65
Vorwort – Sprache65
Wirtschaftliche Ambivalenz66
Naturwissenschaft und Sozialwissenschaft67
Markt und Staat68
Ambiguität (Unentschiedenheit, Mehrdeutigkeit)70
Ambiguität und Nachhaltigkeit72
Konvergenz (Zustreben und Annäherung)73
Konvergenz in der Wirtschaft74
Konvergenz und Energiewende74
Klimawandel und Kohlenstoff79
Emergenz (Einzelteile – Gesamtheit – Neu und mehr?)82
Transitive Inferenz (Zielführende Schlussfolgerung)84
Homöostase (Selbstregulation, Selbststeuerung)85
Emergenz am Beispiel fossiler Brennstoffe und CO287
Die Eule der Minerva89
Aphorismen zur Volkswirtschaftslehre91
Markt und Moral93
Kapitel 495
Nachhaltige Marktwirtschaft95
Nachhaltigkeit96
Das 3-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit99
Nachhaltigkeit103
„Zeit-Nachhaltigkeit“104
„Dimensionen-Nachhaltigkeit“105
Interpretationsmangel der Nachhaltigkeit107
Die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit109
Wahrscheinlichkeiten und Verschränkung113
Das Säulenmodell „Nachhaltige Marktwirtschaft“114
Soziale Marktwirtschaft116
Definitionsversuch „Nachhaltigkeit“119
Die vier Gesetze der Nachhaltigkeit121
Das Nullte Gesetz der Nachhaltigkeit122
Das Erste Gesetz der Nachhaltigkeit122
Das Zweite Gesetz der Nachhaltigkeit122
Das Dritte Gesetz der Nachhaltigkeit123
Begriffe Ressourcen, Emissionen, erkennbar123
Nachhaltige Marktwirtschaft - Eine Begriffserklärung125
Begriffe nach – halten – Markt – wirtschaften128
Stern-Report130
Energiepreiseruption und Begrenzung131
Erneuerbare Energien134
Komposition und Neologismus137
Kapitel 5142
Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit142
Ökologische Betrachtung142
Sozialwissenschaftliche Betrachtung144
Größte Herausforderung der Menschheit145
Moderne Konsumgesellschaften146
Oxymoron147
Transformation147
Die Anderen waren’s148
Gedankenknechtschaft148
Rechtsfertigungsdruck und Moralisierungszwang149
Haben wir es gewollt?149
Die Realität der Zahlen zum Weltenergieverbrauch151
Diagnosen und Strategien152
Theorie der nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit153
Widerspruch154
Konkrete Handlungsanweisungen?159
Beispiel CO2-Abgabe und Klimageld160
Kapitel 6166
Effizienz und Effektivität166
Effizienz und Machbarkeit167
Effektivität und Wirksamkeit168
Was bedeutet richtig?168
Verzicht169
Intrinsischer oder extrinsischer Verzicht171
Kognitive Wahrnehmungsverzerrungen173
Projektionsfehler – Projection Bias173
Überlegenheitsverzerrung – Illusory Superiority173
Begriffe Verkehr und Mobilität175
Entscheidungen treffen176
Verhaltensänderung vs. Strukturänderung177
Alternativen statt Dichotomie (Zweiteiligkeit)177
Was ist Ihre Motivation, über Verzicht zu sprechen?178
Metaphern179
Treibhausgase und KOMEDI180
Treibhausgase und Maulwürfe181
Das Equilibrium des Kapitalismus183
Photosynthese und Photovoltaik184
mRNA und CRISPR/Cas9185
Aspekte der Untätigkeit185
Symmetrisierung und Sinn187
Haiku189
Sinnstiftende Aussichten191
Deepwater Horizon192
Ölkönig192
Wer ist wir und uns?194
Sokratische Methode196
Kapitel 7198
Bürgerstrom – ein Neologismus198
„Bürgerstrom“, „Bürgerprojekt“, „Bürgerenergie“199
Energiewende und Klimawandel200
Das EEG – eine Erfolgsgeschichte202
Kontamination – Kofferwort203
Energiesektoren204
Sektorentrennung neu denken205
100% erneuerbare Energien206
Der Erfolg des EEG war sein Rückschlag206
Energiewende und Bürgerstrom als Gesamtkonzept207
Altersvorsorge neu: Sparvertrag mit Kilowattstunden?210
„Neue“ Altersvorsorge-Idee der Bundesregierung?211
Manifestationspyramide für Komplexe212
Zum Schluss214
Anmerkungen und Quellenverzeichnis215
Quellen Vorwort und Prolog217
Quellen Kapitel 1219
Quellen Kapitel 2220
Quellen Kapitel 3222
Quellen Kapitel 4223
Quellen Kapitel 5226
Quellen Kapitel 6228
Quellen Kapitel 7230
Weitere allgemeine Quellen234
Über den Autor236
Autorenbilder240
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser
werden wird, wenn es anders wird;
aber so viel kann ich sagen, es muss anders
werden, wenn es gut werden soll.
Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799)*
Vorwort
Fange nie an aufzuhören,
höre nie auf anzufangen.
Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.),
römischer Redner und Staatsmann
Aphorismen und Prognosen
Meiner Meinung nach ist es wichtig, ein Buch über den Klimawandel und zur Nachhaltigkeit mit einer gewissen Haltung zur heiteren Ernsthaftigkeit zu schreiben. Oder sollte es besser geschrieben sein mit einer Haltung zur Gewissheit einer ernsthaften Heiterkeit?
Wenn ich in diesem Buch auf verschiedene Weise psychologische oder philosophische Reflexionen einfließen lasse, liegt das auch daran, weil ich dem Autor Thomas Stölzel* in einer wichtigen Grundannahme folge: Es gibt mutmaßlich vier Kernkompetenzen, aufgrund derer wir in der Lage sein können, professionell mit Fragestellungen umzugehen und dies auch in unserem persönlichen Umfeld nutzbar zu machen:
Wie sein Buchtitel bereits verrät, heißen diese vier philosophischen Kompetenzen:
Staunen, Humor, Mut und Skepsis.
Daraus ergeben sich vier Handlungsweisen:
Wahrnehmen, Haltung einnehmen,
Entscheiden und Prüfen.
Erst im Rückblick bekommt man genügend Einblick, um den Ausblick zu verstehen. Ob wir den Ausblick ertragen können, hängt von unserer Fähigkeit ab, einen Rundblick zuzulassen.
Einblick in die Zukunft erhalten wir, wenn wir der Zukunft Einblick in unsere Gedanken lassen.
„Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“* Selbst ein so eingängiges Bonmot hat einen unbekannten Ursprung und wird gerne gebraucht, um zu vermeiden, über unangenehme Dinge, welche die Zukunft betreffen, reden zu müssen.
Aber wir tun es ständig: Wirtschafts- und, Unternehmensprognosen, Wohnungs- und Mietpreis-prognosen, Lohn- und Rentenprognosen …
Es wird hemmungslos prognostiziert. Wenn es um das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den angeblichen Wohlstandszuwachs geht, ist nichts schwierig. Versprechen diese Prognosen doch mehr Gewinne, mehr Wohnungen, mehr Renten, mehr Löhne …
Deshalb Zitat 1-änd.: „Prognosen sind gut, vor allem, wenn sie die Zukunft der wirtschaftlichen Vermehrung von Gütern, Dienstleistungen, Digitalisierung und Konsum betreffen.“
Wenn es um die wirklich großen Fragen unserer Zeit geht, wie Biodiversität, Artenschutz, Klimaerwärmung, fossile Brennstoffe, Ernährung, sind Prognosen eher unerfreulich erscheinend.
Deshalb Zitat 2-änd.: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie uns vor Augen halten, wie sich die von uns aktuell betriebene Art und Weise, wie wir heute Güter, Dienstleistungen, Digitalisierung und Konsum wirtschaftlich vermehren, wahrscheinlich auf die Zukunft auswirken wird.“
Gute Prognosen gehen immer. Schlechte Prognosen will niemand hören. Bisher hat das scheinbar gut funktioniert. Aber bei ehrlicher Gesamtbetrachtung hat es nie wirklich gut funktioniert.
Es sei denn, man setzt – „ceteris paribus“ (= unter sonst gleichen Umständen)oder heißt es „Hokuspokus“ – Verdrängung als Leitgedanken allen menschlichen Handelns voraus.
Deshalb Zitat 3-änd.:
Prolog
Barometer der Angst
Wenn man fragt, wovor „die Deutschen“ Angst haben, dann sind deren 7 größten Ängste im Jahr 2024*:
steigende Lebenshaltungskosten, Überforderung des Staates durch Geflüchtete, Wohnen in Deutschland unbezahlbar, Spannungen durch Zuzug ausländischer Menschen, Steuererhöhungen und Leistungskür-zungen, Überforderung der Politiker und Politiker-innen, Spaltung der Gesellschaft. Klimawandel und Umwelt sind unter den Top 12 nicht mehr zu finden.
Angst und Furcht
Unsere größten Ängste haben also mit persönlichem Wohlstandsverlust zu tun. Warum ist das so? Warum haben wir weniger Angst vor den Dingen, von denen wir glauben, sie seien zeitlich oder räumlich weit weg von uns?
Vor dem Klimawandel sollten wir uns besonders ängstigen oder besser gesagt fürchten, weil er uns großen Wohlstandsverlust bescheren kann.
Angst* führt zu Beklemmung bis hin zur Erstarrung. Angst ist unbestimmt. Sie ist deshalb schwer zu begreifen. Angst kann als eine Kombination von Furcht mit anderen Grundgefühlen wie beispielsweise Neugierde, Überraschung, Kummer, Wut und Scham verstanden werden.
Furcht hingegen ist eineBasisemotion. Wir reagieren dabei typischerweise auf einen äußeren Reiz, auf eine Gefahr oder eine vermutete Gefahr. Wir können vor Angst erstarren, wenn wir eine Spinne sehen, panisch reagieren. Die Spinne ist wahrscheinlich deutlich relaxter. Haben wir Furcht vor einer Spinne, können wir uns bewusst machen, was unser Angstgefühl hervorruft, wovor wir Angst haben – um dann nach Lösungen zu suchen.
Dazu gibt es tiefgreifende psychologische und evolutionäre Erklärungen. Einer der Hauptgründe ist unsere nicht sonderlich ausgeprägte Fähigkeit, Wahrnehmungsverzerrungen als solche zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Dies wiederum hängt mit unserer meisterhaften Fähigkeit zur Verdrängung zusammen. Sie ist überlebens-notwendig, hindert uns aber daran, die wirklich wichtigen Fragen unseres Daseins an- und auszusprechen und Lösungen zu erarbeiten.
Eine Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten,
können wir nur überwinden durch Bilder
von einer Zukunft, die wir wollen.
Wilhelm Ernst Barkhoff
Klimawandel – Realität und Wirklichkeit
In diesem Buch und auf meiner Website stelle ich Lösungskonzepte und Ideen vor, wie wir dem Klimawandel mutig und kraftvoll begegnen können.
Dystopische (düstere, bedrückende) Beschreibungen des Klimawandels gibt es genug und sie werden täglich von Medien und vielen Klimabewegten und ihren Antipoden aufgezeigt. Weil uns die Zukunft als fürchterlich dargestellt wird, verdrängen viele die Tatsachen und Möglichkeiten für das Tun und Können.
Man sieht nicht mehr die (objektive) Realität, sondern man windet sich wie ein Aal in der (subjektiven) Wirklichkeit. Die daraus entstehenden Bias (Verzerrungen) sind ein wesentlicher Grund dafür, dass Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Lebensweise nur sehr zögerlich angenommen werden.
Was ist Nachhaltigkeit?
Die zentrale Frage, auf die ich in diesem Buch andeutungsweise eine Antwort zu geben versuche, lautet:
Was ist Nachhaltigkeit?
Was verstehen wir überhaupt unter Nachhaltigkeit?
Gibt es eine Definition für den Begriff Nachhaltigkeit?
Wir werden sehr bald feststellen, dass wir uns in einer Kakofonie und Dissonanz zu Definitionen des Begriffs Nachhaltigkeit befinden. Da verschiedene Menschen sehr unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen des Begriffs Nachhaltigkeit, öffnen sich leider viele Menschen nicht für die objektive Realität.
Damit möchte ich ausdrücken, dass es je nach Betrachtung der wirtschaftlichen, ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeit zu unterschiedlichen Interpre-tationen kommen kann. Dabei verschließen sich viele einer konstruktiven Debatte über die übergeordnete Bedeutung der Nachhaltigkeit für Klima, Artenschutz, Biodiversität etc.
Die Vereinten Nationen haben es sogar geschafft, 17 Ziele* für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) zu formulieren.
Bei so viel Nachhaltigkeit brauchen wir meines Erachtens ein Wirtschaftsmodell, das diesen vielen Nachhaltigkeitsthemen gerecht werden könnte. Mein Vorschlag: „Nachhaltige Marktwirtschaft“*.
Verstehen Sie meinen Vorschlag als Grundlage für eine Theorie. Wenn Sie wollen, gerne auch nur als Grundlage für eine These.
So wie Sie die X-anderen Ideen des Wirtschaftens in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, in der Philosophie und in vielen anderen Wissenschaften als Hypothesen, Thesen, Theorien betrachten sollten.
Wirtschaftswachstum
Die Theorie des stetigen (exponentiellen) Wirtschaftswachstums ist bis heute sehr umstritten. Sie wird jedoch gelebt und auf Zahlenwerke wie das Bruttoinlandsprodukt oder die „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung“ reduziert.
Dieses Narrativ, diese Erzählung wird uns seit Jahrzehnten von den meisten Unternehmen und Wirtschaftswissenschaftlern in epischen Studien, Lehren, Büchern, Vorträgen, Statistiken so präsentiert, dass wir den Blick für den wahren Kern dieser Erzählung gar nicht mehr erkennen und aus der Angst heraus nicht mehr bereit sind, diese Theorie ernsthaft zu hinterfragen. Warum fürchten wir uns davor, zu lernen, was fehlerhaft ist an der Theorie des stetigen Wachstums?
Liegt es daran, dass es nicht opportun ist, zu hinterfragen, was (stetiges, wirtschaftliches) Wachstum überhaupt bedeutet?
Wie der Begriff Nachhaltigkeit, ist auch der Begriff Wachstum ambigue (mehrdeutig) und wir wirren und wogen umher auf offenem Meer mit unbekanntem Kurs und unbekanntem Ziel.
Wenn Sie Freude daran haben, solche Fragen mit- oder weiterzudenken, sich auf das unbekannte Terrain einzulassen, um neue Länder, Orte oder „Galaxien“ zu entdecken, dann sind Sie hier richtig.
Verschiedene Aspekte, die auch weit über Nachhaltigkeit im engeren Sinne hinausgehen, habe ich auf meiner Website veröffentlicht.
Ein erster Gedankengang vorweg
Wir Menschen leben gerne in unseren (subjektiven) Wirklichkeiten. Dabei vergessen wir gerne, dass es eine (objektive) Realität gibt.
Philosophen diskutieren seit Ewigkeiten darüber, was denn nun ist, das Sein oder das Dasein? Ich will es mal auf den Punkt bringen: Es ist beides Existenz. Es ist da, es ist vorhanden. Sei es materiell oder „nur“ in unseren Gedanken.
Moderne Technologien verwirren uns weiter mit dem Paradoxon „Virtuelle Realität“. Denn es müsste tatsächlich „Virtuelle Wirklichkeit“ heißen. Zumindest im Deutschen. Im englischen Sprachgebrauch verschwimmen die Begriffe und man spricht mal von „reality“ mal von „actuality“.
Und jeder Begriff kann für beide Wortbedeutungen stehen. Machen wir uns also nichts draus. Egal in welcher Sprache Sie sich ausdrücken:
Bleiben Sie in Ihrer Wirklichkeit,
die Realität wird Ihre Gedanken schon einholen.
Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären,
sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner
allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit
vertraut gemacht ist. Max Planck*
Ein zweiter Gedankengang vorweg
Vicco von Bülow alias Loriot* würde es möglicherweise folgendermaßen formuliert haben:
„Die Ente bleibt draußen.“
In Anlehnung an einen Sketch von Loriot möchte ich es metaphorisch so formulieren: „Wer die Welt in viereinhalb Minuten nach Gefühl erklären will, der hat bisher zu wenig Eier selbst gekocht.“
Loriots begnadeter und virtuoser Wortwitz zeigt, wie in diesen kurzen gesellschaftskritischen Sequenzen Ambiguität, Konvergenz und Emergenz zusammenfließen oder auseinanderdriften und doch zusammengehören und mehrdeutig sind.
Welche Lösung bevorzugen Sie für das Ei-Problem? Oder geht es gar nicht um das Ei?
Die Suche nach Orientierung oder gar Lösungen beginnt mit dem Lernen (wollen) und dem sich daraus ergebenden Denken (wollen).
Die Antwort für „Alles“ kennen wir: „42“*. „Ach was!?“ Fragen Sie sich, woher die Antwort „42“ kommt? Sie können Bücher darüber lesen, was dahinterstecken könnte. Der Autor von „Per Anhalter durch die Galaxis“, Douglas Adams, gab auf diese Frage folgende Antwort:
„Die Antwort darauf ist ganz einfach. Es war ein Scherz. Es musste eine Zahl sein, eine gewöhnliche, kleine Zahl, und ich habe diese gewählt. Binäre Darstellungen, die Basis dreizehn, tibetische Mönche - das ist alles völliger Unsinn. Ich saß an meinem Schreibtisch, starrte in den Garten und dachte: „42 wird genügen.“ Ich tippte es hin. Ende der Geschichte.“
Wenn Sie richtig auf Spaß oder Ernst aus sind, wie „wichtig“ die Zahl „42“ für unser Universum ist, dann können Sie sich mit der „Theorie der endlichen Kugelpackungen“ beschäftigen. Sie tauchen ein in die Wurstvermutung* und die Wurstkatastrophe.
Es geht nicht um vegane Ernährung und die Interpretation darüber, ob in einem Fleischprodukt Fleisch oder ein Ersatz dafür beinhaltet ist. Es geht natürlich nicht wirklich um die Wurst und deren denkbaren Klimafolgen.
Es geht um ernst zu nehmende mathematische Fragestellungen und auch um wirtschaftliche Fragen, wie u.a. die Gestaltung einer optimalen Pizzaverpackung oder eines optimalen Containers.
Eine weitere Antwort: „Holleri du dödl di. Diri dudl dö.“
Übrigens: Wussten Sie, dass der französische Name Loriot auf Deutsch Pirol heißt und der gleichnamige Vogel nach „Brehms Thierleben“* auch den Namen „Bülow“ trägt?
Der Ton der Zärtlichkeit ist ein sanftes »Bülow«. Die Stimme des Männchens, welche wir als Gesang anzusehen haben, ist volltönend, laut und ungemein wohlklingend.
Kapitel 1
Narrative – Begriffe – Worte
Warum kommt die Menschheit global nicht REAL voran, wenn es darum geht, die Klimafolgen der anthropogen verursachten Schäden an der Natur und dem Klima zu vermeiden oder zu reduzieren?
Weil Gesellschaften, Unternehmen, Organisationen, Menschengruppen und Individuen sich in ihren WIRKLICHKEITEN aufhalten.
Es fehlt der Überblick über die komplexen Zusammen-hänge und Wirkungsweisen großer Systeme. Man verschanzt sich in der Annahme, die großen Fragen der Menschheit „NUR global“ lösen zu können.
Viele sind nicht bereit, anzuerkennen, dass einige dieser „globalen“ Lösungen in den tausendfachen „lokalen“, dezentralen Lösungen liegen.
Anzuerkennen, dass die wirtschaftsorientierten Wohlstandsgesellschaften andere Lösungen brauchen, wie beispielsweise Länder des globalen Südens, wie man die Ortsbestimmung bestimmter Staaten heutzutage nennt. Diese grobe Einteilung erscheint mir ohnehin zu primitiv.
Sie bedient Narrative (Erzählungen), die so nicht schlüssig sind. Oder will mir jemand beweisen, dass Länder wie Deutschland und Monaco oder China und Mauritius die gleichen Fragestellungen zu beantworten haben und die gleichen Lösungen brauchen?
Hier liegt einer meiner Ansatzpunkte. Ich hinterfrage, ob all die Narrative, die zu unserem Handeln, Dulden oder Nichtstun führen, auf Erzählungen beruhen, die ohne Grundlage, ohne Fundament sind.
In der Wissenschaft ist es erforderlich, dass etwas bewiesen wird. Dieses Prinzip versucht man auf die Gesellschaft zu übertragen: „Erst wenn wir 100%ig wissen, dass es einen Klimawandel gibt und erst wenn wir 100%ig wissen, dass der Mensch die Ursache ist, dann sollten wir anfangen zu handeln.“
Diese Einstellung führt bei Akademikern und allen anderen Menschen dazu, in Rechthaberei zu verfallen, ohne die vor uns liegenden Herausforderungen aktiv und lösungsorientiert anzugehen.
Was hindert viele Menschen daran, Wahrscheinlichkeiten zu akzeptieren und daraus Entscheidungen zu treffen, die nicht nur dem eigenen Wohle dienen, sondern auch dem Wohle der Gesellschaften und der Natur?
Wir wollen Begriffe fassen
Im folgenden Abschnitt und im gesamten Buch beschreibe ich Worte. Dabei stütze ich mich auf das Lexikon des DWDS*. Wer Freude an der Herkunft und Bedeutung, der Etymologie von Worten hat, kommt auf seine Kosten.
Wer darüber hinaus den Thesaurus erfassen möchte, also Zusammenhänge und das Umfassen von Inhalten, den Reichtum und die Fülle der Worte und der Sprache, lässt sich ein auf
Ambiguität (kurz: Mehrdeutigkeit),
Konvergenz (kurz: Annäherung, Zusammentreffen),
Emergenz (kurz: Sinn und Schein vertiefen).
Wort und Begriff
Ein Wort ist dabei die kleinste Sinneinheit einer Äußerung. Wir beschreiben etwas, wir „beschriften“ es. Der Sinn oder die Bedeutung des Wortes kann für sich alleinstehen, wird aber erst umfassend spannend, wenn wir ihm durch andere Worte weiteren Sinn geben.
Beispiel: Baum, schöner Baum, großer Baum, Baum im Weg, Baum muss weg, lebendiger Baum, viele Bäume, Baum im Wald, Baum an der Straße, Linde, Ahorn, Schwarzwald, Amazonas … Wir ordnen dem Wort eine Begrifflichkeit zu.
Dabei werden Begriffe wie Nachhaltigkeit, Klimawandel, Kapitalismus in so vielen Sinnzusammen-hängen beansprucht (im Wortsinn: Anspruch im Sinne von Forderung), dass wir erfolgreich und folgenreich aneinander vorbeireden. Glaubt jemand, seinen präfrontalen Kortex zu überlasten, nur weil man über etwas nachdenkt? Nur weil man zu wenig über eine Sache oder deren Auswirkungen weiß, bedeutet das doch nicht, nichts darüber wissen zu wollen? Dann denken andere für einen – oder eben auch nicht – oder anders, wie man es sich wünscht oder vorstellt.
Suchen – Lernen – Denken
Wenn man etwas sucht, könnte man landläufig meinen, auch etwas finden zu müssen. Suchen kann aber auch bedeuten, zu versuchen, etwas zu erreichen. Man kann auch „das Weite suchen“, also weglaufen oder „hinter allem etwas suchen“, also vermuten, misstrauisch sein.





























