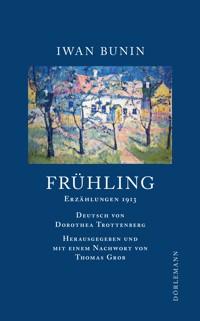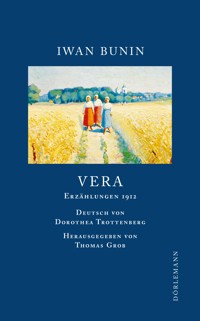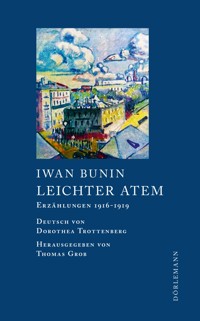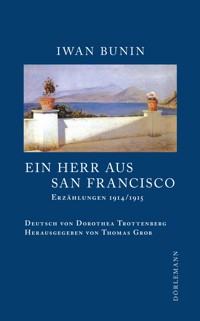19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachts auf dem Meer, auf einem Dampfer in Richtung Krim, begegnet ein Passagier zufällig dem Mann, der ihm vor Jahren seine geliebte Ehefrau abspenstig gemacht hat – und die Erinnerungen kommen wieder hoch.In den 28 Erzählungen, von denen 15 erstmals ins Deutsche übersetzt sind, spiegeln sich die politischen Umwälzungen von Revolution und Bürgerkrieg (»Der rote General«) und vor allem Bunins Zerrissenheit in den ersten Jahren der Emigration. Frankreich bietet ihm Sicherheit, aber er erkennt seinen Verlust, der sich in bitteren Reflexionen ebenso zeigt wie in emotionalen erzählerischen Reminiszenzen an das verlorene Russland: »Längst Vergangenes« (so der Titel einer Erzählung) gibt den bittersüßen Kammerton dieses Bandes vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Iwan Bunin
Nachts auf dem Meer
Erzählungen 1920–1924
Aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg und Swetlana Geier
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Thomas Grob
DÖRLEMANN
Swetlana Geier übersetzte die Erzählung »Ein unbekannter Freund«. Alle anderen Erzählungen wurden von Dorothea Trottenberg übersetzt. Die Übersetzung der Erzählungen »Der Meteor«, »Temir-Aksak-Khan«, »Der wahnsinnige Maler«, »Die Schnitter«, »Über den Narren Jemelja, der allen ein Schnippchen schlug«, »Das Ende«, »Die Nacht der Verleugnung«, »Längst Vergangenes«, »Der Stern der Liebe«, »Verklärung«, »Es war einmal«, »Nachts auf dem Meer«, »Das verzehrende Feuer« und »Immerwährender Frühling« folgt der Ausgabe: Bunin, Iwan: Rosa Ijerichona. Berlin: Slowo, 1924. Die Übersetzung der Erzählungen »Der Hierarch«, »Namenstag«, »Die Göttin«, »Musik«, »Der Blinde«, »Genosse Dosorny«, »Fliegen«, »Der rote General«, »Die Bastschuhe«, »Ruhm«, »Inschriften«, »Der Feldhase« und »Das Buch« folgt der Ausgabe: Bunin, Iwan: Mitina ljubow. Paris: 1925. Die Übersetzung der Erzählung »Ein unbekannter Freund« folgt der Ausgabe: Bunin, Iwan: Sobranie sotschinenii w dewjati tomach. Moskwa: Chudoschestwennaja literatura 1966 (Bd. 6). Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © The Estate of Ivan Bunin © 2022 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Porträt Iwan Bunin: The Estate of Ivan Bunin Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-994-2www.doerlemann.com
Inhalt
Iwan Bunin
Der Meteor
Weihnachten, viel Schnee, klare Frosttage, die Droschkenkutscher fahren rasant und übermütig, ab zwei Uhr spielt auf der Eisbahn im Stadtgarten die Militärmusik.
Etwa drei Werst von der Stadt entfernt liegt ein altes Kiefernwäldchen.
Lachend und plaudernd fahren sie über das verschneite Feld darauf zu, mit den Füßen auf den langen schwedischen Skiern hin und her gleitend, in der rechten Hand lange, dünne Stöcke mit einem Rädchen am Ende – ein Lyzeumsschüler, eine Gymnasiastin, ein hochgewachsener, fülliger, reicher junger Mann, ein Kadett und eine Kursistin mit Pincenez, sehr kurzsichtig, linkisch und überaus zartbesaitet. Sie allein schweigt, sie fährt am bemühtesten und am schlechtesten von allen. Die anderen sind so gekleidet, als ob sie zur Eisbahn gehen würden. Sie allein trägt einen richtigen Skianzug, ein weißes Strickhemd und eine ebensolche Kappe.
Das Wäldchen kommt näher, wird malerischer, majestätischer, dunkler und grüner. Darüber steht schon der durchsichtig-blasse, runde Mond. Rechter Hand streift die klare Sonne in der Ferne beinahe schon die goldglitzernde, zartgrün getönte Schneefläche.
Die Kursistin ist allen voraus – bisweilen stolpert sie und verliert ihr Pincenez, doch taucht sie als Erste in das Wäldchen ein, in eine lange Schneeschneise zwischen den Mastkiefern. Der Skianzug liegt eng um ihr großes Hinterteil und um die Brust. Der lebhafte, braungebrannte, breitnasige Kadett, der kaum einen Schritt hinter ihr zurückbleibt, macht sich in einem fort über sie lustig und reißt Witze. Sie antwortet ihm jedes Mal scharf und schlagfertig, redlich bemüht, das Ihre zu tun. Dennoch, irgendetwas ist da zwischen ihnen.
Im Wäldchen dunkelt der Abend, es friert, der hohe Himmel über der Schneise wird kalt und tiefblau; weit vorne, jenseits der Lichtung, färben sich die Wipfel einiger besonders hoher Kiefern rot. Im Wäldchen ist es noch süßer, sich jung zu fühlen, festtäglich, stets irgendeinem Glück ganz nah, und diese winterliche, ätherische Luft zu atmen. Der Lyzeumsschüler wartet ungeduldiger als alle anderen auf das Glück und bleibt immer dicht neben der Gymnasiastin.
Besonnener als die anderen ist der reiche junge Mann mit seinem stets ungemein zarten Teint, mit seiner feinen, fleckigen, aristokratischen Röte.
Auf der Lichtung halten sie inne, fröhlich machen sie Rast und reden alle auf einmal, die Männer rauchen und empfinden einen besonderen Genuß am Tabak. Sie alle haben erhitzte Gesichter, glänzende Augen und Spuren von Rauhreif an den Wimpern.
»Wohin jetzt?«
»Hinunter zum Fluß natürlich!«
»Da kommen noch mehr Skifahrer, Herrschaften!«
»Wer denn? Sind das etwa die Iljins? Wie schön, daß wir sie treffen!«
Von der Lichtung aus verzweigen sich Fluchten hoher Alleen nach allen Seiten hin. Auf derjenigen, die direkt zum Fluß führt, nähern sich zwei Gestalten, ein Mann und eine Frau. Man hört das hellklingende, aufgesetzt wirkende Lachen der Frau.
»Wer ist das?« fragt die Gymnasiastin den Lyzeumsschüler. »Sie sehen besser als ich.«
»Ihre Partner bei der Theateraufführung. Die Salesskaja und Potjomkin.«
»Ach, ich will ihnen nicht begegnen. Ich kann die Salesskaja nicht ausstehen. Gehen wir irgendwo anders hin. Wir treffen uns mit den anderen auf der Wiese.«
»Zu Befehl. Herrschaften, wir verabschieden uns vorerst von Ihnen. Wir sehen uns am Fluß.«
»Wieso denn das?« fragt der Kadett und rollt albern mit den Augen. »Was hat das plötzlich zu bedeuten?«
»Es wird Zeit, daß wir die Fronten klären«, antwortet die Gymnasiastin lachend. »Au revoir, Herrschaften. Sie können uns beneiden.«
Einander bei den Händen haltend, fahren der Lyzeumsschüler und die Gymnasiastin in eine Waldschneise zur Rechten. Sie werden von Abschiedsrufen und Scherzen begleitet.
Dem Lyzeumsschüler schlägt das Herz bis zum Hals. Er spürt, daß sie unter dem Deckmantel einer scherzhaften Bemerkung, mit dieser gelassenen, verblüffenden Beherztheit, zu der nur Frauen fähig sind, die Wahrheit gesagt hat. Er weiß, daß an den Festtagen zwischen ihnen auch ohne Worte alles gesagt war, daß sie lediglich auf den Moment und den Mut warten, das ohne Worte Gesagte umzusetzen. Und nun ist dieser Moment plötzlich gekommen. Doch sie gleitet dahin und schweigt, und seine Aufregung steigert sich durch den Zweifel, ob er sich nicht vielleicht täuscht.
Sie schweigt und gleitet mit ihren Skiern ruhig dahin, als ob nichts weiter wäre. Und vor Aufregung schweigt auch er, oder aber er sagt etwas ganz und gar Überflüssiges.
»Sollen wir uns links halten? Dort ist der Schnee tiefer …«
»Nein, danke, mir gefällt es hier …«
Wieder stieben sie schweigend und leicht nach vorn geneigt auf den Skiern dahin. Der Schnee zwischen den rosaroten Stämmen der Kiefern ringsum wird tiefer und weißer, die Kiefern stehen dichter und verschneiter. Der Abend wechselt sachte die Farben, verschmilzt mehr und mehr mit der anbrechenden Mondnacht.
»Oh, ich glaube, ich bin müde!« sagt sie schließlich, wobei sie ihm ihr gerötetes Gesicht zuwendet und leicht lächelt. »Wohin laufen wir? Wir werden uns verirren …«
Sein Herz stockt beinahe, aber er erwidert, bemüht, so beiläufig wie möglich zu sprechen:
»Nur noch ein kleines Stück. Bald kommt wieder eine Lichtung mit einer Bank – erinnern Sie sich nicht? Laufen Sie ruhiger und gleichmäßiger. So etwa: und eins und zwei … und eins und zwei …«
Auf der Lichtung, bei der im Schnee versunkenen Bank, läßt er ihre Hand los und empfindet erst dann, welch ein Entzücken es war, diese Hand zu halten, die in sich den ganzen Reiz ihres weiblichen Wesens zu bergen schien.
Er tritt den Schnee um die Bank herum fest, schabt mit seinem Ski das Schneekissen von der Bank und wedelt mit seinem Taschentuch die trockenen Schneereste herunter. Sie setzt sich und schließt für einen Moment selig die Augen.
»Wie schön. Diese Stille! Was sind das für Vögel?«
In den Wacholderbüschen flattern dicke, kropfige Gimpel mit roter Brust.
»Das sind Gimpel.«
»Wie schön sie sind!«
»Soll ich einen töten?«
Er zieht einen kleinen Revolver aus der Tasche.
»Nein, bitte nicht«, erwidert sie mit zaghaftem Lächeln.
Ein dicker Gimpel fliegt näher heran.
»Sehen Sie, er kommt dem Tod selbst entgegen. Also schieße ich.«
»Nein, nein, bitte nicht.«
»Haben Sie Angst?«
»Nein, aber ich will nicht …«
Sie versucht den Gimpel mit einer leichten Handbewegung zu verscheuchen, der aber kommt noch näher herangeflogen. Im selben Moment ertönt wie ein Peitschenknall der Schuß, und sie schließt erschrocken die Augen und hält sich die Ohren zu.
Der Gimpel ist nicht mehr im Gebüsch. Gewiß ein Fehlschuß?
Als sie den Blick heben, sehen sie den Mond in den Wipfeln der Kiefern schon hell leuchten und daneben einen silbrigen Falken kreisen, der durch den Schuß aufgeschreckt wurde. Dann blicken sie zum Gebüsch. Der Gimpel liegt wie ein zerzauster Bausch im Schnee.
»Das ist vollkommen unglaublich!« ruft der Lyzeumsschüler und stürzt sich auf den Vogel. »Mit dem Revolver, und sofort getroffen!«
Noch intensiver spürt er, daß die Zeit vergeht, während sie beide das ganz und gar Falsche sagen und tun.
»Tut er Ihnen nicht leid?« fragt sie, während sie den noch warmen Gimpel genau betrachtet.
»Ach wo, kein bißchen!« flachst er bedrückt und erschauert innerlich beim Anblick ihrer Lippen, ihres Pelzkragens und ihrer kleinen Stiefel im Schnee. »Sie haben Blut an der Hand …«
Sie legt den Gimpel auf die Bank und sieht fragend und abwartend zu ihm auf.
»Gestatten Sie, daß ich es mit Schnee abwische …«
Sie hält ihm ihre Hand hin. Er wischt sie ab, wie gelähmt von dem brennenden Wunsch, sie zu küssen, zu beißen.
Der Abend ist schon fast vorbei. Der Mond zwischen den Kiefern ist schon mattglänzend. Im hellen Schatten der Kiefernwipfel hat der Schnee nun die Farbe von Asche, und an den vom Mond beleuchteten Stellen glitzert er wie Diamanten. Es friert jetzt noch stärker.
»Aber was machen wir nur?« sagt sie und steht unvermittelt auf. »Wir riskieren doch, daß wir sie nicht finden. Kommen Sie schnell!«
Wieder fassen sie einander bei den Händen und stieben auf den Skiern eilig davon. Zehn, fünfzehn Minuten vergehen …
»Warten Sie! Mir scheint, wir fahren in die falsche Richtung! Wo sind wir? Schon wieder eine Lichtung …«
»Nein, wir sind richtig«, sagt der Lyzeumsschüler. »Sehen Sie, die Lichtung ist abschüssig, sie fällt zum Fluß hin ab. Wir sind die ganze Zeit nach links gefahren, ohne es zu merken …«
Doch sie bleibt stehen und blickt verwirrt um sich. Die Lichtung ist still und tief verschneit. Über ihnen glänzt der Mond nun schon tiefnächtlich, die Schatten zwischen den Kiefern sind schwarz und scharf umrissen, am Rand der Lichtung ist eine schwarze, fensterlose Kate in den Schneewehen versunken, und ihr verschneites, rundlich-weiches Dach glitzert über und über vor weißen und blauen Brillanten. Tödliche, namenlose Stille.
»Sie haben mich weit weg geführt«, sagt sie leise, mit echter Furcht. »Gehen wir zurück.«
Doch er blickt sie eigenartig an und zieht sie an der Hand vorwärts.
»Werfen wir einen Blick in die Kate … Nur einen Moment …«
Sie macht ein paar Schritte, doch kurz vor der Kate sträubt sie sich entschieden, bleibt stehen und entzieht ihm ihre Hand. Er läßt die Skier liegen, klettert über die feste Schneewehe zur offenen Tür der Kate, bückt sich und verschwindet in der Dunkelheit. Einen Moment darauf ist aus der Hütte seine Stimme zu hören:
»Wie schön es hier ist! Schauen Sie wenigstens zum Fenster herein! Sie haben doch keine Angst?«
»Nein, aber ich will nicht. Wo sind Sie? Kommen Sie, es ist schon spät!«
»Wie schön das Mondlicht hier ist! Es ist märchenhaft!«
»Wenn Sie nicht herauskommen, gehe ich allein …«
Auf dem gefrorenen Schnee knirschend, nähert sie sich der Hütte und späht hinein.
»Wo sind Sie denn?«
Plötzlich wird sie geblendet von dem grünen Licht eines Meteors, der den ganzen Himmel durchschneidet und explodiert, so wunderbar, so schrecklich und paradiesisch schön, daß sie aufschreit und erschrocken zur Tür der Kate stürzt …
Nach einer halben Stunde kommen sie wieder heraus auf die mondbeschienene Lichtung, und bis sie den Fluß erreichen, wo man die anderen schon nach ihnen rufen hört, können sie kein Wort mehr sprechen.
Temir-Aksak-Khan
»A-a-a, Temir-Aksak-Khan!« schreit wild eine modulierende, leidenschaftlich und hoffnungslos schwermütige Stimme in einem kleinen Kaffeehaus auf dem Lande.
Die Frühlingsnacht ist dunkel und feucht, die schwarze Wand der steilen Berghänge kaum zu erkennen. Neben dem Kaffeehaus, das sich dicht an einen Felsen schmiegt, steht ein Automobil mit offenem Verdeck in dem weißen Schlamm auf der Landstraße, und aus seinen unheimlichen, blendenden Augen recken sich zwei lange, helle Dunstkegel nach vorn, in die Dunkelheit. Von weit unten dringt das Rauschen des unsichtbaren Meeres herauf, und ein unruhiger, feuchter Wind bläst von allen Seiten her aus der Dunkelheit.
Das Kaffeehaus ist dicht verqualmt, es wird trüb beleuchtet von einer Blechfunzel, die an der Decke hängt, und gewärmt von einem Haufen glühender Kohle, der auf der Feuerstelle in der Ecke schwelt. Der Bettler, der so unvermittelt in durchdringend-näselndem Lamento, mit einem qualvollen Schrei das Lied von Temir-Aksak-Khan angestimmt hat, hockt auf dem Lehmboden. Ein hundertjähriger Affe mit Schaffelljacke und einem zottigen Lammfell, das rötlich verblichen ist vom Regen, von der Sonne, von der Zeit. Auf dem Schoß hält er ein plumpes, hölzernes Instrument in der Art einer Leier. Er sitzt vornübergebeugt – die Zuhörer können sein Gesicht nicht sehen, zu sehen sind nur seine braunen Ohren, die unter dem Lammfell herausragen. Er entreißt den Saiten von Zeit zu Zeit schrille Laute und schreit in unerträglichem, verzweifeltem Leid.
Auf einem Schemel in der Nähe der Feuerstelle sitzt ein weiblich fülliger, gutaussehender Tatare, der Besitzer des Kaffeehauses. Anfangs hat er zerstreut Sonnenblumenkerne gekaut und gelächelt – freundlich und ein wenig traurig oder auch herablassend und spöttisch. Jetzt aber sitzt er starr da, mit hochgezogenen Augenbrauen und einem gequälten, verlegenen Lächeln.
Auf der Bank unter dem kleinen Fenster raucht ein Hadschi, ein hochgewachsener Mann mit mageren Schulterblättern und grauem Bart, in einem schwarzen Mantel mit weißem Turban, der die Bräune seines pockennarbigen, herben Gesichts wunderbar unterstreicht. Jetzt hat er seinen Tschibuk vergessen, den Kopf gegen die Wand zurückgeworfen und die Augen geschlossen. Das eine Bein, in einem gestreiften Wollstrumpf, ist angewinkelt und auf die Bank gestellt, das andere, im Schuh steckend, baumelt herab.
Und am Tisch neben dem Hadschi sitzen die Fremden, die auf der Durchreise die Idee hatten, das Automobil anzuhalten und in diesem Kaffeehaus eine Tasse schlechten Kaffee zu trinken: ein massiger Herr mit Melone und englischem Wettermantel und eine schöne junge Dame, blaß vor Anspannung und Erregung. Sie ist aus dem Süden, sie versteht tatarisch, versteht die Worte des Liedes … »A-a-a, Temir-Aksak-Khan.«
Keinen mächtigeren und ruhmreicheren Khan gab es auf der ganzen Welt als Temir-Aksak-Khan. Die gesamte irdische Welt erzitterte vor ihm, und die schönsten Frauen und Mädchen der Welt wären bereitwillig gestorben für das Glück, seine Sklavin zu sein, und sei es auch nur für einen Augenblick. Vor seinem Ableben jedoch saß Temir-Aksak-Khan im Staub auf den Steinen des Basars, küßte die Lumpen der Krüppel und Bettler, die vorüberkamen, und sagte zu ihnen:
»Nehmt meine Seele, ihr Krüppel und Bettler, denn sie hat kein Verlangen mehr!«
Und als schließlich der Herr sich seiner erbarmte und ihn vom eitlen irdischen Ruhm und von den eitlen irdischen Freuden befreite, zerfielen bald alle seine Reiche, verödeten Städte und Paläste, und Sandstaub verwehte ihre Ruinen unter dem wie kostbar glasierten, ewig tiefblauen Himmel und der wie das Höllenfeuer ewig flammenden Sonne … »A-a-a, Temir-Aksak-Khan! Wo sind deine Tage und Taten? Wo die Schlachten und Siege? Wo sind sie, die Jungen, die Zärtlichen, die Eifersüchtigen, die dich liebten, wo sind die Augen, die strahlten wie schwarze Sonnen auf deiner Lagerstatt?«
Alle schweigen, alle sind im Bann des Liedes. Doch seltsam – das verzweifelte Leid, der bittere Vorwurf, von dem dieses Lied schier birst, sind süßer als die höchste, die leidenschaftlichste Freude.
Der Fremde starrt angelegentlich auf den Tisch und schmaucht eine Zigarre. Seine Dame hat die Augen weit aufgerissen, und über ihre Wangen laufen Tränen.
Nach einigen Minuten treten sie beide hinaus vor die Tür. Der Bettler hat sein Lied beendet und angefangen zu kauen, Stücke abzureißen von dem zähen Fladen, den der Kaffeehausbesitzer ihm gegeben hat. Doch es scheint, als klinge das Lied noch nach, als dauere es noch an, als werde es weder jetzt noch künftig enden.
Die Dame hat dem Bettler im Hinausgehen einen ganzen Goldrubel zugesteckt, denkt nun aber besorgt, es sei zu wenig, und will umkehren, um ihm noch ein Goldstück zu geben – nein, zwei, drei, oder ihm gar vor allen Leuten die rauhe Hand zu küssen. Ihre Augen brennen noch vor Tränen, doch sie hat das Gefühl, nie im Leben glücklicher gewesen zu sein als in diesem Moment, nach diesem Lied darüber, daß alles unter der Sonne Eitelkeit und Kummer ist, in dieser dunklen, feuchten Nacht mit dem fernen Rauschen des unsichtbaren Meeres, mit dem Duft nach Frühlingsregen und feuchter Baumrinde, mit dem unruhigen, bis in die Tiefe der Seele dringenden Wind.
Der Chauffeur, der sich lässig im Wagen ausgestreckt hat, springt hastig heraus, beugt sich vor in den Lichtkegel der Scheinwerfer und macht sich dort zu schaffen, einem Tier ähnlich mit seinem wie nach außen gedrehten Pelz, und das Auto erwacht plötzlich zum Leben, brummend und zitternd vor Ungeduld. Der Herr ist der Dame beim Einsteigen behilflich, setzt sich neben sie, bedeckt ihre Knie mit einem Plaid, und sie dankt ihm geistesabwesend … Das Automobil jagt die abschüssige Straße hinunter, erklimmt eine Steigung, bohrt die Lichtkegel dabei in eine Hecke und wischt sie wieder zur Seite, um in die Dunkelheit eines weiteren Abhangs hinabzusinken … In der Höhe, über der Silhouette der kaum sichtbaren, riesenhaft scheinenden Berge, flimmern die Sterne durch die spärlichen Wolken, weit vorn leuchtet die weiße Brandung in der Biegung der Bucht, der Wind schlägt weich und kräftig ins Gesicht …
O, Temir-Aksak-Khan, sagte das Lied, niemand auf Erden war tapferer, glücklicher und ruhmreicher als du, dunkel von Angesicht, mit feurigen Augen, lichthell und gütig wie Gabriel, weise und prächtig wie der Herrscher Süleyman! Leuchtender und grüner als das Blattwerk im Paradies war die Seide deines Turbans, dessen diamantene Feder in siebenfarbigem Sternenfeuer wippte und schillerte, und für das Glück, mit gespitzten Lippen deine dunkle, über und über mit indischen Ringen geschmückte schmale Hand zu berühren, waren der Welt schönste Prinzessinnen und Sklavinnen zu sterben bereit. Doch nachdem du den Becher der irdischen Freuden bis auf den Grund geleert hattest, saßest du, Temir-Aksak-Khan, im Staub auf dem Basar und haschtest und küßtest die Lumpen der Krüppel, die vorüberkamen, und flehtest sie an:
»Nehmt meine leidende Seele, ihr Krüppel!«
Jahrhunderte zogen hinweg über dein vergessenes Grab, Sand verwehte die Ruinen deiner Moscheen und Paläste unter dem ewig blauen Himmel und der erbarmungslos fröhlichen Sonne, wilde Heckenrosen wucherten durch die Überreste der azurblauen Fayencen deiner Grabstätte, auf daß in jedem neuen Frühling wieder und wieder die Herzen der Nachtigallen darauf schmachten, zerrissen von qualvoll-begehrlichen Liedern, von der Sehnsucht nach unsagbarem Glück … A-a-a, Temir-Aksak-Khan, wo ist sie, deine bittere Weisheit? Wo sind alle Qualen deiner Seele, die mit Tränen und Bitterkeit den Honig der irdischen Verlockungen verbannte?
Die Berge sind verschwunden, zurückgetreten, längs der Straße braust schon das Meer, rollt mit seinem Rauschen und dem Geruch nach Wasserfrische schäumend auf den Kiessand des Ufers, das endlosen Hügeln von Gebeinen gleicht. Weit vorn, in der dunklen Niederung, sind rote und weiße Lichter verstreut, steht der rosarote Lichtschein der Stadt, und die Nacht darüber und über der Meeresbucht ist schwarz und weich wie Ruß.
Der wahnsinnige Maler
Golden zeigte sich die Sonne im dunstigen Osten, jenseits der dunstigen Bläue der fernen Wälder, jenseits der weißen Niederung, auf die die alte russische Stadt von der Anhöhe des Ufers herabblickte. Es war der Tag vor Weihnachten, ein frischer Morgen mit leichtem Frost und Rauhreif.
Gerade eben war der Petrograder Zug eingetroffen: Hügelan, über den festgefahrenen Schnee von der Bahnstation her strebten Kutschen, manche mit Fahrgästen, manche ohne.
In dem großen alten Hotel auf dem weiträumigen Platz gegenüber den alten Marktreihen war es still und leer; es war alles hergerichtet für den Feiertag. Gäste wurden keine erwartet. Doch da kam an der Treppe ein Herr mit Pincenez und erstaunten Augen vorgefahren, der ein schwarzes Samtbarett trug, unter dem sich grünliche Locken herausringelten, und einen langen, fellgefütterten Mantel aus glänzendem, kastanienbraunem Pelz.
Der rothaarige, bärtige Mann auf dem Kutschbock krächzte gekünstelt, um zu zeigen, daß er ganz durchgefroren war und einen Zuschlag erwartete. Sein Fahrgast indes beachtete ihn gar nicht und überließ es dem Hotel, ihn zu bezahlen.
»Geben Sie mir das hellste Zimmer«, sagte er laut und folgte mit hoheitsvollem Schritt dem jungen Hausdiener, der seinen teuren ausländischen Koffer trug, durch den breiten Korridor. »Ich bin Maler«, sagte er, »aber für dieses Mal benötige ich kein Zimmer nach Norden hin. Auf keinen Fall!«
Der Hausdiener stieß die Tür zur Nummer eins auf, die vornehmste Suite, die aus einem Vorraum und zwei großen Zimmern bestand, deren Fenster freilich klein und tief in die dicken Mauern eingelassen waren. In den Zimmern war es warm, behaglich und ruhig, bernsteingelb von der Sonne, die durch den Rauhreif an den unteren Fensterscheiben gedämpft wurde. Nachdem er den Koffer vorsichtig auf dem Teppich mitten im Vorraum abgestellt hatte, blieb der Hausdiener, ein junger Bursche mit schlauen, munteren Augen, in Erwartung des Reisepasses und weiterer Anordnungen stehen. Der Maler, nicht sonderlich groß und ungeachtet seines Alters jugendlich rege, durchmaß in Barett und Samtjacke den Raum von einer Ecke zur anderen und rieb sich, nachdem er mit einer Bewegung der Brauen das Pincenez hatte herabgleiten lassen, mit seinen weißen, nahezu alabasterblassen Händen das bleiche, erschöpfte Gesicht. Dann sah er den Diener merkwürdig an, mit dem abwesenden Blick eines sehr kurzsichtigen und zerstreuten Mannes.
»Vierundzwanzigster Dezember neunzehnhundertsechzehn!« sagte er. »Dieses Datum mußt du dir merken!«
»Sehr wohl!« erwiderte der Hausdiener mit bereitwilligem Blick.
Der Maler zog eine goldene Uhr aus der Seitentasche seiner Jacke und warf, ein Auge zusammengekniffen, einen flüchtigen Blick darauf.
»Genau halb zehn«, fuhr er fort und brachte den Zwicker wieder auf seiner Nase an. »Ich bin am Ziel meiner Pilgerreise angekommen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede und den Menschen ein Wohlgefallen! Den Paß gebe ich dir noch, keine Sorge, aber jetzt steht mir nicht der Sinn danach. Ich habe keine einzige freie Minute. Ich muß dringend in die Stadt, damit ich Punkt elf Uhr wieder zurück bin. Ich muß die Aufgabe meines Lebens vollenden. Mein junger Freund«, sagte er, streckte dem Hausdiener die Hand hin und zeigte ihm zwei Eheringe, von denen der eine, der am kleinen Finger steckte, ein Damenring war: »Dieser Ring ist ein letzter Wille, ein Vermächtnis!«
»Jawohl«, ließ der Hausdiener sich schüchtern vernehmen.
»Und ich werde dieses Vermächtnis erfüllen!« sagte der Maler drohend. »Ich werde ein unsterbliches Bild malen! Und ich schenke es – dir!«
»Untertänigsten Dank«, erwiderte der Hausdiener.
»Aber, mein Bester, die Sache ist die, daß ich weder Leinwand noch Farben dabeihabe – sie mitzunehmen war wegen dieses scheußlichen Krieges vollkommen unmöglich. Ich hoffe, sie hier besorgen zu können. Endlich kann ich all das darstellen, was mich zwei ganze Jahre lang in den Wahnsinn getrieben und sich dann in Stockholm so wunderbar verwandelt hat!«
Während er die Worte herunterratterte, hielt der Maler durch das Pincenez den Blick unverwandt auf seinen Gesprächspartner geheftet.
»Die ganze Welt soll diese Offenbarung, diese frohe Botschaft erfahren und verstehen!« rief er aus und schwenkte theatralisch den Arm. »Hörst du? Die ganze Welt! Alle!«
»Aber gewiß doch«, versetzte der Hausdiener. »Ich werde es meinem Herrn mitteilen.«
Der Maler zog seinen Pelzmantel wieder an und ging zur Tür. Der Hausdiener beeilte sich, sie zu öffnen. Der Maler nickte ihm gewichtig zu und schritt den Korridor hinunter. Am Treppenabsatz blieb er kurz stehen und fügte hinzu:
»Es gibt in der Welt, mein Freund, keinen höheren Feiertag als Weihnachten. Und es gibt kein Geheimnis, das der Geburt des Menschen gleichkommt. Der letzte Augenblick der blutigen alten Welt! Ein neuer Mensch wird geboren!«
Draußen war es unterdessen vollends Tag geworden und sehr sonnig. Der Rauhreif an den Telegrafenleitungen zeichnete sich filigran und taubengrau gegen den blauen Himmel ab und bröckelte schon, löste sich ab. Auf dem Platz drängte sich ein ganzer Wald dichter, dunkelgrüner Tannen. An den Marktbuden standen die hartgefrorenen weißen Körper geschlachteter Schweine mit tiefen Einschnitten an den dicken Hälsen, graue Haselhühner hingen da, gerupfte Gänse und Truthähne, fett und steifgefroren. Plaudernde Passanten hasteten vorüber, Droschkenkutscher schlugen auf zottige Pferde ein, Kufen quietschten.
»Ich erkenne dich, Rußland!« sagte der Maler laut, während er über den Platz schritt und die stramm gegürteten, dick eingemummten, fröhlichen Händler und Marktweiber betrachtete, die an ihren Verkaufsbuden selbstgemachtes Holzspielzeug und große, weiße Pfefferkuchen in Form von Pferden, Hähnen oder Fischen unentwegt lautstark anpriesen.
Er winkte einen freien Kutscher herbei und wies ihn an, zur Hauptstraße zu fahren.
»Aber beeil dich, um elf muß ich zu Hause sein, an der Arbeit«, sagte er, stieg in den kalten Schlitten und legte sich die schwere, steifgefrorene Decke über die Knie.
Der Kutscher nickte und trug ihn mit seinem wohlgenährten Wallach hurtig über die glitzernde, glattgefahrene Straße.
»Beeilung, Beeilung!« drängte der Maler immer wieder. »Um zwölf in das beste Sonnenlicht. Ja«, sagte er um sich blickend, »die Gegend ist vertraut und doch gründlich vergessen! Wie heißt diese Piazza?«
»Wie belieben?« fragte der Kutscher.
»Ich frage dich, wie dieser Platz heißt!« schrie der Maler in einem plötzlichen Wutanfall. »Halt an, du Halunke! Wieso fährst du mich zur Kapelle? Ich fürchte mich vor Kirchen und Kapellen! Halt an! Du weißt, daß ein Finne mich einmal auf den Friedhof gefahren hat und ich sofort Briefe an den König und den Papst geschrieben habe und er zum Tode verurteilt wurde! Fahr zurück!«
Der Kutscher zügelte abrupt das flott dahintrabende Pferd und warf seinem Fahrgast einen erstaunten Blick zu:
»Wohin wünschen Sie nun? Sie haben gesagt, zur Hauptstraße …«
»Ich habe dir gesagt, zum Geschäft für Malerbedarf!«
»Sie hätten besser einen anderen genommen, gnädiger Herr, ich verstehe Sie nicht.«
»Ach, geh zum Teufel! Hier hast du deine Silberlinge.«
Der Maler kletterte ungelenk aus dem Schlitten, warf dem Kutscher ein Dreirubelstück zu, machte kehrt und ging zurück, mitten auf der Straße. Sein fellgefütterter Mantel hatte sich geöffnet und schleifte durch den Schnee, die Augen wanderten verzweifelt und verwirrt umher. Als er in einem Schaufenster vergoldete Rahmenleisten entdeckte, betrat er eilig das Geschäft. Aber kaum hatte er etwas von Farben gesagt, als ihm die rotbackige junge Person im Pelzmäntelchen, die an der Kasse saß, bereits ins Wort fiel:
»Ach nein, Farben haben wir nicht. Wir haben nur Rahmen, Rahmenleisten und Tapeten. Überhaupt werden Sie bei uns in der Stadt kaum Leinwand und Ölfarben finden.«
Der Maler faßte sich mit echter Verzweiflung an den Kopf.
»Mein Gott, ist das wahr? Ach, wie entsetzlich! Jetzt, ausgerechnet jetzt sind Farben für mich eine Frage von Leben und Tod! Meine Idee war schon in Stockholm vollkommen ausgereift und wird, wenn sie erst umgesetzt ist, einen unerhörten Eindruck machen. Ich muß die Geburtsgrotte in Bethlehem malen, die Weihnacht, und ich muß das ganze Bild – die Krippe und das Kind und die Madonna und den Löwen und das Lämmchen, die daneben liegen, genau daneben! – mit einem solchen Jubel der Engel und mit solch einem Licht überfluten, daß es wahrhaftig die Geburt eines neuen Menschen zeigt. Nur wird es bei mir in Spanien sein, im Land unserer ersten Reise, der Hochzeitsreise. In der Ferne die blauen Berge, auf den Hügeln blühende Bäume vor dem offenen Himmel …«
»Entschuldigen Sie, mein Herr«, sagte das Fräulein konsterniert. »Jeden Moment können Käufer kommen. Wir haben nur Rahmen, Rahmenleisten und Teppichtapeten …«
Der Maler fuhr zusammen und lüftete mit übertriebener Höflichkeit sein Barett.
»Ach, verzeihen Sie um Gottes willen! Sie haben recht, tausendmal recht!«
Und er eilte hinaus.
Ein paar Häuser weiter, im Geschäft Snanie, kaufte er einen sehr großen Bogen Rohkarton, Farbstifte und Aquarellfarben in einer Farbpalette aus Karton. Darauf sprang er wieder in eine Kutsche und jagte sie zum Hotel. Im Hotel läutete er sogleich. Derselbe Hoteldiener wie zuvor erschien. Der Maler hielt seinen Paß in der Hand.
»Hier!« sagte er und streckte ihn dem Hausdiener hin. »Dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und dann, mein Lieber, mußt du mir ein Glas Wasser für die Aquarellfarben bringen. Ölfarben gibt es leider nirgends. Der Krieg! Die Eisenzeit! Das Höhlenzeitalter!«
Er überlegte eine Weile und strahlte dann vor Begeisterung:
»Was für ein Tag! Mein Gott, was für ein Tag! Genau um Mitternacht wird der Erlöser geboren! Der Erlöser der Welt! Das werde ich unter das Bild schreiben: Die Geburt des neuen Menschen! Die Madonna male ich nach derjenigen, deren Name von heute an heilig ist. Ich werde sie auferstehen lassen, die von einer bösen Macht getötet wurde, zusammen mit dem neuen Leben, welches sie unter dem Herzen trug!«
Der Hausdiener erklärte erneut seine stete Dienstbereitschaft und ging wieder. Doch als er ein paar Minuten später ein Glas und eine Karaffe mit frischem Wasser brachte, schlief der Maler tief und fest. Sein blasses, hageres Gesicht glich einer Alabastermaske. Er lag rücklings hoch in den Kissen auf dem Bett im Schlafzimmer, den Kopf zurückgeworfen, die langen, grau-grünen Haare nach allen Seiten ausgebreitet, und nicht einmal sein Atem war zu hören. Der Hausdiener trat auf Zehenspitzen den Rückzug an und stieß vor der Tür mit dem Hotelbesitzer zusammen, einem stämmigen Mann mit Bürstenschnitt und scharfen Augen.
»Nun, was ist?« fragte er hastig im Flüsterton.
»Er schläft«, erwiderte der Hausdiener.
»Merkwürdig!« bemerkte sein Herr. »Aber der Paß ist echt. Es ist nur eingetragen, daß die Ehefrau verstorben ist. Iwan Matweitsch hat angerufen und nachsehen lassen. Also halt lieber Augen und Ohren offen! Es ist Kriegszeit, Bruder.«
»Er sagt, ich schenke es dir, laß mich nur erst meine Arbeit machen«, sagte der Hausdiener. »Und einen Samowar hat er auch nicht bestellt …«
»Ich sag’s ja!« bekräftigte der Wirt und schmiegte das Ohr an die Tür.
Doch hinter der Tür war alles still, und man spürte lediglich jene Traurigkeit, die immer in einem Raum hängt, in dem jemand schläft.
Langsam wich die Sonne aus dem Zimmer. Schließlich war sie ganz verschwunden. Der Rauhreif an den Fensterscheiben wurde grau und stumpf. In der Dämmerung erwachte der Maler auf einmal und stürzte sogleich zur Klingel.
»Es ist furchtbar!« schrie er, sobald der Hausdiener erschien. »Du hast mich nicht geweckt! Dabei haben wir unsere schreckliche Odyssee genau wegen dieses Tages unternommen. Du weißt natürlich, daß sogar Kitcheners Schiff versenkt wurde. Aber stell dir vor, wie es für sie war, im achten Monat schwanger! Wir haben tausenderlei Hindernisse überwunden, fast sechs Wochen weder geschlafen noch gegessen. Und das Meer! Und das rasende Stampfen und Schlingern! Und diese beständige Angst, wir würden gleich in die Luft fliegen! ›Alle an Deck! Rettungsringe bereitmachen! Dem ersten, der ohne Kommando zum Rettungsboot stürzt, schlage ich den Schädel ein!‹«
»Jawohl!« sagte der Hausdiener, völlig verblüfft durch die Stimmgewalt des Malers.
»Aber was für ein strahlendes Licht das war!« fuhr dieser fort und beruhigte sich langsam wieder. »In so einer Stimmung wie damals hätte ich die Arbeit in zwei, drei Stunden fertig. Doch was will man machen! Ich werde die ganze Nacht arbeiten. Sei du mir nur bei der Vorbereitung behilflich. Dieser Tisch hier sollte ausreichen …«
Er trat an den Sofatisch, zog die Samtdecke herunter und rüttelte am Tisch:
»Er steht ziemlich fest. Aber folgendes: Hier sind nur zwei Kerzen. Du mußt mir noch acht Stück bringen, sonst kann ich nicht malen. Ich brauche eine Menge Licht!«
Der Hausdiener ging wieder hinaus und brachte nach längerer Zeit sieben Kerzen in unterschiedlichen Kerzenhaltern.
»Eine fehlt, alle anderen sind in den Zimmern«, sagte er.
Der Maler echauffierte sich wieder und fing wieder an zu schreien:
»Ach, so ein Ärger! Zehn, zehn brauche ich! Auf Schritt und Tritt Hindernisse und Gemeinheiten! Hilf mir wenigstens, den Tisch genau in die Mitte des Zimmers zu stellen. Wir verstärken das Licht mit den Spiegeln …«
Der Hausdiener schleppte den Tisch an den vorgesehenen Platz und stellte ihn so hin, daß er fest stand.
»Jetzt müssen wir etwas Weißes darauflegen, das das Licht nicht schluckt«, murmelte der Maler, während er ungeschickt zu helfen versuchte und dabei in einem fort sein Pincenez hochschob, das ihm immer wieder hinunterrutschte. »Was nehmen wir bloß? Vor weißen Tischtüchern fürchte ich mich … Ha, ich habe noch einen ganzen Stapel Zeitungen, die habe ich vorsichtshalber nicht weggeworfen!«
Er öffnete seinen Koffer, der auf dem Boden lag, entnahm ihm einige Ausgaben der Neuen Zeit, bedeckte damit den Tisch, befestigte sie mit Reißzwecken, legte Farbstifte und Palette aus, stellte die neun Kerzen in einer Reihe auf und zündete sie an. Der Raum erhielt ein eigentümliches, feierliches und etwas schauerliches Aussehen durch diese Überfülle an Licht. Die Fenster wurden schwarz. Die Kerzen wurden vom Spiegel über dem Sofa reflektiert und warfen ein grelles, goldenes Licht auf das bleiche, ernste Gesicht des Malers und das junge, besorgte Gesicht des Hausdieners. Als schließlich alles bereit war, trat der Hausdiener respektvoll zurück zur Türschwelle und fragte:
»Werden Sie bei uns essen oder auswärts?«
Der Maler lächelte bitter und theatralisch:
»Heilige Einfalt! Er bildet sich ein, ich könnte in einem solchen Moment essen! Geh hin in Frieden, mein Freund. Bis zum Morgen brauche ich dich nicht mehr.«
Und der Hausdiener ging vorsichtig hinaus.
Die Stunden vergingen. Der Maler schritt von einer Ecke in die andere. Er sagte sich: »Ich muß mich bereit machen.« Draußen schimmerte schwarz die frostkalte Winternacht. Er ließ die Vorhänge herab. Im Hotel war alles still. Hinter der Tür waren im Korridor vorsichtige, verstohlene Schritte zu vernehmen – man belauerte den Maler durch das Schlüsselloch, belauschte ihn. Dann verstummten auch die Schritte. Die Kerzen flackerten mit züngelnden Flammen, wurden zurückgeworfen vom Spiegel. Das Gesicht des Malers wurde immer verwirrter, immer strenger, immer schmerzlicher.
»Nein!« rief er plötzlich und blieb unvermittelt stehen. »Zuerst muß ich mir ihre Züge ins Gedächtnis rufen! Fort mit der kindlichen Angst!«
Er beugte sich über den Koffer, seine Haare hingen herab. Er fuhr mit der Hand unter die Wäsche, zog ein großes, weißsamtenes Album hervor und setzte sich auf den Lehnstuhl am Tisch. Er klappte das Album auf, warf entschlossen und stolz den Kopf zurück und verharrte in der Betrachtung versunken.
In dem Album befand sich eine große Photographie: Der Innenraum einer leeren Kirche oder Kapelle mit einer Gewölbedecke und glänzenden Wänden aus glattem Stein. In der Mitte erstreckte sich auf einem mit Trauerfilz bezogenen Podest ein langer Sarg, in dem eine abgehärmte Frau mit geschlossenen, gewölbten Lidern lag. Ihr schmaler, schöner Kopf war von einer Blumengirlande eingerahmt, hoch auf der Brust ruhten die gefalteten Hände. Am Kopfende des Sargs standen drei Kirchenleuchter, am Fußende ein winzig kleiner Sarg mit einem Säugling, der aussah wie eine Puppe.