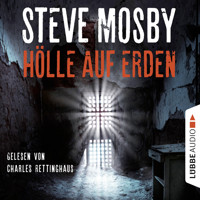6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Detective Inspector Zoe Dolan und ihr Team sehen sich einem Alptraum gegenüber. Ein Stalker, der nachts lautlos in die Wohnungen von jungen Frauen eindringt, um sie zu misshandeln und zu vergewaltigen, sorgt für Panik und Misstrauen. Es hat den Anschein, als würden seine Attacken immer brutaler. Um sich eine trügerische Intimität vorzugaukeln, liebt es der Creeper, bereits im Schlafzimmer unter dem Bett zu liegen, wenn die jungen Frauen von der Arbeit zurückkehren. Zoe Dolan ist überzeugt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Unbekannte zum Killer wird. Doch alle Nachforschungen verlaufen im Sande. Der Druck von Seiten der Öffentlichkeit wird immer stärker, DI Dolan braucht dringend einen Durchbruch in ihren Ermittlungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Ähnliche
Steve Mosby
Nachtschatten
Psychothriller
Aus dem Englischen von Ulrike Clewing
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für Lynn und Zack
Prolog
Für mich ist es einfach nur das Ödland.
Den Ort gibt es wirklich, auch wenn ich seit Jahren schon nicht mehr dort gewesen bin. Er erscheint mir oft im Traum. Die Alpträume fingen an, als ich Mitte zwanzig war, und kommen bis heute immer wieder. Immer, wenn ich im Stress bin. Wenn ich dann wach werde, finde ich mich verschwitzt zwischen zerwühlten Laken im Bett wieder und fühle mich wie gerädert, zerschlagen und einfach nur schlecht. Selbst wenn ich danach dusche, haftet der Traum noch stundenlang an mir wie ein Makel.
Wie in der Realität ist es auch im Traum ein großer, asphaltierter Platz, der sich über ein Areal von etwa einhundert Quadratmetern erstreckt. Er ist übersät von Staub und Schutt, Nägeln, Schrauben und Glasscherben. Früher stand dort eine Fabrik, aber das ist lange her. Davon sind nur noch Reste geblieben. Hier und da gibt es noch ein paar verwitterte Steinstufen, während andere Stellen eingeebnet worden sind. Als wäre die Fabrik nicht abgerissen, sondern von einer gewaltigen Druckwelle einfach zur Seite geschoben worden und hätte sich mit den Fundamenten so fest an den Untergrund geklammert, dass einiges zurückblieb und andere Teile aus dem Grund heraus- und mitgerissen wurden.
Das Areal ist von alten Maschendrahtzäunen umgeben, deren Drähte, von Rost zerfressen, dünn geworden sind. Mir gegenüber auf der anderen Seite befindet sich ein kleiner Erdwall, über den ein Pfad führt, den unzählige Schritte in die Grasnarbe getrampelt haben. Ich muss nicht hinübergehen, um zu wissen, was sich am anderen Ende des Weges hinter der Baumgruppe befindet: die Schule, in die ich früher gegangen bin. Und ohne mich umzudrehen, weiß ich auch, dass hinter mir die Thornton-Siedlung liegt, die sich mir allein durch ihre Präsenz unheilvoll in den Rücken zu bohren scheint.
Auch die Siedlung gibt es wirklich. Zwar bin ich seit Jahren nicht mehr dort gewesen, aber ich kenne sie gut. Als Kind bin ich so oft hindurchgelaufen, dass sich mir ihr Anblick genau wie der Fußweg auf dem Wall unauslöschlich ins Gedächtnis eingegraben hat.
So aber habe ich den Ort nie gesehen.
In den immer wiederkehrenden Alpträumen strahlt der Himmel in einem unbeschreiblichen Aquamarinton, einer verstörenden Mischung aus Blau und Grün, die mir das Gefühl gibt, unter Wasser zu sein. Bis zum Boden ist die Luft von dieser Farbenpracht durchdrungen, als spielte sich die Szene auf dem Grund einer beleuchteten Unterwasserwelt ab. Die Wolken über mir sind hell und voller Leben. Viel zu schnell ziehen sie am Himmel entlang, und die Luft ist von einem Drängen erfüllt, als ginge ein Wind. Aber ich spüre ihn nicht. Außer den Wolken bewegt sich nichts.
Auch die Gestalt nicht.
Sie steht mitten auf dem Platz und verändert sich nie: grau, farblos und geisterhaft. Ich kann nicht sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, denn ihre Konturen sind unscharf, als wäre sie erstarrt, während sie auf mich zugelaufen ist. Sie scheint einfach nur in der Luft zu hängen.
Ich habe das Gefühl, außerhalb von Ort und Zeit zu sein. Als wäre die ganze Welt angehalten worden.
Was der Traum bedeutet, weiß ich nicht. Aber dass er etwas bedeutet, dessen bin ich mir sicher. Mein Unterbewusstsein zeigt mir ein Foto: hält es mir ganz nah vor das Gesicht und fordert mich auf, es zu erkennen, wie ein Polizist im Film, der einem Verdächtigen das Foto eines Mordopfers immer wieder hinüberschiebt, um ihn zu verunsichern.
Sehen Sie sich das an.
Sehen Sie genau hin.
Irgendetwas Furchtbares ist mir auf dem Ödland widerfahren, aber ich weiß nicht, was.
Erinnerungen fühlen sich mitunter seltsam an. Vergleiche ich das Gehirn mit einem Haus, dann landet Erlebtes meistens in den üblichen Räumen; fällt einem etwas nicht gleich ein, dann hat man das Gefühl, nur durch eine Tür hineingehen zu müssen, um es dort wiederzufinden. Selbst wenn man auf der Suche die Möbel ein wenig verrücken muss, irgendwo dort ist es.
Aber es ist nicht immer so. Manchmal ist das, was einem zugestoßen ist, so schrecklich, dass es häppchenweise abgespeichert, auf mehrere Stellen verteilt oder sogar richtig weggesperrt wird. Manchmal macht unser Gedächtnis auch eine Art Falltür auf, wirft Erlebtes ein paar dunkle Stufen hinab und macht die Klappe wieder zu, so dass nur noch eine blasse Ahnung davon in der Luft hängenbleibt. Hin und wieder nimmt man den leichten Geruch wahr und ahnt voller Unbehagen, dass etwas nicht stimmt, ohne wirklich sagen zu können, was es ist.
Natürlich kommen solche Erlebnisse wieder an die Oberfläche, aber wir können das nicht steuern. Sie lauern uns auf. Werden wach, wenn wir schlafen. Bei mir ist es das Ödland. Das ist der Ort meiner Alpträume.
Ich weiß nicht, wie lange dieser Traum dauert. Die Wolken bewegen sich, der Luftstrom wird stärker, die Gestalt verharrt dort, wo sie ist. Und dann fange ich an, mich herumzuwälzen, warte darauf, dass etwas passiert. Das ist das Strömungsgeräusch. Ich verspüre eine Art Geschwindigkeit – nicht nur, dass ich mich schnell, sondern auch in eine bestimmte Richtung, auf einen Augenblick zubewege, in dem etwas Furchtbares geschieht. Während alles wieder von vorn anfängt, die Gestalt mir entgegeneilt und ich endlich ihr Gesicht sehe.
Und genau in diesem Moment wache ich auf.
Ich bleibe dann immer noch ein wenig liegen, mit Herzrasen, oder ich setze mich auf die Bettkante. In jedem Fall aber habe ich immer dieselben Worte im Kopf und denselben Satz.
Irgendetwas wird geschehen.
Etwas Schreckliches bahnt sich an.
ERSTER TEIL
1
Er kann sich glücklich schätzen.
Eine wunderbare Vorstellung. Kaum gibt er sich diesem Gedanken hin, entspannt sich sein erstarrtes Herz, breitet sich mit warmen Fingern langsam tastend über die ganze Brust aus. Und es stimmt tatsächlich: Er kann sich sogar in vielerlei Hinsicht glücklich schätzen. Zum einen ist er jung und erfreut sich bester Gesundheit. Und das bei seiner Größe. Außerdem hat er einen guten Job und ein Dach über dem Kopf, das ihm in diesen schwierigen Zeiten auch noch gehört. Keine Hypothek. Kein Ärger, keine Sorgen.
Vor allem aber hat er Julie.
Er lauscht ihrem sanften Schnarchen und spürt die Wärme, die sich allein durch ihre Anwesenheit, nur dadurch, dass sie so dicht bei ihm liegt, immer weiter ausbreitet. Julie Kennedy ist einfach hinreißend, und immer wenn er Selbstmordgedanken hegt, besinnt er sich darauf, wie sehr sie sich lieben. Kein Mann könnte ihr widerstehen. Sie ist dreiundzwanzig – ein ganzes Stück jünger als er – und so bezaubernd, dass es selbst denjenigen, die sich aus Schönheit im herkömmlichen Sinne nichts machen oder sie gar verabscheuen, schwerfällt, sich diesem Reiz zu entziehen. Sie hat langes, dichtes, sonnengelb, ja fast butterfarben schimmerndes Haar und eine zarte, leicht getönte Haut. Ihre schlanke Statur lässt sie in allem gut aussehen, was sie trägt. Sympathischerweise ahnt sie selbst davon nichts. In einem anderen Leben wäre sie Model oder Filmstar geworden, während sie ihr tatsächliches Leben als kleine Verwaltungsangestellte in einem Büro zubringt. Natürlich hat sie etwas Besseres verdient, und bestimmt ist es auch nicht das, wovon sie immer geträumt hat. Aber sie beklagt sich nie. Und außerdem ist sie jung und hat noch so viel Zeit, sich zu überlegen, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte.
Er hat sie durch die Arbeit kennengelernt. Es war nicht ihre äußerliche Schönheit, die ihn berührte und ihr auf eine so natürliche Art anhaftete, dass sie fast unbemerkt blieb. Vielmehr war es das freundliche Wesen, das sie an den Tag legte. Ihre Art faszinierte ihn. Sie war höflich, zurückhaltend und nicht die Spur arrogant oder eingebildet, wie derart attraktive Frauen es häufig an sich haben. So wie sie sich gab und mit ihm sprach, hielt sie sich keineswegs für etwas Besonderes. Für ihn aber war sie es. Und jetzt, also viele Monate später, sind sie hier.
Er fällt ihm schwer zu glauben, was für ein Glück er hat.
Aber schließlich heißt es ja, dass das Glück mit den Tapferen ist. Er weiß noch, was seine Mutter immer sagte, während die Stricknadeln klapperten: Nur die Tapferen verdienen die Schönen. Sein Vater sah das genauso. Trotz seiner Größe stand er in der Schule immer starr vor Angst auf dem regennassen Rugbyfeld, weil ihn allein der Gedanke an eine dieser abscheulichen Berührungen oder Zusammenstöße schreckte. Gewalt ist ihm zuwider, und andere Männer fürchtet er ein wenig; das war immer schon so. Du musst hart rangehen, musste er sich von seinem Vater immer anhören, der sich nur schwer in seinen weinerlichen Sohn hineinversetzen konnte; dann tut es weniger weh. Ein Treffer ist schlimmer, wenn du zurückweichst. Setzt du dich aber entschlossen zur Wehr, spürst du es kaum. Leichter gesagt als getan, auch wenn etwas Wahres dran ist. Zögerst du, hast du verloren. Greifst du aber an, nimmst du deinem Gegenüber die Entschlossenheit, plötzlich weiß es nicht mehr, was es von dir halten soll.
Das lässt sich natürlich nicht immer steuern, im Wesentlichen aber trifft es zu. Was für ein Glück er hat – aber schließlich ist ja jeder seines Glückes Schmied.
Das war nicht immer so. Denn der Unterschied zwischen seiner Beziehung zu Julie und der, die er letztes Jahr hatte, könnte nicht größer sein. Damals war er nicht halb so mutig. Die Erinnerung daran, wie schüchtern er immer war und wie die ganze schreckliche Angelegenheit schließlich endete, schmerzt ihn sehr.
Sie hieß Sharon. Sie war genauso alt wie Julie jetzt und auch sehr hübsch. Manchmal fühlt er sich zu Frauen hingezogen, die nicht ganz so attraktiv sind, ist sich aber immer bewusst, dass das eine Schutzhaltung ist: ein Überbleibsel aus Schultagen, als die hübschen Mädchen ihn keines Blickes würdigten und es besser war, sich mental auf jemanden zu konzentrieren, der ihn nicht von vorneherein abblitzen ließ. Als er Sharon das erste Mal sah, glaubte er, in ihr eines dieser Schulmädchen zu sehen, die inzwischen erwachsen geworden waren.
Sie arbeitete in einem Kosmetikgeschäft, umgeben von Spuren feinsten Puders, der in der Luft schwebte, und Düften edler Parfüms. Sie trug enge Kleider, die ihre Figur zur Geltung brachten. Das lange schwarze Haar hatte sie zu dichten, glänzenden Korkenzieherlocken frisiert. Er sagte sich, dass sie nicht in seiner Liga spielte, und wollte sie dafür sogar hassen. Ein Teil von ihm hat das vielleicht sogar getan. Allen besten Absichten zum Trotz und obwohl er wusste, dass sie unerreichbar für ihn war, fing er an, sich an sie heranzumachen. Einen Monat lang nahm er behutsam Verbindung zu ihr auf. Es waren immer nur unabsichtliche Situationen. Aus einem rätselhaften Grund war er irgendwann in der Stadt und stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wenn sie nach der Arbeit den Laden verließ. Es gab immer einen Grund, an ihrem Haus vorbeizufahren. Nachdem Sharon in sein Leben getreten war, folgten seine täglichen Unternehmungen einem strikten Programm, wie ein Zug auf Schienen, der Fahrplänen folgt, die zunehmend außer Kontrolle geraten.
In seinem Innersten wusste er, dass es ein gefährliches Spiel war, das er unbedingt beenden musste. Nachts in seinem winzigen Schlafzimmer fühlte er sich erbärmlich und minderwertig. Aber aufhören konnte er nicht, und ihm war, als würde irgendetwas auch gar nicht wollen, dass er aufhört. Er fand heraus, dass sie Single war, und das machte ihm zunächst Mut. Trotzdem legte er den Kopf in die Hände und stimmte das Klagelied des Süchtigen an: Warum lässt mich das nicht endlich in Ruhe? Schon damals, als es anfing, hatte er das Gefühl, dass ihr Zusammenkommen unausweichlich war.
Und so stellte er ihr weiter nach, kam ihr immer ein Stückchen näher. Eine Beziehung als solche würde er mit Sharon nicht haben, das wusste er, aber es war besser als nichts. Die Verbindung zwischen ihnen war etwas Besonderes. Dass sie vollkommen ahnungslos war, änderte daran nichts. Immer wieder schreckte er aus dunklen Träumen auf, und allein der Gedanke an sie zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht. Du bist glücklich. In Gedanken griff er der kurzen Berührung vor, die sie haben würden. Ganz zaghaft, in seiner Phantasie und ohne ihr Wissen, schlief sie mit ihm.
Nicht nur ihr Leben war ihm vertraut, auch ihr Haus kannte er von außen sehr gut. Eine hübsche Doppelhaushälfte inmitten eines Gewirrs sich windender, begrünter Straßen. Davor erstreckte sich ein großes Feld mit zwei Fußballtoren, die fast in sich zusammenfielen. Daran schloss sich ein dichtes Waldstück an. Hinter dem Haus befand sich ein rechteckiges Gartenstück, begrenzt von einem niedrigen Lattenzaun, der es von der rückwärtigen Straße trennte. Eine Wäscheleine hing über drei Ecken locker zwischen Metallpfosten.
Am besten konnte man sie vom Feld aus beobachten.
Kaum aber ergriff die Realität wieder Besitz von ihm, wälzte er sich voller Abscheu vor sich selbst in seinem Bett hin und her. In diesen Momenten machte er ihr Vorwürfe, hasste sie dafür und schwor sich, damit aufzuhören, sich zusammenzunehmen, das Ganze hinter sich zu lassen und ein besserer, normaler Mensch zu werden. Sosehr er sich das zum Ziel setzte, so wenig war er in der Lage, sich dem Fluch der Sucht zu entziehen. Nur wenige Tage später fand er sich wieder in der Nähe ihrer Arbeit, ihres Hauses oder in dem Freizeitzentrum, in dem sie dreimal in der Woche zum Schwimmen ging. Nur, um sie wiederzusehen. Ganz harmlos. Sicher? Nur, je länger das so ging, umso unbefriedigender wurde es. Denn Sucht ist etwas, das eskaliert.
Eines Tages kam ihm der Gedanke, einmal etwas anderes zu tun.
Es war riskant, aber aufregend, und wie zufällig blieb er in jener Nacht lange auf. Die Anspannung in seiner Brust nahm an jenem Abend immer stärker zu, auch wenn er sich das nicht eingestehen wollte. Er stellte sich dem nicht entgegen, also ließ er es zu. Um zwei Uhr in der Früh trat er mit klopfendem Herzen in die kalte Nachtluft hinaus und fuhr zu ihrem Haus, nicht ohne sich einzureden, dass er ja nichts Schlimmes tun würde.
Er stellte den Wagen an der rückwärtigen Straße im Schatten zwischen zwei Straßenlaternen ab. Sharons Garten glitzerte im nächtlichen Frost. Ihr Haus aber, wie alle anderen auch, stand dunkel und still da. Kaum hatte er den Motor abgestellt, machte sich eine beklemmende Stille breit, die seine Nervenenden vor lauter Aufregung zum Sirren brachte.
Im Garten hing Wäsche auf der Leine: ein Dreieck aus schlappen, grauen Fähnchen im Dunkel. Und wieder dieses Gefühl von Unausweichlichkeit. Wenn er es nicht tun sollte, warum stellte sich ihm nichts und niemand in den Weg? Das alles war doch nur ein Produkt seiner Phantasie gewesen, bis jetzt. Ließ man ihm die Tür aber einen Spaltbreit offen stehen, wer konnte es ihm verübeln, wenn er sie aufstieß und hindurchging?
Als er ausstieg, erschien ihm die Nachtluft entsetzlich kalt. Er lehnte die Wagentür nur leicht an. Der Zaun hinter ihrem Haus war gerade mal einen Meter hoch, kaum dass er die Bezeichnung Grenze verdiente. Er stieg darüber hinweg.
Beeil dich.
Das tat er. Die Gefahr, in die er sich jetzt begab, machte ihn wachsam. Für alles, was er bisher getan hatte, gab es einen Grund. Ihren Garten betreten zu haben, das war ganz eindeutig Einbruch. Verrückt. Wenn man ihn erwischte, dann würde man in ihm die Bedrohung sehen, dabei war doch eigentlich sie es, die über die Macht verfügte, und er derjenige, der angreifbar und verletzlich durch ihren Garten schlich und das Risiko für sie beide auf sich nahm.
Bei der Wäscheleine blieb er stehen und versuchte die Stücke zu erkennen, die dort aufgehängt waren. Kleider, Jeans, Blusen, Geschirrtücher. Mit einer Kleinigkeit würde er sich zufriedengeben, hatte er sich gesagt, Hauptsache, es gehörte ihr. Jetzt aber stand er da und wünschte sich etwas Intimeres. Er schlich an der Leine entlang, befühlte die Stücke zwischen Daumen und Zeigefinger und näherte sich langsam dem Haus. In dem Moment ließ der Bewegungsmelder das Licht anspringen.
Gleißend hell schien es ihm ins Gesicht, als hätte man ihm eine Taschenlampe direkt vor die Augen gehalten. Sein Schatten warf eine gespenstisch lange Silhouette auf den Rasen. Die plötzliche Helligkeit war, als hätte ihn jemand mit einem Fingerschnippen in Schockstarre versetzt. Panik packte ihn.
Die Lampe befand sich direkt über dem Hinterausgang. So oft war er hier gewesen. Wie hatte er das übersehen können? Erst später wurde ihm klar, warum. Ihm war gar nicht in den Sinn gekommen, dass sie sich vor ihm oder seinesgleichen vielleicht schützen wollte. Wie versteinert stand er da und rührte sich nicht vom Fleck, als eine männliche Gestalt im Küchenfenster ihres Hauses auftauchte, sich über das Spülbecken beugte und genau in seine Richtung starrte.
Ihm genau ins Gesicht.
Erst dann drehte er sich um und rannte.
Das alles liegt natürlich schon eine ganze Weile zurück, aber allein der Gedanke daran löst immer noch eine Welle von Panik in ihm aus: wie kalte Finger, die sich über die warmen legen. Obwohl er jetzt so nah bei Julie liegt und es zwischen ihnen beiden so schön ist, würde er die Zeit am liebsten zurückdrehen und sein früheres Ich dafür schütteln, dass es so schüchtern gewesen war. Es hatte nicht nur am Bewegungsmelder gelegen. Es war die Tatsache, dass er bei Sharon zu lange gezögert und seine Chance vertan hatte. Ein so wunderbares Mädchen würde wohl kaum ewig Single bleiben.
Entscheidend aber ist, dass er jetzt nicht mehr halb so schüchtern ist und nicht bereit, sich eine solche Gelegenheit noch einmal entgehen zu lassen. Jetzt ist er wirklich ein glücklicher Mann. Er liegt da, denkt an Julie und lauscht dem sanften Geräusch ihres Schnarchens. Und ein paar friedvolle Augenblicke später reicht er hinauf und berührt voller Zärtlichkeit die Unterseite ihres Bettes.
2
Unten ist jemand.
Der Gedanke riss mich augenblicklich aus dem Schlaf. Gerade noch in diesem altbekannten, verstörenden Traum von dem Ödland verhaftet, in dem ich wie gebannt auf eine heruntergekommene Asphaltfläche mit einer geisterhaften Gestalt unter aquamarinblauem Himmel starre, an dem Wolken eilig dahinhuschen, und im nächsten Augenblick liege ich auf dem Rücken in meinem Bett. Es war mitten in der Nacht und stockdunkel im Raum. Aber ich war plötzlich hellwach.
Denn …
Unten ist jemand.
Ich war mir zunächst nicht sicher, ob es wirklich so war oder ob mich der Alptraum aus dem Schlaf gerissen hatte. Ich blieb still liegen, wartete, bis sich meine Augen an die Dunkelheit im Schlafzimmer gewöhnt hatten, und lauschte. Nichts, aber mein Unterbewusstsein bestand darauf, dass etwas nicht stimmte. Dass jemand in mein Reich eingedrungen und ich in Gefahr war. Und ich habe in all den Jahren gelernt, meinem Instinkt zu vertrauen.
Ich war heute Nacht allein zu Hause. Aber wo ich auch schlafe, ich wähle immer die von der Tür am weitesten entfernte Seite des Bettes. Nicht, dass ich mich ernsthaft darauf einstelle, dass jemand einbricht und über mich herfällt, aber ausgeschlossen ist es nicht, und ich habe lieber ein paar Sekunden mehr, die ich nicht brauche, als umgekehrt. Aus demselben Grund setze ich mich auch immer mit dem Rücken zur Wand, um den ganzen Raum im Blick zu haben. Ich schlüpfte möglichst geräuschlos aus dem Bett und hockte mich auf die blanken Fußbodendielen an der Wand.
Der Wecker auf dem Nachttisch zeigte sechsundzwanzig Minuten nach drei an. Die Tür auf der anderen Seite des Zimmers stand eine Katzenkopfbreite weit offen. Also unverändert, und im Treppenhaus dahinter war es dunkel; das Geländer auf dem oberen Treppenabsatz konnte ich nur schwach erkennen. Ich horchte wieder. Sekundenlang nichts als bleierne, alarmierende Stille.
Bis sie jäh durchbrochen wurde.
Ich hörte das Quietschen der Bodendielen unten, dann einen dumpfen Schlag. Geräusche, die nicht die geringste Absicht erkennen ließen, sich ruhig zu verhalten. Die darauf hindeuteten, dass es dem Eindringling gleichgültig war.
Durch die Ermittlungen in einem aktuellen Fall alarmiert, schoss mir zwangsläufig die Frage durch den Kopf, ob es vielleicht der von uns gesuchte Täter sein könnte – verwarf den Gedanken aber sofort wieder. Alles deutete bisher darauf hin, dass er um einiges geräuschloser und vorsichtiger vorging als der, der hier unten sein Unwesen trieb – außerdem wäre er inzwischen längst heraufgekommen. Wenn er es gewesen wäre, hätte ich vermutlich keine Chance gehabt, überhaupt aufzuwachen.
Also Einbrecher.
Ich beugte mich herab und erblickte unter dem Bett vier hellgrüne Punkte, die mir wie von innen beleuchtete Murmeln entgegenstrahlten. Hazel und Willow, meine beiden Katzen. Normalerweise schlafen sie unten, haben vermutlich aber schon beim ersten ungewöhnlichen Geräusch Reißaus genommen und sind hierhergeflüchtet – nicht dumm, alle beide nicht. Sie sind Geschwister, die ich aus dem Tierheim geholt habe. Ich nehme an, dass sie schon früh erfahren mussten, wie grausam Zweibeiner sein können, denn selbst jetzt noch verhalten sie sich Fremden gegenüber sehr scheu; manchmal geraten sie schon beim kleinsten Geräusch an der Tür in Panik und flüchten sich in einen versteckten Winkel im Haus. Jetzt war ich froh darüber, denn man weiß nie, was Leute zu tun imstande sind; bei einem Einbruchsfall, in dem ich vor Jahren ermittelte, haben die Mistkerle dem Familienhund, einem Golden Retriever, einfach gegen den Kopf getreten – völlig grundlos –, so dass das arme Tier eingeschläfert werden musste.
Um die Katzen nicht zu verängstigen, griff ich vorsichtig unter das Bett, um den Hammer zu holen, den ich darunter aufbewahre. Er liegt mit seinem ganzen Gewicht beruhigend und fest in der Hand: eine gute, solide Waffe mit einem polierten Holzgriff und schwerem Eisenkopf.
Auch das zählt zu meinen Angewohnheiten – man entkommt eben nicht so leicht dem Umfeld, in dem man aufgewachsen ist. Schon früheste Kindheitsjahre prägen sich ein. Sie hinterlassen Spuren, und wenn man nicht daran arbeitet, bleiben einem die Narben ein Leben lang erhalten. So habe ich im Kopf eine mentale Karte der Stellen abgespeichert, wo meine Waffen bereitliegen: das Messer in der Küchenschublade gleich neben der Tür; die Schraubenzieher unten auf dem Bücherregal und auf dem Fensterbrett im Wohnzimmer; die hochprozentige Ammoniaklösung in einer Sprühflasche im Bad. Der Hammer hier. Mein Arsenal umfasst noch mehr Gegenstände, und sollte es hart auf hart kommen, könnte ich mich den ganzen Weg von der Haustür bis hierher ins Schlafzimmer ununterbrochen zur Wehr setzen, da ich immer genau weiß, wo die nächste Waffe liegt.
Mit dem Hammer in der Hand ging ich ums Bett herum, machte die Tür so leise auf, wie es ging, und schlich in den Gang hinaus auf den oberen Treppenabsatz.
Ich schaute auf den kleinen Flur hinunter, der zu der Hintertür des Hauses führt. Durch die rechteckigen Milchglasscheiben fiel blassgelb das Licht einer Straßenlaterne auf den grauen Teppich. Die Wohnzimmertür daneben war geschlossen. Doch allein schon wegen der Katzen mache ich die niemals zu. Noch auffälliger aber war die dünne, helle Linie, die sie umrahmte, denn unten lasse ich das Licht über Nacht grundsätzlich nicht an.
Erneut drangen Geräusche zu mir herauf. Gedämpft, aber eindeutig, so dass die Fußsohlen anfingen zu kribbeln. Dann vernahm ich Laute einer schnellen, geflüsterten Unterhaltung, gefolgt von unterdrücktem Lachen.
Es waren also mehrere.
Und wieder dieses verhaltene Lachen. Schon möglich, dass sie nicht über mich lachten, aber es fühlte sich trotzdem so an.
Und das brachte mich gegen sie auf.
»Polizei!«, schrie ich.
Meine Stimme klang streng und entschlossen, und das war gut. Jetzt dämpfte das Adrenalin die Angst, und mit meinem Entschluss zu handeln hatten sich letzte Reste von Nervosität in Luft aufgelöst. Attacke. Nur keine falsche Bescheidenheit.
»Ich bin bewaffnet, und ich komme jetzt runter. Sie haben fünf Sekunden Zeit, Ihren Arsch aus meinem Haus hinauszubewegen.«
Die Geräusche im Wohnzimmer verstummten jäh. Aber während ich mit lauten, schweren Schritten die Treppe hinunterging, setzten sie – jetzt noch deutlicher – wieder ein. Irgendetwas da unten ging scheppernd zu Bruch. Die Einbrecher ergriffen die Flucht. Darüber hätte ich vermutlich froh sein sollen, aber da ich die Sache nun in die Hand genommen hatte, bedauerte ich es ein wenig. Unten angekommen, wurde mir klar, dass ich eigentlich sogar wollte, dass einer es drauf anlegte. Um mir einen Grund zu geben, ihm den Hammer über seinen erbärmlichen Schädel zu ziehen.
Den Oberkörper seitlich durch die Wand geschützt, trat ich gegen die Wohnzimmertür. Sie flog auf, schlug gegen den Heizkörper, und die Vorhänge vor dem hinteren Fenster blähten sich ballonartig auf. Von der plötzlichen Helligkeit geblendet, musste ich ein paarmal blinzeln, bevor ich eintrat. Den Hammer hielt ich dicht an meinem Kopf, zu kurzen, kräftigen Schlägen bereit, sollte jemand in der Nähe stehen.
Das war nicht der Fall, und das war ein Glück, denn einen Augenblick lang stand ich wie gelähmt vor dem falschen Bild, das der Raum mir bot. Wer immer hier unten gewesen war, hatte eine ganze Menge Sachen mitgehen lassen. Als Erstes sprang mir das große Stück freier Wand direkt gegenüber ins Auge, das der Fernseher zurückgelassen hatte. Das DVD-Regal daneben war hastig durchwühlt worden. Ein Meer von Hüllen lag davor über den Boden verstreut. Auch der Rest befand sich in einem nicht minder chaotischen Zustand. Alles war aus den Schubladen gezerrt worden und lag auf dem Boden herum, von einer Flüssigkeit überzogen, die im ersten Moment überhaupt keinen Sinn ergab – falsch, falsch, falsch.
Und dann die Einbrecher selbst.
Ein paar flohen als Bündel flackernder Schatten durch die Küche hinaus, der Letzte kam nur bis zur Tür. Er trug schmutzige Jeans, einen grauen Kapuzenpulli, weiße Turnschuhe und schwarze Handschuhe. Aber keine Maske, dieser Idiot.
»Hey, was ist mit der Hecke?«, rief ich.
Er zögerte. Den Trick hatte ich mir schon angeeignet, als ich noch ein Teenager gewesen war, kleiner als die meisten anderen in meinem Alter, die glaubten, mich schikanieren zu können. Gibt man etwas total Schwachsinniges von sich, bringt das jemanden für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Konzept, lange genug, um ihn abzulenken und den entscheidenden ersten Schlag führen zu können. Dafür war der Eindringling natürlich zu weit entfernt, aber es reichte, um ihn zu irritieren – ihn dazu zu bringen, sich umzudrehen und mich kurz anzusehen, so dass ich sein Gesicht klar und deutlich erkennen konnte.
Klick.
Dann war er verschwunden, mit seinen Kumpels auf und davon.
Ich lief hinterher, jetzt allerdings nur mit halber Entschlusskraft. Ich war stinksauer, trotzdem war mir bewusst, dass ich, von der rechtlichen Situation abgesehen, kaum in der Lage war, mit mehr als nur einem da draußen fertigzuwerden. Außerdem waren sie schnell: Der Motor heulte schon auf, als ich die Haustür erreicht hatte und in die kalte Nacht hinaustrat. Eine Tür flog zu, Reifen quietschten, und schon sausten Scheinwerfer auf der Straße davon. Als ich am Ende des Wegs angekommen war – eher eine Geste denn der ernsthafte Versuch, sie einzuholen –, war der Wagen über alle Berge.
Da stand ich mitten auf der Straße und strich mir mit dem massiven Kopf des Hammers über die Handfläche. Gespenstische Stille machte sich breit: Nichts als das Geräusch der Motten war geblieben, die immer wieder gegen die Straßenlaternen flogen. Dass die Kerle mir entwischt waren, störte mich nicht. Den Letzten hatte ich lange genug gesehen, und ich hatte ihn erkannt. Es war nicht mehr als der Bruchteil eines Geistesblitzes gewesen, aber ich war mir sicher, dass ich ihn von irgendwoher kannte.
Es ist nur eine Frage der Zeit, du Dreckskerl.
Ich sah die menschenleere Straße entlang, während ich versuchte, mich zu erinnern – bis ich bemerkte, wie sehr ich zitterte. Trotz der fast unerträglichen Hitze in den vergangenen Wochen wurde es in den Nächten sehr frisch, und trotz des Adrenalins boten das T-Shirt und die Schlafanzughose, die ich trug, vor der Kälte keinen ausreichenden Schutz. Ich ging wieder ins Haus. Es war allerhöchste Zeit, sich einen Überblick über den Schaden zu verschaffen, der angerichtet worden war. Und die Polizei zu rufen, natürlich auch.
»Meine Güte!«
Es war halb zehn am selben Morgen, als Detective Inspector Chris Sands – mein Partner – neben mir in meinem Wohnzimmer stand. Er sah aus, als könnte er seinen Augen nicht trauen. Aber Chris ist immer so. Ich mag ihn, auch wenn er in jedem Tatort eine Art persönlichen Angriff auf sein Weltbild zu erkennen scheint, während ich darin eher eine Bestätigung sehe: Die Welt ist eben so. Wenn Chris nicht aufpasst, trägt er spätestens mit vierzig das Gesicht eines dauerdeprimierten Hundewelpen mit sich herum.
Um die Ecke in der Küche setzte der Bohrer wieder an. Kurz nach Chris war auch der Mann vom Schlüsseldienst eingetroffen und hatte sich unverzüglich darangemacht, die Schlösser auszutauschen und einen neuen Satz Sicherheitsschlösser einzubauen. Er war angewiesen worden, den Zylinder des alten Schlosses für den Fall aufzubewahren, dass die Leute von der Spurensicherung ihn auf Fingerabdrücke untersuchen wollten. Es gäbe natürlich keine, aber trotzdem. Das war Vorschrift.
Kopfschüttelnd sah Chris sich um. »Was für ein Chaos.«
»Ja«, pflichtete ich ihm bei. »Das kann man wohl sagen.«
Das Scheppern, das ich in der letzten Nacht gehört hatte, war offensichtlich auf den Fernseher zurückzuführen, den die Einbrecher in wilder Hast einfach hatten fallen lassen, als sie geflüchtet waren. Außerdem fehlten jede Menge DVDs, die sie aus den Regalen gefegt hatten, als wäre es darum gegangen, wer die meisten erwischt. Auch meine Playstation und der Laptop waren weg.
Der materielle Schaden aber war nur das eine. Chris hatte recht: Es war ihnen nicht nur darum gegangen, einzubrechen und Sachen mitgehen zu lassen. Auf dem Tisch hatten sie eine Tube Sonnencreme entdeckt und das Zeug überall und in großzügigen Mengen im Raum verteilt. Das Sofa, die Wände, alles war beschmiert. Dessen nicht genug, hatten sie sich eine Flasche Olivenöl aus der Küche geholt und deren Inhalt ebenfalls überall verschüttet. Schließlich, und das war besonders abstoßend, hatte einer sich eine Banane aus der Obstschale genommen, sie im Mund zu Brei gekaut und dann auf den Boden gespuckt. Die Verachtung, die sie mir – einer vollkommen Fremden – damit entgegengebracht hatten, war offensichtlich, und den Rest der Nacht war mir der Gedanke nicht aus dem Kopf gegangen, dass ich am liebsten die Zeit zurückgedreht und die Kerle mit größerer Entschlossenheit verfolgt hätte.
»Drecksäcke.« Chris machte eine Geste, als gäbe es keine Erklärung dafür, wie das hatte passieren können, oder als wäre es auf die zerstörerischen Kräfte eines Tornados oder einer ähnlichen Naturgewalt zurückzuführen. »Irgendwie kann man es verstehen – den Einbruch, meine ich. Dafür gibt es einen Grund. Junkies vielleicht. Sie brauchen das Geld. Aber warum nehmen sie sich das Zeug nicht einfach und gehen? Das werde ich nie begreifen. Warum das hier?«
»Mir leuchtet es ein. Der Grund steckt in dem Wort Drecksäcke.«
»Das wird es sein.«
Überzeugt klang er nicht, aber ich hatte recht. Diese Leute hatten nicht gewusst, wer sich im Obergeschoss aufhielt – ob es eine alleinstehende Frau war wie ich oder eine ganze Familie –, aber vermutlich hatte sie das nicht einmal interessiert. Es war nicht wichtig gewesen. Nicht nur, dass sie sich anderer Leute Hab und Gut unter den Nagel rissen, sondern sie besaßen auch noch die Dreistigkeit, ihnen eine Lektion zu erteilen. Du unterstehst dich, ein eigenes Haus und Besitz zu haben? Bist du wirklich so blöd, hart zu arbeiten und dir eine Existenz aufzubauen? Hier, wir zeigen dir, was wir davon halten. Stell dir vor, welchen Spaß es uns macht, die Früchte deiner Arbeit zu ernten, das kaputt zu machen, was wir nicht haben wollen, und auf das zu spucken, was liegen bleibt.
Das unterdrückte Lachen ging mir nicht aus dem Kopf, das ich gehört hatte. Ich glaube, in meinem ganzen Leben war ich noch nie so wütend gewesen.
»Waren sie schnell da?«, wollte Chris wissen.
»Die Kollegen? Ja. Zehn Minuten später waren sie da und sind etwa eine halbe Stunde geblieben. Einer von ihnen hat sich sogar die Mühe gemacht, mit einer Taschenlampe hinten den Garten abzusuchen. War natürlich überflüssig, aber trotzdem nett von ihm.«
»Wenigstens nehmen sie die Sache ernst.«
»Das stimmt.«
Was das betraf, war es vielleicht hilfreich, selbst Polizistin zu sein, aber Chris hatte etwas anderes gemeint. Generell gibt man sich gern dem Vorurteil hin, dass die Polizei Einbrüchen keine hohe Priorität beimisst. Das ist schlicht falsch; tatsächlich werden die sogar sehr ernst genommen, insbesondere dann, wenn der Hausbesitzer anwesend ist. Sie aufzuklären ist nur schwierig. In der Regel werden keine Spuren hinterlassen, und die Beute ist meistens schnell weiterverkauft. Ein großer Teil der Fälle wird lediglich dadurch von der Liste gestrichen, dass jemand für eine andere Tat geschnappt wird und noch ein paar weitere zugibt, damit seine Kooperation bei der Strafzumessung berücksichtigt wird. Auf diese Weise hat jeder etwas davon.
Das gilt aber nur für normale Einbrüche – wenn der Dieb einfach nur einsteigt und wieder geht. Hinter dieser Sache aber, einem Fall von Vandalismus, steckte eine Art emotionaler Triebfeder. Hier war eine Form von Eskalation zu erkennen. Noch ein paar solcher Straftaten und man konnte sich vorstellen, dass die Typen brutaler vorgingen: es riskierten, hinaufzugehen und vielleicht sogar Menschen zu verletzen. Sie mussten gefasst werden, bevor wir es mit etwas Schlimmerem als Diebstahl zu tun bekamen.
Insbesondere in Anbetracht der vorherrschenden Stimmung.
»Und dann bist du runtergegangen?«, fragte Chris.
»Ja. Natürlich.«
»Na klasse.«
Da war es wieder, das Gesicht eines geprügelten Hundewelpen. Wir arbeiteten schon seit Jahren zusammen, und er wusste, wie gut ich war. Trotzdem konnte er es sich nicht verkneifen, den großen Beschützer zu geben. In solchen Momenten riss ich mich immer zusammen, um ihm nicht zu zeigen, wie oberlehrerhaft ich das fand. Dazu fehlte mir heute allerdings die Geduld.
»Was hätte ich deiner Meinung nach denn tun sollen? Ich war wütend, Chris. Die Leute sind in mein Haus eingedrungen, haben alles kurz und klein geschlagen und sich an meinen Sachen vergriffen.«
»Ja, aber du solltest vorsichtig sein.«
»Glücklicherweise gibt es im Schlafzimmer eine Bodendiele, die sich ständig lockert. Deshalb habe ich dort immer einen Hammer liegen.«
»Trotzdem.« Er zuckte verlegen mit den Schultern. »Man kann doch nie wissen, oder? Schließlich hätte es auch unser Stalker sein können, der sich hier unten herumtreibt.«
Unser Stalker. Die Bezeichnung war unpassend. Obwohl der Fall bei der Polizei im Augenblick allerhöchste Priorität genoss, waren ein paar Kollegen dazu übergegangen, ihn so zu nennen, als würde ihnen durch diese Verharmlosung der Umgang mit den schmutzigen Details der Überfälle erleichtert.
»Ja, eben«, sagte ich. »Dann hätten wir ihn jetzt.«
»Oder er dich.« Aber er bemerkte meinen Gesichtsausdruck, der hinter der draufgängerischen Pose meine wahre Gemütslage durchblicken ließ. »Schon gut, du hast ja recht.«
»Im Übrigen gehört es nicht zu den Eigenheiten unseres Stalkers, Türschlösser aufzubohren«, setzte ich mit einer Kopfbewegung in Richtung Küche hinzu, in der der Schlüsseldienst immer noch bei der Arbeit war. »Oder wie ein Anfänger in den Wohnzimmern anderer Leute herumzustolpern. In dem Fall wäre es für die Frauen vermutlich glimpflicher abgegangen.«
»Jedenfalls ist dir nichts passiert, und das ist die Hauptsache.«
»Ja, mir geht’s gut.«
»Und ich wette, dass die Kollegen begeistert waren.«
»Du meinst, darüber, dass ich den Fall für sie schon gelöst hatte? Klar, sie waren zutiefst beeindruckt.«
Während des Wartens war mir der Name des Mannes, dessen Gesicht ich gesehen hatte, wieder eingefallen. Vermutlich wäre ich schneller draufgekommen, wenn es nicht so lange her gewesen wäre, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, und so gut hatte ich ihn auch wieder nicht gekannt. Meine Clique als Teenager damals in der Thornton-Siedlung hatte nicht viel mit den Leuten gemeinsam, die jetzt meine Kollegen waren. Ich hatte mich ins Zeug gelegt, um mich von all dem loszumachen, und selten an sie gedacht, seit ich mich dem Sumpf dieser Gegend entzogen hatte. Und jetzt war es wieder da – eine Episode meiner Vergangenheit platzte plötzlich in mein Leben hinein.
Drew MacKenzie war der kleine Bruder eines der Mädchen aus der Clique, mit denen ich damals rumhing. Ich hatte ihn ein paarmal bei seiner Schwester gesehen. Ein pfiffiges Kerlchen – damals so um die zehn Jahre alt, und ich meine, mich zu erinnern, dass er ganz schön clever war. Natürlich hatte er damals schon eine gewisse Attitüde: wie Kinder sie eben bekommen, die in einer solchen Umgebung aufwachsen. Eine Art Hülle, unvermeidbar wie die billigen Klamotten aus dem Secondhandladen. Vermutlich hatte diese Pose über die Intelligenz gesiegt, so dass er seiner Schwester ins Familienunternehmen gefolgt ist.
»Du überlässt ihn aber den Kammerjägern, oder?«, fragte Chris.
Ich antwortete nicht.
»Zoe?«
»Ja. Schon gut. Soll ich es dir noch schriftlich geben? Ich überlasse ihn den Kammerjägern.«
Chris wollte noch etwas sagen, wurde aber vom Schlüsseldienst unterbrochen, der mit einer Kiste voller Schlüssel und einem Stapel Papierkram in der Tür stand.
»Entschuldigung, ich bin fertig. Den alten Zylinder habe ich auf die Küchentheke gelegt. Ich brauche nur noch ein paar Unterschriften, dann bin ich verschwunden.«
»Danke. Ich komme gleich.«
»Wann will die Spurensicherung hier sein?«, fragte Chris.
»Jeden Moment. Danach komme ich ins Büro.«
»Musst du nicht. Vielleicht solltest du …«
»Danach komme ich ins Büro.«
Ich sah ihn scharf an, was die Schwermut in seinem geschlagenen Welpengesicht wieder zu verstärken schien. Aber wir wussten beide, warum ich gar nicht anders konnte. Julie Kennedy war vor zwei Tagen in ihrem eigenen Haus überfallen und vergewaltigt worden. Das letzte Opfer unseres Stalkers. Seitdem hatte sie im Krankenhaus gelegen, und es sah so aus, als ließen uns die Ärzte an diesem Nachmittag endlich zu ihr, damit wir mit ihr reden konnten.
Ich sah mich noch einmal in meinem Wohnzimmer um. Nichts als ein großer Saustall und Dinge, die nicht mehr da waren. Aber das alles ließ sich wieder sauber machen beziehungsweise ersetzen. Vor allem aber konnte es warten. Gemessen an dem, was Julie widerfahren war, war das hier nichts.
»Danach komme ich ins Büro«, wiederholte ich ruhig. »Das ist das Beste, was ich tun kann.«
3
Das schaffst du nicht.
Während Jane sich in der halbgeschlossenen Kabine einrichtete und darauf wartete, dass das Lämpchen am Telefon aufblinkte, um ihr anzuzeigen, dass sie einen Anruf bekam, dachte sie nur:
Das schaffst du nicht.
Es war die Stimme ihres Vaters. Seit er tot war, hatte sie alles versucht, um diese Stimme aus dem Kopf zu bekommen, ihr zumindest aber etwas entgegenzusetzen. Du schaffst das. Und zwar gut. Manchmal vollbrachte sie sogar das Kunststück, es wirklich zu glauben. Trotzdem war seine Stimme immer da, im Hintergrund, um sich besonders in Situationen, in denen sie sich unter Druck fühlte, eindringlich Gehör zu verschaffen.
Das schaffst du nicht …
Das rote Lämpchen am Telefon blinkte.
Fast im selben Augenblick hatte Jane den Hörer schon in der Hand. Wenn sie eines nämlich tatsächlich nicht konnte, dann war es warten. Denn dann neigte sie dazu, in eine Art Schockstarre zu verfallen. In der Schule und selbst noch an der Uni war es immer wieder zu peinlichen Pausen gekommen, die sich unerträglich hinzogen: Momente, wenn sie die erwartungsvollen Blicke der anderen auf sich gerichtet spürte und ihr nichts anderes einfiel, als dazusitzen und rot anzulaufen. Handle sofort, hatte die Therapeutin ihr seitdem immer geraten. Angst entsteht meistens aus etwas Vorweggenommenem, also nimm dir gar nicht erst die Zeit zu überlegen. Hätte sie das Telefon noch länger läuten lassen, wäre sie vielleicht gar nicht mehr drangegangen.
»Hallo.« Ihre Stimme klang überraschend fest. »Hier ist Mayday. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Zunächst meldete sich niemand, tot war die Leitung aber nicht. Sie hörte den Mann atmen – ein schleppendes, schweres Geräusch, so dass sie sich schon fragte, ob das einer dieser Sexanrufe werden würde. In der Ausbildung war ihnen von solchen Anrufen erzählt worden, aber aus ihrer Gruppe hatte noch niemand einen bekommen. Irgendwann würde das passieren, aber bitte, lieber Gott, dachte sie, nicht jetzt. Das wäre die Feuertaufe.
Endlich fing der Mann an zu reden. »Ich heiße Gary.«
»Hallo, Gary.« Sie war nicht verpflichtet, ihren tatsächlichen Namen zu nennen. Trotzdem entschloss sie sich, es zu tun. »Ich heiße Jane. Worüber möchten Sie reden?«
»Ich weiß nicht so genau.« Er schniefte. »Ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt anrufe. Ich hatte mir die Nummer irgendwann mal mitgenommen.«
»Sie haben sich unsere Nummer mitgenommen?«
»Hmm.« Die Stimme veränderte sich, und sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass er angefangen hatte zu weinen oder zumindest kurz davor war. »Das ist alles, was ich dabeihabe. Mehr brauche ich nicht. Ich bin in einem Hotel.«
Mehr brauche ich nicht. Jetzt erkannte Jane den Zweck des Anrufs, den sie angenommen hatte. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihrem Magen breit. Sie sah sich in der kleinen Kabine um, die sie vom übrigen Raum trennte, rang die Angst nieder, die sich ihrer zu bemächtigen begann. Alles hätte sie jetzt für einen Sexanruf gegeben. Stattdessen hatte sie es mit einem SIP zu tun. Das war bei Mayday, der Seelsorge-Hotline, das Kürzel für einen angekündigten Suizid.
Bleib ruhig, redete sie sich zu.
Du schaffst das.
»Gary, ganz ruhig. Wir können über alles reden, wenn Sie möchten. Wir haben Zeit.«
»Ich möchte über Amanda sprechen.« Er schniefte. »Aber bringt das überhaupt was? Sie kennen Amanda ja nicht. Vielleicht aber doch. Könnte ja sein, ich weiß schließlich gar nicht, wer Sie sind.«
»Lassen Sie sich Zeit, Gary.«
»Aber ich kenne sie. Besser als alle anderen. Sie weiß es nur nicht.«
»Okay. Wir können über Amanda sprechen.«
»Ich kenne sie schon seit Jahren. Wir haben zusammen gearbeitet, und dann – wissen Sie, waren wir zusammen. Mein Gott, letztes Jahr um diese Zeit haben wir zusammen gewohnt.«
Erneut brach er in Tränen aus, und Jane verspürte in sich einen Widerhall der Trauer, die der Mann empfand. Es reichte gerade eben aus, dieses vertraute, schwankende Gefühl von Anteilnahme in ihr zu entfachen, diesen Schritt, den man auf einen anderen zugeht, um ihn zu verstehen. Darin war Jane immer schon gut gewesen – zu gut, vielleicht –, und an diese Verbindung knüpfte sie an. Letztes Jahr um diese Zeit. Es gab eine Menge Beispiele aus ihrem eigenen Leben, auf die sie sich beziehen konnte. Den Tod ihres Vaters. Peter.
Du schaffst das.
»Ja, manchmal fühlt es sich seltsam an, wenn man zurückblickt, stimmt’s?«, fing sie an. »Wenn einem klarwird, dass vor nicht allzu langer Zeit so vieles noch ganz anders war. Manchmal kann man es gar nicht begreifen.«
»Ja, genauso ist es.«
»Lassen Sie sich Zeit, Gary.«
Während Gary seine Geschichte stockend vorbrachte, ließen Alkohol oder Drogen, vielleicht aber auch ein Mix aus beidem – was immer er genommen hatte –, seine Sprache immer verwaschener klingen. Nach wenigen Minuten wurde Janes Handfläche schweißfeucht. Sie musste den Hörer in die andere Hand nehmen. Aber sie bemühte sich, ruhig zu bleiben: sich in seine Lage zu versetzen und sich vorzustellen, was er durchmachte; ihm zu helfen, so gut sie konnte.
Und das hieß nichts anderes, als fast während der gesamten Dauer des Gesprächs zu schweigen. Je länger Gary redete, umso überflüssiger schien sie zu werden. Er wollte einfach nur, dass es am anderen Ende der Leitung jemanden gab, der ihm zuhörte.
Amanda und Gary waren ein paar Monate lang zusammen gewesen, und sie hatten eine wunderschöne Zeit miteinander gehabt – sagte er jedenfalls. Dann aber hatte die Beziehung angefangen, sich abzukühlen. Amanda ging immer öfter allein aus, und Gary hatte ihr nicht vertraut. Er fing an, ihre SMS und E-Mails zu lesen, und fand auch etwas: zunächst nichts wirklich Belastendes, aber genug, um sich in seinem Misstrauen bestätigt zu fühlen und weiter nach neuen Anhaltspunkten zu suchen, die er stets auch fand.
»Sie hat SMS mit ihrem Ex ausgetauscht. Sie waren in Kontakt geblieben. Ich konnte es einfach nicht ertragen. Tut mir leid. Aber sie sagte, dass ich das akzeptieren muss, und ich wollte ihr vertrauen. Ich habe es versucht.«
Jane ahnte, dass das nicht die ganze Wahrheit war, unterdrückte aber ihren Verdacht. Es war wichtig, dass sie die Geschichte, die er erzählte, weder bewertete noch deutete. Während Gary ihr die Einzelheiten der Trennung schilderte und erzählte, wie Amanda seine Anrufe und Nachrichten ignorierte, konzentrierte sie sich darauf, sich in ihn hineinzuversetzen: nach vergleichbaren Gefühlen aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz zu suchen, nach emotionalen Spielkarten, die zu denen passten, die er spielte. Das fiel ihr nicht schwer. Sie erinnerte sich noch gut an die Zeit der Trennung von Peter. Selbst wenn sie damals gewusst hatte, dass es für beide das Beste war – manchmal hatte sie das Gefühl des Verlusts als unerträglich empfunden. Die Trauer um diese Beziehung war echt gewesen, als trauerte sie um ein Lebewesen, und die letzten wenigen Wochen, in denen sie es leiden und schließlich sterben sah, hatten sich unendlich hingezogen. Jane wusste, wie schmerzhaft das war. Während sie Gary nun zuhörte, keimte dieses Gefühl erneut in ihr auf.
»Sie ist in Urlaub.« Die ersten drei Wörter verbanden sich zu einem verwaschenen sissn. »Hier bei ihm. Letztes Jahr haben wir zusammengelebt, und jetzt ist sie hier bei ihm, und deshalb bin ich auch hier.«
»Sie sind auch da?«
»Ja. Im selben Hotel. Es liegt an der Küste. Wenn sie mich finden, dann weiß sie, wie wichtig sie für mich war. Dann wird sie mich nicht mehr zurückweisen können, oder?«
Jane fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und dachte nach. Sie begriff, was Gary vorhatte. Er wollte sich nicht nur das Leben nehmen, sondern das auch noch in der Nähe seiner Ex-Freundin tun. Nachdem Amanda all die Anrufe und SMS ignoriert hatte, würde er sie nun zwingen, ihm zuzuhören.
Ein eiskalter Schauer durchfuhr sie – aber ein Urteil stand ihr nicht zu. Genauso wenig war es ihre Aufgabe, ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Einzugreifen widersprach den Regeln der Seelsorge-Hotline; es war nur dann erlaubt, wenn er sie ausdrücklich darum bat. Und selbst wenn sie es gewollt hätte, hatte sie gar keine Möglichkeit, es zu tun.
Sie überlegte.
»Wollen Sie mir das Hotel nennen, Gary?«
»Ich habe sie schon gesehen.« Seine Sprache wurde immer undeutlicher, er war kaum noch zu verstehen. »Heute Morgen – durchs Fenster. Hier steht ein Sofa im Raum, man kann sich einfach hinsetzen. Sie sind die Promenade entlanggegangen. Hand in Hand. Ich weiß nicht, wann sie zurück sind. Aber es interessiert mich auch nicht mehr.«
»Gary«, sagte Jane. »Eine Frage. Möchten Sie, dass ich jemanden für Sie anrufe?«
»Nein, tun Sie das nicht.«
»Natürlich nicht«, setzte sie schnell hinzu. »Nicht, wenn Sie mich nicht drum bitten. Aber wenn Sie Ihre Meinung ändern, kann ich Ihnen jemanden schicken.«
»Es ist zu spät. Es fühlt sich gut an.«
Janes Herz schlug zu hastig, und sie zwang sich, ruhig zu atmen. Als sie spürte, dass es nichts mehr zu sagen gab, ließ sie die Stille wirken, die sich in der Leitung ausbreitete, und stellte sich vor, wie Gary diese Leere nach seinen Bedürfnissen füllte.
»Es fühlt sich gut an«, sagte er schließlich. »Weit weg.«
Im nächsten Moment war die Leitung tot.
Wie betäubt verließ Jane die halboffene Kabine und ging zu ihrer Ausbildungsgruppe. Als sie allmählich wieder zu sich kam, fühlte sich ihr Körper federleicht und seltsam an. Sie setzte sich langsam hin.
Zu Beginn jeder Sitzung wurden alle ehrenamtlichen Mitarbeiter willkürlich in Gruppen aufgeteilt. An diesem Abend war sie mit Simon, Brenda und Rachel zusammen. Rachel – eine kleine, punkige Doktorandin Mitte zwanzig – war die Einzige, mit der sie schon einmal gesprochen hatte. Sie lächelte Jane zu und signalisierte ihr mit ausgestrecktem Daumen ein Okay.
Jane lächelte schwach zurück.
Kurz darauf kam Richard aus einem der abgetrennten Bereiche gleich neben dem, in dem sie gesessen hatte. Er hatte den Papierstapel in der Hand, von dem er abgelesen hatte.
»Gut, das war ganz schön heftig, findet ihr nicht auch? Jane, alles okay mir dir?«
Sie nickte. »Ich glaub schon. Aber … ja.«
»Heftig. Aber du hast dich tapfer geschlagen. Das war eine sehr schwierige Situation, aber ich hatte den Eindruck, dass du es ausgezeichnet gemeistert hast.« Er setzte sich zu den anderen Mitarbeitern. »Okay – Fragen aus der Gruppe. Hat jemand von euch etwas dazu zu sagen? Gab es etwas, was Jane hätte anders machen können?«
Jane sah sich um. Sie war nervös. Während des Gesprächs mit »Gary« hatte sie es geschafft, ihre Nervosität und aufkommenden Selbstzweifel in Schach zu halten und sich voll und ganz auf die Unterhaltung zu konzentrieren. Als hätte es sie gar nicht gegeben. Aber jetzt war sie wieder da, und die anderen drei sahen sie an. Sie spürte schon, wie sie errötete, und ihre Augen begannen, sich mit Tränen zu füllen.
Starrt mich doch nicht so an.
»Ich finde, es war perfekt«, fing Rachel an.
Jane riskierte einen kurzen Blick, sah, wie das Mädchen sie erneut anlächelte, und wandte sich wieder ab. Eine freundliche Geste, dachte Jane, ihr Mut zu machen, ohne sie zu bedrängen. Wie eine Freundin, die kurz anrief, um sich zu erkundigen, ob es einem gutging, und gleich wieder auflegte, weil sie nur das hatte wissen wollen.
Simon und Brenda suchten nach etwas, das als konstruktive Kritik gelten konnte, taten sich aber schwer. Richard hörte zu und nickte trotzdem, denn das taten sie immer bei Mayday. Jane war überrascht, dass die Kritik an ihrer Leistung so viel kürzer ausfiel als bei den anderen. Schließlich bedachte auch Richard sie mit einem herzlichen Lächeln.
»Gut gemacht«, sagte er. »Das war richtig gut.«
Nein, war es nicht, dachte sie.
Behielt es aber für sich. Vor wenigen Monaten hatte sie das noch getan: Leuten ihre Schmeicheleien zurückgeworfen. Das ist ein Fortschritt, dachte sie. Sie wurde besser.
Nachdem die Trainingssitzung beendet war, mischten sich die Teilnehmer unter die Mitarbeiter der anderen Gruppen, tranken Kaffee und plauderten ein wenig oder gingen gleich nach Hause. Jane war meistens eine der Ersten, die sich verabschiedeten, heute Abend aber ließ sie sich Zeit. Das Gespräch mit »Gary« ließ sie nicht los. Auch wenn ihr die ganze Zeit klar gewesen war, dass es sich um kein wirklich geführtes Gespräch gehandelt hatte, hatte es sich so angefühlt. Die Namen waren geändert worden, das wusste sie. Aber alle Trainingsszenarien basierten auf echten Anrufen, die die Ausbilder irgendwann einmal bekommen hatten.
Im Gehen sah sie Richard, der gerade einen der Tische sauber machte und Plastikbecher wegräumte. Sie warf sich ihre Tasche über die Schulter, nahm all ihren Mut zusammen und ging zu ihm.
»Richard?«
»Jane. Hallo. Ach – du willst gehen?«
»Ja«, antwortete sie verlegen. Richard war um die fünfzig, von großer Statur und hatte einen kurzgeschorenen, ergrauten Haarkranz auf dem Kopf. Er war freundlich, aber seine Art, sie anzusehen, irritierte sie. Blickkontakt zu halten schien für ihn lebenswichtig zu sein. »Ich habe nur noch eine Frage zu diesem Anruf.«
»Ja, du hast das wirklich gut gemacht.«
»Danke.« Das ist ein echter Fortschritt. »Ich frage mich … ob es wirklich nichts gab, was ich noch hätte tun können? Am Schluss, meine ich.«
»Okay. Ich weiß, was du meinst.« Er hielt mit seiner Arbeit inne und wandte sich ihr zu. »Nein. Nichts. Glaub mir, ich weiß, dass du den Leuten helfen möchtest. Aber es geht nicht. Vergiss nicht, dass unser Dienst absolut vertraulich ist. Und wäre er es nicht, könntest du trotzdem nichts für sie tun.«
»Nein, ich weiß.«
Er hatte recht. Müsste jemand wie Gary fürchten, dass sie ihn finden könnte oder aufhalten würde, hätte er gar nicht erst angerufen. Irgendwie verrückt. Richard sah sie freundlich an, und sie spürte, dass er ihr eine Hand auf die Schulter legen wollte, um ihr Mut zu machen. Als väterliche Geste. Aber das tat er natürlich nicht.
»Ein schales Gefühl bleibt immer zurück«, sagte er. »Vergiss nicht, dass der Anrufer für sich selbst entscheiden muss. Nur er allein ist für das verantwortlich, was er tut. Nicht du.«
Sie nickte. Das hatten sie in den ersten Stunden ihrer Schulung schon besprochen; sie hatte sich immer Notizen gemacht. Trotzdem quälte sie ihr Gewissen.
Richard seufzte, als er den Konflikt wahrnahm, in dem sie steckte.
»Weißt du, was ich immer mache?«, fragte er. »Etwas, das wirklich hilft, schwierigere Fälle zu verarbeiten. Ich sage mir immer, dass sie nicht echt sind.«
»Nicht echt?«
»Genau.« Er breitete die Hände aus, in einer hielt er den schmutzigen Lappen. »Ob diese Menschen dir die Wahrheit erzählen, wenn sie anrufen, wirst du nie erfahren. Es gibt Anrufer, die uns jedes Mal dieselbe Geschichte erzählen und nur ein paar Details verändern. Dann weißt du, dass alles nur erfunden ist. Aber auch bei denen, wo es nicht offensichtlich ist, kannst du dir nie sicher sein.«
»Stimmt.«
»Und was den echten Gary angeht«, fuhr er fort, »weiß ich nicht, was mit ihm passiert ist, und ich werde es auch nie erfahren. Das ändert aber nichts daran, wofür ich hier bin. Ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Ich kann mir ausmalen, dass er alles nur erfunden hat oder dass er einfach nur eingeschlafen ist und sich die Sache am Ende eingerenkt hat.«
Richard nickte vor sich hin.
»Ganz ehrlich«, fuhr er fort, »wenn ich solch einen Anruf bekomme, dann tu ich genau das.«
4
»Gut«, sagte ich zu Julie Kennedy.
Aber sie war gerade erst zum Ende der Schilderung dessen gekommen, was sie erlebt hatte, und ich erschrak, kaum dass mir das Wort über die Lippen gekommen war. So wie ich daherredete, empfand sie mich vielleicht sogar als gleichgültig; ich sollte vorsichtiger sein. Tatsächlich war nämlich gar nichts gut. Wie schnell auch immer sie sich körperlich von der Tortur erholte, nichts würde für sie je wieder gut sein.
Sollte Julie überhaupt Notiz von dieser Plattheit genommen haben, ließ sie es sich zumindest nicht anmerken, aber vielleicht nahm ich mich auch einfach nur zu wichtig: als würde sie nach dem, was sie durchgemacht hatte, auf die Wahl meiner Worte achten oder sich gar beleidigt fühlen.
Jetzt saß sie halb aufgerichtet in ihrem Krankenhausbett. Den Blick von mir und Chris abgewandt, auf die Lamellen der herabgelassenen Jalousie gerichtet. Die Bettdecke war zur Taille heruntergerutscht, und die Hände – einer der gebrochenen Finger bis zum Handgelenk in einem Gipsverband – lagen auf ihrem Schoß. Das Licht in dem kleinen Raum spendete nur eine schwache Leuchte auf dem Nachtschrank neben dem Bett, aber die äußerlichen Verletzungen waren nicht zu übersehen. Die abgewandte Seite ihres Gesichts war verbunden, die andere von starken Schwellungen entstellt. Die Haut war bleich, von Hämatomen und gezackten Linien mit auffälligen Nähten überzogen.
Eine Weile herrschte bedrückende Stille im Raum, dann hob sich ihr Brustkorb langsam, und sie seufzte lang und gedehnt.
»Wenn ich mich doch nur gewehrt hätte«, sagte sie.
Das hatte sie schon gesagt, während sie uns die Einzelheiten des Überfalls beschrieb, und ich wiederholte meine Antwort.
»Das wünschen Sie sich besser nicht. Er hätte Sie sonst umgebracht. Sie dürfen sich nicht die Schuld für etwas geben, was Sie nicht getan haben, und schon gar nicht für etwas, was Sie auf keinen Fall hätten tun dürfen. Sehen Sie mich an, Julie.«
Zögernd drehte sie sich zu mir um. Ich sah ihr in das eine noch erkennbare Auge.
»Nur er ist schuld«, sagte ich.
»Ich hatte viel zu viel Angst.«
»Ich weiß.«
»Und er war so groß und stark.«
»Ich weiß.«
Zweieinhalb Tage war es her, seit Julie Kennedy in ihrem Haus überfallen worden war. Die Einzelheiten darüber standen auf dem Block, der vor mir lag, ohne dass ich meine Notizen bemühen musste; jedes einzelne Wort, das sie in der letzten halben Stunde mit ruhiger Stimme vorgebracht hatte, hallte in meinem Kopf wider. Julie war unser fünftes Opfer, und sie hatte uns dieselbe Geschichte erzählt wie die vier Frauen vor ihr. Dennoch schien ihr das Schicksal gnädig gewesen zu sein, denn ihre Erinnerung war nur vage und lückenhaft. Den größten Teil des Überfalls hatte sie dorthin verbannt, wo Alpträume eingeschlossen werden. Aber das, woran sie sich erinnerte, war noch mehr als genug.
Es war in den frühen Morgenstunden passiert, als sie aufgewacht war und einen Mann neben ihrem Bett erblickt hatte. Er war vollkommen schwarz gekleidet und trug eine Maske und Handschuhe. Julie erzählte, dass er mit seiner Statur die Vorhänge vollkommen zu verdecken schien, was natürlich gar nicht möglich und entweder auf eine optische Täuschung oder eine Überzeichnung als Folge ihrer panischen Angst zurückzuführen war. Aber die anderen Opfer hatten Ähnliches berichtet: dass der Mann ihnen als ein gigantischer Schattenriss erschienen war – ein Monster –, der allein durch seine Gegenwart Panik verbreitete, ohne dass er etwas tat. Und während er sich an ihnen verging, sagte er kein Wort. Eine Frau hatte ihn als die geballte Form des Hasses charakterisiert; eine andere sagte, dass ihm der Geruch von Gewalt angehaftet hatte. Alles scheinbar bizarre, flüchtige Darstellungen, die jedoch für mich einen Sinn ergaben. In allen Fällen hatte ich beobachtet, wie die Frau versuchte, den Täter auf eine Weise zu beschreiben, die über Worte hinausging. Für das, was sie erlebt hatte, gab es keine adäquate Sprache.
Genau wie die vorherigen Opfer war Julie vergewaltigt und schwer misshandelt worden. Nachdem der Mann verschwunden war, hatte sie über Stunden immer wieder das Bewusstsein verloren und war gegen fünf Uhr am Morgen gerade noch in der Lage gewesen, die Polizei anzurufen, bevor ihr Kreislauf vollständig kollabierte. Zwei Tage hatte sie danach in kritischem Zustand hier im Baines-Flügel des Krankenhauses zugebracht, während wir in ihrem Haus die Spuren gesichert und Nachbarn befragt hatten sowie allen möglichen Hinweisen nachgegangen waren.
»Julie«, sagte ich. »Ich weiß, dass es schwer für Sie ist, und bisher haben Sie Ihre Sache sehr gut gemacht. Aber ich würde trotzdem gern mit Ihnen über das sprechen, was vor dem Überfall passiert ist.«
»Da hab ich geschlafen.«
»Nein, ich meine davor. Als Sie ins Bett gegangen sind.«
Ihr Reflex, die Stirn krauszuziehen, wurde von den Nähten in ihrem Gesicht schmerzhaft vereitelt.
»Es war … einfach so wie immer.«
»Haben Sie nachgesehen, ob die Wohnungstür verschlossen war?«
»Ja. Wie immer. Abgeschlossen und die Kette vorgelegt. Das Sicherheitsschloss war eingerastet.«
Sie sagte es sehr entschlossen, und ich glaubte ihr.
»Gut«, sagte ich.