
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nachdem Holly aus den Fängen der Acrai befreit und in die Zentrale des Volkes V23 gebracht wurde, beginnt für sie erneut ein von Unterdrückung bestimmter Alltag. Allen Bemühungen zum Trotz, findet sie sich in ihrem neuen Leben nicht zurecht. Als sie eine mysteriöse Entdeckung macht, kreisen ihre Gedanken mehr denn je um eine Flucht. Währendessen kämpft Cade weit weg von New York City um sein Überleben. Wird es ihm gelingen, Holly aus der Zentrale zu befreien? Und wie steht es überhaupt um ihre Gefühle? Wird sie ihm noch einmal vertrauen können?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Narcia Kensing
Nachtschwarze Sonne
Undying Blood 2
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Hinweis an den Leser
Weitere Werke der Autorin
Impressum neobooks
Kapitel eins
Holly
Es ist so windig, dass ich die Augen kaum öffnen kann. Meine Haare wirbeln um meinen Kopf und peitschen mir ins Gesicht. Ich gehe gebeugt, den Kopf gesenkt, damit der Wind mich nicht umstößt. Bis auf meine Füße, die in zerschlissenen gelben Schlappen stecken, sehe ich nichts. Ich gehe auf glattem grauen Betonboden.
Neals Griff um meine rechte Hand ist fest. Nicht grob, eher Trost spendend. Ich sehe ihn nicht, weiß aber, dass er da ist. Durch den ohrenbetäubenden Lärm der Rotorblätter kann ich nicht hören, ob er mit mir spricht. Er zieht mich hinter sich her, als wüsste er genau, wohin wir gehen müssen. Ich folge ihm blind.
Shelly, das blonde Mädchen, das ich aus dem Quartier der Acrai gerettet habe, ist vor uns aus dem Bauch des Helikopters ausgestiegen. Eine Frau im schwarzen Anzug hat sie weggeführt. Das Mädchen hat den gesamten unruhigen Flug über aus dem Fenster gesehen, in den Nachthimmel hinein. Es ist stockdunkel und ich bezweifle, dass sie etwas erkennen konnte. Sie hat kein Wort gesprochen, genau wie ich. Mit gesenkten Kopf saß ich zwischen ihr und Neal und hoffte, der Flug würde rasch ein Ende nehmen. Nicht, weil ich Angst gehabt hätte, obwohl mich bis vor wenigen Tagen sogar die Fahrt in einem Auto an den Rand der Selbstbeherrschung getrieben hatte. Nein, ich fühle nichts, mein Innerstes ist leer. Ich hatte bloß gehofft, die Obersten würden mich zurück nach Hause bringen. Endlich Ordnung, Struktur, Disziplin und - Vergessen. Ja, tief in mir drin ist das mein sehnlichster Wunsch. Aber ich habe nicht ernsthaft daran geglaubt, dass ich alsbald Carl und Candice wiedersehen würde, die sicherlich krank vor Sorge sind.
Meine Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet, denn ich befinde mich schon wieder in einer mir völlig fremden Umgebung. Obwohl es tiefste Nacht ist und meine Augen tränen, kann ich mit absoluter Sicherheit behaupten, nie zuvor hier gewesen zu sein. Das ist nicht Manhattan, auch nicht Jersey City.
Ich stolpere noch immer hinter Neal her. Ich hebe erst den Blick, als er plötzlich stehen bleibt. Vor uns ist ein mehr als drei oder vier Yards hohes Metalltor, rechts und links gesäumt von einer Betonmauer, an deren oberem Ende spiralförmig darauf angebrachter Stacheldraht glitzert. Einer der Männer zieht etwas hervor, das im Dunkeln wie eine Karte aussieht, etwa so groß wie die Individuenausweise. Er steckt die Karte in ein Gerät, woraufhin eine grüne Lampe aufleuchtet. Alles geht so schnell, dass ich seinen Bewegungen kaum folgen kann.
Eine Hälfte des Flügeltors schwingt lautlos auf. Allmählich lassen Lärm und Wind hinter mir nach. Der Pilot des Hubschraubers hat den Motor abgestellt. Wir treten durch das Tor, das hinter uns mit einem leisen metallischen Geräusch wieder ins Schloss fällt. Was ich jetzt sehe, kitzelt etwas in der Leere meiner Seele wach, aber es ist kein angenehmes Gefühl. Eher so, als hätte ich etwas Schlechtes gegessen. Tiefes Unbehagen, gepaart mit einem Anflug von Ehrfurcht. Grelles weißes Licht, das sich trichterförmig von mehreren, in regelmäßigen Abständen aufgestellten Laternen ausgehend auf den Boden ergießt, scheint auf uns herab.
Die glatte graue Straße, auf der wir gehen, führt strikt geradeaus. Wir passieren Kreuzungen, andere Straßen zweigen in akkuratem rechten Winkel von dieser ab. Am Wegrand stehen flache schmucklose Gebäude, manche nur mit einem Stockwerk, andere mit zwei oder drei. Sie sehen alle ähnlich aus: graue hässliche Betonquader mit winzigen Fenstern, die das Mauerwerk durchbrechen. Wir gehen immer weiter, aber meine Umgebung ändert sich nicht. Alles sieht gleich aus, als kämen wir überhaupt nicht voran.
Neben mir geht Neal. Sein Gesicht ist verkniffen, seine Augen zucken wachsam von rechts nach links. Seine Hand ist warm und ich spüre die Zuversicht, die er ausstrahlt. Er macht nicht den Eindruck, als wäre die Umgebung neu für ihn.
Vor uns geht eine Frau, die den Arm um Shellys Schultern gelegt hat. Das Mädchen dreht sich immer wieder zu mir um. Ich würde sie gerne anlächeln, aber ich kann einfach nicht. Es ist, als seien meine Mundwinkel festgeklebt. Auch sie verzieht keine Miene. Sie sieht mich einfach nur an, sekundenlang, ehe sie sich wieder umdreht. Ein Schauder läuft mir den Rücken herunter. Die Haare der Frau, die Shelly zum Weitergehen antreibt, sind ebenso schwarz wie ihr Anzug. Ihre Silhouette hebt sich kaum von der stockfinsteren Nacht ab. Ich sehe sie nur, wenn sie in den Lichtschein einer Laterne tritt.
Ganz vorne gehen zwei Männer. Sie haben ebenfalls mit uns im Helikopter gesessen. Niemand spricht ein Wort. Unsere Schritte sind das einzige Geräusch, das ich wahrnehme, sie hallen von den bedrohlich aufragenden Wänden der hässlichen Häuser wider.
Endlich erreichen wir einen Ort, der anders aussieht. Es ist ein quadratischer Platz, der mit glatten Steinplatten ausgelegt ist und mindestens dreißig Yards an jeder Seite misst. Ein Gebäudekomplex erstreckt sich an drei Seiten um den Platz herum. Hier sehe ich zum ersten Mal Lichter hinter den Fenstern. Drei Stockwerke ragen über uns auf, auf dem flachen Dach gibt es an jeder Ecke einen Fahnenmast, an dem eine Flagge weht - ein schwarzer siebenzackiger Stern auf weißem Grund, der im fahlen Licht der Sterne schimmert. Das ist die Zentrale der Obersten? Ein trostloser Ort und ganz gewiss nicht das Paradies, das in meinen Büchern beschrieben wird. Ich habe mir alles viel bunter vorgestellt, habe von exotischen Pflanzen und belaubten Bäumen geträumt, aber nichts davon sieht so aus wie in meiner Vorstellung. Es gibt keine Bäume, nicht einmal einen Grashalm. Alles ist grau.
Vielleicht sieht es bei Tag freundlicher aus, versuche ich mich zu beruhigen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich diese Stadt, die sich Zentrale nennt, nie wieder verlassen werde.
Die beiden Männer, die voran gegangen sind, bleiben stehen und drehen sich zu uns um. Sie nicken der Frau mit den schwarzen Haaren zu. Sie dreht Shelly an der Schulter herum und wendet sich mit ihr nach links. Shelly dreht sich wieder zu mir um, diesmal blickt sie mich flehend an. Ich möchte einen Schritt auf sie zu gehen, aber Neal greift meine Hand noch fester und hält mich zurück. Er schüttelt kaum merklich den Kopf und sieht mich eindringend an. Ich muss hilflos zusehen, wie Shelly und die Oberste auf den linken Flügel des u-förmigen Gebäudes zugehen. Die Laternen leuchten nicht den gesamten Platz aus, weshalb sie irgendwann aus meinem Blickfeld verschwinden. Sie tauchen in den Schatten der Mauern ein, die sich schwarz vom erleuchteten Firmament abheben. Ich höre nur noch ihre Schritte, dann das Surren des Scanners einer Tür. Dann ist es still.
»Wohin gehen sie?«, frage ich. Meine Stimme klingt belegt und leise.
Einer der Männer sieht mich an. Im ersten Moment denke ich, dass er meine Frage nicht verstanden hat, weil ich keine Regung in seinem Gesicht sehe.
»Mach dir keine Sorgen. Dem Mädchen wird es gut gehen.«
Er sagt, ich solle mich nicht sorgen, aber sein Tonfall ist alles andere als beruhigend. Als würde er einen Text herunterleiern, den er auswendig gelernt hat.
»Es ist spät und ihr habt heute Nacht viel durchgemacht«, sagt der andere Mann und kommt auf mich zu. Er ist groß und seine Haare sind blond. Fast wie die von Neal, aber nicht so schön gewellt. »Wir bringen euch auf eure Zimmer. Morgen erfahrt ihr, wie es weitergeht.«
Er legt mir eine Hand auf die Schulter und lächelt, aber es reicht nicht bis zu seinen Augen hinauf. Auch er wirkt auf mich eher wie ein Roboter als ein Mensch. Ich würde mich am liebsten umdrehen und weglaufen, aber das ist keine Lösung. Zum einen käme ich nicht weit, zum anderen wüsste ich auch gar nicht, wohin ich gehen sollte. Ich könnte mich nirgendwo verstecken.
In diesem Moment lässt Neal meine Hand los. Kühler Wind streift durch meine Finger. Auch er lächelt mich an. Nicht so breit und freundlich wie früher, aber immerhin wärmer als das Lächeln des Mannes, der vor mir steht und auf mich hinab sieht. Neal geht auf den anderen Mann zu. Dieser nickt wie zum Gruß, als sei Neal kein Unbekannter. Mir fährt ein Stich in die Brust. Neal ist schon einmal hier gewesen. Mir wird schmerzhaft bewusst, dass er ein Verräter ist. Oder bin ich bloß zu blind gewesen, richtig von falsch zu unterscheiden? Bin ich zu verliebt gewesen, um die Wahrheit zu sehen?
Neal und der Oberste wenden sich ab und gehen auf den rechten Gebäudeflügel zu. Der blonde Mann vor mir gibt mir mit einer Geste zu verstehen, dass die Gebäudemitte unser Ziel sein wird. Er gibt mir einen sanften Schubs gegen die Schulter und animiert mich, ihm zu folgen. Zögerlich tue ich wie mir geheißen. Weshalb gehen wir woanders hin als Neal und Shelly?
Ich spüre, dass meine Knie zittern, während wir auf ein großes Eingangsportal zulaufen. Zwei Treppenstufen schälen sich aus der Dunkelheit, dahinter eine graue Metalltür ohne Klinke. Sie ist mehr als drei Yards hoch und wird auf beiden Seiten von zwei Fahnenmasten gesäumt. Auch hier weht der siebenzackige Stern sanft in der nächtlichen Brise.
Müdigkeit und Erschöpfung lähmen meine Gedanken. Ich habe nicht mehr die Kraft, Fragen zu stellen oder mich zu widersetzen. Wozu auch.
Ich steige die beiden Stufen hinauf und drehe mich noch einmal um, während der Mann wieder eine Karte in ein Gerät neben der Tür steckt. Neal und seine Begleitung sind bereits in einem anderen Teil des Gebäudes verschwunden, ich kann sie nicht mehr sehen. Niemand befindet sich mehr auf dem Platz, er liegt still und wie ausgestorben da, hässlich und grau.
»Komm mit«, sagt der Mann. Die Tür ist weit geöffnet, dahinter liegt ein schwach beleuchteter Flur.
Ich schlucke meine zart aufkeimende Angst hinunter und folge ihm ins Gebäude. Erst jetzt, im Licht, kann ich den Obersten besser erkennen. Sein Gesicht ist ganz glatt, er sieht jung aus. Auf einem kleinen Schild über der linken Brusttasche seines schwarzen Einheitsanzuges steht seine Nummer. 67-45, Ordnungsdienst.
Hinter uns schließt sich die Tür mit einem leisen metallischen Klong. Wir befinden uns in einer Art Foyer. Die Decke ist hoch, eine weiß geflieste Treppe liegt vor uns. Sie führt in einer schwungvollen Biegung hinauf ins obere Stockwerk. Der Boden ist ebenfalls weiß gefliest, die Wände bestehen hingegen aus matt gebürstetem Metall, in dem man sich nicht spiegeln kann. Ich fühle mich schmerzlich an meine Zeit im Quartier der Acrai erinnert. Hier ist es ebenso steril und unpersönlich. In die Decke eingelassene Strahler spenden gedämpftes Licht. Ich nehme an, dass sie sich dimmen lassen und jetzt bei Nacht nur mit geringerer Intensität leuchten.
67-45 geht die Treppe hinauf, ich folge ihm. Ich sehe die ganze Zeit auf seinen breiten Rücken. Er ist gerade und angespannt, seine Bewegungen seltsam mechanisch und akkurat. Er scheint es nicht für nötig zu halten, mit mir zu sprechen oder sich auch nur zu mir umzudrehen. So wenig Herzlichkeit habe ich selten bei einem Menschen erlebt.
Ich zittere am ganzen Körper, mein zerschlissenes T-Shirt und die kurze Hose, die Cade mir in Jersey City beschafft hat, riechen nach Qualm, sind zerlöchert und schmutzig. Ich komme mir vor wie ein Schandfleck in dieser absolut sterilen Umgebung. Obwohl ich vor Erschöpfung zusammenbrechen könnte, kreisen meine Gedanken immer wieder um das Erlebte, jeder Gedanke lässt das Grauen wieder lebendig werden.
»Wo sind die Männer und Frauen, die uns überfallen haben? Was geschieht mit den Verletzten? Was ist mit den Leichen?«
Der Oberste bleibt stehen und dreht sich auf der Treppe zu mir um, in seinem Gesicht ein Ausdruck, als würde er meine Sprache gar nicht verstehen.
»'Uns überfallen haben'?«
Im ersten Moment weiß ich nicht, worauf er anspielt, dann fällt es mir ein. »Die Acrai in ihrem Quartier.« Ich habe mich wie selbstverständlich dazugezählt.
»Die Verletzten sind noch vor uns mit einem anderen Helikopter aus der Gefahrenzone gebracht worden. Die Leichen sind noch dort. Ich wüsste nicht, weshalb man sich mit Toten belasten sollte.« Er zieht die Stirn kraus. Möchte er mich veralbern? Nein, er meint das völlig ernst. Seine Miene ist starr, sein Tonfall nüchtern, frei von Sarkasmus.
Während ich noch perplex darüber bin, dass die Obersten ihre Verluste nicht betrauern, setzt sich 67-45 wieder in Bewegung.
Die Treppe führt hinauf in eine Galerie, von der fünf Metalltüten abzweigen. Wieder zieht er die Karte aus der Brusttasche seines Anzuges. Jetzt erkenne ich sie zum ersten Mal richtig. Weiß, aus Plastik, unbeschriftet und etwa halb so lang wie meine Hand. Er zieht sie durch einen Schlitz in einem schwarzen Gerät neben der Tür. Die Tür gleitet zur Seite hin auf. Dahinter befindet sich ein langer Gang. Rechts und links davon sind wieder Metalltüren, auch die Wände bestehen aus demselben matt gebürstetem Material, in dem man sich nicht spiegeln kann. Das Licht ist ebenso gedimmt wie im Foyer. Auf dem weiß gefliesten Boden entdecke ich einen gelben Streifen, zwei Zoll breit und so lang wie der Gang, an dessen Ende sich eine T-Kreuzung befindet. Der gelbe Streifen spaltet sich auf und verläuft in beide Richtungen.
»Was hat das zu bedeuten?« Meine Stimme hallt an diesem seltsamen Ort nicht einmal von den Wänden wider.
Diesmal antwortet 67-45 mir, ohne sich zu mir umzudrehen. »In diesem Gebäudetrakt befinden sich die Unterkünfte der ranghöheren Diener des Systems. Die niederen Angestellten und Rekruten sind im rechten und linken Gebäudeflügel untergebracht, aber ich habe die Anweisung erhalten, dir im Mittelteil ein Zimmer zuzuteilen. Eigentlich dürftest du gar nicht hier sein.«
Höre ich so etwas wie Missbilligung oder gar Neid aus seiner Stimme heraus? Nein, das habe ich mir eingebildet.
»Weshalb?«
»Das weiß ich nicht und ich bin nicht befugt, die Entscheidungen der Führungsetage infrage zu stellen.« Jetzt fährt er mich harsch an, als hätte ich ein Verbrechen begangen, weil ich eine Frage gestellt habe. Ich beiße mir auf die Unterlippe und sage nichts mehr.
67-45 bleibt abrupt vor einer der Türen direkt vor der T-Kreuzung stehen, ich wäre beinahe gegen ihn geprallt. Wieder zieht er seine weiße Plastikkarte durch den Schlitz neben der Tür, die daraufhin nach rechts aufgleitet. Dann drückt er mir überraschend die Karte in die Hand.
»Das wird künftig dein Schlüssel sein. Den wirst du brauchen, wenn du dich auch nur drei Yards weit im Gebäude bewegen möchtest. Er passt zu diesem Zimmer, außerdem zu einer Reihe anderer Türen. Allerdings hat der Schlüssel die niedrigste Berechtigungsstufe des Hauptgebäudes, du kannst damit weder in einen anderen Gang gelangen noch herumschnüffeln. Hast du das verstanden?« Sein Tonfall lässt jede Freundlichkeit missen. Ich nicke zaghaft. Früher habe ich immer große Ehrfurcht für jeden empfunden, der einen schwarzen Anzug trägt. Obwohl ich weiß, dass auch er nur ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, habe ich meine alten Gewohnheiten nicht gänzlich abgelegt. Seit Cade mir erzählt hat, was die Obersten in ihrer Zentrale wirklich treiben, hat sich zu der Ehrfurcht noch ein anderes Gefühl gesellt: Angst.
67-45 bemerkt, dass ich ihn nur verständnislos ansehe, meine Finger krampfen sich um die Plastikkarte. »Morgen früh um sieben wird jemand kommen, der dich abholt. Dann erfährst du alles Weitere. Die neuen Rekruten leben sich sehr schnell ein, also hab keine Angst.« Obwohl er das sagt, hören sich seine Worte gar nicht Trost spendend an, eher genervt. »In deinem Zimmer kannst du dich ausruhen, dort findest du erst einmal alles, was du brauchst. Es ist mitten in der Nacht, ich rate dir also, noch ein paar Stunden zu schlafen.«
Er wendet sich ab und geht den Gang hinunter. Ich sehe ihm nach und starre ihm auch noch hinterher, als er längst aus meinem Blickfeld verschwunden ist. Ich höre, wie die Tür am anderen Ende des Flurs aufgleitet und sich wieder schließt. Dann ist es völlig still. Inzwischen ist auch die Tür, zu der meine Karte passt, wieder geschlossen, ohne dass ich hinein gegangen wäre. Mich durchzuckt der Impuls, noch weiter zu gehen und nachzusehen, was sich hinter der T-Kreuzung befindet. Vorsichtig sehe ich um die Ecke. Der Gang dahinter sieht genauso aus wie der andere. Dort gibt es nichts, das meine Aufmerksamkeit erregt hätte.
Mit zitternden Fingern ziehe ich die Karte erneut durch den Schlitz, wie es auch 67-45 getan hat. Die Tür gleitet auf. Ich fasse mir ein Herz und gehe hinein.
Ohne, dass ich etwas getan hätte, geht das Licht an. Im ersten Moment denke ich, dass noch jemand anderes im Raum ist, weshalb ich zusammenfahre. Dann leuchtet mir ein, dass es einen Bewegungsmelder geben muss. So etwas kenne ich aus den Badehäusern in Manhattan. Dort fließt automatisch Wasser, wenn jemand unter der Dusche steht.
Der Raum, in dem ich mich befinde, ist klein und quadratisch, vielleicht das zweifache meiner Körperlänge an jeder Seite. Es gibt kein Fenster, nur das ungemütliche weiße Licht dreier runder, in die Decke eingelassener Strahler. Außerdem gibt es über mir ein Lüftungsgitter. Ich spüre einen schwachen Luftzug auf meiner Haut.
In einer der Wände ist eine Nische, quaderförmig und etwa in der Länge eines Bettes. Das Loch in der Wand ist weniger als einen Yard tief. Dass sich darin ein weißes Kissen und eine weiße Decke befinden, bestätigt meine Vermutung, dass es sich um eine Schlafstätte handelt. Die Bettwäsche ist faltenfrei und akkurat zusammengelegt. Es gibt eine Klappe an der dem Bett gegenüberliegenden Wand. Sie hat einen runden weißen Knauf. Ich ziehe daran, woraufhin sie aufschwingt. Dahinter sind drei Regalfächer in denen schwarze Kleidungsstücke liegen, ebenfalls akkurat gefaltet. Ein in die Wand eingelassener Kleiderschrank also. Ich untersuche dessen Inhalt: schwarze einteilige Anzüge, schwarze Unterwäsche und ein schwarzes Nachthemd. Ganz unten eine schwarze Plastikkiste. Auf einem weißen Etikett am Rand der Kiste steht 4-19, meine Indviduennummer. Ich wundere mich nur kurz darüber. Eigentlich sind die Kleidungsstücke und die Sammelbox dieselben, die ich schon aus Manhattan kenne, nur in einer anderen Farbe.
An der Wand rechts neben dem Kleiderschrank ist eine weitere Klappe. Sie ist größer und reicht bis zum Boden, fast wie eine niedrige Tür. Ich öffne sie. Dahinter befindet sich ein winziger Raum mit einer Toilette und einem Waschbecken. Einen Spiegel gibt es nicht, dafür Handtücher und Toilettenpapier. Beides ist mit dem Emblem des Volkes V23 bedruckt - der siebenzackige Stern.
Mangels einer Sitzgelegenheit - die Schlafnische ist zu niedrig, um aufrecht darin zu sitzen - lasse ich mich an der kahlen Wand hinunter gleiten und kauere mich auf den Boden. Ich fühle mich fast zu schwach, um meine Kleidung zu wechseln. Mein Blick irrt durch mein winziges Zimmer, in dem ich gegen Platzangst ankämpfen muss. Erst jetzt fällt mir die Uhr über der Tür auf. Sie ist weiß mit schwarzen Zeigern. Es ist halb drei. Mir fallen die Worte von 67-45 wieder ein, nach denen man mich bereits um sieben Uhr am morgen wieder abholen wird.
Widerwillig erhebe ich mich, nehme mir frische Unterwäsche und das Nachthemd aus dem Kleiderschrank, wasche mich notdürftig über dem Waschbecken im Toilettenraum und lege mich in die Schlafnische. An deren Kopfende befindet sich ein Schalter. Ich betätige ihn, woraufhin das Licht erlischt.
Nachdem ich eine gefühlte Ewigkeit lang stocksteif auf dem Rücken gelegen und meinen eigenen schnellen Atemzügen gelauscht habe, mache ich das Licht wieder an. Mich ängstigt die Dunkelheit für gewöhnlich nicht, aber heute Nacht möchte ich das Licht doch lieber an lassen.
Ich wälze mich hin und her. Die Bettdecke und das Kissen riechen nach Waschmittel. Eigentlich ein Geruch, den ich immer gemocht habe, aber heute vermag er mich nicht zu trösten. Meine Gedanken drehen sich trotz der Erschöpfung unentwegt im Kreis. Wo ist Neal? Wo ist Shelly? Hat man sie auch in einen Raum wie meinen gebracht? Ich denke auch an Cade, obwohl ich es nicht möchte. Immer wieder sehe ich sein Gesicht vor mir, bevor mich Neal vom Schlachtfeld getragen hat. Seine orangebraunen Augen, die wie vom Wahn getrieben glühten, als er gegen einen der Obersten gekämpft hat. Unmenschlich, grausam. Und dennoch habe ich das Monster in ihm nie sehen wollen.
Eine Träne löst sich aus meinem Augenwinkel und tropft mir ins Ohr. Ich kann nichts dagegen tun. Noch immer habe ich das Gefühl, Cades Lippen auf meinen zu spüren. Ob es ihm gut geht? Es muss mir egal sein. Ein neues Leben wartet auf mich. Ich habe keine Wahl.
***
»Sind alle Rekruten anwesend?« Die Dame mit der klangvollen Individuennummer 3-33 lässt den Blick durch den Raum schweifen, als gäbe es hier mehr zu sehen als einen Haufen leerer Stühle und drei bang dreinblickende Personen, die der Herr vom Ordnungsdienst mit größtmöglichem Abstand zueinander auf ihre Plätze verteilt hat. Alle Rekruten. Sie tut gerade so, als hielte sie eine Rede vor Hunderten. Ihr schmales spitzes Gesicht zeugt von Desinteresse für ihre Aufgabe. Vielleicht hat sie diesen Vortrag schon dutzende Male gehalten. Das Haar der Obersten ist blond und kinnlang, ihre winzige Nase sticht zwischen zwei eng beieinander stehenden Augen heraus. Ihr schwarzer Anzug wirft Falten um ihre dürren Arme und Beine. Sie sitzt an einem Pult mehrere Stuhlreihen vor mir. In dem fensterlosen Raum gibt es insgesamt zehn solcher Reihen, jede mit acht kantigen Metallstühlen. Bis auf das Pult an der Frontseite gibt es keine Tische. Es gibt überhaupt nichts, das den Blick hätte ablenken können. Die Wände sind grau, der Boden weiß. Es riecht nach Putzmitteln. Neal sitzt zwei Reihen hinter mir am rechten Rand, Shelly in der letzten Stuhlreihe am linken Rand. Langsam drehe ich mich zu ihr um und fange ihren ängstlichen Blick auf. Sie zittert am ganzen Körper. Auch sie scheint schlecht geschlafen und keine erholsame Nacht gehabt zu haben. Der Anzug, in den sie das kleine Mädchen gesteckt haben, ist ihr viel zu groß. Sie musste ihn an den Armen und Beinen zwei Mal umschlagen.
»4-19, dort hinten gibt es nichts zu sehen!«, fährt mich die Oberste an und schlägt mit der flachen Hand auf das Pult, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen.
Ich wende mich wieder nach vorn. Auch ich habe eine grauenvolle Nacht hinter mir. Ich bin gar nicht sicher, ob ich überhaupt geschlafen habe. Ich bin schon lange, bevor mich jemand um sieben Uhr vor meiner Tür abgeholt hat, auf den Beinen gewesen. Ich habe mich und meine Haare notdürftig über dem Waschbecken gewaschen und danach gefühlte Stunden auf dem Boden meiner nackten Zelle gekauert. Ja, ich bezeichne es als Zelle. Ich weigere mich, es als einen Ort zu bezeichnen, an dem ich mich freiwillig aufhalten würde. Ich ringe permanent mit meiner Verzweiflung, aber auch mit Wut auf mich selbst. Unfassbar, dass ich mir all dies einmal gewünscht habe.
Ich würde gerne noch einen Blick nach hinten auf Neal riskieren, aber ich fürchte, 3-33 würde mich dann wieder anschreien. Mein Kopf dröhnt ob des Schlafmangels ohnehin schon mit steigender Intensität.
Wir befinden uns in einem Raum außerhalb des Hauptgebäudes. Ein Mann hat mich heute morgen wortlos durch das akkurat angelegte Straßensystem der Zentrale hierher geführt. Schon nach wenigen Biegungen habe ich die Orientierung verloren, weil alles gleich aussieht. Es ist unmöglich, sich die Umgebung anhand prägnanter Wegpunkte einzuprägen. Ich muss mich daran gewöhnen, Kreuzungen zu zählen. Das nehme ich mir für den Rückweg vor.
Als ich den Raum betreten habe, haben Shelly und Neal bereits auf ihren Plätzen gesessen. Das Mädchen wollte sofort aufspringen und mir entgegen laufen, aber der Ordnungshüter, der mich hergeführt hat, hat sie grob wieder auf ihren Platz gedrückt und sie derartig böse angesehen, dass Shelly keinen Versuch mehr gewagt hat, sich von der Stelle zu bewegen.
»Da wir nun vollzählig sind -«, fährt 3-33 fort, deren Nummer ich im Übrigen nur anhand des Schildes über ihrer Brust kenne. Sie hat sich nicht die Mühe gemacht, sich vorzustellen. Ich frage mich, wie sie wirklich heißt. »- kann ich endlich damit beginnen, Ihnen die Regeln unseres künftiges Zusammenlebens zu erläutern, damit alles seinen gewohnten Gang geht.« Sie hebt den Blick und deutet ein verkniffenes Lächeln an, das aber eher wie das Schneiden einer Grimasse auf mich wirkt, als wüsste sie nur aus Büchern, wie man lächelt. »Für gewöhnlich halte ich diesen Vortrag nicht zwei Mal in einer Saison, aber die Umstände verlangen es von mir.«
Umstände. Wie sie das sagt! Ich komme mir mehr denn je überflüssig vor. Wir sind Nachzügler, ja, aber das hat sich niemand von uns so ausgesucht. Die anderen Rekruten haben schon vor über einer Woche ihre Einweisung bekommen. Inklusive Suzie, die an meiner Statt hier gewesen ist ... Ich frage mich, was aus ihr geworden ist.
»Ich mache es kurz und knapp.« Die Oberste sieht geradeaus, an uns allen vorbei. Wie ein Roboter, schießt es mir in den Kopf. »Die Zimmer, die Ihnen gestern Nacht zugeteilt wurden, werden Ihr Zuhause sein für die Zeit, in der sie dem System dienen, was heißt: bis zu Ihrem Tod.«
Oh ja. Also mit ungefähr dreißig. Ich erinnere mich nicht gerne an das, was Cade mir erzählt hat. Plötzlich wird mir ganz heiß. Ich möchte dieses schreckliche Serum nicht verabreicht bekommen, das mich in einen von ihnen verwandelt. Das Blut rauscht in meinen Ohren und ich habe große Mühe, den Worten der Dame überhaupt noch zu folgen.
»Wir tragen alle dieselbe Einheitskleidung. Ihnen stehen drei komplette Sets zur Verfügung. Verschmutzte Kleidung legen Sie bitte in die Plastikkiste und stellen diese vor Ihre Zimmertür. Jemand sammelt sie ein und bringt sie auch wieder zurück. Aber das kennen Sie ja alles schon aus der Stadt.« Wieder dieses künstliche Lächeln. Ich kann mich kaum noch auf meinem Platz halten. Alles in mir schreit danach, einfach aufzuspringen und zu flüchten, aber ich weiß, dass das keine Lösung ist. Wir kommen hier nicht heraus. Mit Unbehagen denke ich an die mit Stacheldraht gespickte Mauer, die die Zentrale umgibt.
»Gegessen wird jeweils um sieben, um dreizehn und um neunzehn Uhr im Speisesaal, der Ihnen noch gezeigt wird. Heute ist eine Ausnahme. Das Frühmahl werden Sie nachher auf Ihren Zimmern einnehmen, weil sie es heute verpasst haben. Niemand in unserer Gemeinschaft besitzt mehr oder weniger als ein anderer. Es besteht kein Grund, jemandem sein Eigentum zu neiden. Solche Eigenschaften werden Sie ablegen müssen. Damit unser Zusammenleben funktioniert, geht jeder einer geregelten Arbeit nach, die Sie zugeteilt bekommen. Neue Rekruten arbeiten zunächst in Klasse drei, das heißt, dass Sie innerhalb der Zentrale im Wäschereibetrieb, als Reinigungskraft, in der Küche oder als Hilfsarbeiter jedweder Art eingesetzt werden. Manchmal werden Klasse-drei-Arbeiter auch in die Stadt geschickt, um dort niedere Arbeiten zu verrichten. Das allerdings erst, wenn sichergestellt werden kann, dass Sie ihr früheres Leben hinter sich gelassen haben und loyal zum System stehen. Später ist es möglich, in Klasse zwei aufzusteigen. Diese Klasse macht den Großteil aller Bewohner unserer Zentrale aus. Klasse-zwei-Arbeiter besetzen die medizinischen Stationen und die Patrouillen innerhalb Manhattans.«
Ich stutze kurz. Sie weiß also, wie man meine Stadt nennt?
»Außerdem zählen zu den Arbeitern der zweiten Klasse unsere Haustechniker und auch die Feld- und Fabrikarbeiter, die außerhalb New Yorks für Nahrungsmittelnachschub sorgen. Mehr müssen Sie einstweilen nicht wissen.«
»Gibt es Klasse-eins-Arbeiter?« Es ist Shellys leise und piepsende Stimme aus dem hinteren Teil des Raumes. Trotz der Mahnung von 3-33 drehe ich mich noch einmal zu ihr um. Sie sitzt noch immer zitternd wie ein Häufchen Elend auf ihrem Stuhl. Sie ist blass. Dann irrt mein Blick zu Neal schräg hinter mir. Er hat die Arme vor der Brust verschränkt, die Beine lässig ausgestreckt, zwischen seinen Augenbrauen hat sich eine Falte gebildet. Er starrt ernst und konzentriert nach vorne, ohne mir einen Blick zu schenken.
3-33 räuspert sich. »Aber natürlich gibt es Klasse-eins-Arbeiter, Schätzchen. Aber diese Klasse werden Sie nicht erreichen, zumindest nicht innerhalb der nächsten fünf bis acht Jahre. Das sind die Wissenschaftler, Laboranten und natürlich unsere Führer. Sie können von Glück reden, wenn sie denen jemals über den Weg laufen, also verschwenden Sie keinen Gedanken an diese Klasse, okay?« Wieder lächelt sie so falsch. Ich kann sie nicht leiden.
»Einen Punkt hätte ich noch auf meine Liste.« Jetzt sieht sie endlich abwechselnd jeden von uns einmal an. Ihre Augen sind eisblau und kalt, frei von jeglicher Emotion. Wieder muss ich an Cades Worte denken, nach denen die V23er nichts anderes als mit Acraiblut verseuchte Menschen sind, die irgendwann die Fähigkeit verlieren, zu fühlen. Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter.
»Direkt zu Anfang Ihrer Karriere in der Zentrale werden Sie geimpft.«
Ich ziehe fragend die Augenbrauen zusammen, weil ich absolut nicht verstehe, wovon sie spricht. Sie macht eine wegwerfende Handbewegung. »Nur eine kleine medizinische Notwendigkeit. Sie werden dadurch frei sein von Krankheiten und Seuchen, außerdem wird es Ihnen immer gut gehen. Ein wunderbarer Zustand! Das Mal auf ihrem linken Arm, das die Impfung mit sich bringt, ist ein Zeichen von hohem Ansehen. Je größer es wird, desto mehr wird man Sie respektieren.« Zur Demonstration krempelt sie ihren linken Ärmel auf und offenbart die schwarzen verschlungenen Linien auf ihrem Unterarm. Ihr Mal reicht schon bis über den Ellenbogen. Ob sie weiß, dass sie sterben wird, wenn es ihr Herz erreicht hat? Wie kann sie es als Ehre bezeichnen?
Ich fühle mich herausgefordert. Was habe ich zu verlieren, wenn ich ihr etwas auf den Zahn fühle? Es ist der Mut einer Verzweifelten, der mich antreibt. »Wie lange werden wir arbeiten?«
3-33 hebt fragend die Augenbrauen, als könne sie es nicht fassen, dass ihr eine Frage gestellt wurde. Dann setzt sie wieder ihr altbekanntes Kunstlächeln auf. »Von acht bis achtzehn Uhr an sechs Tagen in der Woche.«
»Nein, das meinte ich nicht. Bis zu welchem Alter müssen wir arbeiten?«
Ich sehe etwas in ihren Augen aufblitzen, das man als Verärgerung hätte bezeichnen können. Vielleicht auch Geringschätzung, so genau kann man das bei einem emotionalen Krüppel wie ihr nicht sagen.
»So lange, wie Sie selbst glauben, dass Sie dazu in der Lage sind.«
»Und was passiert mit den alten Menschen, mit den Gebrechlichen?« Ich stelle mich bewusst dumm. Ich möchte, dass sie zugibt, dass wir alle jung sterben müssen.
»Diese Menschen leben in einem gesonderten Bereich fernab der Zentrale. Dort geht es ihnen gut bis an ihr Lebensende. Für ihre Altersvorsorge ist also gesorgt.«
Glaubt sie das etwa wirklich? Hat man ihr das damals auch erzählt? Unmöglich, es herauszufinden.
»Was wird mit Shelly passieren? Sie ist zu jung für eine Rekrutin, noch keine achtzehn.« Ich höre, wie Shelly hinter mir nach Luft schnappt, als würde sie weinen.
»Das stimmt, sie ist zu jung. Zudem ist sie nicht einmal Einwohnerin von Manhattan gewesen, ehe sie hierher kam. Sie war nur die Brut von freien Rebellen.«
Soso. Jetzt wird also kein Geheimnis mehr daraus gemacht, dass es außerhalb von New York noch etwas anderes gibt als den Energieschild. Sonst hat es immer geheißen, die Welt sei dahinter zuende.
3-33 seufzt, unecht und falsch. »Ich bin mir sicher, dass wir einen Platz für sie finden werden. Wie nannten Sie sie noch gleich? Shelly? Sie wird eine Nummer benötigen, wenn sie bei uns bleibt. Kümmern Sie sich indes nicht um ihren Verbleib. In Zukunft werden Sie sich um nichts anderes kümmern als die Erfüllung Ihrer Aufgaben, haben wir uns verstanden?«
Haben wir nicht, aber dennoch nicke ich. Ich bin so voller Bitterkeit, dass ich der Schnepfe am liebsten an den Hals springen würde. Ich knirsche mit den Zähnen, um mich davon abzuhalten. Meine Hände balle ich so fest zu Fäusten, dass sich meine Fingernägel in die Handflächen graben.
Jetzt lacht diese dumme Tussi auch noch auf, spitz und kalt. »Ich hätte es beinahe vergessen. Ich soll Ihnen doch noch Ihre Zuteilung mitteilen.« Sie öffnet eine Schublade des Pultes und zieht ein Blatt Papier heraus.
»Individuennummer 46-19«, sie sieht kurz auf und fixiert den Blick von Neal, »Sie werden im Computerraum die Überwachung aller technischen Anlagen übernehmen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie handwerklich sehr geschickt sein sollen und zudem noch des Lesens mächtig sind. Das erspart uns die Arbeit, es Ihnen beizubringen.«
»Und was bedeutet das für mich? Was muss ich tun?« Ich erschrecke mich, weil Neals Stimme so nüchtern klingt, als ginge es gar nicht um den Rest seines Lebens.
»In erster Linie nur darauf achten, dass es keinen Alarm im System gibt. Die Reparaturen werden Sie vorerst nicht vornehmen, dafür ist es noch zu früh. Allerdings ist es auch nicht meine Aufgabe, Sie einzuweisen. Sehe ich so aus, als würde ich den ganzen Tag nichts anderes tun als auf einen Monitor zu starren?«
Sie wird mir immer unsympathischer. Dieses selbstgefällige dumme Lächeln, das so falsch und kalt ist. Ich sehe zu Neal herüber, aber der nimmt ihre Worte gelassen hin und verzieht keine Miene. Ist das der Mann, der einst so aufbrausend gewesen ist? Ich kann es kaum glauben.
»Nummer 4-19, Sie sind für die Arbeit in der Wäscherei eingeteilt worden. Harte Arbeit, darum beneide ich Sie nicht.«
Ich nehme es weniger abgeklärt hin als Neal. In der Wäscherei? Das soll mein Schicksal sein? Ich habe alle Bücher gelesen, habe schreiben und rechnen gelernt. Und jetzt soll ich schmutzige Wäsche waschen? Es fühlt sich an, als hätte mir jemand in den Magen geboxt.
»Natürlich bedeutet das nicht, dass Sie das für den Rest Ihres Lebens tun werden«, kommentiert 3-33 meinen Gedankengang und sieht wieder auf das Blatt Papier. »Hier steht, dass Sie in ein paar Jahren in einer medizinischen Station eingesetzt werden können, weil sie ebenfalls lesen und schreiben können.«
Zumindest würde mir das die Möglichkeit bieten, Carl und Candice noch einmal wiederzusehen. Ein kleiner Trost.
»4-19 bleibt bitte noch hier, die anderen beiden gehen hinaus und lassen sich zurück auf ihre Zimmer führen.« Sie klatscht einmal in die Hände. Neal schiebt seinen Stuhl geräuschvoll zurück und zögert nicht, den Ausgang anzusteuern. Im Vorbeigehen wirft er mir einen undeutbaren Blick zu, irgendetwas zwischen Mach dir keine Gedanken, es wird alles gut und Stell dich nicht so an.
Shelly erhebt sich nur zögerlich von ihrem Platz. Ich merke deutlich, dass sie lieber bei mir geblieben wäre. Sie sieht mir lange hinterher, bis sich die Tür hinter ihr schließt. Weshalb muss ich noch bleiben?
3-33 winkt mich zu sich heran, ich folge ihrer Aufforderung und trete vor das Pult. Sie nimmt wieder etwas aus der Schublade heraus und schiebt es mir auf der Tischplatte zu. Ich erkenne es sofort.
»Das ist meine Individuenkarte.«
»Schlaues Mädchen. Die sollten Sie immer bei sich tragen. Wohin das bei Missachtung führen kann, haben Sie doch erlebt. Also hoffentlich ist es Ihnen eine Lehre gewesen.«
Mir schlägt das Herz bis zum Hals, als ich die Karte in die Tasche meines neuen schwarzen Anzuges stecke. »Was ist mit Suzie passiert?«
»Mit wem?«
»21-19. Das blonde Mädchen, das mir meine Karte gestohlen und an meiner Stelle hierher gekommen ist.«
3-33 macht eine Geste, als wolle sie Fliegen verscheuchen. »Sie wurde bestraft. Die Details gehen Sie nichts an.« Etwas in ihrer Stimme verrät mir, dass es nicht angenehm für Suzie gewesen sein muss. Ich schlucke. Meine Kehle ist wie zugeschnürt.
»Wann muss ich mit der Arbeit in der Wäscherei beginnen?«
»Morgen, nachdem man sie heute noch geimpft hat. 46-19 hat die Prozedur schon hinter sich.«
Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert: Die Tatsache, dass ich heute noch das verdammte Serum verabreicht bekommen soll oder dass Neal bereits in einen V23er verwandelt wurde. Wann? Habe ich etwas nicht mitbekommen? Ist das der Grund, weshalb sich Neal so seltsam verhält? Ist das vielleicht sogar der Grund, weshalb er die Acrai verraten hat? Mir klappt die Kinnlade herunter. Gleichzeitig erfüllt mich eine unbändige Wut. Ich möchte dieses Leben nicht. Niemals möchte ich so kalt und emotionslos werden wie die V23er.
»Was ist, wenn ich das alles nicht mitmachen möchte? Wenn ich zurück nach Hause will?« In mir manifestiert sich der unbedingte Wille zu rebellieren. Ich bin mein ganzes Leben lang fremdbestimmt worden. Man hat mir vorgeschrieben, wann ich esse und wie ich meine Freizeit verbringen darf. Durch meine Zeit bei Cade habe ich erlebt, was es bedeutet, frei zu sein. Es birgt eine gewisse Ironie in sich, weil Cade doch mein Entführer war ...
3-33 zieht die Augenbrauen hoch, ihre Miene verfinstert sich. »Das hier ist ab jetzt Ihr Zuhause. Sie können nicht zurückgehen. Sie dürfen nicht einmal ein Wort mit den Menschen in Manhattan reden. Wir brauchen hier keine undichten Stellen, die Informationen durchsickern lassen. Wenn Sie sich weigern sollten, die Regeln zu akzeptieren, werden Sie beseitigt. So einfach ist das, da bin ich ganz ehrlich. Aber machen Sie sich keine Sorgen, nach der Impfung werden Sie von allein merken, wie wundervoll das Leben hier ist. Ich kenne keinen, bei dem es anders gewesen wäre. Und glauben Sie mir, nicht alle Rekruten waren von vornherein von ihrem neuen Leben begeistert. Jetzt sind sie es. Also hören Sie auf zu jammern. Ab heute Nachmittag wird sich alles ändern. So übel ist es hier nicht, Sie werden es schon sehen. Und jetzt gehen Sie, draußen wartet bereits jemand, der Sie ins Labor bringen wird.«
Sie zeigt auf die Tür und gibt mir unmissverständlich zu verstehen, dass ich hier unerwünscht bin.
»Was ist mit dem versprochenen Frühstück?«
»Nach der Impfung, die geht vor. Und jetzt raus!«
Mit zitternden Knien gehe ich auf die Tür zu. Ich fühle mich bedrängt, verzweifelt und frustriert. Auf keinen Fall möchte ich dieses Zeug verabreicht bekommen. Wie kann ich mich bloß dagegen wehren? Gedanklich gehe ich bereits meine Flucht durch, doch alle Überlegungen versanden im Nirgendwo. Es gibt kein Entrinnen.
Ich habe die Tür noch nicht wieder hinter mir geschlossen, als mich bereits ein hoch gewachsener Mann am Oberarm greift und mich mit finsterer Miene den Flur entlang bugsiert.
Kapitel zwei
Holly
Ich versuche, mir den Weg einzuprägen, doch die Gleichförmigkeit aller Flure, Treppen und Türen im Hauptgebäude macht es mir nicht leicht. Es geht mehrere Gänge hindurch und eine Treppe hinunter. Hier weisen die Böden einen roten Streifen auf, keinen gelben, wie vor meinem Zimmer. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied. Ich bezweifle, dass ich den Rückweg allein finden würde.
Bewaffnete Männer versperren uns jäh den Weg. Die Tür, die sie bewachen, ist größer und macht einen stabileren Eindruck als die einfachen Metalltüren der anderen Zimmer. Sie ist mit zusätzlichen Eisenbeschlägen versehen. Die Nummer des Kerls, der mich hergebracht hat, lautet 75-2. Nicht, dass er sich mir vorgestellt hätte, aber jeder Anzug eines Obersten ist mit dessen Nummer bestickt, auch meiner. Der Mann hat überhaupt kein Wort mit mir gesprochen, seine Miene ist finster, er hat mir nicht einmal in die Augen gesehen, während er mich durch das Labyrinth der Zentrale geführt hat.
»Anliegen?« Die Stimme des Türwächters ist monoton, aber sein Blick zuckt kurz über mich hinweg, ehe er 75-2 streng in die Augen sieht. Mir entgeht nicht, dass eine seiner Hände auf seiner Waffe ruht, die in seinem Gürtel steckt. Auch sein Kollege spannt den Rücken, als müsste er sich auf einen Angriff vorbereiten.
»Ich bringe 4-19 zur Impfung. Befehl von ganz oben.« Zum ersten Mal höre ich 75-2 sprechen. Er knurrt undeutlich und tief, fast wie Cade. Unwillkürlich schießt mir ein Schmerz ins Herz.
»Wo ist die Genehmigung?«
75-2 zieht eine schwarze Plastikkarte aus seiner Hosentasche. Er hält sie dem Wächter hin, dieser greift danach und zieht sie durch den Schlitz des schwarzen Apparates neben der Tür. Ein grünes Licht blinkt daneben auf.
»Haben Sie noch eine schriftliche Erklärung, dass Sie die Sicherheitszone betreten dürfen?«
»Nein«, fährt 75-2 den anderen V23er harsch an. »Das brauche ich nicht. Die Karte hat die höchste Zugangsberechtigung. Reicht das nicht als Erklärung?«
Er greift plötzlich nach meinem Arm und zerrt grob meinen linken Ärmel nach oben. Er präsentiert meinen Arm den beiden Türstehern. Ich will ihn zurückziehen, aber 75-2 ist schnell und stark, fast wie ein Acrai. Mir wird plötzlich wieder bewusst, dass ich körperlich keine Chance gegen die V23er hätte.
»Sie ist eine neue Rekrutin, sie hat noch kein Mal. Wollt ihr das Risiko tatsächlich eingehen, Mr. Hampton zu verärgern?«
Mr. Hampton? Wer ist das?
Der Türsteher verzieht das Gesicht, tritt dann jedoch zur Seite und gibt uns den Weg frei. Die Tür steht offen, wir können passieren.
Der Flur dahinter unterscheidet sich von den anderen. Er ist nicht grau und aus Metall, sondern komplett weiß gefliest. Es blendet mich. Während 75-2 mich am Arm hinter sich her zieht, werfe ich einen Blick zurück auf die massive Stahltür, die mit einem Klong wieder ins Schloss fällt. Okay, dies scheidet als Fluchtweg aus. Ich fühle mich einer Ohnmacht nahe. Was bleiben mir noch für Optionen? Alle Obersten überwältigen, die mich zwingen werden, das Serum zu bekommen? Wohl kaum. Sie sind um einiges stärker als ich.
Ich kämpfe mit den Tränen und kann kaum noch erkennen, wohin er mich führt. Nachdem wir noch um zwei Ecken abgebogen sind, bleiben wir stehen. Zu meiner Verwunderung steht eine Tür am Ende des Ganges weit offen, als würde man uns bereits erwarten. Der scharfe Geruch nach Desinfektionsmitteln steigt mir in die Nase.
Wir betreten einen großen Raum, der mich im ersten Moment so sehr in Erstaunen versetzt, dass ich sogar mein wild pochendes Herz ignoriere. An drei Wänden reihen sich über die ganze Länge Tische aneinander, sie bestehen aus glattem weißen Stein. Darüber befinden sich zahlreiche Schränke und Regale, alles ebenfalls schneeweiß. Surrende Apparate stehen auf den Tischen, ein jeder so unbekannt und fremd in Form und Funktion, dass ich mich in einem Traum wähne. An manchen Tischen stehen Hocker, auf denen Menschen in Kitteln sitzen, die bis zum Boden reichen. Sie tragen Gummihandschuhe und seltsame große Brillen. Es befinden sich acht Personen im Raum, einige sehen überhaupt nicht auf, als wir ihn betreten, sondern beugen sich über ihre Arbeitsplätze und gehen Tätigkeiten nach, deren Sinn sich mir nicht erschließt. Mit spitz zulaufenden handlangen Gegenständen überführen sie Flüssigkeiten von einem Gefäß in ein anderes, es wird geschüttelt, gemixt, und an Schaltern herumgedreht. Einer starrt in einen auf dem Tisch stehenden Apparat, der zwei Gucklöcher für die Augen hat und mich entfernt an ein Fernglas erinnert.
»Ich bringe 4-19«, sagt mein Begleiter. Mir fällt auf, dass auch er sich schaudernd umsieht, als wäre auch ihm die Umgebung fremd.
Eine Frau schiebt geräuschvoll ihren Hocker zurück und kommt auf uns zu. Unter ihrem weißen Kittel sehe ich den Kragen ihres schwarzen Einheitsanzuges hervorblitzen. Ihre Haare hat sie zu einem strengen braunen Pferdeschwanz zurückgebunden. Ihre Augen sind kaltblau. Sie sieht mich überhaupt nicht an, sondern deutet nur mit dem Kinn auf mich.
»Ist sie die Nachzüglerin? Alle anderen Rekruten sind letzte Woche schon hier gewesen.« Sie seufzt genervt. »Ich habe eigentlich gar keine Zeit für die Prozedur. Ich weiß ohnehin nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Können wir schnell machen?«
»Meinetwegen, soll mir recht sein«, sagt 75-2. Mich wundert es nicht, dass mich niemand nach meiner Meinung fragt.
»Hoffentlich wird es bei ihr komplikationslos ablaufen. Einer der Neuen hat uns letzte Woche das halbe Labor vollgekotzt.« Die Missbilligung in der Stimme der Frau jagt mir einen Schauder über den Rücken. Sie sagt es ohne Mitgefühl.
Mehr denn je möchte ich fliehen. Das Blut rauscht nun unüberhörbar laut in meinen Ohren. 75-2 und die Labormitarbeiterin sprechen miteinander, während sie mich voran stoßen. Ich kann nicht hören, was sie sagen, die Worte verwaschen sich zu einem monotonen Singsang in meinem Kopf. Mir ist schwindlig. Meine Beine fühlen sich an, als seien keine Knochen mehr darin. Früher habe ich immer Angst vor dem Zahnarzt gehabt, wenn er einmal im Jahr nach Manhattan gekommen ist. Ich habe stets mit feuchten Händen auf dem Stuhl gesessen und geglaubt, es sei das Schlimmste, das einem Menschen widerfahren könne, wenn der Arzt mit seinen Instrumenten im Mund herumfummelt. Doch das war gar nichts gegen die nackte Panik, die mich jetzt schüttelt. Kalter Schweiß läuft meinen Rücken hinab. Ich fühle mich wie vor einer Hinrichtung, und in gewisser Weise liegt der Vergleich gar nicht so fern.
Neal hat es auch schon hinter sich und er lebt noch, versuche ich mich zu beruhigen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie Cade mich hat glauben lassen. Aber ich möchte nicht mit dreißig sterben! Oder war das etwa auch nur ein Märchen? Vielleicht leben die alten V23er tatsächlich in einem gesonderten Bereich der Zentrale. Nur, weil sie niemand gesehen hat, bedeutet dies doch nicht, dass es sie nicht gibt, oder? Andererseits ... Müsste Cade es nicht am besten wissen? Er ist ein Acrai, und die sterben auch früh. Sie haben ebenfalls das Mal. Wenn die V23er tatsächlich von ihnen abstammen, ist ihr Schicksal vielleicht doch ein früher Tod ...
75-2 drückt mich auf einen Stuhl. Ein weiterer Mann in einem weißen Kittel steht plötzlich neben mir. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Seine Haare sind schwarz und streng zurückgekämmt. Um seinen Mund herum liegt ein verärgerter Zug. »Glauben Sie, dass dies der richtige Ort ist, um sie zu optimieren? Sollten wir nicht lieber woanders hingehen? Eine Liege wäre besser als ein Stuhl. Außerdem ist das hier ein Forschungsbereich. Hier darf nichts zu Bruch gehen!«
Die Dame macht eine wegwerfende Geste. »Stephen, ich habe keine Zeit, um mit ihr zur medizinischen Station zu gehen. Wie du siehst, stecke ich bis zum Hals in Arbeit! Es wird auch so gehen müssen. Kanüle rein, Serum rein, fertig. Was kann ich dafür, wenn noch Nachzügler mit Extraeinladungen kommen? Es muss jetzt leider schnell gehen. 75-2 kann sie danach meinetwegen zur Krankenstation bringen, sollte sie sich schlecht fühlen.«
Stephen? Man spricht sich also doch mit dem Vornamen an, aber anscheinend nur unter guten Bekannten, die man nicht siezt. Okay, das macht mir die Obersten nur geringfügig sympathischer. Mein Blick irrt von einem zum anderen. Ich hoffe, dass sie mich doch noch woanders hinbringen, obwohl es nur eine Verzögerung des Unvermeidbaren wäre. Sie drängen mich in die Ecke, mein Unwille steigert sich ins Unermessliche. Ich bin kurz davor aufzuspringen und alles kurz und klein zu schlagen.
Die Oberste entfernt sich ein paar Schritte von uns. Ich beobachte, wie sie zu einer Tür am Ende des Raumes geht, ihre Handfläche auf einen Scanner drückt und in dem dahinter liegenden Raum verschwindet. Weiße Dampfwolken quellen daraus hervor. Sie kommt mit einem winzigen gläsernen Gefäß wieder heraus. Aus einer Schublade nimmt sie weitere Gegenstände und legt sie auf ein Metalltablett. Ich habe das schon einmal gesehen, damals, bei der Erstuntersuchung, als mir Blut abgenommen wurde. Es ist eine verschweißte Nadel mit einem kurzen dünnen Schlauch am Ende. Mit all dem kommt sie zurück zu meinem Stuhl, 75-2 und der andere Mann flankieren mich. Als die Oberste sich einen Hocker heranzieht und sich anschickt, die Nadel aus der Verpackung zu schälen, bricht meine Angst aus mir hervor. Ich verliere die Kontrolle über meine Handlungen, es ist der nackte Überlebensinstinkt, der mich nun steuert. Mein Atem geht stoßweise und ich spüre, wie mein Gehirn ohne mein Zutun den Befehl an meine Beine gibt, vom Stuhl zu springen.
Im ersten Moment liegt die Überraschung auf meiner Seite. Der Dame fällt die Nadel aus der Hand, weil ich gegen ihren Arm gestoßen bin. Blitzschnell, schneller als meine Augen es wahrnehmen können, greifen 75-2 und Stephen zugleich nach mir. Sie erwischen mich am Ärmel, ziehen mich brutal zurück, aber ich versteife meinen Körper und weigere mich, mich wieder hinzusetzen. Ich trete um mich, treffe aber nur Luft.
»Siehst du, Melissa, das ist nicht der richtige Ort für die Prozedur!« Ich höre Stephens Worte, aber ihre Bedeutung sickert nicht bis zu meinem Verstand durch. Ich bin beseelt von dem Gedanken, mich aus der Situation zu befreien.
In meiner Panik beiße ich in die Hand von 75-2, der mich in seinem eisernen Griff am Arm hält. Er schreit kurz auf und lässt los, aber er packt schneller wieder zu, als ich um mich schlagen kann.
»Sie hat mich gebissen!«
»Sie ist wahnsinnig!« Melissa stellt das Tablett mit der Nadel und dem Serum neben sich, außerhalb meiner Reichweite. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als darauf herumzutrampeln, kann mich aber keinen Zoll weit von der Stelle bewegen. Ich spüre, wie mir Speichel am Kinn hinab läuft. Ich knurre wie ein Tier, was sich sogar in meinen eigenen Ohren furchterregend anhört. Ich will leben! Weshalb versteht das niemand?
Dann fährt mir ein scharfer Schmerz durch Mark und Bein, ich sehe Sterne vor meinen Augen tanzen. Meine Wange brennt wie Feuer. Jemand hat mir ins Gesicht geschlagen.
»Bringt sie auf die Krankenstation«, höre ich Melissa rufen. Nur am Rande nehme ich wahr, dass sich inzwischen auch alle anderen Labormitarbeiter um uns geschart haben.
Stephen greift um meine Taille und wirft mich in einer schwungvollen Bewegung über seine Schulter. Ich trete weiterhin um mich. Wieder schlägt mir jemand ins Gesicht. Es ist 75-2, der hinter Stephen geht und ihm aus dem Labor hinaus folgt. Auch Melissa schließt sich an, zuvor nimmt sie das Tablett wieder auf und trägt es hinter uns her.
Es geht wieder mehrere Flure entlang, aber ich schaffe es nicht, mir den Weg einzuprägen. Ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, mich zu winden und zu kreischen, bis ich nass geschwitzt und völlig entkräftet bin. Tränen der Verzweiflung tropfen von meinem Kinn auf Stephens Rücken, der immerwährend vor sich hin flucht und Melissa anfährt, weshalb sie mich nicht sofort in ein Krankenzimmer hat bringen lassen.
Irgendwann bleibt Stephen stehen. Ich höre, wie er seine Plastikkarte durch den Apparat zieht und ein leises Piepen ertönt, ehe eine Tür aufschwingt.

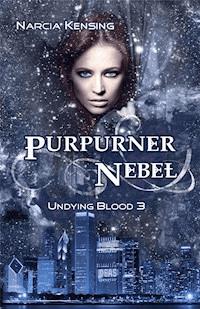

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









