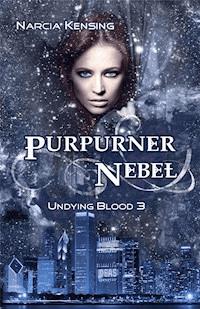
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Holly, Cade und Shelly ist es gelungen, aus dem Hochsicherheitstrakt der Zentrale zu fliehen. Wieder zurück in Freiheit, stoßen sie auf eine Gruppe freier Rebellen, die sie herzlich in ihrer Mitte aufnehmen. Endlich scheinen sie das Leben wieder genießen zu können, doch erneut ziehen dunkle Wolken am Horizont auf. In Manhattan bricht Chaos aus, denn die Acrai erheben sich und töten wahllos und in großer Zahl die Bevölkerung. Die Rebellen beschließen, den Obersten endgültig das Handwerk zu legen, denn diese denken gar nicht daran, trotz des Ausnahmezustands die Barrieren um die Stadt aufzugeben. Kann es einer Handvoll Menschen gelingen, ein ganzes System in die Knie zu zwingen? Das packende Finale der Undying Blood Trilogie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Narcia Kensing
Purpurner Nebel: Undying Blood 3
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Hinweis an den Leser
Weitere Werke der Autorin
Impressum neobooks
Kapitel eins
Holly
Das Licht der aufgehenden Spätsommersonne bricht sich tausendfach auf der Wasseroberfläche. Kühl perlen die Tropfen durch meine Finger, laufen meine Arme bis zum Ellenbogen hinab und durchfeuchten die Ärmel meines dunkelblauen Shirts. Es ist mir egal, wenn ich nass werde, denn mein Herz erfreut sich seit Wochen zum ersten Mal wieder am Wunder eines anbrechenden Tages und an der Reinheit von klarem Wasser, das ich mit den Händen schöpfen kann. In der Zentrale gab es nur Duschen, deren harter Strahl unangenehm auf der Haut brannte. Dort roch es immer nach Reinigungsmitteln, nicht so erdig und frisch wie ein früher Morgen.
Noch einmal tauche ich meine Hände in den kleinen See und benetze mein Gesicht. Wir verfügen auch im Lager über Trink - und Waschwasser, aber dort müssen die Mitglieder der Rebellengruppe es aus einem nahe gelegenen Brunnen schöpfen. Cade und ich sind heute morgen vor Tagesanbruch fast drei Meilen von Newark aus nach Nordosten gegangen, in ein unbebautes Stück Land hinein, auf dem sich Wiesen und kleine Wälder wie Farbkleckse in einer Landschaft aus Betonleichen und verfallenen Ruinen verteilen. Den Korb, den Susan mir mitgegeben hat, habe ich unweit des Ufers abgestellt. Dann habe ich mir die Schuhe ausgezogen und bin quietschend vor Freude zum Wasser gelaufen. Ach, hätten wir doch Shelly mitgenommen! Sie hätte sicherlich viel Freude daran gehabt, doch sie ist bei Susan und den anderen geblieben. Susan kümmert sich gut um das Mädchen, und obwohl ich sie erst seit einem Tag kenne, mag ich sie jetzt schon. Shelly ist bei unserer Ankunft gestern Nachmittag sehr müde und erschöpft gewesen, sie ist fast augenblicklich in einem der drei Zelte eingeschlafen, als Susan ihr eine Decke und ein Kissen gegeben hat. Es erschien uns das Beste, dass wir sie schlafen lassen und heute früh allein losziehen, um Beeren zu sammeln. Ich hatte freilich keine Ahnung, was Beeren sind und wie sie aussehen. Mit verdutzter Miene habe ich den Korb entgegen genommen und ratlos die Augenbrauen gehoben, als Susan ihr glockenreines Lachen ertönen ließ und sich darüber amüsierte, dass ich vom Überleben im Großstadtdschungel rein gar nichts weiß. Ich war erleichtert, als Cade sich angeboten hat, mich zu begleiten. Es sei besser, wenn ich nicht ohne Schutz ginge, sagte er.
In der letzten Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich habe neben Shelly im Zelt gesessen und sie beim Schlafen beobachtet, dabei immer wieder über ihr kurzes Haar gestrichen. Irgendwann - es war noch dunkel - bin ich vor das Zelt gekrochen, um die kühle frische Luft in meine Lungen zu saugen. Cade lehnte an einem Baum, der krüppelig und knorrig neben der Senke, in der die Zelte stehen, seine ausladenden Äste über das Lager streckt. Cade schläft nie, und ich hatte den Eindruck, dass er meine Gesellschaft genossen hat. Lange haben wir schweigend nebeneinander gesessen. Ich habe meinen Kopf an seine Brust gelegt und seinem kräftigen regelmäßigen Herzschlag gelauscht. Irgendwann hat er mir flüsternd erzählt, was er seit unserer übereilten Trennung vor vielen Wochen erlebt hat. Dass sein Quartier und die Maschine für immer zerstört seien, dass es andere Wandler wie ihn gäbe, die nach meinem Blut trachteten und dass er fortan sippenlos und auf der Flucht sei. Ich habe ihm zugehört, seiner leisen dunklen Stimme gelauscht und versucht, mich von meinen eigenen Sorgen abzulenken. Von nun an bin ich ebenfalls auf der Flucht - allein, ohne Neal. Es bricht mir noch immer das Herz, ihn für immer verloren zu haben.
Irgendwann muss ich dennoch eingeschlafen sein, denn das Geräusch eines Reißverschlusses hat mich hochschrecken lassen. Es war Susan, die aus ihrem Zelt kroch. Sie sagte, sie stehe jeden Morgen so früh auf, um Wasser zu erhitzen und das Frühstück vorzubereiten. Als sie mich fragte, ob ich Lust hätte, frische Beeren zu suchen, habe ich zugestimmt. Ich komme mir ohnehin vor wie ein Eindringling in ihrem Lager, da erschien es mir nur richtig, wenn ich mich nützlich mache.
Richard, von dem ich seit gestern weiß, dass er mein totgeglaubter Vater ist, ist noch am frühen Abend mit dem Auto losgefahren, um Jamie und Sarah zu suchen, die beiden Rebellen, die Cade, Shelly und mir vor dem Einkaufszentrum das Leben gerettet haben. Sie sind bis heute morgen nicht zurückgekehrt. So gerne hätte ich Richard mit Fragen gelöchert, aber er hat mir nur zärtlich über das Haar gestrichen, mich auf die Stirn geküsst und gesagt, dass wir es nachholen würden. Die ganze Nacht über sind mir zermürbende Gedanken durch den Kopf geschossen - wie hätte ich da schlafen sollen? Ich möchte wissen, was aus meiner Mutter geworden ist und wie Richard es geschafft hat, aus Manhattan zu fliehen. Doch ich fürchte, ich werde bis zum Frühstück warten müssen, um ihm diese Fragen stellen zu können. Ich hoffe, dass er schnell und unverletzt zurückkehrt. Ich habe Verständnis dafür, dass er seine beiden Kollegen suchen muss. Ich habe sechzehn Jahre lang auf Antworten warten müssen, da kommt es auf ein paar Stunden sicherlich nicht mehr an.
Der Weg zu dem Ort, an dem die stacheligen weichen Beeren wachsen, kam mir sehr weit vor, doch es machte mir nichts aus. Ich genoss es, Arm in Arm neben Cade zu gehen - seit Wochen endlich wieder einmal keine unmittelbare Bedrohung im Nacken zu spüren.
Ich stecke meinen Fuß ins Wasser, es wirft ringförmige Wellen, die das Sonnenlicht auf der Oberfläche tanzen lassen.
»Sieht aus wie Diamanten, oder?«, fragt Cade, der in sicherem Abstand zum See im trockenen derben Gras sitzt und die Arme um die angezogenen Knie gelegt hat.
Ich hebe den Blick, ziehe meinen Fuß aus dem eiskalten Wasser, nehme meine Schlappen in die Hand und gehe zu ihm. »Diamanten?«
»Edelsteine, funkelnde kleine Dinger, die sehr wertvoll sind.« Er lächelt, erhebt sich und streckt den Rücken. »Schade, dass du nie welche gesehen hast. Sie sind wunderschön.«
»Das glaube ich, wenn sie aussehen wie glitzerndes Wasser. Vielleicht werde ich eines Tages mal einen Diamanten sehen.«
»Das würde ich dir wünschen.« Cade sieht sich um und beschattet dabei die Augen mit der Handkante. Er nimmt seine Aufgabe als mein Aufpasser sehr ernst. Doch es ist totenstill um uns herum, lediglich der Wind pfeift durch die dürren verkrüppelten Äste der Bäume, die am Ufer wachsen. Ich lege den Kopf in den Nacken und betrachte den klaren Himmel, der dort, wo die Sonne steht, von dem fahlen Graublau der sterbenden Nacht in ein helles Orangegelb übergeht. Es wird ein schöner, warmer Tag werden. Ich sehe keine hässlichen schwarzen Helikopter, die mit ihrem Lärm die friedliche Stille zerreißen. Entweder haben die Obersten aufgegeben, nach Cade und mir zu suchen, oder sie schmieden bereits Pläne, wie sie mich zurück in ihr kaltes tristes Stahlgefängnis holen können. Ein Schauder läuft mir bei dem Gedanken über den Rücken.
Cade nimmt den Korb vom Boden auf und drückt ihn mir in die Hand. »Siehst du den Brombeerstrauch dort drüben?« Er deutet auf eine Stelle nahe des Seeufers. »Dort wachsen noch ein paar der kleinen roten Biester. Pflück sie ab und dann machen wir uns auf den Rückweg.«
Er klingt plötzlich wieder ein wenig genervt, dennoch lächle ich ihn an, nicke und streife meine Schlappen über die Füße, ehe ich auf den Strauch zugehe. Ich weiß, dass Cade nicht damit einverstanden war, dass wir bei den freien Menschen bleiben. Er wäre lieber gestern noch nach Philadelphia aufgebrochen, um Shelly und mich möglichst weit aus der Gefahrenzone zu bringen. Im Lichte der Tatsache, dass ich gerade erst meinen Dad wiedergefunden habe, hat er jedoch zähneknirschend eingesehen, dass sich unsere Abreise verzögern wird - wenn wir überhaupt je weiterziehen. Mir gefällt es bei Richard, Susan und den anderen.
Ich ziehe die prallen dunklen Beeren von den Ästen und lasse sie in den Korb fallen. Ich bin fasziniert von der Tatsache, dass Essen an Pflanzen wächst. Im Central Park wachsen auch Pflanzen, aber an keiner davon habe ich je rote Beeren gesehen. Die Welt ist voller Wunder und neuer Eindrücke.
Ich zerquetsche eine der Beeren zwischen Daumen und Zeigefinger. Roter klebriger Saft rinnt meine Finger entlang. Er riecht süß, intensiv und appetitlich. Ich lecke ihn zögerlich ab. Ein wundervoller süßer Geschmack legt sich auf meine Zunge. In meiner Heimat gab es nur zu besonderen Anlässen süßes Gebäck. Ich habe immer gedacht, diese Art von Essen sei selten und unglaublich wertvoll. Dass süße Beeren im Überfluss an Pflanzen wachsen, habe ich mir nie träumen lassen.
»Beeil dich, Holly. Wir haben noch einen weiten Weg zurückzulegen!«
Ich wende mich vom Strauch ab und gehe zurück zu Cade, der mir mit einer Geste bedeutet, ihm den ausgetretenen Trampelpfad, über den wir gekommen sind, zurück zu folgen.
Wir erreichen bald wieder die breite mehrspurige Straße, die in den grauen Betonwald von Newark zurückführt. Mir wird schwer ums Herz, weil ich gerne länger zwischen den Bäumen geblieben wäre. Zerfallene Gebäude kenne ich bereits im Überfluss, aber die Natur zieht mich magisch an. Nur der Gedanke daran, Richard im Lager wiederzusehen, lässt mich schneller laufen.
Wir haben etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt - die Sonne steht bereits höher am Himmel und wärmt unsere Haut - als ich hinter mir das Geräusch eines fahrenden Autos vernehme. Reflexartig drehen Cade und ich zugleich die Köpfe. Ein Anflug von Panik durchfährt mich. Suchen die Obersten doch noch nach mir? Ich sehe mich hektisch nach allen Seiten hin um, aber ich habe keine Chance, ein Versteck zu erreichen, ehe der Fahrer des Wagens uns gesehen hätte. Cade greift blitzschnell um meine Taille, beinahe hätte ich den Korb fallen gelassen. Er macht mit mir einen Sprung zur Seite, doch in diesem Moment kann ich schon das Gesicht des Fahrers sehen. Er sitzt in einem schmutzigen weißen Auto. Also kein V23er.
Cade atmet hörbar erleichtert aus und setzt mich zurück auf meine Füße. Das Auto hält neben uns, die Scheibe auf der Fahrerseite senkt sich herab.
»Soll ich euch mitnehmen?«, knurrt Elijah, einer der Rebellen, die zu unserem Lager gehören. Ich habe bislang einen Bogen um ihn gemacht, weil er mir unheimlich ist. Er scheint nie guter Laune zu sein.
»Du hast uns erschreckt«, sagt Cade, nicht weniger unfreundlich.
»Sorry. Ich war auf der Jagd, hab die Fallen kontrolliert. Sonst gibt's heute Mittag nichts zu beißen. Im Kofferraum sind drei Karnickel, viel mehr lässt sich in dieser gottverlassenen Welt kaum auftreiben.« Er gähnt herzhaft. Elijah ist gestern Abend weggefahren, ohne zu sagen, wohin. Ich habe den Eindruck, dass er innerhalb der Gruppe ein Einzelgänger ist.
»Wir wären dankbar, wenn du uns die restlichen zwei Meilen mitnehmen könntest.« Cade klingt allerdings alles andere als dankbar. Es scheint, als müsste er sich zusammenreißen, um höflich zu bleiben. Er greift nach dem Griff der hinteren Autotür und öffnet sie. Ich klettere auf den Rücksitz, das Körbchen mit den Beeren auf meinem Schoß. Dann fällt die Tür wieder zu.
»Hätte ja schlecht an euch vorbeifahren können, ohne dass es unhöflich erscheint, was?« Elijah stößt ein hämisches Lachen aus, das mir nicht gefällt.
Cade lässt sich auf dem Beifahrersitz nieder und schließt die Tür, woraufhin das Auto mit quietschenden Reifen durchstartet. Elijahs Fahrstil ist mir in schlechter Erinnerung geblieben. Als er und Zac uns gestern vor der Mall einkassierten, hat er schon ein ähnliches Tempo vorgelegt.
Elijahs Blick trifft meinen im Rückspiegel. Er hat dunkle unergründliche Augen, deren Funkeln mir eine Gänsehaut über die Arme jagt.
»Weißt du, wann Richard zurückkommt?«, frage ich ihn. Um seine Augen bilden sich leichte Fältchen, als würde er grinsen.
»Ich hoffe, dass er Jamie und Sarah gefunden hat und schon im Lager ist. Mag sein, dass sie noch einen Abstecher gemacht haben, um neues Benzin zu besorgen. Unsere Karren sind nicht so nobel wie das Teil, das wir von euch übernommen haben, die fahren noch mit Treibstoff.«
»Was ist Richard für ein Mann?«
Cade knurrt auf dem Beifahrersitz, als wollte er mich ermahnen, ruhig zu sein. Aber ich denke gar nicht daran. Ich lasse mich von Elijah nicht einschüchtern.
»Er ist dein Vater, was? Mensch, hätte nie gedacht, dass du nochmal aufkreuzt. Richard hat oft von dir erzählt, aber du bist als Baby angeblich gestorben. Mach dir ein eigenes Bild von ihm. Er ist ein anständiger Kerl, den kriegt nichts unter. Hat mich und meine Schwester Sarah bei sich aufgenommen, obwohl ich ihn damals bestohlen habe.« Er stößt einen Laut aus - halb Lachen, halb Husten.
Für den Rest der Fahrt spricht niemand ein Wort. Es ist mir unangenehm. Irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass es Elijah alles andere als recht war, dass wir zu der Gruppe gestoßen sind.
Er stellt den Wagen unweit des Lagerplatzes hinter den Überbleibseln einer eingefallenen Mauer ab, verborgen vor den Blicken von der Hauptstraße, die in etwa dreißig bis vierzig Yards Entfernung am Camp vorbeiführt. Bislang habe ich jedoch keinen anderen Menschen in der Nähe gesehen, weder zu Fuß noch motorisiert.
Elijah öffnet den Kofferraum und nimmt drei pelzige Bündel heraus, die ich offen anstarre, weil sie mich zugleich ängstigen und faszinieren.
»Was ist denn das?«, entfährt es mir.
Elijah grinst und schnaubt, sagt jedoch nichts. Er sieht mich nicht einmal an, als er die Riesenratten mit den langen Ohren schultert und in Richtung Lager geht.
Cade legt mir eine Hand auf die Schulter. »Kaninchen. Euer Abendessen.«
»Sind das Ratten?«
»Nein. Es gibt allerhand Viehzeug auf der Welt, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Sei froh, dass er kein Reh erlegt hat. Das wäre fast so groß wie du.« Er stößt ein kurzes Lachen aus, aber ich finde das gar nicht lustig.
Ich funkle ihn böse an, aber Cade zwinkert nur und wuschelt mir durch die Haare.
»Komm jetzt«, sagt er. »Wir gehen ins Camp, auch wenn es mir nicht gefällt.«
Ich beobachte, wie Elijah die Kaninchen an Susan übergibt. Sie lächelt. Ich kann nicht hören, was sie zu ihm sagt, aber offensichtlich freut sie sich über seinen Fang. Mit den Tieren über der Schulter entfernt sie sich Richtung Feuerstelle, die sich ein paar Yards abseits des Zeltplatzes befindet.
Elijah steuert auf eine Frau zu, die ich im Camp noch nicht gesehen habe. Sie ähnelt ihm ein wenig, aber ihre kinnlangen Haare sind etwas heller als seine. Die beiden nehmen sich in den Arm und begrüßen sich stürmisch.
In diesem Moment erblickt mich Shelly und läuft auf mich zu. »Holly!«
Ihre dünnen blassen Arme legen sich um meine Schultern, beinahe wäre mir der Korb mit den Beeren aus den Händen gerutscht. Shelly riecht nach Seife, ihre Haare sind nass. »Wo bist du gewesen?«
»Bloß Beeren sammeln.«
»Ich dachte, du kämst gar nicht mehr zurück!«
»Aber natürlich komme ich immer wieder zurück. Glaubst du, ich lasse dich im Stich?« Ich lächle sie breit an. Shelly sieht verlegen zu Boden.
»Weshalb hast du mich nicht mitgenommen?«
»Weil du sehr erschöpft warst und noch geschlafen hast. Ich wollte dich nicht wecken. Außerdem ist es ein sehr weiter Weg gewesen.«
Shelly nimmt die Arme herunter und entlässt mich aus ihrem stürmischen Klammergriff. »Susan war sehr nett zu mir. Sie hat mir gezeigt, wo ich mich waschen kann. Mir gefällt es hier. Können wir für immer bleiben?«
Ich höre, wie Cade hinter mir geräuschvoll die Luft durch die Zähne einsaugt. Er wird nicht bleiben wollen, und ich kann ihn verstehen. So lange die anderen im Camp ihn für einen Menschen halten, besteht keine Gefahr für ihn. Irgendwann wird ihnen jedoch auffallen, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Als Susan mir heute morgen ein frisches blaues T-Shirt angeboten hat, weil es ein warmer Tag werden würde, habe ich es bereitwillig entgegen genommen, Cade hat jedoch abgelehnt, sich umzuziehen. Er trägt noch immer den schwarzen Anzug der Obersten. Ich weiß, dass er ihn verabscheut, aber er will sein schwarzes Mal am Arm nicht preisgeben. Ich mache mir eine gedankliche Notiz, nach einem Kleidungsstück mit langen Ärmeln für ihn zu suchen. Die Rebellengruppe besitzt viele Kleidungsstücke, das meiste davon aus den Lagern der Sunset Mall.
Ich streiche über Shellys kurzen blonden Haarschopf. »Lass uns noch nicht darüber reden, ob wir bleiben oder nicht. Wir sind doch gerade erst angekommen.«
Shelly nickt. Fürs erste scheint ihr die Antwort zu genügen.
Wir gehen hinab in die Senke zu den Zelten. Davor liegen abgehackte dicke Baumstämme als Sitzgelegenheit. Ich finde es beinahe gemütlich. Susan nimmt mir den Korb mit den Beeren ab und verspricht, sich schnell um die Zubereitung des Frühstücks zu kümmern. Elijah und die fremde Frau sitzen auf einem der Baumstämme und sprechen angeregt miteinander.
»Wohin ist Jamie gegangen?«, fragt Elijah. »Richard ist noch immer nicht zurück, er sucht ihn überall.«
»Was weiß ich, bin ich sein Kindermädchen? Wir können von Glück reden, dass wir unverletzt aus der Schießerei heraus gekommen sind.«
Als ich mich nähere, sieht sie mich an. Als würde sie unsere Anwesenheit erst jetzt zur Kenntnis nehmen, hebt sie fragend die Augenbrauen.
»Das sind Cade, Holly und Shelly. Drei Neuankömmlinge.« So, wie Elijah es sagt, klingt es nicht gerade begeistert. »Und das ist meine Schwester Sarah. Sie hat euch gestern vom Dach der Mall aus den Hintern gerettet.«
Ich setze mich auf einen Baumstamm den anderen beiden gegenüber, Shelly lässt sich neben mich darauf fallen. Cade bleibt in einigem Abstand hinter uns stehen. »Ich danke euch, dass ihr uns geholfen habt.«
Sarah macht eine wegwerfende Handbewegung. »Papperlapapp. Jamie und ich waren auf dem Weg zur Mall, als wir das Mutantenpack bemerkt haben. Wir lassen keine Gelegenheit aus, sie zu töten, sollten sie so dumm sein, uns vor die Flinte zu laufen.«
Sarah macht auf mich einen nicht weniger frostigen und abgehärteten Eindruck als Elijah. Kaum zu leugnen, dass sie Geschwister sind.
Mein Herz beginnt, schneller zu schlagen, als ich meinen Mut zusammen nehme, um ihr eine Frage zu stellen, die mir schon die ganze Nacht durch den Kopf geht. »Habt ihr alle Obersten vor der Mall getötet?«
Der Gedanke, sie könnten Neal erwischt haben, trifft mich härter als ich dachte, obwohl mein Verstand mir sagt, dass ich endlich von ihm ablassen und ihn vergessen muss.
»Nein, nur drei. Leider. Die anderen sind mit ihrer Karre geflohen. Tun sie dir etwa leid?«
Ich schüttle den Kopf und schlucke den Kloß hinunter, der sich in meinem Hals bildet.
»Wo ist mein Vater?« Es fühlt sich seltsam an, das Wort auszusprechen. Ich habe es sechzehn Jahre lang zu niemandem gesagt und auch jetzt ist es mir noch sehr fremd. Ich kenne ihn erst seit gestern. Ich kann es noch immer nicht so recht glauben.
»Er wird bald zurückkommen, mach dir keine Sorgen«, knurrt Elijah. »Er streunert häufig durch die Gegend, ist ein harter Hund. Mach dir um ihn keine Sorgen. Ich könnte bloß Jamie den Kopf abreißen, dass er ständig verschwindet und wieder auftaucht, als sei nichts gewesen. Richard wird ihm die Ohren lang ziehen, wenn er ihn findet.«
In diesem Moment gesellt sich Susan zu uns. Sie legt Shelly und mir je eine Hand auf die Schulter. »Wollt ihr mir helfen, das Essen zu machen?« Mir entgeht nicht, dass sie Elijah einen strengen Blick zuwirft.
Shelly ist sofort begeistert von der Idee. Ich werfe Cade einen Blick über die Schulter zu. Er steht dort mit finsterer Miene und mit vor der Brust verschränkten Armen, nickt mir jedoch zu, als würde er mir die Erlaubnis erteilen.
*** Susan ist eine sehr nette Frau, die ich gut leiden kann. Zac ist relativ still, wenngleich nicht unfreundlich. Er hat bislang nicht viel gesprochen, sondern an den beiden Autos der Rebellen herumgeschraubt. Susan sagt, er sei sehr hilfsbereit und zuvorkommend, aber das Leben habe ihn zu einem verbitterten Mann gemacht. Er hat eine Frau und einen Sohn an skrupellose Entführer verloren, die Menschen stehlen und sie töten, weil sie sich von ihnen ernähren. Susan hat bewusst das Wort Acrai vermieden, aber ich weiß, dass sie von ihnen gesprochen hat. Als ich ihr erzähle, dass ich selbst schon einmal von Acrai gefangen genommen wurde, sieht sie mich ungläubig an.
»Du scheinst ja schon eine Menge durchgemacht zu haben.«
Ich zucke nur die Achseln und dränge die Tränen zurück, die mir bei dem Gedanken an meine Vergangenheit in die Augen zu steigen drohen.
Susan sagt, Zac habe bittere Rache geschworen, von allen Rebellen im Camp ist er derjenige, der die Acrai noch lieber tot sehen würde als die V23er. Ich schlucke trocken und wende mich wieder den Beeren zu, die ich in einem Zinkeimer mit klarem Wasser wasche. Ein Seitenblick zu Shelly, die gerade Wurzeln mit einem Messer schält (man merkt deutlich, dass sie mehr Erfahrung als freier Mensch hat als ich), verrät mir, dass ihr derselbe Gedanke durch den Kopf geht wie mir: Cade darf unter keinen Umständen auffliegen. Shellys Wangen röten sich, sie wendet den Blick ab und legt die Stirn in Falten, aber sie bleibt stumm. Ich bin ihr unendlich dankbar dafür, dabei hat sie durch die Acrai ebenfalls eine Familie verloren. Ich hätte es ihr wahrscheinlich nicht einmal übel genommen, wenn sie Cade verraten hätte.
Susan erzählt mir auch etwas über die anderen Mitglieder des Camps. Sie haben alle keine Familie mehr und gewähren sich gegenseitig Schutz in einer Welt, in der man allein kaum überleben könne. Es erinnert mich ein wenig an meine ehemalige Kommune in Manhattan - wir waren auch alle Waisen ohne Familie gewesen. Elijah und seine Schwester Sarah seien die einzigen, die zumindest noch ein einziges Familienmitglied haben. Die beiden seien vor etwa zwei Jahren zu der Gruppe dazugestoßen, als sie in der Sunset Mall auf Richard stießen, der damals noch in seinem Versteck im Lüftungsschacht gelebt hat. Jamie, den ich bislang noch nicht kennengelernt habe, sei ein Eigenbrötler und ein Sturkopf, sagt Susan. Er sei noch jung, gerade zweiundzwanzig, und ein guter Schütze. Er sei noch neu in der Gruppe, seit nicht einmal einem Monat dabei. Doch er engagiere sich bereitwillig für das Gemeinwohl. Wie Susan in die Gruppe gekommen sei, fragt Shelly. Susan seufzt und berichtet, dass sie und Richard zu den ältesten Mitgliedern gehören, die einzigen, die von der ursprünglichen Gruppe noch übrig seien. Richard habe sie vor vielen Jahren allein in einer verfallenen Wohnung gefunden. Sie habe beschlossen, mit ihm zu gehen und ins Camp zu ziehen. Wenn Susan von Richard erzählt, nehmen ihre Wangen einen zarten Rotton an. Ich habe den Eindruck, dass sie mehr für ihn empfindet als Freundschaft. Ein leichter Anflug von Ärger streift mich, für den ich mich gleich darauf schäme. Meine Mutter ist offensichtlich seit langem tot oder verschollen. Ich kann nicht verlangen, dass mein Vater allein bleibt. Außerdem kenne ich ihn kaum, ich darf mir nicht anmaßen, über ihn zu urteilen.
Inzwischen habe ich alle Beeren gewaschen. Susan verteilt sie in grob geschnitzte Holzschalen. Sie nimmt den Eimer mit den geschälten Wurzeln von Shelly entgegen und füllt sie in ein Metallgefäß, das sie mit Wasser aufgießt und es an einer hölzernen Halterung über dem Feuer befestigt. Sie schickt Shelly zu einer Stelle etwas abseits des Lagers, wo Kisten und Kartons unter einer Plane lagern.
»In einer weißen Blechdose müssten noch Brotscheiben sein. Hol sie bitte hierher.«
Shelly lächelt und springt sogleich auf.
Ich sehe auf meine Finger hinab, die vom Beerensaft rötlich verfärbt sind. Ich räuspere mich. »Weshalb seid ihr so nett zu uns? Wir sind doch nur Ballast.«
Susan setzt sich mir gegenüber auf den staubigen Boden und legt ihre Hände auf meine Schultern. Ich hebe den Blick und sehe in ihre blauen Augen, um die sich zarte Fältchen ziehen.
»Du bist Richards Tochter. Natürlich bist du willkommen, und deine Freunde ebenfalls.«
»Und wenn ich nicht seine Tochter gewesen wäre? Als Zac und Elijah uns auf dem Parkplatz aufgelesen haben, konnten sie das noch nicht wissen.«
Susan seufzt und beißt sich auf die Unterlippe. »Sie haben euch sicherlich für Feinde gehalten. Dein Freund trägt einen schwarzen Anzug.«
»Dann hätten sie uns auch gleich erschießen können.«
»Ihr seid unbewaffnet gewesen, keine Gefahr für die beiden. Manchmal ist es besser, an Informationen zu gelangen als jemanden sofort zu töten.«
»Ihr wolltet also bloß etwas aus uns herausbekommen?«
Susan streicht sich eine Haarsträhne, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hat, hinter das Ohr. In diesem Moment kehrt Shelly zurück, unter dem Arm eine weiße Blechdose, etwa so lang wie eine Elle. Susan nimmt sie ihr ab. »Danke, Liebes. Dann werden wir gleich frühstücken. Es wird kein schönes Mahl sein, aber besser als nichts.«
Shelly lässt sich mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht auf den Baumstamm sinken, während Susan sich wieder mir zuwendet. »Wir haben uns eben getäuscht. Harte Zeiten verlangen nach harten Maßnahmen, das musst du verstehen.« Dann erzählt sie mir, dass die Rebellengruppe seit ihrer Gründung plant, einen Weg zu finden, den Obersten das Handwerk zu legen. Dass Richard selbst schon in der Zentrale gewesen sei, dass sie sich seit Jahren auf eine Revolution vorbereiteten. Als Susan erfährt, dass auch ich, Shelly und Cade schon in der Zentrale gewesen seien und fliehen konnten, weiten sich ihre Augen. Wir seien ein echter Glücksgriff, ein Quell an Informationen. Ich lasse es unkommentiert. Einerseits möchte ich mich nicht wieder benutzen lassen, andererseits wünsche auch ich mir, dass die Obersten endlich damit aufhören würden, Menschen zu unterdrücken und zu quälen.
»Wer ist der Mann, der dich hierher begleitet hat?«, fragt Susan, als wir die Schalen mit den Beeren und das Brot zum Tisch bringen, der im Schatten des Baumes am Rand der Senke steht.
»Er ist ein Freund von mir, auch ein freier Mensch. Er hat Shelly und mich aus der Zentrale befreit. Den Anzug trägt er nur zur Tarnung.« Ich merke, wie meine Ohren zu glühen beginnen. Ich konnte noch nie gut lügen.
»Woher kennst du ihn? Nach meinem Kenntnisstand werden die Menschen aus Manhattan unverzüglich in die Zentrale gebracht. Du dürftest nie in Kontakt mit freien Menschen gekommen sein.«
»Ich habe dir doch erzählt, dass ich in die Fänge von Acrai geraten bin. Sie haben mich damals direkt in Manhattan gefangen genommen. Ich konnte ihnen entkommen, mit Cade zusammen.«
»Dieses schlimme Pack! Macht nicht einmal vor den armen Leuten in Manhattan Halt. Ich möchte wetten, sie nutzen deren Naivität schamlos aus, um sie zu sich zu locken. Ich möchte mal wissen, durch welche undichte Stelle sie in die Stadt gelangen.«
Ich nicke nur, sage aber nichts. Susan muss spüren, dass mir das Thema unangenehm ist, denn sie löchert mich nicht weiter mit Fragen.
Der Tisch, auf dem wir das Essen verteilen, ist zu klein für alle. Es gibt nur sechs Stühle (wenn man die grob zusammen gezimmerten Holzkisten als Stühle bezeichnen möchte). Ich versichere ihr, dass Cade, Shelly und ich freiwillig auf dem Boden sitzen würden.
»Nun gut, dann wäre alles vorbereitet«, sagt Susan und klatscht in die Hände. »Wenn es euch wirklich nichts ausmacht?«
»Nein, ganz sicher nicht. Wir sind sehr dankbar für eure Gastfreundschaft.«
Susan lächelt warm, mein Herz macht einen Hüpfer. Ich habe diese menschlichen Verhaltensweisen wochenlang so schmerzlich vermisst. Ich kann nichts dagegen tun, dass ich breit zurück grinse.
»Shelly, lauf los und hol die anderen, wir haben Hunger«, lacht Susan. Shellys Augen strahlen, ehe sie mit großen Sprüngen durch das Camp läuft und die anderen antreibt, zum Frühstück zu erscheinen.
Kapitel zwei
Holly
Während wir essen, herrscht unangenehmes Schweigen innerhalb der Gruppe. Susan, Elijah, Sarah, Zac und Shelly sitzen auf den behelfsmäßigen Stühlen, während Cade und ich etwas abseits an den Stamm des Baumes lehnen und die Knie anziehen. Die Beeren schmecken süß, und Cade schiebt mir seine Schale zu, ohne eine einzige Beere angerührt zu haben.
»Möchtest du nicht...«
Er unterbricht mich, legt mir seinen Zeigefinger auf die Lippen und schüttelt den Kopf. »Nein«, flüstert er mir zu. »Ich möchte nichts essen. Ich verspüre momentan kein Verlangen nach fester Nahrung.« Ein wehmütiges Lächeln huscht über seine Züge.
Ich werfe einen flüchtigen Blick zurück zu den anderen, aber niemand sieht zu uns herüber oder scheint etwas von unserer Unterhaltung mitzubekommen. Unauffällig tausche ich meine leere Schale gegen die volle von Cade und nehme auch sein Stück Brot von ihm entgegen. Eigentlich würde ich es lieber Shelly geben, aber wie soll ich das machen, ohne Fragen aufzuwerfen? Also verzehre ich stumm Cades Portion und lehne anschließend meinen Kopf an seine Schulter. Ich schließe die Augen und lausche. Der Wind streicht durch das Laub der kleinen derben Blätter, die sich in den Ästen über uns wiegen. Ich höre, wie die anderen essen, wie sie sich auf ihren Stühlen bewegen, höre ihre Kleidung rascheln. Die warme Spätsommerluft riecht nach Erde und Pflanzen. Cade atmet langsam und regelmäßig, die Wärme seines Körpers beruhigt mich. Ich habe mich lange nicht mehr so wohl gefühlt. Freiheit. Ein Wort, dessen Bedeutung ich schon vergessen geglaubt hatte. Ich möchte mich in diesen wenigen Momenten des Friedens verlieren und am liebsten nie wieder zurückkehren in die grausame Realität, in der ich auf der Flucht vor gleich mehreren Feinden bin.
Das surrende Geräusch eines Motors, gepaart mit dem von Reifen, die über Schotter fahren, lässt mich die Augen aufreißen und hochfahren. Eine schwarze Limousine kommt den Pfad herauf gefahren, der zu unserem kleinen Krater führt, in dem sich das Lager befindet. Im ersten Moment bleibt mein Herz stehen, denn es ist ein Wagen der Obersten. Als ich jedoch das Kennzeichen V23-7 lesen kann, atme ich durch. Das ist das Auto, das Cade damals gestohlen hatte.
Inzwischen haben es auch die anderen bemerkt. Sarah steht von ihrem Stuhl auf und beschattet die Augen mit der Handkante.
»Da kommt Richard«, sagt sie.
In diesem Moment öffnet sich die Autotür, das leise Surren des Motors hält jedoch an. Richard steigt aus und fährt sich mit der Hand durch die dunklen Locken. Er sieht müde aus, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. Er kommt zu unserem Tisch herüber, ich stehe auf und geselle mich zu den anderen, Cade bleibt jedoch beim Baum sitzen. Er beobachtet die Szene argwöhnisch.
Susan springt auf und fällt Richard um den Hals. Er legt ebenfalls seine Arme um sie, aber nicht halb so stürmisch. Als sie sich voneinander lösen, glitzern Tränen in Susans Augen.
»Wo warst du nur so lange? Wo ist Jamie?«
»Ich habe ihn nicht gefunden. Ich nehme an, er ist nach Manhattan gefahren. Sein Motorrad parkt nahe der Williamsburg Bridge. Mir war es allerdings zu heikel, ihm zu folgen. In der Gegend wimmelte es von Patrouillen. Er soll sich warm anziehen, wenn er zurückkommen sollte. So etwas Riskantes zu wagen! Ich frage mich, was er dort wollte.«
»Williamsburg Bridge? Gibt es dort etwa auch einen Durchlass durch die Barriere?«, frage ich.
Richard wendet sich mir zu und sieht mich einen Augenblick lang verstört an, dann lächelt er, als würde er sich erst jetzt wieder an mich erinnern. Er legt mir eine Hand auf die Schulter.
»Ja, es gibt unterhalb der Brücke einen Riss in der Barriere, man muss allerdings darunter her klettern und kann nicht mir dem Auto durchfahren. Es ist riskant, weil man leicht abrutschen und in die Fluten stürzen kann. Wir wagen es nur, wenn es nötig ist.« Er wendet sich an Sarah. »Hat Jamie dir nach dem Angriff nicht gesagt, wohin er geht?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, und ich hatte in diesem Moment ernsthaft andere Sorgen, als mich um den Neuling zu kümmern. Ich bin froh, dass ich überlebt habe.«
Richard nickt. »Ist noch etwas zu essen da?«
»Ja, in den Vorratskisten müsste noch etwas sein. Ich hole es dir.« Susan wendet sich ab und steuert auf die Kisten abseits der Feuerstelle zu. Elijah und Sarah erheben sich beinahe zeitgleich von ihren Stühlen.
»Wir gehen dann mal wieder auf unseren Posten«, knurrt Elijah. »Irgendjemand muss die Zufahrt von der Hauptstraße schließlich bewachen. Mir ist fast das Herz stehen geblieben, als ich den schwarzen Schlitten herauf fahren sah. Hab einen Augenblick gebraucht, um mich daran zu erinnern, dass wir jetzt auch so eine Mutantenkarre besitzen.«
»Haben wir noch Munition?«, fragt Sarah während sie ihre Pistole aus dem Gürtel zieht.
Zac nickt. »Ja, in der Tasche im Kofferraum des Mitsubishi ist noch genug Munition für deine Knarre.«
Sarah und Elijah verlassen die Gruppe. Ich setze mich auf einen der frei gewordenen Stühle und lasse meinen Blick zu Cade herüber schweifen. Mit einer Geste bedeute ich ihm, sich neben mich zu setzen, aber er schüttelt bloß den Kopf und blickt dabei finster.
»Ist nicht besonders gesprächig dein Freund, was?«, fragt Zac mit einem Grinsen.
In Ermangelung einer Antwort zucke ich nur die Achseln. Ich spüre, wie mir heißes Blut in die Wangen steigt. Cade mausert sich schon jetzt zum Außenseiter, und das gefällt mir überhaupt nicht. Er sollte sich ein wenig dankbarer zeigen.
Shelly steht auf und beginnt, das Geschirr abzuräumen und es zur Wasserstelle zu tragen. Ich bin stolz auf sie, dass sie sich bereits so gut in die Gruppe integriert hat. Ich wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie wieder glücklich werden und lachen kann.
Richard lässt sich neben mich auf den Stuhl fallen, den ich zuvor Cade angeboten hatte. Er reibt sich über das Gesicht. Dann sieht er mich an und lächelt. Ich merke ihm deutlich an, dass er sehr müde ist.
»Möchtest du nicht etwas schlafen?«, frage ich, aber Richard schüttelt nur den Kopf.
»Schlimm genug, dass ich gestern Abend so übereilt das Camp verlassen musste, wo wir uns doch noch gar nicht richtig kennen. Es hat mir im Herzen weh getan und ich habe gehofft, dass du es mir verzeihen wirst. Aber ich habe mir Sorgen um Jamie gemacht, das musst du verstehen.«
»Natürlich.«
Einen Augenblick lang breitet sich Schweigen zwischen uns aus. Ich fühle mich befangen, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Er ist mein Vater, aber dennoch ein fremder Mann. Alles kommt mir unwirklich vor, als würde ich träumen. Hatten mich gestern Nacht noch so viele Fragen geplagt, wollen sie mir nun nicht über die Lippen kommen.
Richard nimmt es mir ab, zuerst das Wort zu ergreifen. »Du möchtest sicher wissen, wo ich all die Jahre gewesen bin und was aus deiner Mutter geworden ist, oder? Ich kann immer noch nicht glauben, dass du überlebt hast und wieder da bist. Es muss Schicksal sein.« Seine Mundwinkel zittern, als müsste er sich beherrschen, nicht in Tränen auszubrechen. Mir ergeht es ähnlich. Zac scheint zu spüren, dass dies ein sehr inniger Moment zwischen meinem Vater und mir ist, deshalb erhebt er sich lautlos von seinem Stuhl und entfernt sich von uns. Richard und ich sind nun allein, lediglich beobachtet von Cade, der zwar den Kopf auf seine Knie gelegt hat, als würde er schlafen, doch ich sehe durch den schwarzen Vorhang seiner Haare deutlich die orangebraunen Augen in meine Richtung blicken.
»Ja, ich würde es gerne wissen«, bringe ich mit erstickter Stimme hervor. »Aber wenn du zu müde bist, musst du es mir nicht sofort erzählen.«
»Ach was. Schlafen kann ich noch, wenn ich tot bin. Nichts ist mir wichtiger als meine Tochter.«
Mein Herz schlägt in einem schnellen Rhythmus gegen meine Rippen, aber ausnahmsweise nicht aus Angst, sondern aus purer Freude. Wann habe ich zuletzt so etwas gespürt?
Richard atmet einmal tief ein und sieht in die Ferne. Sein Blick ist der eines Mannes, der in Erinnerungen schwelgt.
»Es ist eine lange Geschichte. Wir haben mehr als sechzehn Jahre verloren. Jahre, die nie wiederkehren. Ich habe dich nicht aufwachsen sehen, und das schmerzt mich am meisten. Wenn ich nur geahnt hätte, dass du lebst, hätte ich dich längst zu mir geholt. Du warst mir die ganze Zeit so nah. In den letzten Jahren bin ich öfters in Manhattan gewesen. Wer weiß, vielleicht sind wir uns über den Weg gelaufen, ohne uns erkannt zu haben? Mir wird ganz heiß bei der Vorstellung.« Wieder atmet er schwer. Eine Träne löst sich aus seinem Augenwinkel. Irgendwie passt es nicht zu ihm. Sein Gesicht ist kantig, seine Wangen bedecken Bartstoppeln. Eine Narbe zieht sich über seine Schläfe. Er sieht aus wie ein Mann, der viel erlebt und den das Leben hart gemacht hat.
»Deine Mutter Eva war etwas Besonderes. Ich habe sie schon geliebt, als mir noch kein einziges Barthaar gewachsen ist.« Er lächelt wehmütig. Mir fällt auf, dass er meinen Blick meidet, als könnte er nicht ertragen, mir in die Augen zu sehen.
»Wir haben wie alle anderen in Manhattan gelebt«, fährt er fort. »Wir stammten beide aus Bezirk 31, sie lebte nur einen Häuserblock weiter. Schon früh haben wir uns ineinander verliebt. Wir wussten von Anfang an, dass wir zusammen gehörten, haben jede freie Minute miteinander verbracht. Bis zu jenem Tag, der alles ändern sollte: der Tag unserer Erstuntersuchung im Alter von sechzehn. Eva wurde rekrutiert, ich nicht. Sie wollte nicht gehen, aber sie haben sie mir aus den Händen gerissen.« Seine Stimme bricht, er macht eine Pause, in der er sich sammelt. Ich sage nichts, denn auch ich kann meiner Stimme nicht mehr trauen. Tränen tropfen auf die Tischplatte. Die Geschichte erinnert mich schmerzlich an meine eigene.
»Einige Wochen vergingen ohne ein Lebenszeichen von ihr. Ich habe gedacht, ich müsse sterben. Nie zuvor in meinem Leben habe ich größeren Schmerz erfahren. Fast zwei Monate später kehrte sie zurück, weil sie eine Arbeitsstelle im Wäschereibetrieb zugewiesen bekommen hat. Jeden Samstag hat sie die Kisten mit der Schmutzwäsche von den Bewohnern entgegen genommen und in LKWs geladen. Endlich haben wir uns wiedergesehen. Natürlich hatte ich Angst, dass sie sich verändert haben könnte. Die anderen Rekruten haben fortan nie wieder ein Wort mit den Einwohnern gesprochen, aber Eva war anders. Sie war noch immer die alte. Heulend hat sie sich in meine Arme geworfen und mir von ihrem Leid erzählt. Sie würden den Rekruten ein Serum spritzen, dass sie zu gefühlskalten Robotern werden lässt, hat sie erzählt. Aber bei ihr hat es keine Wirkung gezeigt.« Jetzt sieht Richard mich doch an und streicht mir über den Oberarm. »Ich nehme an, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht?«
Ich nicke stumm. Durch den Tränenschleier kann ich sein Gesicht kaum erkennen.
»Damals hatten die V23er noch keinerlei Erfahrung mit diesem Phänomen. Eva ist es über einen langen Zeitraum hinweg gelungen, unauffällig zu bleiben. Sie muss fürchterlich gelitten haben und durfte sich dabei keine Regung anmerken lassen. Jeden Samstag haben wir uns heimlich getroffen, es hat uns beiden Kraft gegeben. Allerdings gab es ein Problem: Eva fehlte das schwarze Mal am linken Unterarm, ohne das sie früher oder später aufgeflogen wäre. Und als ob das noch nicht genug Schwierigkeiten bedeutet hätte, ist Eva auch noch schwanger geworden. Da die V23er unfruchtbar sind, wäre ihre Tarnung in jedem Fall aufgeflogen. Eine Lösung musste er, und zwar schnell. Und dann kommt es zum unschönen Teil der Geschichte ...«
Richard stützt die Ellenbogen auf die Tischplatte und legt den Kopf in die Hände. Er ist ein großer breitschultriger Mann, aber in diesem Moment wirkt er verletzlich. Ich fühle mich beschämt und befangen, weil ich ihn so sehe.
Mein Blick fliegt zu Cade. Er beobachtet uns noch immer, rührt sich jedoch nicht. Die anderen wahren respektvollen Abstand und lassen mich mit Richard allein, sogar Shelly. Susan lenkt sie damit ab, den Platz um die Feuerstelle herum zu fegen.
»Du musst nicht weitersprechen, wenn du nicht willst«, presse ich gequält hervor.
»Doch, doch. Das bin ich dir schuldig. Ich habe die Erinnerungen lange verdrängt und dachte eigentlich, ich käme inzwischen besser damit klar.« Er räuspert sich und atmet tief ein und aus, ehe er fortfährt. »In meiner Verzweiflung habe ich mit windigen Typen Geschäfte gemacht. Ich wusste, dass es Orte in Manhattan gibt, an denen illegale Tauschgeschäfte abgewickelt werden. Manche hochrangige V23er werden nicht verwandelt. Diese Leute verhandeln in düsteren Bars manchmal mit noch düsteren Typen. Korruption gibt es anscheinend überall. Jedenfalls war das die Zeit, in der ich zum ersten Mal auf die Acrai gestoßen bin. Für gewöhnlich töten sie Menschen, aber ich hatte das Glück, ein lukratives Tauschgeschäft aushandeln zu können. Einer der Dreckskerle, sein Name war Lucas, hat sich meine Geschichte angehört. Er war angetan von der Tatsache, dass bei Eva das Serum nicht gewirkt hat. Er versprach mir, uns beide durch eine undichte Stelle in der Barriere zu schleusen und im Gegenzug ein bisschen von ihrem Blut für Forschungszwecke abnehmen zu dürfen, wenn das Kind geboren sei. Das war der Deal, auf den ich bereitwillig eingegangen bin.«
Mein Blick irrt abermals zu Cade. War Lucas nicht der Typ, von dem er mir erzählt hat? Der Kerl, bei dem Cade wochenlang gewohnt hat und der jetzt angeblich auch hinter meinem Blut her ist? Cade hebt den Kopf und sieht jetzt ganz unverhohlen in unsere Richtung. Seine Augen verengen sich, seine Kiefermuskeln sind aufeinandergepresst. Sein ganzer Körper spannt sich an, als wartete er nur darauf, aufzuspringen. Ich sehe, dass er mit sich kämpft, ruhig zu bleiben und nichts zu sagen, um sich nicht zu verraten.
Richard fährt unbeirrt fort. »Lucas und ich haben eine Weile lang Kontakt gepflegt. Er hat mir einiges über sich und sein Volk erzählt. Auch, dass er ein Wandler sei. Aber dir das jetzt zu erklären, würde zu weit führen.«
Das muss er gar nicht, denn ich weiß darüber bereits bestens Bescheid, deshalb nicke ich nur.
»Lucas hat seinen Teil der Abmachung eingehalten. Er hat uns durch einen Tunnel aus Manhattan hinaus gebracht und uns zur Flucht verholfen.« Richard sieht nicht so aus, als hätte er bemerkt, dass Cade bei der Erwähnung von Lucas' Namen aufgemerkt hat.
»Eva und ich haben uns bei den freien Menschen versteckt, monatelang, bis das Baby da war.« Er lächelt mich an. »Das warst du. Wir haben dich Holly genannt, weil ich in einem leer stehenden Supermarkt in Jersey City eine Postkarte mit der Aufschrift Hollywood gefunden habe.«
Mit fahrigen Fingern ziehe ich die Karte aus der Gesäßtasche der Hose, die Susan mir gestern Abend aus der Kleiderkiste gegeben hat. Das Bild ist kaum noch zu erkennen.
»Ja, genau die ist es! Du hast sie noch? Das ist unglaublich.« Richard ringt mit der Fassung. Er tut mir so unendlich leid. Ich stecke die Karte zurück in meine Tasche, obwohl ich plötzlich das Gefühl habe, sie nicht mehr zu benötigen. Ich habe endlich Antworten erhalten.
»Als du geboren wurdest, lag der Deal mit Lucas schon so lange zurück. Wir fühlten uns sicher in Jersey. Ich habe im Traum nicht mehr daran gedacht, meinen Teil der Abmachung einzuhalten. Eva und ich haben uns vor Lucas versteckt und er hat uns nie gefunden. Bis heute fürchte ich mich noch vor einer Begegnung mit ihm. Er würde nicht zögern, mich mit bloßen Händen zu töten. Eva und ich haben lange darüber diskutiert, weshalb er Interesse an ihrem Blut hatte und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich daraus irgendetwas extrahieren lassen muss, das den Acrai nützen könnte.«
»Undying Blood.«
»Wie bitte?«
»Sie wollen Undying Blood gewinnen«, sage ich. »Die Acrai und auch die V23er, weil sie früh sterben müssen. Inzwischen sind die Obersten erfahrener auf dem Gebiet. Mein Blut ist ebenso besonders wie das meiner Mutter.«
Dann erzähle ich Richard alles, was ich herausgefunden und was ich erlebt habe. Es sprudelt aus mir heraus, ich kann nichts dagegen tun. Es fühlt sich gut an, sich die Sorgen von der Seele zu reden. Richard hört mir aufmerksam zu, ohne mich zu unterbrechen. Als ich fertig bin, bin ich unendlich erschöpft.
»Das sind sehr wertvolle Informationen, Holly. Sie bringen uns auf unserem Feldzug gegen die V23er ein ganzes Stück weiter. Ich bin so dankbar, dass wir dich gefunden haben.«
»Was ist aus meiner Mutter geworden? Wie ist die Geschichte ausgegangen?« Einerseits möchte ich es wissen, andererseits fürchte ich nichts mehr als seine Antwort.
»Leider nimmt sie kein gutes Ende, wie du dir sicher denken kannst. Als du noch ganz klein warst, keine vier Wochen alt, haben V23er die Wohnungsruine gestürmt, in der wir zu dieser Zeit lebten. Möglich, dass das Babygeschrei sie angelockt hat. Deine Mutter ist durch einen unglücklichen Umstand im Kugelhagel gestorben. Ich glaube nicht einmal, dass es Absicht gewesen war. Kann sein, dass die Obersten inzwischen um die Besonderheit ihres Blutes wussten, keine Ahnung.« Richards Stimme klingt seltsam tonlos, als hätte er innerlich eine Mauer um sich errichtet, um mir überhaupt davon erzählen zu können. »Mich hat man gefangen genommen und in die Zentrale verschleppt. Was aus dir geworden ist, habe ich nie erfahren.«
»Ich bin als Waise in einer Kommune in Manhattan aufgewachsen.«
»Richard nickt. Ich bin sehr dankbar, dass sie dich leben ließen.«
»Und wie ist es mit dir weitergegangen? Was hat man in der Zentrale mit dir gemacht?«
»Ich habe eine ganze Weile lang dort gelebt. Sie haben mir das Serum verabreicht, aber auch bei mir hat es nicht gewirkt. Ich habe lange darüber nachgedacht, weshalb das so gewesen ist, denn ich verfüge nicht über das genetische Merkmal deiner Mutter, das sie immun dagegen gemacht hat. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass das Blut deiner Mutter, mit dem ich beim Angriff auf unser Versteck in Kontakt gekommen bin, eine schützende Wirkung entfaltet haben könnte, wie ein Impfserum. Die Akten, die ich im Archiv heimlich darüber gelesen habe, haben meinen Verdacht bestätigt. Das war auch der Grund, weshalb sie mich nicht sofort getötet, sondern mitgenommen und mir das Serum verabreicht haben. Sie wollten ihre Theorie einer praktischen Prüfung unterziehen. Ich hatte mehr Glück als Verstand, denn ich konnte aus der Zentrale fliehen, ehe sie bemerkt haben, dass das Serum unwirksam war.«
»Wie bist du herausgekommen?«
»In einem Müllcontainer. Ich schätze jedoch, dass die Sicherheitsvorkehrungen in den letzten fünfzehn Jahren verschärft worden sind, nicht zuletzt auch wegen Eva und mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer noch so einfach ist, an geheime Akten zu gelangen.«
»Nein, davon kann ich ein Lied singen.«
Richard öffnet den Mund, um noch etwas zu sagen, doch ein lautes Knattern unterbricht ihn. Zeitgleich drehen wir die Köpfe.
Eine seltsame zweirädrige Maschine mit einem Griff und einem Sitz in der Mitte, auf dem ein unrasierter, dunkelblonder junger Mann sitzt, fährt ins Lager. Ich erschrecke so sehr, dass ich zusammenfahre. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich sehe glänzende Metallteile und zwei Reifen, die wie die eines Autos aussehen, aber ohne Gehäuse drum herum.
Richard bemerkt meine Unsicherheit. »Jamies Motorrad. Davor musst du keine Angst haben. Na, der kann was erleben!« Er springt vom Stuhl auf und geht auf das besagte Motorrad zu. Den Mann, der es gesteuert hat, schätze ich auf nicht älter als Cade, Anfang zwanzig. Er trägt fleckige und zerrissene Kleidung, ein graues Shirt und blaue derbe Hosen mit Nietenbesatz. Auch Cade hat sich erhoben, er lehnt jetzt stehend am Baumstamm und beobachtet den Neuankömmling mit zu Schlitzen verengten Augen. Ich geselle mich zu ihm. Dann kommen Elijah und Sarah von ihrem Wachtposten aus die Auffahrt hinauf gerannt, beide sehen verschwitzt aus.
»Jamie, du Idiot, wo warst du die ganze Zeit?«, blafft Elijah. »Du hast mich da unten fast über den Haufen gefahren!«
Inzwischen haben sich auch Susan, Zac und Shelly zu ihnen gestellt. Cade und ich bleiben etwas abseits, dennoch in Hörweite.
Jamie wischt sich mit dem Unterarm Schweiß von der Stirn. »Ich war in Manhattan.« Seine Stimme ist angenehm, aber er scheint außer Atem. Mir fährt ein Schauder über den Rücken. Aus irgendeinem Grund ist er mir unheimlich. Seine kleinen Augen blitzen gefährlich.
»Und was hast du dort verloren?« Richard bemüht sich, ihn nicht anzuschreien, das merkt man ihm deutlich an. Er verschränkt die Arme vor der Brust und presst die Zähne aufeinander. »Ich habe die ganze Nacht nach dir gesucht, weil ich dachte, die Mutanten hätten dich geholt!«
Jamie macht eine Geste, als wolle er Fliegen verscheuchen. »Keine Panik, mich bekommen die nicht. Bin bewaffnet bis an die Zähne. Zumindest war ich es, bis mir die Munition ausging. Ihr glaubt nicht, was in Manhattan los ist. Ausnahmezustand!«
»Dann lass mal hören, bin gespannt«, sagt Sarah. Ihr Mund ist verkniffen, zwischen ihre Augenbrauen hat sich eine Falte gegraben.
»Ich wollte unsere Kontaktmänner in der Stadt aufsuchen. Dachte, es könnte nicht schaden, mal wieder Neuigkeiten zu erfahren. Viele von unseren Leuten leben jedoch gar nicht mehr.« Er schnaubt.





























